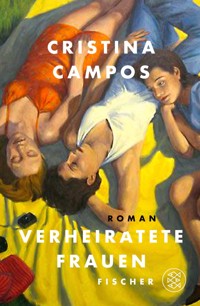9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kleine Bäckerei auf Mallorca, der Duft des Sommers und ein geheimnisvolles Erbe …
Als Marina von ihrem Erbe erfährt, ahnt sie nicht, dass es ihr ganzes Leben verändern wird. Vor langer Zeit verließ sie ihre Heimat Mallorca und brach den Kontakt zu ihrer Schwester Anna ab. Niemals mehr wollte sie zurückkehren. Doch jetzt wurde ihnen beiden die kleine Bäckerei in Valldemossa vermacht. Auf der Insel angekommen, kann Marina dem Duft von Zitronenbrot nicht widerstehen. Sie weiß, sie sollte das alte Anwesen einfach verkaufen, aber irgendetwas hält sie davon ab – ein Geheimnis, das nur darauf wartet, gelüftet zu werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Als Marina von ihrem Erbe erfährt, ahnt sie nicht, dass es ihr ganzes Leben verändern wird. Vor langer Zeit verließ sie ihre Heimat Mallorca und brach den Kontakt zu ihrer Schwester Anna ab. Niemals mehr wollte sie zurückkehren. Doch jetzt wurde ihnen beiden die kleine Bäckerei in Valldemossa vermacht. Auf der Insel angekommen, kann Marina dem Duft von Zitronenbrot nicht widerstehen. Sie weiß, sie sollte das alte Anwesen einfach verkaufen, aber irgendetwas hält sie davon ab – ein Geheimnis, das nur darauf wartet, gelüftet zu werden …
Autorin
Cristina Campos wurde 1975 in Barcelona geboren und machte ihren Abschluss in Geisteswissenschaften an der Universität von Barcelona. Anschließend studierte sie an der Universität in Heidelberg, wo sie auch das dortige Filmfestival mitorganisierte. Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat widmete sie sich ganz der Filmindustrie und arbeitet inzwischen seit zehn Jahren als Castingagentin für Film und Fernsehen. Nebenbei lebt sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben aus. Die Insel der Zitronenblüten ist ihr erster Roman.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Pan de limón con semillas de amapola« bei Editorial Planeta, Barcelona.Das Zitat stammt aus: Miguel de Cervantes Saavedra: Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha,Übersetzung Susanne Lange, dtv 2016Das Zitat stammt aus: Herman Melville, Moby-Dick, Übersetzung Matthias Jendis, Hanser Verlag, 2001
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Cristina Campos
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Ainara Garcia/Alamy Stock Foto
NG · Herstellung: cm
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19870-1V009
www.blanvalet.de
Prolog
Anna hatte ihre Beerdigung sorgfältig geplant. Ihr Liebster hatte beim Spielen mit ihrer Brust das Knötchen entdeckt, das ein Jahr später ihren Tod bedeuten sollte. In diesem letzten Jahr auf Erden hatte Anna die Zügel ihres Lebens endlich selbst in die Hand genommen.
Sie hatte alles in einem Brief festgehalten und diesen wenige Tage vor ihrem Tod an ihre Schwester Marina geschickt. Zur Beerdigung waren bloß ihre Schwester, ihr Mann und eine kleine Freundesschar geladen worden. Sie sollten sich an einer Steilküste der Serra de Tramuntana auf Mallorca versammeln, den Text vorlesen, den sie für alle geschrieben hatte, und dann gemeinsam ihre Asche ins Meer streuen.
Von den Trauergästen, die sich zu dieser Beerdigung im kleinsten Kreis versammelt hatten, wusste niemand, weshalb Anna sie an diesen weltabgewandten Ort gerufen hatte. Aber es waren alle gekommen, um an der Steilküste von Sa Foradada ihren letzten Willen zu erfüllen. Es schien fast, als habe selbst der Wind auf sie gehört, denn er blies sanft, ganz wie sie es sich gewünscht haben würde. Das Meer war ruhig wie ein riesengroßer Teich.
Die Tochter nahm die Urne, die ihr Vater in Händen hielt, und entfernte sich damit ein paar Meter, als könnte sie die Mutter dadurch ein klein wenig länger an ihrer Seite behalten. Sie schlang beide Arme um das Gefäß und setzte sich an den Rand des Felsens. Dann schloss sie die Augen, und eine Träne nach der anderen kullerte über die Asche ihrer Mutter.
Marina machte ein paar Schritte auf ihre Nichte zu, doch dann blieb sie stehen. Sie senkte den Blick und begann ganz für sich jene Worte zu lesen, die ihre Schwester ihr vor dem Tod zugedacht hatte.
Liebe Schwester, geliebte Freundin,
ich fände es schön, wenn du beim Gedanken an mich und uns die letzten dreißig Jahre streichen und zu dem Zeitpunkt zurückspringen würdest, an dem wir getrennt wurden. Denn für mich warst du meine kleine Schwester, meine Freundin, meine Vertraute, und als du fortgingst, und das auch noch fast für immer, da war es, als risse man mir die Seele aus dem Leib. Du warst gerade vierzehn Jahre alt. Ich habe nie verstanden, warum du gegangen bist.
Als du gingst, dachte ich mit Sehnsucht an die Ausflüge zurück, die wir in Papas Llaüt gemacht haben. Erinnerst du dich, wie sehr Papa dieses kleine Holzboot geliebt hat? Fast mehr als uns …
Ihr Blick glitt übers Meer, jenes Meer, in dem sie geschwommen, an dem sie aufgewachsen waren. Sie wanderte im Geiste zurück zu ihrer Kindheit, zu den Buchten im Norden der Insel, zu dem alten Boot. Immerzu waren sie unterwegs zu windgeschützten kleinen Buchten gewesen. Sie sah Anna im Bug des Llaüt sitzen, jung, zerbrechlich, das helle Haar, das weiße Leinenkleid, gehalten von dünnen Trägern, ihr schlanker Hals, ihre zarte Figur. Das blonde Haar zerzaust von dem stets sanften Wind des Inselsommers. Sie streckte so gern ihre Arme aus und spielte mit den kleinen Wogen, die gegen die Bootswand schwappten. Schöpfte Wasser in die hohle Hand und öffnete dann langsam die Finger, um es hinausfließen zu lassen. Immer und immer wieder.
Dort, auf diesem alten Boot, erzählten sie einander ihre Geheimnisse, lachten miteinander, stritten sich und vertrugen sich wieder oder ließen einfach schweigend die Stunden verrinnen, ließen sich von der Meeresbrise wiegen, bis ihr Vater mit einem Schatz wiederkehrte, wie er es immer genannt hatte.
Marina steckte den Brief zurück in den Umschlag und dachte an den letzten gemeinsamen Bootsausflug. Es war nichts Besonderes vorgefallen, nichts Erinnerungswürdiges oder Einzigartiges. Außer dass sie diese drei Worte ausgesprochen hatten, die man sich unter Schwestern eigentlich nicht sagt. Sie waren aus dem Hafen von Valldemossa hinausgefahren, hatten die einsamste Bucht angesteuert, eine, in die sich sonst keine Sommergäste verirrten. Sie hielten vor der Cala Deià, wunderschön und von Bergen umschlossen. Nestór warf den Anker, der lange sank, bis er vollkommen verschwunden war. Dann spannten sie gemeinsam die weiße Stoffplane auf, die sie vor der stechenden Sonne schützen sollte.
»Flichtst du mir einen Zopf?«
Marina setzte sich im Bug auf den Boden und löste den Haargummi, der ihre wilde schwarze Mähne bändigte. Anna teilte das Haar der Schwester in drei Teile und befeuchtete sie mit Meerwasser. Dann flocht sie behutsam einen Zopf, hielt dabei jedes Mal inne, wenn sie eine Strähne über die andere legte, und dachte unwillkürlich, dass dies das letzte Mal war. Nie wieder würde sie ihre Schwester kämmen, nie wieder würden sie gemeinsam mit dem Boot aufs Meer fahren. Und auf dem Haar ihrer Schwester mischte sich das Meerwasser mit ihren Tränen. Anna blickte auf, und lange sahen sie einander traurig an, mit ihren haselnussbraunen Augen, die sie vom Vater geerbt hatten. Und dann sprach Anna jene drei Worte, die Schwestern eigentlich nicht zueinander sagen. Sie setzte sich neben Marina, legte den Kopf auf ihre Schulter und sagte zu ihr: »Ich liebe dich.«
Marina steckte den Brief in ihre Jackentasche. Sie betrachtete diese schmale, verängstigte Person, die noch immer die Asche ihrer Mutter umklammert hielt und sich schier die Augen ausweinte.
»Ich bitte dich, pass auf meine Tochter auf«, hieß es in dem Brief. »Sie ist ganz verloren auf ihrer Suche nach sich selbst. Begleite sie bitte auf ihrem Weg durch diese verwirrende Pubertät.«
Sie ging zu ihrer Nichte und setzte sich neben sie an den Rand der Steilküste.
»Wollen wir sie gehen lassen?«, fragte Marina sanft.
Ihre Nichte nickte und strich langsam über die Urne, ein letztes Mal.
Der Lärm eines Motorrads zerschnitt die Stille. Marina drehte sich um. Der Fahrer zog den Zündschlüssel ab und stieg von der Maschine. Den Helm nahm er ab und legte ihn auf den Motorradsattel. Er wirkte unsicher, schien nicht recht zu wissen, wie er sich verhalten sollte.
Marina wusste sofort, wer dieser Mann war, den hier niemand erwartet hatte und der dennoch dazugehörte. Denn Anna hatte diesen Ort gewählt, weil sie sich von den Menschen verabschieden wollte, die sie geliebt hatte. Von der Welt. Von ihm.
1Mutterschaft oder Injera
Zutaten:
300 g Teffmehl
250 ml Wasser
eine Prise Salz
Zubereitung im Keramik-Mogogo:
Teffmehl in einer Schüssel mit Wasser und Salz anrühren und abgedeckt einen bis drei Tage ruhen lassen, bis die Mischung fermentiert ist.
Den Mogogo mit Essig auswischen und bei mittlerer Temperatur aufs Feuer stellen. Den Teig auf dem Mogogo verteilen und ausbacken. Das Injera darf nur von einer Seite gebacken werden.
Es wurde dunkel. Am heißesten und entlegensten Ort des Planeten, in der Danakil-Wüste im Nordosten von Äthiopien, pfiff ein unbarmherziger Wind. Nichts als Salz, Sand und Schwefel in dieser endlosen Weite, wo die Temperatur auf sechzig Grad anstieg und es kaum Leben gab. Dort, mitten in der Stille und dem Nichts, versteckt in einem weißen Betonhäuschen, lag Marina nach dem Liebesakt eng umschlungen mit Mathias, und er liebkoste sie.
»Ausgerechnet eine Bäckerei«, sagte Mathias.
»Dauernd muss ich daran denken«, sagte Marina und legte ihre Hand sanft in die von Mathias. »Warum schenkt uns jemand eine Bäckerei? Warum Anna und mir? Man vermacht sein Haus und seinen Laden doch nicht einfach irgendwelchen Unbekannten.«
»War dem Testament denn kein Brief beigelegt?«
»Nicht dass ich wüsste. Meine Schwester stellt Nachforschungen an, aber noch wissen wir nicht, was uns mit dieser Frau verbindet.«
»Und die Mühle, ist die noch in Ordnung?«, fragte Mathias.
»Das Gebäude ist heruntergekommen. Aber die Bäckerei funktioniert schon noch. In Valldemossa war sie die einzige.«
Marina dachte eine Weile nach.
»María Dolores Molí … Ich kann diesen Namen noch so oft aussprechen, bei mir klingelt einfach nichts …«
»Dolores … das heißt auf Deutsch Schmerzen, stimmt’s?«, fragte Mathias.
Marina nickte.
»Merkwürdig, wie kann man nur seine Tochter Dolores nennen, das ist ja fast so, als würde man jemanden Angst oder Schwermut nennen«, setzte er hinzu.
»Dolores ist in Spanien ein ganz gewöhnlicher Name«, erklärte ihm Marina.
»Ich würde dich gerne begleiten. Ich bin wahrscheinlich der einzige Deutsche, der noch nie auf Malorca war«, sagte Mathias mit einem Gähnen.
»Mallorca, mit zwei L«, erwiderte sie mit einem zärtlichen Lächeln.
Den Laut des Doppel-L gibt es nicht im deutschen Alphabet, und Mathias konnte noch so viele Spanischkurse machen, er machte immer denselben Fehler. Genau wie Marina, die das deutsche Ä und das Ö immer noch nicht aussprechen konnte. Sie sprachen Englisch miteinander, und manchmal brachten sie sich gegenseitig etwas aus ihrer Muttersprache bei. Vor zwei Jahren hatten sie sich in einer Buchhandlung am Flughafen von Barajas ein schwarzes Moleskine-Büchlein gekauft, in dem sie sich ihr ganz eigenes Wörterbuch angelegt hatten. Sie schrieben die Wörter hinein, die ihnen wichtig vorkamen. In der rechten Spalte die spanischen und in der linken die deutsche Übersetzung.
Marina streckte ihre Hand aus und griff nach dem Büchlein, das auf dem Nachttisch lag. Sie öffnete ihr Mäppchen und holte einen schwarzen Kugelschreiber heraus.
»Mit zwei Punkten?«
»Auf dem A.«
Marina schrieb panadería und daneben Bäckerei.
Seufzend legte sie das Büchlein auf den Nachttisch zurück.
»Jetzt bin ich schon über zehn Jahre nicht mehr auf Mallorca gewesen«, sagte Marina ein wenig traurig.
Mathias schaltete die nackte Glühbirne aus, die von der Decke hing. »Gute Nacht, Erbin, und denk nicht länger darüber nach, ich kenne dich doch. Solange du hier bist, findest du ohnehin keine Lösung.«
Marina drehte ihm den Rücken zu, und er schlang die Arme um sie.
Nach wenigen Minuten schlief Mathias ein. Mit dem Einschlafen hatte Marina immer Schwierigkeiten. Sie dachte noch einmal alle Probleme durch, die tagsüber bei der Arbeit angefallen waren, und überlegte sich Lösungen für den nächsten Tag. Aber diesmal kreisten ihre Gedanken nicht um die Arbeit, sondern um die Reise nach Mallorca, auf die sie zwar keine Lust hatte, die aber sein musste. Sie erinnerte sich an die letzten Worte in Annas Mail.
Vielleicht ist diese mysteriöse Erbschaft am Ende dazu gut, dass wir uns wiedersehen, dass du endlich wieder nach Hause kommst.
Über den letzten Satz hatte Marina sich geärgert. Mallorca ist nicht mein Zuhause, hatte sie gedacht. Es ist der Ort, an dem ich geboren wurde und an dem ich einen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Wo meine Eltern gelebt haben und wo heute nur noch Anna lebt. Nein, das ist nicht mein Zuhause. Nichts verbindet mich mehr mit dieser Insel.
Da Marina kein eigenes Haus besaß, gab es auch keinen Ort, an den sie an Weihnachten fahren konnte. Ein Ort, wie normale Familien ihn hatten, ein Ort, an dem sie die Feiertage verbrachten. Marina hatte zwar das nötige Geld, um sich ein Haus zu kaufen, aber den Wunsch nach eigenen vier Wänden hatte sie nie verspürt. Ihre Psychologin hatte einmal gesagt – und dabei einen Schriftsteller zitiert, dessen Name Marina entfallen war: »Zu Hause ist dort, wo man erwartet wird.« Dieser Satz hatte sie tage- und nächtelang verfolgt. Ihre Eltern waren schon gestorben. Mit anderen Verwandten hatte sie kaum Kontakt gehalten. Und natürlich war da noch Anna, ihre ältere Schwester. Anna und alles, was so lange zwischen ihnen gestanden hatte.
Marina hatte sich schon in ihrer Jugend entwurzelt gefühlt. Mit vierzehn war sie aufgebrochen, mittlerweile war sie fünfundvierzig und immer noch unterwegs. Ihre Arbeit zwang sie zum Reisen. Warum nur hatte sie dieses Nomadenleben gewählt? Immer von einem Ort zum andern. Sie wollte nirgendwo Wurzeln schlagen. Wo ist dein Zuhause, Marina? Wer wartet auf dich? Dass sie diese Frage nicht beantworten konnte, machte ihr manchmal Angst. Seit Jahren schon suchte sie nach einer ehrlichen Antwort und war irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ihr Zuhause, ihr echtes Zuhause, die ganze Welt war – die ganze Welt und Mathias. Das war die Antwort, die sie sich selbst gab. Eine Antwort, die sie beruhigte und die außerdem der Wahrheit entsprach, denn an allen Orten dieser Welt, an denen sie schon gewesen waren – mochten sie auch noch so klein, geheim und verborgen gewesen sein –, waren sie von den Menschen stets mit offenen Armen empfangen worden.
Diese Antwort beruhigte sie zwar, dennoch war eines gewiss: Sie hatte keinen festen Zufluchtsort, kein Ithaka wie ihre Freunde und Arbeitskollegen und wie Mathias natürlich, dessen Eltern in Berlin-Kreuzberg eine Wohnung besaßen, in der Bergmannstraße Nr. 11.
Sicher, Marina hätte sich auch für ein konventionelleres Leben entscheiden können. Ein Leben mit mehr Sicherheit. Mit mehr Beständigkeit. Sie hätte auf diesem vom Meer umschlossenen Fleckchen Erde bleiben können, auf dieser Insel, die hundert Kilometer lang und achtundsechzig Kilometer breit war. Wäre sie nach Mallorca zurückgegangen, wäre sie jetzt vielleicht verheiratet wie ihre Schwester, mit einem von den Männern aus dem Königlichen Segelclub von Palma, so wie ihre Mutter es ihr geraten hatte. Oder vielleicht würde sie, dem Wunsch ihres Vaters entsprechend, in der Geburtshilfe-und-Gynäkologie-Abteilung des Universitätskrankenhauses San Dureta arbeiten, das im Bezirk Poniente am Stadtrand von Palma lag.
Aber stattdessen war sie 7843 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt, mitten in der Danakil-Wüste, in den Armen des Mannes, den sie liebte.
Sie konnte noch immer keinen Schlaf finden. Sie drehte sich zu Mathias um und sah ihm zu, wie er friedlich schlief. Sie waren so verschieden, er war groß, kräftig, ungemein deutsch. Sie hatte dunklere Haut, schwarzes Haar, das ihr auf die Schulter fiel, sie war klein, etwas stämmig, ungemein spanisch. Liebevoll strich sie ihm übers Kinn, über den wilden braunen Bart. Dann strich sie ihm das Haar aus dem Gesicht, und ihre Finger fuhren sanft über die Haut rund um die Augen. Während sie diese Geste wiederholte, dachte sie an die zarten Fältchen, die sie langsam bekam. Er war fünfunddreißig Jahre alt. Sie selbst würde im August sechsundvierzig werden. Dieser Gedanke beunruhigte sie für einen Moment. Dann verbannte sie ihn sogleich wieder. Sie nahm seinen Arm und legte ihn sich um die Taille, denn es beruhigte sie und machte sie glücklich, im Arm dieses Mannes zu liegen, der so durch und durch gut war, zehn Jahre jünger als sie, der sie liebte und sie bewunderte. Marina schloss die Augen und fand endlich Schlaf. Unbewusst drückte er sie an sich. Sein Zuhause. Sein Heim.
Ein festes Klopfen. Marina hatte erst eine Stunde geschlafen. Sie schlug die Augen auf. Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Wieder dieses Klopfen. Leise erhob sie sich und schlich zur Schlafzimmertür. Das Klopfen kam von der Haustür. Sie ging weiter durchs Esszimmer, hin zu dem kleinen Fenster. Sah hinaus. Es war zu dunkel draußen. Sie konnte niemanden erkennen. Wieder hämmerte jemand gegen die Tür, diesmal schon kraftloser.
Sie ging hin und machte auf. Auf dem Boden lag, halb bewusstlos, eine junge, schwangere Äthiopierin …
»Mathias!«, rief Marina und kauerte sich neben das junge Mädchen, das nicht älter als fünfzehn sein konnte.
»Ganz ruhig«, sagte sie zu ihr auf Englisch.
Sie legte die Fingerspitzen auf das Handgelenk der jungen Frau. Nahm den Puls. Er raste.
Mathias kam aus dem Schlafzimmer geeilt, schob die Arme unter die junge Frau und hob sie hoch. Auf der nackten Erde unter ihrem Körper hatte sich eine Blutlache gebildet. Sie rannten zu dem Haus nebenan, und Mathias wuchtete die junge Frau aufs Krankenbett. Marina griff sich ein Stethoskop von dem Metalltisch, auf dem das chirurgische Besteck und die Abhörinstrumente lagen. Mathias zerschnitt den marineblauen Schleier, der den Körper der Schwangeren bedeckte. Sie handelten schnell und ohne miteinander zu sprechen. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Die junge Äthiopierin schloss die Augen und ließ alles still geschehen.
Marina hielt das Stethoskop an den Bauch der jungen Frau und überprüfte die Herztöne des Ungeborenen. Der Fötus lebte noch. Marina zog sich Latexhandschuhe an, öffnete die Beine der jungen Äthiopierin und setzte sich auf den kleinen Schemel, um ihre Scheide abzutasten. Wie alle Frauen vom Stamm der Afar hatte sie verstümmelte Genitalien, und durch den kleinen Spalt, den man nach der Infibulation offen gelassen hatte, konnte der Fötus nicht hindurch.
Sie führte die Finger in die Vagina ein und tastete sie ab. Der Gebärmutterhals war vernarbt und der Muttermund sieben Zentimeter weit geöffnet. Die Wehen hatten schon eingesetzt, wahrscheinlich schon vor über zwei Stunden, und der Fötus arbeitete nicht mehr mit.
Sie musste eine Entscheidung treffen. Sie tastete den Bauch ab. Eine Desinfibulation wäre sinnlos. Der Fötus lag zu weit oben, und das junge Mädchen hatte zu viel Blut verloren.
»Kaiserschnitt, schnell«, sagte sie zu Mathias.
Mathias nahm den Arm der jungen Frau, tastete ihn nach Venen ab und legte ihr eine Infusionsnadel.
»Sëmëwot man nô?«, fragte Mathias auf Amharisch.
Die junge Frau antwortete nicht.
»Sëme Mathias nô.«
»Sëme Mathias nô.«
Die junge Frau blickte ihn kurz an und schloss dann wieder die Augen. Sie wirkte erschöpft.
»Halte sie wach, so gut es nur irgend geht.«
Mathias brachte sie zum Sitzen. Marina schob sich hinter sie, die Injektionsnadel mit dem Novokain in der Hand. Sie setzte die Spritze und injizierte das Betäubungsmittel in den Rückenmarkskanal, und dann legten sie sie vorsichtig wieder zurück auf die Liege. Zwanzig lange Minuten mussten sie warten, bis die Anästhesie zu wirken begann. Die ganze Zeit sprachen sie mit ihr, halb auf Englisch, halb auf Amharisch, um sie wach zu halten, legten ihr ein paar sterile Tücher auf und pinselten den Bauch mit Jod ein. Anschließend bereiteten sie das OP-Besteck vor, Skalpell, Spreizklammern, Gefäßklemmen, Nadel und Faden. Unablässig tropften Schweißperlen von der Stirn der jungen Frau. Um die fünfunddreißig Grad musste es haben. Marina machte ein Tuch nass, fuhr ihr damit über die Stirn, hob ihren Kopf an und gab ihr zu trinken. Sie fragte sie wieder nach ihrem Namen, ob sie im Nachbardorf wohne, ob sie einen Ehemann habe, aber sie antwortete nicht.
»Wie soll das Baby heißen?«, fragte Marina und gestikulierte, um sich verständlich zu machen.
Auch darauf antwortete sie nicht, vermochte kaum die verängstigten Augen offen zu halten.
»Sie verliert zu viel Blut«, sagte Mathias besorgt.
Noch zehn Minuten, dann würde die Anästhesie wirken. Marina legte dem jungen Mädchen die Hände aufs Haar. Sie fuhr ihr behutsam mit der Hand über die vielen pechschwarzen Zöpfchen, die ihren Kopf bedeckten. Sie setzte sich vor sie, damit sie sie gut sehen konnte, und indem sie mit beiden Händen die Bewegungen des Zöpfeflechtens nachahmte, gab sie ihr zu verstehen, dass sie ihr die Zöpfe genauso flechten sollte, sobald das Baby geboren wäre. Die junge Äthiopierin verstand die zärtliche Geste dieser weißen Frau, und auf ihren Lippen erschien ein kleines tapferes Lächeln.
Das Skalpell schnitt unter dem Bauchnabel in die Bauchwand. Marina öffnete mit leichtem Druck nach innen die Unterhaut und setzte einen vertikalen Schnitt bis zum Rand des Schamhaars. Dann nahm sie die Schere. Mit äußerster Vorsicht durchtrennte sie die Faszie. Sie griff mit den Fingern in den Schnitt und trennte das Gewebe, bis sie zu den Muskeln stieß. Klemmen. Mit einem präzisen Schnitt durchtrennte sie die Muskeln, bis sie zur Fruchtblase mit dem Fruchtwasser kam. Die Flüssigkeit mischte sich mit dem Blut, das reichlich floss. Mit einem präzisen Griff führte sie die Hand in den Uterus und spürte, dass die Plazenta wie ein Pfropfen auf dem Gebärmutterhals saß. Sie tastete nach dem Körper des Fötus. Dann drehte sie ihn in die richtige Lage, packte ihn bei den Füßen und zog ihn mit einer schnellen Bewegung aus dem Uterus. Der Fötus regte sich nicht. Mathias durchtrennte die Nabelschnur. Auch als sie das Baby von der mütterlichen Sauerstoffzufuhr abschnitten, reagierte es nicht.
Marina hielt das Baby mit dem Kopf nach unten und versetzte ihm mehrere kleine Schläge auf den Po. Es blieb still. Marina versuchte es erneut, packte das Baby im Nacken, richtete es auf und ließ es dann wieder mit dem Kopf nach unten hängen. Es blieb reglos und still. Marina zog sich die Handschuhe aus. Sie legte das Baby auf den Tisch, mit leicht überstrecktem Kopf. Mit der anderen Hand hob sie sein Kinn. Sie näherte sich seinem Herzen, legte Mittel- und Ringfinger der einen Hand auf das Sternum des Babys, und dann, sanft und rhythmisch, machte sie eine schnelle Herzmassage. Vielleicht hatte es im Uterus Kindspech geschluckt und die Atemwege waren verstopft.
Marina warf Mathias einen besorgten Blick zu. Er hatte bereits die Plazenta entfernt und nähte jetzt mit einem chirurgischen Faden den Körper der jungen Äthiopierin wieder zu, die viel Blut verloren hatte und mit offenen Augen und vollkommen still auf dem Krankenbett lag und ihr Baby betrachtete. Die erste Tochter, die sie zur Welt gebracht hatte.
Mit dem reglosen Baby auf dem Arm ging Marina zu ihr. Setzte sich an ihre Seite. Sie legte sich das Baby in den Schoß, nahm die Hand der Mutter, und dann versuchten sie gemeinsam eine Herzmassage.
Das Baby war jetzt schon über eine Minute aus dem Bauch, ohne Sauerstoff. Es würde nicht viel länger durchhalten. Marina wusste das. Mathias sah Marina an. Sie blickte zurück und senkte den Blick. Die Mutter würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Zwei Tote mehr, neben den vielen anderen, die sie in den fünf Jahren, die sie nun schon gemeinsam für die NGO arbeiteten, nicht hatten verhindern können. Man konnte noch so oft miterleben, wie ein Mensch starb, man würde trotzdem nie unempfindlich werden gegenüber der Wucht, mit der einen das traf. Marina, die ihre Hand auf die Hand der äthiopischen Frau gelegt hatte, drückte noch einmal, jetzt mit mehr Kraft, auf den Körper des Babys.
Ganz unerwartet griff die junge Äthiopierin, die kaum bei Bewusstsein zu sein schien, mit letzter Kraft nach ihrer Tochter, nahm sie aus Marinas Schoß und legte sie sich auf die Brust. Das Baby hörte ihren Herzschlag, ganz wie in den letzten neun Monaten. Die junge Frau atmete tief ein. Sie sagte ein paar Worte in ihrer Sprache und nahm ihre Tochter wie zum Abschied fest in den Arm. Und als hätte das kleine Mädchen das Flehen seiner Mutter gehört, öffnete es schließlich seine kleine Lunge und schrie.
Die junge Äthiopierin hörte das Schreien ihrer Tochter, lächelte glücklich und sah die weiße Frau, die ihrer Tochter auf die Welt geholfen hatte, mit unendlicher Dankbarkeit an. Dann schloss sie die Augen und starb.
Im letzten Geburtshilfekursus, den Dr. Sherman gegeben hatte, sprach er über die internationale Zusammenarbeit. Er zeigte ihnen Dias, auf denen Ärzte, die alle einen weißen Kittel mit dem roten Ärzte-ohne-Grenzen-Logo trugen, auf dem afrikanischen Kontinent Patienten in Notfallsituationen behandelten. Damals hatte Marina nicht viel mehr gewusst als die meisten Studenten der Universität von Pennsylvania: dass die Welt ungerecht war und medizinische Versorgung das Privileg einiger weniger.
Seit jenem Kursus an einer der angesehensten Universitäten dieser Welt waren neunzehn Jahre vergangen, und mit diesem afrikanischen Kind in ihren Armen verstand sie besser als je zuvor, was Dr. Sherman meinte, als er gesagt hatte, es komme auf die Großzügigkeit einiger weniger an, die auf die Annehmlichkeiten der westlichen Welt verzichteten, um Menschenleben an den unwirtlichsten Orten des Planeten retten zu können.
Behutsam trug Mathias den Leichnam der jungen Frau aus dem Ambulanzraum. Marina blieb mit dem Baby zurück. Sie sah jetzt keinen Fötus mehr in ihm, sondern ein menschliches Wesen, und wurde plötzlich gewahr, dass sie eine Persönlichkeit vor sich hatte. Ein dunkelhäutiges, verklebtes und etwas klein geratenes Baby, das soeben Waise geworden war. In den zehn Jahren ihrer Arbeit als Entwicklungshelferin hatte sie bereits bei zahllosen Geburten assistiert, aber es war für sie das erste Mal, dass eine Mutter vor ihren Augen starb. Mit einem feuchten Tuch wischte sie die Mischung aus Blut, Fruchtwasser und Käseschmiere von seinem kleinen Körper. Dann wickelte sie es in ein Laken, das ebenso grün war wie das Tuch, das den Leichnam der Mutter bedeckte, und barg es in ihren Armen. Der Säugling machte den Mund auf und suchte nach der Brustwarze seiner Mutter, um daran zu saugen. Marina öffnete den Kühlschrank. Sie griff in einen Karton mit dem Logo der Ärzte ohne Grenzen und holte ein vorbereitetes Fläschchen heraus. Sie stellte es ins Fenster, um es von den ersten Sonnenstrahlen wärmen zu lassen.
Für den Buchteil einer Sekunde spielte das Baby mit dem Sauger, aber dann leerte es, als hätte es die Mutterbrust vor sich, die Flasche mit einer für ein Neugeborenes recht ungewöhnlichen Geschwindigkeit. Es bewegte weiter die Lippen und wollte mehr. Aber Marina fand, fürs Erste sei es genug. Sie wiegte das Kleine sanft in ihren Armen und legte sein Köpfchen nah an ihre Brust, damit es die Schläge ihres Herzens hören konnte. Es wirkte unruhig, und Marina lief mit ihm umher und verließ dann den Ambulanzraum. Der Tag brach an, es waren 48 Grad im Schatten. Der Himmel färbte sich orange und rosa, ein wunderschöner Anblick, wie jeden Morgen. Das Baby weinte. Marina streichelte es, und während sie es streichelte, sang sie ihm ganz leise ein Lied vor.
A la nanita nana, nanita ella, nanita ella,
mi niña tiene sueño, bendita sea.
Fuentecita que corre clara y sonora,
ruiseñor que en la selva cantando llora,
calla mientras la cuna se balancea.
A la nanita nana, nanita ella.
Es war das spanische Wiegenlied, das Großmutter Nerea in den milden mallorquinischen Nächten immer für sie gesungen hatte. Das Baby schlief sogleich ein. Und so stand sie mit ihm vor der Wüste von Danakil, bei Sand, Salz und Schwefel. Sie machte der Welt schon lange keine Vorwürfe mehr. Ganz wie eine Frau im ersten Ehejahr, die ihrem Mann vorwirft, seine Versprechen nicht zu erfüllen, hatte Marina in ihren ersten Jahren als Entwicklungshelferin der Welt so allerlei vorgeworfen. Als sie zwanzig gewesen war und noch diese herrliche Naivität der Jugend besessen hatte, hatte sie fest geglaubt, dass die Menschheit sich ändern werde. Mit dreißig war sie eine engagierte Aktivistin im Kampf für die Menschenrechte gewesen. Vor allem für die Rechte der Frauen. Für solche Frauen wie jene, die gerade unter ihren Händen gestorben war, und für das Mädchen, das jetzt in ihren Armen weiterlebte.
Aber die Naivität der Zwanzigjährigen und die Stärke der Dreißigjährigen waren mit der Zeit einer gewissen Abgeklärtheit und Mäßigung gewichen, und mittlerweile war Marina eine reife Frau, eine engagierte Ärztin mit viel Berufserfahrung, die sich aus ganzem Herzen für die Menschen einsetzte, die sie behandelte. Ihr einziger Ehrgeiz bestand darin, das Leben dieser Menschen zu verbessern. Und sie wusste: Wichtiger als jeder Kampf, jede Forderung, jede Petition und jede Bitte an die übernationalen Gesellschaften, die die Welt regierten, war es, das Leben dieses äthiopischen Babys zu schützen, das soeben auf die Welt gekommen war.
Auf ihrer Armbanduhr war es 7 Uhr 20 am Morgen. Es wurde schon wieder drückend heiß, die Hitze drang in das Behandlungszimmer, in das sie sich mit dem schlafenden Baby im Arm zurückgezogen hatte. Sie betrachtete das Kind, es war entzückend, schwarz, etwas mickrig und glatzköpfig. Es schlief ruhig. Sie setzte sich, sah es unverwandt an und spürte diesen Frieden, der von schlafenden Babys ausgeht, die gerade zur Welt gekommen waren. Sie lehnte ihren Kopf an die Wand und ließ sich erschöpft von der friedlichen Stille einhüllen.
Durch die Tür sah sie aus dem Dunst rötlicher Erde verschwommen ein paar weibliche Gestalten auftauchen. Sicher die Familienangehörigen des Mädchens, dachte sie erleichtert. Sie strich dem Baby zärtlich übers Kinn und stellte sich vor, wie sie das Kind einer anderen Frau übergab. Sie würde es aus dem grünen Laken herausnehmen und in einen dieser bunten Stoffe einwickeln, wie afrikanische Frauen sie so gerne tragen. Sie dachte an das Leben, das dieses Mädchen erwartete. Sie wusste, es würde ihr nicht an Liebe fehlen. Die Afar waren ein mildes und gütiges Volk, und sie liebten ihre Kinder. Obwohl das Mädchen eine Halbwaise war, würde sie vom Rest des Stammes alle Zuneigung bekommen, vom Vater, von ihren Tanten, von ihren zahllosen Cousinen, von den Großmüttern, von den Freundinnen ihrer Mutter. Denn in Afrika wird die Sorge für die Kinder auf sämtliche Frauen verteilt, die zum Clan gehören.
Zwar war Marina selbst keine Mutter, aber sie dachte oft darüber nach, dass die Mutterschaft für die europäischen Frauen, die völlig isoliert in ihren aseptischen Stadtwohnungen wohnten, ein Synonym für Einsamkeit war. Wie die Mutterschaft ihrer Schwester Anna, die eine Tochter hatte und mit ihrem Mann in dieser fünfhundert Quadratmeter großen Villa wohnte, ausgekleidet mit weißem Marmor und ausgestattet mit einem Schwimmbad mit Seeblick. Marina hatte gelernt, nicht zu urteilen, aber sie war sich dessen bewusst, dass die europäischen und die afrikanischen Frauen viel voneinander zu lernen hatten.
Sie strich diesem schwarzen Mädchen übers Kinn und dachte darüber nach, was für ein hartes Leben sie erwartete. Ein Nomadenleben. Diese dürre Erde würde die einzige Landschaft sein, die ihre Augen sehen würden. Immer über vierzig Grad Hitze. Sie würde ihr ganzes Leben mit der Suche nach Wasser verbringen, wie der Wind. Würde Reisighölzer auf dem Rücken tragen, aus denen sie auf irgendeinem Fleckchen Erde ihr Zuhause erschaffen würde. Sie würde mit Sicherheit weder lesen noch schreiben lernen, sie würde Ziegen melken, Holz sammeln, Getreide mahlen und Brotteig kneten, und was noch wichtiger war als all diese Haushaltspflichten: Wenn sie zwei Jahre alt wäre, würden vier Frauen sie, einer tausendjährigen Tradition folgend, im Morgengrauen abholen und unter einen Baum bringen. Dort würden sie sie zu Boden werfen. Zwei von ihnen würden sie an den Schultern festhalten, die anderen beiden würden ihr die Beinchen öffnen und sie festhalten, damit die Geburtshelferin des Clans ihr mit einer Rasierklinge die Klitoris herausschneiden könnte. Sie schloss die Augen, als sie daran dachte. Sie drückte den kleinen Körper des Babys an sich, als wollte sie es schützen.
»Schläft sie schon?«, fragte Mathias, der in der Tür stand.
Marina nickte.
»Samala ist gekommen. Ich löse dich ab.«
Sehr vorsichtig gab sie ihm das Baby. Sie ging zur Tür und hörte noch, wie Mathias ein paar Worte auf Deutsch zu dem Baby sagte, ganz leise, um es nicht aufzuwecken.
»Willkommen im Leben, du großartiges Mädchen«, sagte er.
Marina drehte sich zu ihnen um. Das Bild rührte sie zu Tränen: der so kräftige und so europäische Mathias, wie er dieses winzige schwarze Mädchen wiegte und aus seinen großen grünen Augen ansah.
»Ich glaube, ein paar von diesen Wörtern haben wir schon in unser kleines Buch aufgenommen«, sagte Marina von der Tür aus.
Mathias wartete auf die spanische Übersetzung seiner Frau: Bienvenida a la vida, mi niña bonita.
»Die müssen ein GPS im Hypothalamus haben«, sagte Marina, als sie sah, wie die afrikanischen Frauen durch die Wüste auf sie zukamen.
Jeden Morgen fragte sie sich dasselbe. Wie war es nur möglich, dass sie sich orientieren konnten in diesem gewaltigen Meer aus Sand, das in Marinas Augen in alle Richtungen gleich aussah? Die mobilen Kliniken der NGO waren flexibel und wurden in der Nähe der Afar-Dörfer errichtet. Aber es kamen auch Frauen aus ferner gelegenen Dörfern, die sich angeblich orientierten, indem sie im Morgengrauen den Sternen und den Wellen im Sand folgten.
Marina sah zu, wie sie langsam näher kamen; sie hatten ihre Babys auf den Rücken gebunden, und eine Gruppe von zwei- bis achtjährigen Kindern lief neben ihnen her. Die Afar waren schlanke Frauen von natürlicher Eleganz, die ihre Körper in große, mit bunten Mustern bedruckte Tücher wickelten, die herrlich mit ihrer schwarzen Hautfarbe kontrastierten. Marina ging auf sie zu.
»Ëndemën aderu«, sagte sie zu ihnen.
Die Frauen lachten, als sie hörten, wie Marina sie auf Kuschitisch begrüßte. Sie waren immer freundlich und dankbar für alles. Aber einige Babys wandten unter den Tüchern ihre Gesichter ab und plärrten los. Wahrscheinlich war es das erste Mal, dass sie eine weiße Frau sahen. Seltsamerweise erkundigte sich keine von ihnen nach der Schwangeren, und Marina gestikulierte und erklärte ihnen in den einfachsten englischen Wörtern, was in der Nacht geschehen war.
»Wisst ihr, wer sie ist, kennt ihr sie?«, fragte sie.
Sie wussten nichts von der jungen Frau. In dem Dorf, in dem sie lebten, war keine Frau verschwunden. Sie bat sie trotzdem, hinter das Betonhaus zu gehen, wo Mathias die Krankentrage mit dem Leichnam abgestellt und mit einem grünen Laken zugedeckt hatte. Vielleicht hatten sie sie ja schon einmal gesehen.
Bevor Marina diese Frauen und die vielen anderen Patienten behandelte, die im Laufe des Tages noch kommen würden, musste sie etwas essen, eine Dusche nehmen und vor allem Wasser trinken. Sie ging ins Haus. Samala war mit dem Backen von Injera beschäftigt, dem äthiopischen Brot, das sie jeden Morgen aßen. Samala gehörte zu dem lokalen Personal, das Ärzte ohne Grenzen eingestellt hatte, und es war ihre Aufgabe, die Schlafzimmer zu putzen, die Wäsche zu waschen, Lebensmittel einzukaufen und für die Entwicklungshelfer zu kochen. Ihre Kinder waren schon erwachsen, und vor fünf Jahren war sie Witwe geworden. Sie hatte in einem der einfachsten Kebeles[1] von Addis Abeba gehaust, in denen die Neuigkeiten von Mund zu Mund die Runde machten, und erfahren, dass einige europäische Ärzte gerade für ein Arbeitsprojekt Personal aus der Gegend einstellten. Es wurden vor allem Logistiker gesucht, Männer mit Führerschein, Männer mit Vorkenntnissen im Bau, Elektriker und Klempner, denn im ganzen Land sollten mobile Kliniken aufgezogen werden. Aber sie stellte sich trotzdem vor, denn sie konnte kochen und putzen, das hatte sie ihr Leben lang getan. Zwei Monate lang setzte sie sich dort täglich in die Bürotür und wartete, ob vielleicht einer der weißen Ärzte sie brauchen könnte. Eines Tages, an einem Montag, tauchte dann eine der angestellten Frauen nicht auf, und fortan war Samala ein Teil der großen Familie von Ärzte ohne Grenzen. Das war jetzt schon ein Jahr her. Zusammen mit Kaleb, dem örtlichen Organisator, bildeten sie das Team, das Marina und Mathias bei dem Mutter-Kind-Ernährungsprojekt in der Afar-Senke begleitete.
Nachdem Marina Samala herzlich begrüßt und sich fürs Frühstück bedankt hatte, nahm sie einen großen Schluck Wasser und ging in ihr Zimmer.
Die Dusche war ein haarfeiner Wasserstrahl, der nicht länger als zwei Minuten floss. Aber diese zwei Minuten waren ein solcher Genuss, dass Marina manchmal die hundertzwanzig Sekunden mitzählte, um sich zu zwingen, an nichts anderes als diesen seltenen Schatz der Wüste zu denken, der über ihren Körper floss. Aber der Geist ist ein seltsames Ding, und so kam ihr ganz ungewollt der Flug LH2039 der Lufthansa in den Sinn, der sie in drei Tagen wieder »nach Hause« bringen würde.
Den Tag über saßen immer wieder äthiopische Frauen, an die Wand der Ambulanz gelehnt, auf dem Boden und warteten darauf, von den Ärzten behandelt zu werden. Sie erzählten einander, was passiert war, und gingen gemeinsam zu der Krankentrage, auf der die tote junge Frau lag. Über sechzig Frauen gingen sich den Leichnam anschauen. Niemand wusste, wer sie war. Bis zum Abend war der Todesgestank unerträglich geworden. Vom Küchenfenster aus sah Marina, während sie dem Baby gerade das Fläschchen gab, wie Kaleb den leblosen Körper der Frau auf den Rücksitz des Jeeps hievte, der zum Besitz der NGO gehörte.
Der Logistiker schloss die Tür, schaltete den Motor an und fuhr durch die Wüste davon. Er würde ein paar Kilometer weiter ein Loch graben, das er nach Mekka ausrichten würde, und den Leichnam hineinlegen. Dann würde er es zuschaufeln, einen Steinhaufen bauen, wie es im Afar-Ritual vorgeschrieben ist, und zu Allah beten.
Der vom Jeep aufgewirbelte Staub hatte sich wieder vollkommen gelegt. Und diese so unbedeutende Einzelheit beunruhigte Marina. Sie spürte, wie ihr Herz schneller schlug, und es kam ihr so vor, als wäre die Temperatur innerhalb weniger Sekunden um mehrere Grade gestiegen. Während der zwölf Stunden, in denen die Leiche da gewesen war, hatte dieses kleine Menschenwesen, das Marina im Arm hielt, der toten Frau gehört, und so wurde es auch jedem erzählt, der in die Ambulanz kam. Aber jetzt, da die Leiche fort war, gehörte dieses Baby zu niemandem mehr. Es bedeutete niemandem etwas. Wenn es weinte, wenn es Durst hatte, wenn es Hunger hatte, wenn es sich bewegen wollte, würde kein anderer Mensch außer ihr ihm zu Hilfe eilen. Die große Einsamkeit dieses namenlosen Mädchens am Horn von Afrika ließ eine tiefe Traurigkeit in Marina aufsteigen. Und gerade weil es so schmerzvoll war, wurde die Traurigkeit zum Schuldgefühl. Sie hatte getan, was jeder andere Arzt auch getan haben würde. Aber das war es gar nicht, was ihr Sorgen machte, vielmehr gab es da eine Frage, die sie sich schon bei anderen medizinischen Einsätzen im Laufe ihrer Arbeit für Ärzte ohne Grenzen gestellt hatte.
»War es für diesen Menschen wirklich die beste Lösung, am Leben zu bleiben?«
Sie sah sich selbst als eine westliche Ärztin, die stolz darauf war, in den ärmsten Ländern der Dritten Welt Leben zu retten. Aber vielleicht war das alles ein Irrtum, und eigentlich sollte das Gesetz der Natur darüber entscheiden, wer leben sollte und wer nicht. Und vielleicht sollte das Baby, das sie jetzt in den Armen wiegte, in den Armen ihrer Mutter liegen, unter der Erde, in Frieden.
Marina fuhr sich mit der Hand über die Stirn und versuchte, diesen Gedanken wegzuwischen.
»Es ist merkwürdig, dass niemand gekommen ist, um sie zu holen. Bestimmt ist sie ein ungewolltes Kind, die Frucht einer Vergewaltigung«, sagte Kaleb.
Diese Antwort hatten Marina und Mathias nicht erwartet, und es war ihnen nicht wohl dabei.
»Ich kann sie ins Waisenhaus von Addis Abeba bringen«, fuhr Kaleb fort.
»Warten wir noch ein paar Tage, vielleicht kommt ja noch jemand«, erwiderte Marina. »Wenn niemand ein Anrecht auf sie geltend macht, dann bringen wir sie selbst auf dem Weg zum Flughafen im Waisenhaus vorbei.«
Wieder wehte ein starker Wind um das Haus aus Beton, in dem Marina, Mathias und das Baby schliefen. Und das Baby weinte wieder, so wie Neugeborene weinen, wenn sie Hunger haben – verzweifelt.
»Das ist doch nicht normal«, sagte Mathias und schlug besorgt die Augen auf. Es war das dritte Mal, dass das Mädchen in dieser Nacht wach wurde. Marina nahm das Baby wieder in ihre Arme. Mathias stand auf. Er übernahm die Aufgabe, das Fläschchen zu holen. »Jetzt verstehe ich, warum mein älterer Bruder sich in dem Jahr von seiner Frau getrennt hat, in dem sie einen Sohn bekamen.«
»Meine Nichte hat tage- und nächtelang geweint«, sagte Marina. »Um vier Uhr morgens setzten wir uns in unserer Verzweiflung ins Auto und fuhren herum, damit sie endlich einschlief.«
»Und ist sie eingeschlafen?«, fragte Mathias.
»Ja. Ist sie. Zumindest bis wir das Auto geparkt und den Zündschlüssel abgezogen hatten.«
Und so ging es noch zwei Tage und zwei Nächte weiter. Sie konnten kaum schlafen. Sie wechselten sich mit der Behandlung der Frauen und Kinder ab, die zu Hunderten in die Ambulanz kamen, und in der Sorge um dieses namenlose Mädchen, das niemand haben wollte.
Ihr alter schwarzer Rucksack war randvoll gepackt. Fünf weiße Hemden, drei Khakihosen mit Seitentaschen, Unterwäsche, Anorak, ein Necessaire und ein afrikanischer Stoff mit einem Muster in Grün, Gelb und Lila, sie hatte ihn mit Mathias im Kongo gekauft, und da, wo sie hinfuhr, würde er ihr als Tagesdecke dienen. Sie öffnete das Moleskine-Büchlein, legte das Flugticket und den Reisepass hinein und steckte es in die Seitentasche ihres Rucksacks. Dann holte sie das Stethoskop ihres Vaters aus dem Schrank. Sie hatte über dreißig Länder damit bereist, hatte nie ein anderes haben wollen. Es nach Mallorca mitzunehmen war eigentlich nicht sinnvoll, denn in weniger als einer Woche würde sie schon wieder zurück sein, aber ohne dieses alte Stethoskop ging sie nirgendwohin. Vorsichtig legte sie den flexiblen Schlauch des Bruststücks um den Ohrbügel und verschloss den Rucksack.
Das Baby lag auf dem Bett, und obwohl es erst zwei Tage alt war, verfolgte es mit seinen Äuglein Marinas Bewegungen. Von draußen roch es nach Injera. Marina ging zur Tür, um sich ihr Frühstück zu holen, und das Baby machte einen Laut. Marina drehte sich um und betrachtete es eine Weile. Da brabbelte das Mädchen wieder. Marina lächelte, als ihr einfiel, dass es sie rief. Sie ging zu ihm hin. Ihr wurde klar, dass das Mädchen sie bereits wiedererkannte. Es war jetzt drei Tage bei ihnen. Hörte ihre Stimmen. Ihr Lachen. Ihre täglichen Gespräche. Marina setzte sich zu ihm und nahm sein Händchen – das Baby schloss die kleine Faust um ihren Zeigefinger und brabbelte, als wollte es ihr etwas sagen … Bleib bei mir.
»Ich hole mir jetzt einen Kaffee und ein bisschen Injera mit Butter, und dann komme ich wieder«, sagte sie auf Spanisch.
Das Baby brabbelte.
»Nein, ich trödle nicht … Und ich bring dir dein Fläschchen mit.«
Wieder antwortete das Mädchen.
Marina streichelte das Baby, das weiter ihren Finger gepackt hielt und noch stärker drückte. Diese subtile kleine Geste, die alle Babys dieser Welt machen, erschreckte sie auf eine seltsame Art.
Der Jeep fuhr mit fünfzig Stundenkilometern in die Wüste. Kaleb kannte diese Straße wie seine Westentasche, beim Fahren erzählte er stolz von seiner Heimat in der Region Kaffa, aus der der Kaffee stammte, die Etymologie des Wortes verrät es ja schon, Kaffa-Kaffee, und sah immer wieder beschwichtigend zu Mathias hinüber, der auf dem Beifahrersitz saß, nickte und sich mit der einen Hand am Armaturenbrett festklammerte und mit der anderen am Griff unterm Seitenfenster.
Auf dem Rücksitz saß Marina mit dem schlafenden Baby im Arm. Sie achtete nicht auf das Gespräch, sondern schaute hinaus auf den kilometerweiten Sand. In der Ferne sah man eine Reihe von mit Salzblöcken beladenen Kamelen den Horizont entlangschreiten.
Sie kamen durch ein Dorf, in dem einige Nomadenfrauen Reisighütten bauten. Die einen legten Steine für den Sockel auf dem Boden aus, die anderen befestigten darüber das Geflecht aus Zweigen, das das Grundgerüst für die Hütte bildete, wieder andere gaben ihren Babys die Brust und saßen auf den kleinen Matten, die ihnen später als Dach dienen würden.
Der Jeep fuhr durch die Hüttensiedlung. Kinder kamen gelaufen und folgten dem Wagen, der sein Tempo drosselte.
»Hallo, hallo!«, riefen sie lachend.
»Doktor, Doktor!«
Marina lächelte ihnen zu. Sie freute sich, dass die Kinder sie erkannt hatten.
Kilometerweit nichts als Sand. Der Jeep fuhr auf eine tiefer gelegene heiße Ebene. Sie sah einen kreisförmig errichteten Steinhaufen, ein Zeichen dafür, dass hier jemand beerdigt worden war, und Kaleb bestätigte ihre Vermutung: Unter diesen Steinen lag die Mutter des Mädchens begraben, das in ihren Armen schlief.
Marina betrachtete das Baby. Es war fünf Mal aufgewacht in der Nacht, und jetzt schlief es friedlich, wahrscheinlich weil der Wagen so schön schaukelte. Fast sieben Stunden Fahrt hatten sie vor sich. Sie fuhren an den Salzbergen und den Schwefelseen am Seitenhang des Ertale-Vulkans vorbei, bis sie in die Nähe der Grenze zu Somalia kamen.
Eine Gruppe von Äthiopiern in Militäruniform hatte Kalaschnikows geschultert. Einer von ihnen hob die Hand. Kaleb brachte den Jeep zum Stehen und kurbelte das Fenster herunter. Der Militär kam näher und musterte die Seitentür des Wagens, auf der das große rote Logo von Ärzte ohne Grenzen prangte. Sie wechselten ein paar Worte auf Amharisch, dann steckte Kaleb ihm einen Geldschein zu, zehn Birr. Der Militär lächelte den Ärzten freundlich zu und ließ sie passieren. Dieser kurze Moment, in dem sie gehalten hatten, hatte genügt: Das Baby hatte keine Bewegung mehr gespürt und war aufgewacht. Marina sah es an und strich ihm zärtlich mit dem Finger übers Kinn. Das Baby lächelte. Sie wiederholte die Geste, und es lächelte erneut. Es bewegte die Hände und streckte sich auf diese seltsame, für Babys so typische Art. Marina wurde nachdenklich. Etwas hatte sie kurz beunruhigt. Sie beugte sich zum Vordersitz vor.
»Es hat keinen Namen«, sagte sie.
»Wie bitte?«, fragte Mathias.
»Das Baby. Es hat keinen Namen«, wiederholte Marina.
»Im Waisenhaus werden sie ihm einen geben«, mischte Kaleb sich ein.
Marina lehnte sich wieder zurück. Das Mädchen weinte, und ganz automatisch öffnete Mathias seinen Rucksack und reichte ihr das Fläschchen.
»Im Waisenhaus? Wer sollte ihr da einen Namen geben? Es ist wichtig, was für einen Namen man bekommt«, sagte sie mehr zu sich selbst.
Sie dachte darüber nach, aus welchem Grund ihre Eltern sie wohl Marina genannt hatten. Diese Frage hatte sie sich noch nie gestellt. Bei der Abiturvorbereitung hatte sie im Lateinunterricht entdeckt, dass Marina »die vom Meer Stammende« bedeutete, und daraus geschlossen, dass ihr Vater, der sich immer im Scherz damit brüstete, er sei Arzt und Seemann, diesen Namen ausgesucht hatte. »Ich bin ein echter alter Seebär«, hatte er immer im Brustton der Überzeugung verkündet, wenn er sein Llaüt bestieg, und seine Töchter damit zum Lachen gebracht. Und so schloss sie, dass ihr Name der Liebe geschuldet war, die ihr Vater, Néstor, für das Mittelmeer empfand. Marina war die Tochter des Seemanns, die Tochter des alten Seebärs.
Ihrer älteren Schwester hatten sie jenen Vornamen gegeben, den alle Erstgeborenen in dem Matriarchat, in das sie hineingeboren wurden, bekamen: Ana. Aber sie hatten noch ein zweites N hinzufügt, wie es alle Annas auf Mallorca im Namen tragen. Und Anna hatte die Familientradition fortgeführt und ihrer Tochter den gleichen Namen gegeben, den schon ihre Ururgroßmutter getragen hatte, ihre Urgroßmutter, ihre Großmutter, ihre Mutter und sie selbst. Aber diesmal ohne das zweite N.
Während Marina dem Baby zärtlich übers Kinn strich, lächelte sie unwillkürlich bei der Erinnerung an ein Gespräch, das sie mit Anna am Strand von Mallorca geführt hatte. Sie hatten damals in der Sonne gelegen, Anna mit einem riesigen Bauch. Sie war in der achtunddreißigsten Schwangerschaftswoche gewesen und hatte Marina erklärt, warum ihre Tochter Ana mit nur einem N heißen würde.
»Meine Tochter wird Ana heißen. Ana ohne das zweite N. Ich lasse mir da überhaupt nicht reinreden. Mein Leben lang musste ich meinen Namen korrigieren, sei es an Schultafeln oder in amtlichen Dokumenten, und das will ich ihr ersparen. Einfach nur Ana. Anita«, sagte Anna im Brustton der Überzeugung. »Anita. Wir werden sie Anita nennen.«
Das kleine Mädchen öffnete ein wenig die Augen und zog seltsame Grimassen, weil die Sonne, die durchs Fenster schien, sie störte.
»Du brauchst einen Namen, meine Kleine, einen aussagekräftigen Namen, einen fürs ganze Leben«, sagte sie zu ihr.
Marina ließ im Geiste die einzelnen Buchstaben ihres Namens an sich vorbeiziehen. M, A, R, I, N, A. Das gleiche Spiel machte sie mit den Buchstaben des Namens ihrer Schwester: A, N, N, A; und mit denen von M, A, T, H, I, A, S. Dabei fiel ihr auf, dass vier Buchstaben ihres Namens mit den Buchstaben in Mathias übereinstimmten und die letzte Silbe mit der im Namen ihrer Schwester Anna, und während sie so mit dem Abc herumspielte, fand sie schließlich den Namen, der das Baby, das sie im Arm wiegte, für den Rest seines Lebens begleiten sollte: Naomi.
Schließlich konnte man in der Ferne die Silhouette von Addis Abeba sehen. Die luxuriösen Wolkenkratzer und daneben die Berghänge des Entoto-Gebirges. Marina seufzte erleichtert auf. Sie war erschöpft. Alles tat ihr weh, und ihre Arme waren eingeschlafen, weil sie das Baby sieben Stunden lang gehalten hatte. Sie fuhren über eine asphaltierte Straße, vorbei am Gerippe eines noch im Bau befindlichen Gebäudes, dem zukünftigen prachtvollen Sitz der Afrikanischen Union, an dem etwa hundert Arbeiter im Einsatz waren. Sie fuhren am Hilton vorbei, am Sheraton, am Kaiserpalast und am Stadion, bis sie in die Churchill Avenue kamen, wo ein übergewichtiger Gemeindepolizist mit den Armen ruderte, um den Verkehr zu steuern.
Gehupe. Taxis. Autos. Motorräder. Afrikaner in Armani-Anzügen. Schöne Äthiopierinnen im Kostüm und mit Pfennigabsätzen. Kunsthandwerksläden. Touristen. Bettler. Eine europäische Straße, eine Fata Morgana am Horn von Afrika, die Marina, je öfter sie dort hinkam, immer weniger gleichgültig ließ … Direkt neben dem Luxus lag das Elend von Afrika, Hunderte von Lehm- und Wellblechhütten, ohne fließendes Wasser, ohne Licht und ohne jede Zukunft.
Sie fuhren in Schlangenlinien durch eine Gasse, durch Ziegenherden und kleine Märkte voller Menschen, bis sie einen ungepflasterten Weg erreichten, der sie vom Stadtzentrum weg und wieder in das echte Äthiopien führte. Neben der Straße lagen Getreidefelder, die von gebückten Frauen abgeerntet wurden. Nach weiteren anderthalb Kilometern kamen sie zu einer elenden Hütte mit mürben Wänden in Blassrosa. Das staatliche Waisenhaus: Minim Aydelem Children Orphanage. Kaleb parkte vor dem Gebäude. Mathias öffnete Marina die Wagentür. Sie zögerte einen Moment und sah sich durch die staubige Windschutzscheibe hindurch diesen Ort an, unendlich traurig kam er ihr vor. Sie betrachtete das Mädchen, das ruhig in ihrem Schoß lag und schlief.
»Wie still es hier ist«, sagte sie befremdet.
Sie stieg aus dem Wagen und versuchte, das Baby nicht aufzuwecken. Sie gingen zum Eingang des Waisenhauses. Mathias klopfte an die Tür. Eine äthiopische Frau mit gütigen Augen öffnete ihnen.
»Sprichst du Englisch?«, fragte Mathias.
Sie nickte. Marina erklärte ihr, wer sie waren und wie Naomi zur Welt gekommen war. Währenddessen sah sie unwillkürlich zu den Eisenbettchen hinüber, die zuhauf im Gang standen, mit stillen Babys darin. Einige waren wach und blickten aus den Bettchen ins Leere. Es roch nach Urin, verdorbener Milch und den Exkrementen der Babys. Die Stille an dem Ort störte sie. Es war viel zu still für ein Haus, das voller Kinder war. Es war der düsterste Ort, den sie in all den Jahren ihrer Arbeit als Entwicklungshelferin je gesehen hatte. Ihre Hände hatten verstümmelte Jungen im Kongo behandelt, an Ebola erkrankte Babys, erschöpfte Flüchtlingsmädchen im Sudan. Aber immer vor dem aufmerksamen Blick ihrer Mütter oder dem einer Großmutter, eines Bruders, irgendeines Verwandten. Nie hatte sie einen Ort wie diesen gesehen, wo die Kinder nicht weinten, um nichts baten, mit niemandem Blickkontakt hielten …
Die Frau zeigte ihnen das Bettchen, in das sie Naomi legen sollten. Ein kaputtes Eisenbettchen mit einer Plastikmatratze, die noch keinen Bezug hatte, und in dem außerdem schon ein anderes, ebenfalls wenige Tage altes Baby lag. Marina sah das Bettchen und warf Mathias einen Blick zu. Naomi war ganz ruhig, sie war gerade am Erwachen und hatte die Augen noch geschlossen. Mathias streckte die Hand nach dem Gesicht des Mädchens aus und streichelte sie. Marina betrachtete sie noch ein paar Sekunden, küsste sie auf die Wange und legte sie ausgestreckt auf die Plastikmatratze des kaputten Bettchens, und dann war ihr, als zerspringe ihr die Seele.
Sie wandte sich dem Ausgang zu und ging mit gesenktem Kopf zur Tür. Ohne sich umzusehen. Naomi machte kleine Geräusche beim Erwachen und wartete auf die Arme dieser Frau, die sie in den ersten drei Tagen ihres kleinen Lebens immer gewiegt hatte. Naomi ließ einen schärferen Ton vernehmen. Noch einen. Sie stieß einen Schrei aus. Noch einen und noch einen. Bis sie anfing zu weinen, um diese vertrauten Arme zu rufen. Marina schloss die Augen. Die Seele in tausend Scherben. Sie spürte den Schmerz in ihrem Herzen. Einen Schmerz, der sich mit Wut, Scham und Traurigkeit mischte. Beim Verlassen des Waisenhauses hatte sie das hysterische Weinen des Babys im Ohr. Sie spürte einen Druck auf der Brust, und aus ihrem Seufzer wurde ein Schluchzen. Sie atmete tief durch und lief schnell zum Jeep. In diesem Augenblick hatte sie verstanden, warum es in dem Waisenhaus so still war. Es gab nicht genug Hände dort, um den fünfzig weinenden Babys, die in ihren Bettchen lagen, zu helfen. Und so weinten und weinten sie in den ersten Tagen, bis sie sich an die Leere gewöhnt hatten und nach und nach verstummten.
Kaleb steckte den Zündschlüssel ins Zündschloss. Mathias saß schon auf dem Beifahrersitz und sah sie traurig an. Marina stieg ein, schloss die Tür und öffnete das Fenster. Naomis Weinen war so durchdringend, dass man es vom Auto aus hören konnte. Kaleb fuhr los, und Marina wandte den Blick wieder der verfallenen Hütte mit den mürben blassrosa Wänden zu.
»Halt an.«
»Wie bitte?«, fragte der Fahrer ungläubig.
»Bitte halt an, Kaleb.«
»In zwei Stunden geht dein Flieger, Marina«, sagte Mathias.
»Bitte halt an«, forderte sie hartnäckig.
Kaleb bremste. Marina öffnete die Tür. Sie rannte zum Waisenhaus, ging hinein und lief bis zu dem Eisenbettchen, in dem Naomi lag und verzweifelt weinte. Sie nahm das Baby hoch und legte es sich auf die Brust.
»Ganz ruhig«, flüsterte sie mit sanfter Stimme. »Du hast Hunger, mein Mädchen, stimmt’s? Stimmt’s, Naomi?«
Naomi hatte vor mehr als vier Stunden zum letzten Mal ihr Fläschchen bekommen. Ein kleines Mädchen, das eigentlich schon zu groß war, um noch länger in einem so kleinen Bettchen zu schlafen, beobachtete sie schweigend und mit traurigen Augen. Mit Naomi auf dem Arm ging sie zu einer der Türen, die in den rückwärtigen Teil führten. Sie gelangte in einen kleinen Patio mit einem Betonanbau, aus dessen behelfsmäßigem Kamin Rauch aufstieg. Darin stand eine Frau, die einen riesigen Topf Wasser mit schmutzigen Fläschchen darin zum Kochen brachte. Die Frau hörte Naomis Gewimmer und drehte sich zu ihnen um.
»Bitte«, sagte Marina, »könnten Sie mir Milch für die Kleine geben?«
Ohne Naomi auch nur anzuschauen, ging die Frau zu einem hölzernen Regalbrett, auf dem eine große Büchse Milchpulver stand.
»Wenn ich die Fläschchen ausgekocht habe, bringe ich Ihnen eins«, sagte sie und deutete auf den Topf.
»Amesegënallô«, sagte Marina.
Angesichts der respektvollen Geste Marinas, sich auf Amharisch bei ihr zu bedanken, lächelte die Frau.
Naomi weinte immer noch. Marina nahm sie so auf den Arm, dass die Kleine möglichst viel von ihrer Umwelt sehen konnte. Sie wiegte sie, ging durch den Patio zu einem kleinen Fenster und entdeckte die zehn Kinder, die schweigend in ihren Eisenbettchen lagen.
Naomi hatte Hunger und weinte immer lauter, und ohne es zu wollen, lief Marina eine Träne über die Wange, als sie dem Baby ganz zart das Wiegenlied ins Ohr sang, das Großmutter Nerea ihr in den lauen mallorquinischen Nächten immer vorgesungen hatte: »A la nanita nana«.
Die Passkontrolle am Internationalen Flughafen von Addis Abeba war kurz vorm Kollaps. Lächelnde Stewardessen begleiteten stolze Piloten, chinesische Geschäftsleute schüttelten afrikanischen Kollegen die Hände, mit Koffern beladene Touristen wimmelten die Straßenhändler ab, während das Reinigungspersonal unaufhörlich das futuristische Flughafengebäude durchputzte.
Hand in Hand mit Mathias stand Marina in der Schlange und wartete. Mathias nahm den Rucksack ab, während Marina ihren Zopf nach vorn auf die Brust legte, damit sie ihn aufsetzen konnte.
»Du wirst mir fehlen.«
»Es sind ja nur zehn Tage«, antwortete Marina und stellte sich auf die Zehenspitzen, um Mathias auf den Mund zu küssen. Dann kehrte sie ihm den Rücken zu und entfernte sich Richtung Passkontrolle. Mathias ging ihr ein paar Schritte hinterher und rief sie. Sie drehte sich um, und er ergriff ihre Hand.
»Liebst du mich?«, fragte er sie leise.
Marina sah ihn erstaunt an. Diese einfachen Worte waren das Letzte, was sie in diesem Augenblick erwartet hätte. Sie küsste ihn. »Aber ja doch …«
»Dann sag es mir bitte. Wenigstens ab und zu.«
Marina strich ihm zärtlich über die Wange. Sie wusste um ihre Schwächen, sie war keine offenherzige Frau, die gern ihre Gefühle zeigte. Sie war eher reserviert und in ihren Beziehungen stets zurückhaltend. Diesen Vorwurf hatte sie im Laufe ihres Lebens schon einige Male gehört. In der Liebe war sie wie jede andere Frau auch, vielleicht nicht ganz so leidenschaftlich, aber vollkommen ehrlich. Sie war treu und ohne Falsch. Mathias wusste das, ganz wie die wenigen anderen Männer, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt hatten. Marina küsste ihn innig und sagte leise zu ihm: »Das sind doch nur Worte. Aber wenn du sie hören magst, kann ich sie dir jeden Tag und jede Nacht sagen, so oft du willst.«
»Ab und zu würde schon genügen.«
Da brachte Marina drei Abschiedsworte über die Lippen: »Ich liebe dich.«
»Die äthiopische Küche« stand auf dem Cover des Buches, das Marina in einem Duty-free-Shop im Terminal des Flughafens kaufte. Während sie das Abfluggate suchte, las sie das riesige Plakat mit dem Slogan, den die äthiopische Regierung sich ausgedacht hatte, um die Touristen ins Land zu locken. »Willkommen in Äthiopien, der Wiege der Menschheit«. Denn so hatten die Paläontologen dieses Land getauft. In Äthiopien war das erste weibliche Skelett gefunden worden, die erste Frau auf der Erde, beerdigt vor drei Millionen Jahren. Marina musste unwillkürlich an Naomis junge Mutter denken, die jetzt unter der Erde lag.
Sie gelangte zum Gate. Es war noch geschlossen. Sie setzte sich neben andere europäische Passagiere auf eine moderne, durchsichtige Bank von mehreren Metern Länge.
In wie vielen Flughäfen hatte sie schon gesessen und gewartet? Wie oft war sie in ihrem Leben schon geflogen? Und wie oft würde sie es noch tun? Internationale Flüge, Inlandsflüge, Flüge mit dem Propellerflugzeug in abgelegenere Gebiete. Auf diese Weise eilte Marina schon seit zehn Jahren im Dienst an der Menschheit von Kontinent zu Kontinent.
Mit der Ankunft in Äthiopien war paradoxerweise etwas Stabilität in ihr Leben gekommen. Ärzte ohne Grenzen war seit zwanzig Jahren in Äthiopien im Einsatz. Nur hier hatte die NGO eine beständige Einrichtung, denn aufgrund der dauerhaften Unterernährung eines Großteils der Bevölkerung galt in diesem Land der permanente Ausnahmezustand. Als Marina dreiundvierzig war, wurde ihr für ein Jahr die Stelle der Missionsleiterin in dem afrikanischen Land angeboten. Jetzt befand sie sich schon im dritten Jahr …
Sie holte das äthiopische Kochbuch aus der Tasche und strich mit der Hand übers Cover. Sie schlug es auf und blätterte darin. Das erste Foto zeigte eine afrikanische Frau beim Teigkneten. Neben dem Foto stand das Rezept für dieses Grundnahrungsmittel des äthiopischen Volkes. Der Lärm eines abhebenden Flugzeugs ließ Marina den Blick heben. Keine einzige Wolke. Blauer Himmel.
Anna würde das Buch gefallen. Schon als Kinder hatten sie beide Großmutter Nerea beim Brotbacken geholfen. Jeden Nachmittag hatte die Großmutter vor der Schule auf sie gewartet. Auf dem großen Holztisch standen schon die Zutaten für das dunkle Brot bereit, das angeblich so nahrhaft war, das pa moreno amb farina de xeixa. Sie mischten das Wasser mit dem Mehl und mantschten mit ihren kleinen Fingern in dem Teig herum. Es war unglaublich, aber selbst nach all den Jahren erinnerte sie sich immer noch an die genauen Mengenangaben für das pa moreno. Und daran, wie der Teig sich angefühlt hatte. Und an den Geruch. Dieser Geruch von frischem Brot, der das ganze Haus durchzog und sich in ihrem Herzen einnistete.
Es roch nach zu Hause.
»Your attention, please. This is the boarding announcement for flight number 2039 destination Frankfurt. Please proceed to gate number eleven.«
[1]Nach den Stadtbezirken die kleinste Verwaltungseinheit der Stadt
2Freundschaft oder Chapati
Zutaten:
200 g Mehl
1 Messerspitze Salz
1 EL Olivenöl
1 Tasse Milch oder Wasser
Zubereitung:
Das Mehl mit dem Salz vermischen. Öl dazugeben und alles vermengen. Nach und nach Wasser dazugeben, bis eine homogene Masse entsteht, die nicht mehr an den Händen klebt. Eine halbe Stunde ruhen lassen. Kugeln formen und mit dem Nudelholz zu dünnen Teigfladen ausrollen. Eine Pfanne ohne Öl heiß werden lassen, dann die Chapati ausbacken. Den Teig langsam aufgehen lassen. Sobald der Chapati-Fladen Farbe bekommt, aus der Pfanne nehmen.