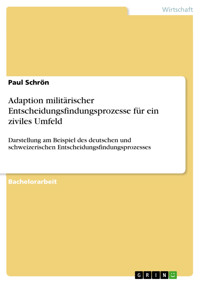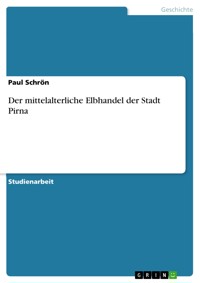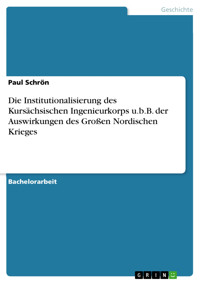
Die Institutionalisierung des Kursächsischen Ingenieurkorps u.b.B. der Auswirkungen des Großen Nordischen Krieges E-Book
Paul Schrön
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Neuere Geschichte, Note: 2,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Das späte 17. und frühe 18. Jahrhundert sahen einen tiefgreifenden Umschwung in nahezu allen Bereichen des Militärs. An die Stelle wuchtiger Trutzburgen traten flache, mit geometrischer Exaktheit geplante, Festungen. Der Söldner musste dem „miles perpetuus“ (Soldat eines stehenden Heeres) weichen. Die Artillerie entwickelte sich von einer Waffe, die hauptsächlich Angst verbreiten sollte, aber wenig Wirkung „im Ziel“ hatte, zu einer schlagkräftigen Waffengattung. Der Aufbau einer „[…] große[n] Anzahl der Befestigungen veränderte ohne Frage das Verhältnis der Belagerungen zu den Schlachten erheblich“. Obwohl einem späteren Zeitalter zuzuordnen sollte in diesem Atemzug Clausewitz zitiert werden: „Eine Festung, die eine wirkliche Belagerung veranlaßt und aushält, drückt natürlich mit einem stärkeren Gewicht auf die Waagschale des Krieges als eine, welche durch ihre Werke bloß den Gedanken einer Wegnahme dieses Punktes entfernt […]“. Damit stieg sowohl der Bedarf an geeigneten Erbauern dieser Festungen als auch an geeigneten Fachkräften und Möglichkeiten zu ihrer Belagerung. Einzelne Truppengattungen begannen sich im Laufe dieser Entwicklung herauszubilden. So wurden aus Artilleriehandwerkern sehr schnell Pontoniere, Sappeure, Mineure und schließlich Pioniere. Festungsbaumeister, die, zeitweilig angestellt und der Artillerie angegliedert, das militärische und teilweise auch zivile Bauwesen leiteten, wurden schließlich ein separater Teil des Heeres und in dauerhaften Diensten gehalten. Doch lief die Entwicklung in diesem Bereich wirklich so geradlinig ab? Was veranlasste das militärisch rückständige Sachsen dazu, ein Ingenieurkorps aus der Taufe zu heben – noch weit vor der Führungsmacht dieser Zeit, Frankreich, und vor dem militärisch dominanten Brandenburg-Preußen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Neuere Geschichte I
Professur für die Geschichte der Frühen Neuzeit
u. b. B. der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte HSU/UniBw HH
Die Institutionalisierung
des Kursächsischen
Ingenieurkorps u.b.B. der
Auswirkungen des Großen
Nordischen Krieges
Studienarbeit zur Erlangung des Bachelorgrades
Leutnant Paul Schrön
SFB B, SFBGrp 3/B
Page 3
1. Einleitung
a. Herleitung des Themas
Das späte 17. und frühe 18. Jahrhundert sahen einen tiefgreifenden Umschwung in nahezu allen Bereichen des Militärs. An die Stelle wuchtiger Trutzburgen traten flache, mit geometrischer Exaktheit geplante, Festungen. Der Söldner musste dem „miles perpetuus“ (Soldat eines stehenden Heeres) weichen. Die Artillerie entwickelte sich von einer Waffe, die hauptsächlich Angst verbreiten sollte, aber wenig Wirkung „im Ziel“ hatte, zu einer schlagkräftigen Waffengattung. Der Aufbau einer „[…] große[n] Anzahl der Befestigungen veränderte ohne Frage das Verhältnis der Belagerungen zu den Schlachten erheblich“.1Obwohl einem späteren Zeitalter zuzuordnen sollte in diesem Atemzug Clausewitz zitiert werden: „Eine Festung, die eine wirkliche Belagerung veranlaßt und aushält, drückt natürlich mit einem stärkeren Gewicht auf die Waagschale des Krieges als eine, welche durch ihre Werke bloß den Gedanken einer Wegnahme dieses Punktes entfernt […]“.2Damit stieg sowohl der Bedarf an geeigneten Erbauern dieser Festungen als auch an geeigneten Fachkräften und Möglichkeiten zu ihrer Belagerung.
Einzelne Truppengattungen begannen sich im Laufe dieser Entwicklung herauszubilden. So wurden aus Artilleriehandwerkern sehr schnell Pontoniere, Sappeure, Mineure und schließlich Pioniere. Festungsbaumeister, die, zeitweilig angestellt und der Artillerie angegliedert, das militärische und teilweise auch zivile Bauwesen leiteten, wurden schließlich ein separater Teil des Heeres und in dauerhaften Diensten gehalten.
Doch lief die Entwicklung in diesem Bereich wirklich so geradlinig ab? Was veranlasste das militärisch rückständige Sachsen dazu, ein Ingenieurkorps aus
1Luh: Kriegskunst. S. 99.
2Clausewitz: Vom Kriege. S.146.
Die Bedeutung von Festungen, sowie deren Erbauung und die Möglichkeiten ihrer Belagerung waren in den Napoleonischen Kriegen, trotz Weiterentwicklung der Artillerie und Massenheer, im Wesentlichen nicht anders als nahezu einhundert Jahre zuvor.
¡
Page 4
der Taufe zu heben - noch weit vor der Führungsmacht dieser Zeit, Frankreich, und vor dem militärisch dominanten Brandenburg-Preußen?
Betrachtet man die Lage und den Ausbau der kursächsischen Festungen als deutlichste Arbeit von Ingenieuren, bzw. Kriegsbaumeistern dieses Zeitrahmens, fällt auf, dass sie, militärisch gesehen, veraltet waren. Oftmals als Artilleriefestung nach italienischem Vorbild auf Anhöhen oder Bergen gelegen, waren sie für einen eventuellen Angreifer sicher nicht einfach zu nehmen. War jedoch die Artillerie zerschlagen oder ohne Munition, war die Festung keine Bedrohung mehr. Anders Brandenburg-Preußen und Frankreich. Beide bedienten sich des neuen, flachen Festungstyps (Brandenburg-Preußen in der niederländischen Variante, die Franzosen maßgeblich beeinflusst von Vauban).3
Der nächste Unterschied betrifft die Lage der Festungen. Während Brandenburg-Preußen und Frankreich vornehmlich Festungsanlagen anlegten, um die Grenzen zu sichern, setzte man in Sachsen auf die Sperrung der Gebirgspässe nach Böhmen und die Verteidigung der Elbe als Nachschub- und Transportweg. Dies ist nicht als die Handlungsweise einer fortschrittlichen, militärisch gleichwertigen, Partei anzusehen, sondern als Versuch, sich angesichts qualitativer und quantitativer Unterlegenheit mit möglichst wenigen Kräften zu behaupten.
Zahlenmäßig waren die sächsischen Ingenieure bei der offiziellen Aufstellung des Korps 1712 nicht annähernd so stark wie die „Ingenieurgruppe“ Frankreichs - also scheint auch die Größe kein ausschlaggebender Punkt gewesen zu sein.
3Beide Festungstypen sind dazu ausgelegt, vor den Mauern keinen toten Raum zu lassen, sondern auf das gesamte Feld, auch mit Musketenfeuer, wirken zu können. Der Unterschied zwischen beiden Typen liegt weniger in der Form oder der Planung, sondern in der Nutzung des Baumaterials. Während französische Festungen zumeist aus Stein errichtet wurden, setzte das niederländische System auf Erdwälle.
Vauban entwickelte allerdings auch die Angriffsweise auf eine solche Festung weiter, u.a. durch neue Formen von Laufgräben und Sappen. Vgl.: Luh: Kriegskunst. S. 84.
Vgl.: Duffy, Christopher: Fire and Stone: The science of Fortress Warfare 1660-1860. Castle Books: Edison 2006. S. 10-12.
¡
Page 5
Weicht man also von dem Gedanken ab, dass eine gewisse Professionalisierung und Größe die Aufstellung eines Korps nötig machen, so bleibt nur die militärische Notwendigkeit. Seit dem Erlangen der polnischen Krone befand sich Sachsen unter August I.4nahezu dauerhaft in militärischen Konflikten. Den wichtigsten davon stellt der sogenannte „Große Nordische Krieg“ dar, in dem Sachsen, Russland und Dänemark auf Gebietserweiterungen auf Kosten des noch sehr jungen Karl XII. von Schweden spekulierten. Nach anfänglichen Erfolgen musste Sachsen mit dem Frieden von Altranstädt vorläufig aus dem Geschehen ausscheiden - nicht, ohne jedoch die Gunst der Stunde nach dem Eingreifen Zar Peters I. zu nutzen und wieder in den Krieg einzutreten.
Die Aufstellung des Korps fand unmittelbar nach der ersten Phase dieses Krieges statt. Nimmt man nun den zynischen militärischen Grundsatz, dass „Vorschriften mit Blut geschrieben werden“, so besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass die Aufstellung als Folge und Lehre der ersten Kriegsjahre erfolgte. Dies wird in dieser Arbeit zu untersuchen sein.
4August der Starke/der Prächtige, August II. von Polen
¡