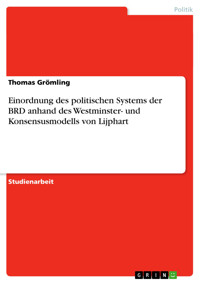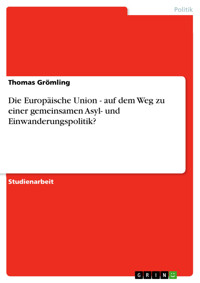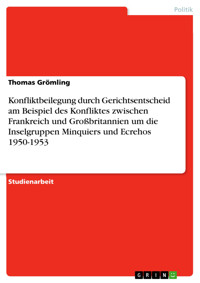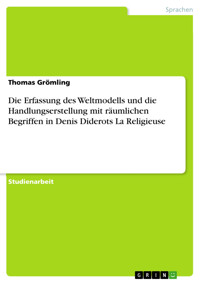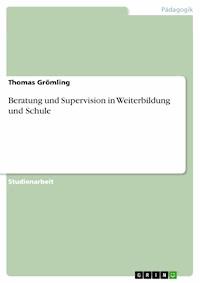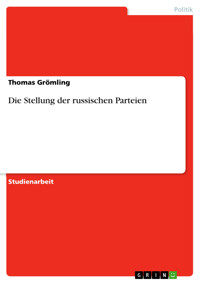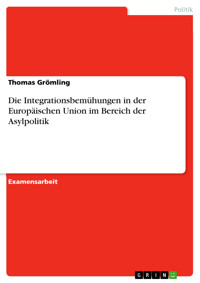
Die Integrationsbemühungen in der Europäischen Union im Bereich der Asylpolitik E-Book
Thomas Grömling
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,7, Universität Hamburg (Institut für Politische Wissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema Asyl begleitet mich seit geraumer Zeit. Im Zuge einiger Seminare wurde mir schnell bewusst, dass sich mein Interesse für Internationale Politik (und dort besonders für die EU) und meine Faszination für die Gewährung von Asyl miteinander verbinden ließen. Die Faszination des Asylbereiches auf mich erklärt sich dadurch, dass ich durch Freunde, die in einer Heidelberger Organisation arbeiteten, welche sich unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes um Asylbewerber in schwebenden Verfahren kümmerte, mit dem Thema Asyl über Jahre konfrontiert wurde. Im Rahmen eines Studentenjobs für die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung habe ich Anfang 2001 eine Erhebung an 9 Hamburger Grundschulen durchgeführt. Diese hatte zum Ziel Mehrsprachigkeit bei Grundschülern aufzuzeigen. Im Laufe dieser Tätigkeit sind mir besonders die Kinder von Asylbewerbern aufgefallen. Ihre schwere Stellung im Sozialgefüge der Klassen und ihre oft beeindruckende Sprachkompetenz (in mehreren Sprachen) hat mich bewegt. Teilweise wurden mir aber auch Bruchstücke ihres schrecklichen Fluchthintergrundes bei Fragen, die den familiären Background betrafen, bewußt. Diese Kinder werden eine absehbare Zeit oder ganz in Deutschland bleiben und auch vielleicht meine Schüler sein. Die Beschäftigung mit dem Thema Asyl wurde mir allein schon durch diesen Gedanken immer wichtiger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Page 1
Page 2
Universität Hamburg
Fachbereich Sozialwissenschaften Institut für Politische Wissenschaft
'LH,QWHJUDWLRQVEHPKXQJHQLQGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ
Erstgutachter: Prof. Dr. Cord Jakobeit
Zweitgutachter: Prof. Dr. Rainer Tetzlaff
Vorgelegt von: Thomas Grömling
Abgabedatum: 15.01.2002
Page 4
III
5HFKWOLFKHUXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHU6WDWXVYRQ$V\OEHZHUEHUQ Seite 36
6WDDWVDQJHK|ULJNHLWXQG(LQEUJHUXQJ Seite 37 2.4. Vergleich Seite 37
3. Die Situation der EU-Asylpolitik Seite 41 3.1. Die Anfänge Seite 426FKHQJHQXQG'XEOLQ Seite 43'HU9HUWUDJYRQ0DDVWULFKW Seite 44 3.2. Der Vertrag von Amsterdam Seite 45 3.3. Aktuelle Situation Seite 47 3.4. Bewertung Seite 48
4. Die EU-Asylpolitik im Hinblick auf die Integration der Union Seite 51 4.1. Hypothesen Seite 51 4.2. Situation der EU bei der Aushandlung des Amsterdamer Vertrages Seite 52
3UlIHUHQ]VWUXNWXUHQGHUZLFKWLJVWHQ%HWHLOLJWHQ Seite 52'LH%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG Seite 53'LH9)UDQ]|VLVFKH5HSXEOLN Seite 53
'DV9HUHLQLJWH.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQXQG1RUGLUODQG Seite 53'LH.RPPLVVLRQXQGGDV(XURSlLVFKH3DUODPHQW Seite 546SLOORYHUXQG6SLOOEDFNV Seite 54$V\OSROLWLN Seite 559LVDSROLWLN Seite 56(LQZDQGHUXQJVXQG(LQEUJHUXQJVSROLWLN Seite 57 4.3. Beurteilung durch die theoretischen Ansätze Seite 581HRIXQNWLRQDOLVWLVFKH6LFKWZHLVH Seite 58
,QWHUJRXYHUQHPHQWDOLVWLVFKH6LFKWZHLVH Seite 61 4.4. Bewertung Seite 67
Page 5
,,, )D]LW Seite 74,9 /LWHUDWXUYHU]HLFKQLVI Alphabetisches Abkürzungsverzeichnis
Page 1
, (LQOHLWXQJ
Das Thema Asyl begleitet mich seit geraumer Zeit. Im Zuge einiger Seminare wurde mirschnell bewusst, dass sich mein Interesse für Internationale Politik (und dort besonders für die EU) und meine Faszination für die Gewährung von Asyl miteinander verbinden ließen. Die Faszination des Asylbereiches auf mich erklärt sich dadurch, dass ich durch Freunde, die in einer Heidelberger Organisation arbeiteten, welche sich unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes um Asylbewerber in schwebenden Verfahren kümmerte, mit dem Thema Asyl über Jahre konfrontiert wurde.
Im Rahmen eines Studentenjobs für die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung habe ich Anfang 2001 eine Erhebung an 9 Hamburger Grundschulen durchgeführt.1Diese hatte zum Ziel Mehrsprachigkeit bei Grundschülern aufzuzeigen. Im Laufe dieser Tätigkeit sind mir besonders die Kinder von Asylbewerbern aufgefallen. Ihre schwere Stellung im Sozialgefüge der Klassen und ihre oft beeindruckende Sprachkompetenz (in mehreren Sprachen) hat mich bewegt. Teilweise wurden mir aber auch Bruchstücke ihres schrecklichen Fluchthintergrundes bei Fragen, die den familiären Background betrafen, bewußt. Diese Kinder werden eine absehbare Zeit oder ganz in Deutschland bleiben und auch vielleicht meine Schüler sein. Die Beschäftigung mit dem Thema Asyl wurde mir allein schon durch diesen Gedanken immer wichtiger.
1999 lebten in den Mitgliedstaaten der EU ungefähr 18 Millionen Menschen aus Nicht-EU-Staaten, rund 4,8 % der EU-Bevölkerung. Dieser Wert variiert sehr zwischen den einzelnen Staaten (Angenendt 1999, 6).
Unabhängig davon ob man den Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung der EU nun als hoch oder nicht erachtet, wird in den meisten Mitgliedstaaten eine lebhafte Diskussion um die Ausländerproblematik geführt und dabei auch immer die Asylgewährung miteinbezogen. Jüngstes Beispiel hierfür sind die Parlaments- und Kommunalwahlen in Dänemark im November 2001, in denen als ein Hauptpunkt des Wahlkampfes die Ausländerproblematik gestellt wurde. Dies löste eine Asyl- und Ausländerdebatte auf nationalem
1Es handelte sich hierbei um eine europäische Studie der Universität Tilburg (NL). In Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Belgien wurden Städte ausgewählt und zur Mehrsprachigkeit von Grundschülern befragt. In Deutschland fiel die Wahl auf Hamburg als Untersuchungsort. Alle staatlichen Grundschulen der Hansestadt nahmen an der Untersuchung teil und wurden von Studenten befragt.
Page 2
Niveau aus. Obwohl gerade die Asylbewerber, anerkannt oder nicht, an den 18 MillionenAusländern in der EU nur einen verschwindend geringen Teil ausmachen, so sind sie doch die am meisten in Debatten um Integration und Ausländer thematisierte Gruppe. Trotz vieler offensichtlicher Gemeinsamkeiten bei diesem Thema im öffentlichen Diskurs der Mitgliedstaaten, hat das Politikfeld der Asylpolitik in den Gemeinschaftsbereich der EU noch nicht lange und auch nicht vollständig Einzug gehalten. Da die Asylpolitik nicht zu den klassischen Herzstücken der EU gehört, wie etwa die Wirtschafts- und Agrarpolitik, aber gerade in den letzten 10 Jahren in den integrativen Fokus der Gemeinschaft/Union geriet, kann sie als Gradmesser für weitere Integration in anderen Politikfeldern der Union dienen.
Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Asylpolitik auf EU-Ebene. Hierbei werden mit dem Asylbereich verwandte Bereiche wie die Einwanderungspolitik nur insofern betrachtet, als sie wichtig sind um Integrationsbemühungen und Mechanismen in der Asylpolitik zu verdeutlichen. Ziel ist es aufzuzeigen, welche integrativen Maßnahmen im Politikfeld Asyl auf Gemeinschaftsebene ergangen sind und wie diese bewertet werden können. Hat die EU einen Weg zur Integration dieses Politikfeldes eingeschlagen oder handelt es sich lediglich um eine lose zwischenstaatliche Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten?
Die Disziplin der Internationalen Politik hat einige Theorien herausgebildet, um dem Phänomen der Integration von Einzelstaaten in einer supranationalen Organisation Herr zu werden. Viele dieser Theorien wurden explizit im Hinblick auf den Prozess der europäischen Integration ausgearbeitet. So stand auch der prozessorientierte Ansatz des Funktionalimus Mitranys in den 1940er und 1950er Jahren im Mittelpunkt der theoretischen Diskussion (Mitrany 1943). Dieser erklärt Integration als einen Prozess, der nicht politisch gerichtet sein muss. Funktionale Zusammenarbeit führt nach Mitranys Auffassung zu verstärkter Integration. Eine Weiterentwicklung des Funktionalismus stellt der Neofunktionalismus dar. Dieser von Haas entwickelte Ansatz (Haas 1964) trennt das Politische nicht mehr vom Funktionalen und erklärt wie sich Integrationsdruck aufbaut und welche Weiterentwicklung dieser erfahren kann. Gerade die 60er Jahre waren die Hochzeit des Neofunktionalismus, der versuchte die konkrete Form der damaligen Zusammenarbeit in der Europäischen Gemeinschaft zu erklären.
Auch staatszentristische Theorien wie der Intergouvernementalismus versuchen, Integrati- on zu erklären und weisen dem Nationalstaat die entscheidende Rolle dabei zu. Dieser An-
Page 3
satz wurde entwickelt, um die zunehmend zwischenstaatlich motivierte Zusammenarbeit in der Europäischen Gemeinschaft in den 70er und 80er Jahren zu erklären. Neben diesen großen Schulen existieren noch viele andere. Der Föderalismus ist hier zu nennen, der in der europäischen Integration den Prozess einer Schaffung eines föderalen Staates als Ziel sieht. Die Interdependenztheorie führt Integration auf die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Staaten zurück. Andere Theorien beschäftigen sich mit Teilaspekten der Integration, wie zum Beispiel juristische Ansätze, die in der gesetzlichen Basis der EG/EU einen fruchtbaren Untersuchungsgegenstand ausgemacht haben, aber auch die Institution des Europäischen Gerichtshofes und seine Rolle im Integrationsprozess untersuchen. Auch in den 90er Jahren hat die theoretische Entwicklung nicht halt gemacht. Gerade der Ansatz des liberalen Intergouvernementalismus von Moravcsik (Moravcsik 1998), trägt, durch Kombination dreier analytischer Ansätze, ein großes Erklärungspotential in sich.
In der folgenden Untersuchung werden der Neofunktionalismus und der Intergouvernementalismus einander gegenüber gestellt. Es wird sich auf diese beiden Theorien beschränkt, da der Umfang der Arbeit keine umfassendere theoretische Diskussion und deren empirische Überprüfung erlaubt. Der Neofunktionalismus und der Intergouvernementalismus erscheinen durch ihre Verschiedenheit vielversprechend zur Erstellung konkurrierender Hypothesen. Diese werden dann an empirischen Fakten überprüft.
Die Materiallage für den theoretischen Bereich ist mannigfach und warf das Problem der begründeten Auswahl auf. Anzumerken ist lediglich, daß die renommierteren Theorien älteren Datums sind und sich neuere Ansätze noch nicht so durchgesetzt haben wie etwa der Neofunktionalismus oder der Intergounernementalismus. Anders hingegen gestaltete sich die Materiallage die jeweiligen Präferenzstrukturen der Einzelstaaten betreffend. Hier war es nicht einfach relevante Informationen aus der Fülle herauszufiltern. Aus diesem Grund beschränkt sich die Darstellung der Verhandlungspositionen in dieser Arbeit hauptsächlich auf die Situation zur Aushandlung des Amsterdamer Vertrages.
Im theoretischen Bereich der vorliegenden Arbeit findet zunächst die Erstellung einer Arbeitsdefinition des Begriffes „Integration“ statt, mit der nachfolgend gearbeitet wird. Ausgehend von der Darstellung der Theorien des Funktionalismus/Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus erfolgt dann die Aufstellung zweier konkurrierender Hypo-
Page 4
thesen zur Integration des Politikfeldes Asyl in der EU, welche im weiteren Verlauf auf die empirischen Fakten angewandt werden.
Die Situation der Asylgewährung in der Bundesrepublik Deutschland, der V. Französischen Republik und des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ist Gegenstand des zweiten Punktes. Hierzu werden jeweils immer die Entwicklung der Asylgewährung bis heute, die (rechtliche) Basis auf der Asyl gewährt wird, das Asylverfahren, die rechtliche und soziale Stellung der Asylbewerber im jeweiligen Land, sowie Prinzipien und Praxis der Staatsangehörigkeit und Einbürgerung dargestellt. Ein Vergleich der Situation dieser drei EU-Staaten beschließt diesen Punkt.
Der dritte Teil zeichnet die Entwicklung und die aktuelle Situation der Asylpolitik auf EU-Ebene nach. Eine kritische Bewertung führt die Ergebnisse am Ende dieses Teiles zusammen.
Die theoretische Ebene findet im vierten Punkt Anwendung auf die empirische Faktenlage. Die Hypothesen des Neofunktionalismus und Intergouvernementalismus überprüfen die Situation der Asylpolitik auf EU-Ebene seit Amsterdam nach deren jeweiligen theoretischen Prämissen. Nach der nochmaligen Hypothesennennung schließt sich die Vorstellung der Handlungspräferenzen der wichtigsten Verhandlungspartner in Amsterdam an. Die zum Vertrag von Amsterdam führenden Spill-over werden dargestellt. Hierauf erfolgt die Erklärung des Integrationsprozesses nach den beiden theoretischen Ansätzen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse erfahren, in einem weiteren Schritt, eine kritische Beleuchtung. Die Problembereiche der theoretischen Erklärungskraft des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus finden sich im letzten Punkt in einer kritischen Reflexion wieder. Mögliche Lösungen dieser Probleme, und vielversprechende weitere Ansätze für die theoretische Diskussion der Integration, werden danach aufgezeigt. Eine abschließende Bewertung führt die Ergebnisse der vorherigen Teile in einer knappen Darstellung zusammen. Erweiterung erfährt diese Bewertung durch meine persönliche Stellungnahme.
,, +DXSWWHLO
1. Integrationstheorien
Zunächst erfolgt eine Arbeitsdefinition des Begriffs Integration, um dann in einem zweiten Schritt zwei miteinander konkurrierende Theorien der Internationalen Politik darzustellen,
Page 5
den Neofunktionalismus als Weiterentwicklung des Funktionalismus und, in Abgrenzung zu diesem, den Intergouvernementalismus. Anhand dieser beiden Ansätze wird eine Hypothesenbildung, die Integration der EU im Asylbereich betreffend, vorgenommen. Diese Hypothesen finden im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit Anwendung, um die empirischen Fakten zu analysieren und in das jeweilige theoretische Gedankengebäude einzu-ordnen.
1.1. Definition des Begriffs „Integration“
„Politische Integration bezeichnet die staatliche Einigung einerÆNation (im Sinne von „Kulturnation“) in einemÆNationalstaat (nationalstaatliche I.), die Gründung, Aufrechterhaltung und Erweiterung einerÆinternationalen Organisation und das Zusammenwachsen von zuvor unabhängigen Staaten zu einer supranationalen (überstaatlichen) Organisation wie im Falle derÆEuropäischen Union (Æ Supranationale Organisation).“ (Schmidt 1995, 431/432)
Ausgehend von der obigen Definition, soll im Weiteren unter Integration ein Prozess ver-standen werden, der in einer Internationalen Organisation souveräner Partner stattfindet, die im Laufe ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit, Politikbereiche gemeinschaftlich zu gestalten versuchen.
Integration kann einerseits ein bereits erreichter Zustand sein, oder der Prozess zu dessen Herstellung. In beiden Fällen wird unter Integration das Zusammengehen von zuvor unabhängigen Einheiten in einem neuen Zentrum verstanden (Chryssochoou/Tsinisizelis/ Stavridis/Ifantis 1999, 147). Der Übergang des Integrationsprozesses in den Integrationszustand und umgekehrt ist fließend und schwer voneinander abzugrenzen. Integrationsprozesse können auf mehreren Ebenen ablaufen und in Teilbereichen durchaus rückläufig werden.
1.2. Darstellung zweier konkurrierender Integrationstheorien
Der Funktionalismus/Neofunktionalismus und der Intergouvernementalismus sind bewusst als miteinander konkurrierende Ansätze ausgewählt worden, da sie jeweils einen unterschiedlichen Fokus auf das Phänomen der Integration werfen und somit auch in ihrer Analyse mit unterschiedlicher Gewichtung jeweils andere Schwerpunkte herausstellen. Dadurch ist anzunehmen, dass sie jeweils unterschiedliche Bereiche stärker favorisieren und somit Aspekte herausgearbeitet werden, die vom anderen Ansatz vernachlässigt werden.
Page 6
Aufgrund des festgelegten Umfanges der Arbeit musste eine Beschränkung auf zwei Theorien erfolgen.
)XQNWLRQDOLVPXV1HRIXQNWLRQDOLVPXV
Der Funktionalismus stellt eine Theorieschule in der Internationalen Politik dar. Der Begründer und Hauptvertreter ist David Mitrany. In Bezug und Abgrenzung zum Föderalismus postuliert er eine Methode zur internationalen Integration, die sich an funktionalen Elementen orientiert. Eine Liga als Integrationsziel beurteilt er als zu lose, während die Idee der föderalen Organisation ihm zu eng erscheint. Es soll eine Art internationaler Regierung geschaffen werden, deren Arbeit und Aufbau sich direkt an den internationalen Aktivitäten orientiert. Die Funktion allein, frei von theoretischen, ideologischen oder gouvernementalen Prämissen, soll die Form determinieren (Mutimer 1994, 21). Der Integrationsmotor im Funktionalismus stellt die Dynamik der internationalen Probleme mit staatenübergreifendem Inhalt dar. Dadurch, dass sich moderne Staaten, wie zum Beispiel im Bereich der Sicherheits-, Wirtschafts- oder Umweltpolitik mit Problemen konfrontiert sehen, die sie nicht allein, sondern nur in Zusammenarbeit mit anderen Staaten bewältigen können, kommt Kooperation und somit Integration zustande. Die logische Antwort des Funktionalismus auf diese Situation ist die Errichtung von Institutionen, die sich der spezifischen Problembereiche annehmen und auch mit Kompetenzen für diese umgrenzten Bereiche ausgestattet werden (Mutimer 1994, 22/23), aber auch nur so viele Institutionen wie gerade nötig sind, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen (Chryssochoou/Tsinisizelis/ Stavridis/Ifantis 1999, 9). Die Funktionen der jeweiligen Institutionen determinieren die Art und Weise, in der sich die Machtfülle der Institution entwickeln wird (Mutimer 1994, 24). Die Institutionen der demokratischen Vertretung (Parlamente) werden eher als Hindernisse des effizienten Regierens angesehen und in der Theorie zugunsten zentraler Institutionen vernachlässigt (Chryssochoou/Tsinisizelis/ Stavridis/Ifantis 1999, 8).
Der Neofunktionalismus ist am entscheidendsten von Ernst B. Haas geprägt worden. Er ging zunächst von einer Kritik an Mitranys Funktionalismus aus und entwickelte dabei eine eigene Integrationstheorie. Haas’ Hauptkritikpunkt an Mitrany war, dass er (Haas) es nicht für möglich hält, das Funktionale vom Politischen abzutrennen: