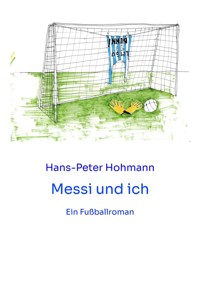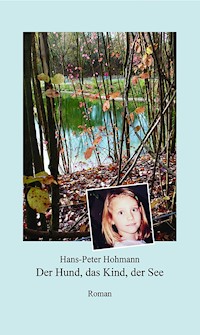6,99 €
Mehr erfahren.
Leopold Oberlin, Hauptkommissar im Münchner Morddezernat, ist seit einem Jahr mehr oder weniger arbeitslos. Ein missglückter Zugriff in einem Fall, der die Öffentlichkeit aufgewühlt hat - und schon ist er auf dem Abstellgleis gelandet. Er begehrt nicht gegen die ungerechte Behandlung auf, sondern zieht sich beleidigt in sein Schneckenhaus zurück. Wie zum Hohn wird ihm auch noch eine Assistentin zugeteilt, die als überfordert und inkompetent gilt. Außerdem ist sie hässlich, was Oberlin in seinem Schönheitsempfinden beleidigt. Um überhaupt irgendetwas zu tun, gräbt er einen alten Fall aus, den er zwar zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst hat, der ihn aber noch immer umtreibt. Und seine angeblich unfähige Assistentin Bernadette macht sich daran, ihn nach Kräften zu unterstützen. Schon nach kurzer Zeit ist eines klar: Nichts ist so, wie es scheint, und der "alte Fall" hält jede Menge lebensgefährliche Wendungen für die beiden bereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gewidmet der Schauspielerin Bernadette H., alias „Angelika Flierl“
Hans-Peter Hohmann
Die Isar kann sehr nass sein
Kommissar Oberlins letzter Fall
Ein München-Krimi
© 2021 Hans-Peter Hohmann
Satz, Layout und Fotografie: Dr. Pedi Lehmann
Lektorat: Barbara Hohmann
ISBN Softcover: 978–3–347–48214–2
ISBN Hardcover: 978–3–347–48216–6
ISBN E-Book: 978–3–347–48220–3
ISBN Großdruck: 978–3–347–48222–7
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition
GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, tredition GmbH, Halenreie 40-44, Hamburg, Deutschland
…zwei Jahre zuvor
Noch ist nichts passiert. Und daran ändert sich vorerst auch nichts. Denn es ist September, irgendein Tag. Ein warmer Tag immerhin, um die Mittagszeit.
Zwei junge Menschen haben auf einer Bank, die unter hohen Bäumen steht, Platz genommen. Sie liest in einem Buch. Er isst. So weit, so gewöhnlich.
Doch plötzlich hebt sie den Kopf und schaut ihren Begleiter an. Dann sagt sie:
„Die Wahrheit kann einen Menschen sehr einsam machen.“
„Äh, von dir?“
„Leider nicht. Steht hier, habe ich gerade gelesen.“
„Aha. Lass mal sehen. Haruki Murakami. Die Ermordung des Commendatore. Spannend?“
„Geht so. Manchmal zieht es sich.“
„Na dann.“
„Findest du, dass der Satz stimmt?“
„Keine Ahnung. Vielleicht schon. Es gibt ja nicht viele, die die Wahrheit vertragen können.“
„Genau. Und wenn du einem was sagst, und dem passt das nicht, ist es schnell aus mit der Freundschaft. Nehmen wir mal dich, zum Beispiel. Du bist richtig fett geworden.“
„Spinnst du? Willst du mich beleidigen?“
„Ich sage nur die Wahrheit.“
„Die will ich aber nicht hören. Schon gar nicht von dir, du blöde Kuh.“
„Ah, jetzt wird der Satz erklärt. Willst du wenigstens das hören?“
„Ich dachte, das Buch ist langweilig.“
„Manchmal. Manchmal aber auch nicht. Was ist! Willst du, oder willst du nicht?“
„Na gut, lass schon hören, Nervensäge.“
„Also, die Person will damit sagen, dass man lieber darauf verzichten soll, die Wahrheit herauszufinden, wenn der Schaden, der dadurch angerichtet wird, größer ist als der Nutzen.“
„Klingt irgendwie logisch. Dass ich, ähm, zu fett bin, weiß ich selber. Das musst du mir nicht noch unter die Nase reiben, du mit deiner blöden Wahrheit.“
„Bist du noch sauer?“
„Schon.“
„Sorry. Andererseits, ein bisschen was auf den Rippen, das steht dir. Irgendwie.“
„Du kannst mich mal.“
„Eigentlich ist das ja ziemlicher Unsinn.“
„Was?“
„Na, das mit dem Schaden und dem Nutzen.“
„Wieso?“
„Wenn ich es demnächst als Polizistin mit einem Verbrechen zu tun kriege, dann will ich doch die Wahrheit herausfinden, oder? Wer ist der Täter. Warum hat er…“
„oder sie!“
„… ja, meinetwegen, hat er oder sie das Verbrechen begangen. Sowas. Wenn dann der Fall aufgeklärt ist, gibt es doch nur einen Nutzen. Und keinen Schaden.“
„Der Täter hat eindeutig einen Schaden erlitten und keinen Vorteil von der Aufdeckung seiner Tat.“
„Und du hast einen Dachschaden. Das ist die Wahrheit.“
„Und du verträgst nicht, dass man dir widerspricht. Das ist auch die Wahrheit.“
„Du hast recht. Aber wenn es um die Wahrheit geht, ertrage ich keinen Widerspruch. Ich will halt immer die Wahrheit wissen.“
„Und wozu soll das gut sein?“
„Ich will Gerechtigkeit, ganz einfach. Zum Beispiel soll jemand, der ein Verbrechen begangen hat, bestraft werden. Damit Gerechtigkeit herrscht, muss die Wahrheit ans Tageslicht kommen. So einfach ist das.“
„Du bist halt eine hoffnungslose Idealistin, Bernie.“
„Und du bist ein Idiot.“
„Was isst'n du da? Thüringer Bratwurst? Lass mich mal abbeißen.“
„He, nicht alles!“
„Zu spät. Sorry.“
1
Ein möbliertes Zimmer – Bett, Tisch, zwei Stühle. Ein Schrank, der fast bis zur Decke reicht und der das Nötigste enthält, was man zum Leben braucht.
Am Fenster ein Ohrensessel aus dunklem Leder, davor ein Beistelltischchen, das hübsche, gedrechselte Beine hat. Das Fenster geht zum Hinterhof, wo es ruhig ist und schattig. Von der Decke baumelt eine Lampe, deren grelles Licht den ganzen Raum ausleuchtet. In einer Nische Bad und Toilette, vom Zimmer durch einen verschlissenen Vorhang abgetrennt.
Auf der nussbraunen, zerkratzten Holzplatte des Tischchens liegen alte Zeitungen, ein Krimi von Patricia Highsmith, Der talentierte Mister Ripley, und Erzählungen von Ingeborg Bachmann. Dazu ein amtliches Schreiben, geöffnet, und eine Brieftasche. Das Rotweinglas vom Vorabend steht nicht mehr da.
Er hatte es vorhin gespült und abgetrocknet, in der winzigen Küche, draußen, im Flur, die sich alle Bewohner der Pension teilen. Dann hatte er das Glas zurück in den Schrank zu den zwei anderen gestellt. Die Brieftasche steckte er ein. Jetzt konnte er gehen.
Frühstücken würde er im kleinen Café Zöttl in der Müllerstraße. Die Frau hinter der Theke, sie hieß Anni, den Nachnamen kannte er nicht, Frau Anni, wie sie angesprochen werden wollte, bediente ihn äußerst zuvorkommend. Sie nannte ihn beim Namen, sobald er die Tür öffnete und eintrat: „Schönen guten Morgen, Herr Oberlin.“
Sie fügte hinzu: „Wie immer?“, und als er nickte, erhellte ein Lächeln ihr Gesicht und strahlte in den schummrigen Raum hinein.
Vor knapp zehn Jahren war er ins Glockenbachviertel gezogen. Das hatte sich inzwischen vom Schmuddeleck der Münchner Innenstadt zur angesagten location gemausert. Nur die Müllerstraße, die streng genommen zur Isar-Vorstadt gehörte, hatte ihren leicht verranzten Charme in die neue Zeit hinübergerettet. Auf seinem täglichen Fußweg ins Zentrum erlebte Oberlin die Häutungen der Stadt so unmittelbar, als vollzögen sie sich an seinem eigenen Leib.
Nach dem schlichten Frühstück – ein Cappuccino, eine Semmel mit Butter und etwas Erdbeermarmelade, ein Croissant – ließ er sich noch ein wenig durch die Gässchen nördlich der Sendlinger Straße treiben. Mit dem trotz seiner Leibesfülle tänzelnden Schritt, dem hellgrauen Staubmantel, den er auch heute, an einem sonnig-kühlen Märztag, aufgeknöpft trug, mit den graumelierten Haaren, die ihm inzwischen fast wieder auf die Schultern fielen, hätte man ihn eher für einen Flaneur halten können als für einen Beamten, der auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte war.
Unter dem Mantel war er leger gekleidet: ein alter, unverwüstlicher Lodenjanker, ein kariertes Hemd ohne Krawatte, eine ausgeleierte Jeans. Seine schwarzen Haferlschuhe waren sorgfältig gepflegt. Auf den Gehstock, den er gelegentlich benutzte, wenn der Rücken sein Körpergewicht nicht mehr alleine tragen wollte, hatte er heute verzichtet; er fühlte sich beschwingt, das ruhige Wochenende hatte ihm gutgetan.
Man erkannte ihn hier und da auf den morgendlich frischen Straßen, ein herzliches „Grüß Gott“, ein Winken. Einer älteren Dame half er, ganz Kavalier der alten Schule, über die kaum befahrene Straße – die gute Tat des Tages, dachte er, das konnte er also abhaken.
Kurz nach acht Uhr dreißig war er fast am Ziel. Er bog in die Ettstraße ein, durchquerte den Hof, wich zwei eiligen Einsatzfahrzeugen aus und betrat das schmutzig-grüne Polizeipräsidium.
„Tach, Herr Hauptkommissar“, begrüßte ihn der Pförtner Ludwig, deutete eine salutierende Geste an und schlug im Geist vielleicht sogar die Hacken zusammen. Oberlin quittierte den Empfang mit einem freundlichen Nicken.
Gelegentlich, wenn der Gruß besonders zackig ausfiel, ließ er sich zu einem ironischen „Rühren!“ hinreißen, worauf Ludwig zuverlässig „Danke, Herr Hauptkommissar! Keine besonderen Vorkommnisse!“ antwortete.
Oberlin wusste, dass an dieser Stelle, nach dem Passieren der Eingangsloge, der erfreulichste Teil seines Arbeitstages bereits hinter ihm lag. Auf ihn warteten in den endlosen Fluren des Präsidiums nur noch knappe, allenfalls höfliche Begrüßungen, meistens jedoch verlegenes Schweigen oder hastig sich schließende Türen.
Außer dem Portier wartete nur eine einzige Person auf ihn: seine Assistentin Bernadette Rösler, die ihm erst vor wenigen Wochen zugeteilt worden war. Er hatte nicht darum gebeten, doch eines Tages saß sie da, als er kam, mit durchgestrecktem Rücken und einem wässrigen Blick aus blauen, durch eine groteske Brille unnatürlich vergrößerten Augen.
Er hatte sie unhöflich begrüßt, daraufhin war sie rot geworden und hätte fast angefangen zu weinen. Sie hatte dann den Kopf gesenkt, so dass er auf ihr struppiges, glanzloses braunes Haar starren musste. Er hatte sich eine Entschuldigung abgerungen, hatte etwas von Überarbeitung gemurmelt, was eine glatte Lüge war.
Sie hatte währenddessen ein Papiertaschentuch zwischen den Fingern zerkrümelt und anschließend die Teile in ihre Manteltasche gestopft. Dabei war sie erneut feuerrot geworden, nicht zum letzten Mal an jenem belanglosen Tag.
In der Zwischenzeit hatte er sich an sie gewöhnt, notgedrungen, denn sie erschien jeden Morgen auf die Minute pünktlich und wartete darauf, dass etwas geschah.
Auch heute saß sie an ihrem penibel aufgeräumten Schreibtisch und schaute ihn erwartungsvoll an, als er den kleinen Raum betrat, in den man ihn abgeschoben hatte. Oberlin seufzte, allerdings nur innerlich, schließlich wollte er die junge Frau nicht schon zu dieser frühen Stunde entmutigen. Sie hatte mehrere Stationen im Präsidium schneller als vorgesehen durchlaufen, denn jedes Mal war sie eiligst weitergereicht worden, „mit wärmsten Empfehlungen“, bis sie bei ihm, auf dem Abstellgleis, gelandet war.
Zwei Entsorgungsfälle, dachte Oberlin und setzte sich auf seinen Stuhl. Der knarzte, sobald der massige Körper des Kommissars mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Drei Entsorgungsfälle, präzisierte Oberlin und musste grinsen. Dieses jämmerliche Kabuff, fensterlos und nur auf verschlungenen Wegen erreichbar – im Vergleich dazu wohnte er in seiner Pension geradezu luxuriös, wenn nicht sogar herrschaftlich.
„Eine neue Woche liegt vor uns, Bernadette. Was steht an?“, fragte er, eine Spur zu forsch, er wusste ja, dass nichts anstand, was sie ihm auch bestätigte: „Nichts, Herr Hauptkommissar.“ Und nach einer kurzen Pause: „Tut mir leid, Herr Hauptkommissar.“ Den letzten Satz hatte sie dahingehaucht und war dabei wieder rot geworden, als trüge sie persönlich die Schuld daran, dass erneut kein Kriminalfall den Weg zu ihm gefunden hatte. Sie übergab ihm die Kladde mit den Ein- und Ausgängen. Seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit, falls man ihr untätiges Herumsitzen so nennen konnte, hatte sie Buch geführt. Hatte mit ihrer sorgfältigen Jungmädchenschrift das Datum eingetragen, die Posten „eingehende Fälle“ und „abgeschlossene Fälle“ jeweils mit einem zarten Strich markiert, „Keine besonderen Vorkommnisse“ als Fazit des Tages notiert und eine kringelige Unterschrift daruntergesetzt: Bernadette Rösler, dreiunddreißig Mal, Zeile für Zeile akkurat mit identischem Schriftbild.
„Danke, Bernadette“, antwortete Oberlin und schaute sie prüfend an. Dass es ihr leid tat, ihn jeden Tag wieder enttäuschen zu müssen, war neu. Wollte sie, dass er sich gegen die Missachtung, die ihm widerfuhr, zur Wehr setzte? Wollte sie ihn vielleicht zu einer heroischen Tat anstacheln – das Zimmer des Leitenden Kriminalrats stürmen, eine der herumliegenden Akten mit den unerledigten Fällen an sich reißen, rascheste Aufklärung versprechen – etwas in dieser Richtung?
„Danke, Bernadette“, wiederholte Oberlin, „Sie können jetzt…“
Er wusste für den Bruchteil einer Sekunde nicht weiter, „…äh, jetzt Mittagspause machen.“
Bernadette schaute auf ihre Armbanduhr. Es war acht Uhr fünfundfünfzig. So früh war sie noch nie in die Mittagspause geschickt worden. Bisher hatten sie wenigstens immer ein paar Worte gewechselt. Der Kommissar hatte sie ausgefragt, woher sie komme, was sie zur Polizei geführt habe, ob sie anständig untergebracht sei, ob sie ihre Familie vermisse.
Smalltalk, nicht mehr, aber sie hatte gewissenhaft Auskunft gegeben. Und sie hatte mit sichtbarer Erleichterung registriert, dass ihr neuer Vorgesetzter, der sechste oder siebte, ein Mindestmaß an Interesse für sie aufbrachte. Offenbar waren ihm inzwischen die Fragen ausgegangen, oder er hatte heute keine Lust auf ein Gespräch.
Bernadette erhob sich zögernd, ging zur Tür, drehte sich um und schaute noch einmal demonstrativ auf die Uhr. Dann nestelte sie verlegen an ihrem Armband. Sie hoffte vielleicht, dass ihr Chef doch eine Bitte äußerte, einen Wunsch, den sie erfüllen könnte.
Vielleicht glaubte sie auch, dass er noch ein freundliches Wort für sie übrig haben würde, eine kleine Geste der Zuwendung. Oder wenigstens einen Abschiedsgruß, „Bis später“, zum Beispiel, oder „Erholen Sie sich gut!“.
Aber der Kommissar schaute mit leerem Blick auf die vergilbte Tapete an der Wand, die zum Innenhof ging. Da seine Assistentin den Ausgang versperrte, wäre ein Fenster an dieser Wand die einzige Fluchtmöglichkeit gewesen. Doch dieses Fenster gab es nicht. Hier, wo es hätte sein können, lehnte sich eine magere Birke von draußen an das Gebäude. Oberlin wusste das, denn sie war der letzte Baum, der sich dem energischen Entgrünungsprogramm der Direktion widersetzte.
Wo er, Oberlin, bis vor einem Jahr sein Büro hatte, in der Hansastraße, wurde man vom Grün des angrenzenden Parks fast zugewuchert. Sein Lieblingsbaum, eine libanesische Zeder, ließ ihre Äste in Richtung seines Fensters besonders kräftig austreiben, so dass sie, wenn der Wind ging, zärtlich über die Scheiben zu streifen schienen. Eichhörnchen waren auf den filigranen Zweigen bis zum Fenster balanciert und hatten neugierig die Schreibarbeiten des Kommissars beobachtet. Als Belohnung für diese lobenswerte Aufmerksamkeit hatte Oberlin immer ein paar Nüsse oder getrocknetes Obst auf den Sims gelegt.
Petrik, sein schreckhafter Assistent, war jedes Mal in Panik geraten, sobald er das Kratzen der Krallen auf dem Holzimitat des Fensterbretts hörte. Um seine empfindsamen Nerven zu schonen, war er irgendwann ins Präsidium gewechselt, wo er seinen wie mit der Axt gezogenen Seitenscheitel nun im Dunstkreis der Eliten spazieren tragen durfte.
Wenn er jetzt zufällig seinem früheren Vorgesetzten über den Weg lief, bemerkte Oberlin, dass Petriks Gesicht stets von feinen Schweißperlen überzogen war. Die ganze Welt hätte bezeugen können, welch schier unmenschliche Verantwortung der junge Mann auf seinen schmalen Schultern trug.
Oberlin hatte keine Veranlassung zu schwitzen. Im Gegenteil. Ihn hatte man ja kaltgestellt, er musste keine Verantwortung mehr tragen. Dabei hatte er jahrelang zu den erfolgreichen Ermittlern der Stadt gezählt – gründlich, methodisch sauber, dazu persönlich korrekt, was keine Selbstverständlichkeit war. Ab und zu hatte er geradezu genialisches Gespür bewiesen, bei vertrackten Fällen, die dank seiner unorthodoxen Ansätze gelöst werden konnten.
Natürlich hatte er keine hundertprozentige Aufklärungsquote vorzuweisen, anders als seine ehemaligen Kollegen Batič und Leitmayr, deren Ruf fast schon legendär war. Die ließen das gemeine Fußvolk allerdings auch spüren, dass sie etwas Besonderes waren, mit geradezu überirdischen Fähigkeiten gesegnet.
Oberlin hatte das kalt gelassen. „Die einen stehen halt im Licht, und die im Dunkeln sieht man nicht“, war sein üblicher Kommentar gewesen, und mehr gab es dazu seiner Meinung nach nicht zu sagen.
Noch unbeliebter als die zwei „Unzertrennlichen“ war nur Meuffels gewesen. Hanns Meuffels bzw. Hanns von Meuffels, aber das „von“ hatte man ihm schon früh ausgetrieben im Kommissariat. Oberlin hatte sich mit dem „Baron“ immer gut verstanden. Sie hatten den gleichen trockenen Humor und einen ähnlichen, ironischen Blick auf die Gesellschaft. Und auf Hanns‘ Freundin Constanze hatte auch Oberlin ein Auge geworfen. Aber er hatte keine Chance gesehen, bei ihr landen zu können, also ließ er es sein.
Seit Hanns mit Constanze nach Hamburg gezogen war, hatte Oberlin ihn nur noch zwei, drei Mal getroffen. Bei diesen seltenen Gelegenheiten hatten sie gewohnheitsmäßig eine Partie Schach im Café Münchner Freiheit gespielt, hatten über dies und das gesprochen, nichts Weltbewegendes.
Irgendwann war der Kontakt eingeschlafen. Hanns jedoch hätte ihm bestimmt beigestanden, vor einem Jahr, bei jenem verwünschten Fall, dessen desaströsen Ausgang man Oberlin in die Schuhe schob und der letztlich zu seiner Strafversetzung ins Präsidium geführt hatte.
Der Kommissar blickte um sich. Bernadette hatte den Raum verlassen. Wo ist sie?, dachte er mit leichter Besorgnis. Und warum war sie nicht mehr da? Dann fiel es ihm wieder ein, er selbst hatte sie ja weggeschickt. In die „Mittagspause“. Das Wort war ihm spontan eingefallen, aber dass er es ausgesprochen hatte, war mehr als peinlich. Was würde sie jetzt von ihm denken? Sein schlechtes Gewissen rührte sich. Vielleicht könnte er sie ja einladen, überlegte er. Als eine Art Wiedergutmachung.
Er hatte für heute Abend zwei Opernkarten zurücklegen lassen, Lucia di Lammermoor, im Nationaltheater. Petrenko würde dirigieren, die fabelhafte Diana Damrau gab die Lucia. Er würde Bernadette fragen, ob sie ihn begleiten wollte. Sein Opernfreund Achim hatte gestern, kurz vor Mitternacht, „mit größtem Bedauern“ abgesagt. Gleich, wenn sie aus ihrer „Mittagspause“ zurückkam, würde er sie fragen. Falls sie zurückkam. Und falls sie sich überhaupt etwas aus Opern machte.
2
Es war spät geworden. Erst kurz nach Mitternacht hatten die letzten Besucher das Nationaltheater verlassen. Die Ovationen für die Stars hatten kein Ende nehmen wollen, also mussten sich auch Oberlin und Bernadette gedulden, bis sie ins Freie hinaustreten konnten. Es hatte geschneit, die Straßen waren glatt.
Von der oberen Treppenplattform konnte man gut die Verrenkungen der älteren Herrschaften verfolgen, die zur Straßenbahn schlitterten und auf den vereisten Pflastersteinen mehrmals hinzufallen drohten, bis sie endlich in das wartende Fahrzeug eingestiegen waren.
Oberlin verkniff sich eine süffisante Bemerkung, er fürchtete, Bernadette könnte sie ungnädig aufnehmen. Er schaute zu ihr hinüber. Sie kramte gerade in ihrer Handtasche. Ob es ihr gefallen hatte? Das hätte er gern gewusst. Sie hatte applaudiert, wie man das eben tat, aber nicht so enthusiastisch, wie es die meisten in dem bis auf den letzten Platz gefüllten riesigen Saal zu tun pflegten. Allerdings hatte es auch nicht wie Pflichtapplaus ausgesehen. Ihm hatte die Vorstellung insgesamt gut gefallen. Über gewisse Dinge, die sehr gewöhnungsbedürftigen Regieeinfälle zum Beispiel, musste er noch nachdenken.
Nachdenken musste er auch über seine Begleiterin. War das die gleiche Person wie jene Frau Rösler, die ihm tagtäglich gegenübersaß und so aussah, als wollte sie jeden Augenblick im Boden versinken? Vor Scham, vor Schüchternheit, vor Bedeutungslosigkeit, was wusste er? Mit ihrer riesigen Brille, ihrer altmodischen Kleidung und mit den glanzlosen braunen Haaren, die zur immer gleichen „Frisur“ gebunden waren, wirkte sie wie eine graue Maus, die in ihrer beider Abstellkammer genau am rechten Ort war.
Nachdem er sich vor Beginn der Vorstellung an der verabredeten Stelle eingefunden hatte, etwas später als ausgemacht, und als weitere zehn Minuten verstrichen waren, wurde er allmählich unruhig, denn er konnte Bernadette nirgends entdecken.
Dass sie zu spät kommen würde, war eigentlich ausgeschlossen, und inzwischen hatte sich die Schar der Wartenden deutlich ausgedünnt.
Der schönen jungen Frau, die ein paar Schritte entfernt stand, schien es wie ihm zu gehen. Sie schaute unentwegt in Richtung Straßenbahn, der ihre Begleitung offenbar entsteigen sollte. Mit ihren dunklen, glänzenden Locken und dem bodenlangen schwarzen Kleid, das mit funkelnden Pailletten besetzt war, ähnelte sie der „Königin der Nacht“ die er vor zwei Wochen hier im Haus bewundert hatte. Er zögerte, ob er der eleganten Dame ein Kompliment machen sollte, gab sich dann aber doch einen Ruck, trat zu ihr und sagte: „Nur schade, dass heute nicht Die Zauberflöte auf dem Programm steht. Sie hätten die Hauptrolle sicher gehabt.“
Dabei lächelte er verlegen, denn es stand zu befürchten, dass die junge Frau seine Anspielung nicht verstehen würde.
Sie wandte sich zu ihm um, er erkannte sie, sie ihn ebenfalls. Sie wurde purpurrot und rief aus: „Gott sei Dank, Herr Hauptkommissar, ich dachte schon, ich hätte Sie verpasst!“
Bernadette – die „Königin der Nacht“! Oberlin konnte nicht fassen, was er da zu sehen bekam. Ihr war kalt, das immerhin bemerkte er, denn sie trug über dem Kleid nur eine dünne Stola um die Schultern. Deshalb schob er seine Assistentin rasch ins Foyer, wo man sie zur Eile mahnte, denn es hatte bereits dreimal geläutet. Das Orchester saß im Graben und wartete nur noch auf Kirill Petrenko, damit das dramma tragico beginnen konnte.
In den Pausen schwiegen sie – Oberlin, weil es vorläufig nichts zu sagen gab, Bernadette, weil sie, wie er annahm, zu benommen war von den flirrenden Eindrücken, die auf sie einstürzten. Er hatte ihr in der ersten Pause ein Glas Sekt spendiert, an dem sie sich festhielt, weil sie nicht wusste, wohin mit ihren Händen. An der lauwarmen Brause hatte sie nur genippt, und als es Zeit war, wieder in den Saal zu gehen, hatte sie das fast volle Glas auf einem Tischchen abgestellt. Dabei war sie dunkelrot angelaufen.
Die zweite Pause verbrachte sie größtenteils mit dem Anstehen vor der Toilette, weshalb Oberlin einige Bekannte begrüßte. Friederike Michalek zum Beispiel, eine Freundin seiner Frau, beziehungsweise Ex-Frau, und Inhaberin einer Großbäckerei mit siebzehn Filialen im Stadtgebiet. Sie hatte, wie er wusste, nah am Wasser gebaut und folgerichtig Tränen in den Augen.
„Du weinst jetzt schon, Fritzi?“, fragte er, nachdem er zu ihr getreten war und von einer Parfümwolke eingenebelt wurde.
„Du kennst mich ja, Leo“, antwortete sie und schnäuzte sich kräftig in ein Taschentuch, „ich denke halt das schlimme Ende immer schon mit.“
„Hier hast du noch eine Packung Tempos, du Ärmste. Du wirst sie brauchen“, lachte Oberlin, verabschiedete sich und tänzelte weiter durch das Stimmengewirr.
Von weitem sah er den Polizeipräsidenten, wie immer umringt von einer Schar halb verblühter Verehrerinnen. Er trug Galauniform. Das wäre dem Kommissar nie eingefallen. Er hielt Beruf und Freizeit immer strikt getrennt, und wenn er in die Oper ging, gab es für ihn nur Smoking, da war er altmodisch. Obwohl, fiel ihm ein, in Uniform zu gehen war eigentlich noch altmodischer, da dachte man doch gleich an „Preußens Gloria“ und an die „tausend Jahre“, die darauf folgten. Aber Geschichtsvergessenheit schien gerade wieder groß in Mode zu kommen, und den dümmlichen Tanz der gackernden Hühner um den eitlen Gockel empfand er als peinlich und beschämend.
Er bewegte sich wieder in Richtung Saal und wartete an der seitlichen Flügeltür auf Bernadette, die wenig später eintraf. Er sah sie schon aus der Ferne, denn die Menge schien sich bereitwillig zu teilen, sobald diese funkelnde Erscheinung sie durchschritt. Und Oberlin konnte es noch immer nicht fassen.
Lucias Wahnsinn hatte sich an der kalten Nachtluft verflüchtigt. Und was nun?, überlegte Oberlin, da sie inzwischen ganz allein auf der Plattform standen. Ein Taxi, zuerst zu ihr, dann zu mir, war sein von leichtem Bedauern unterlegter Gedanke. Aber, wies er sich zurecht, was sollte er mit seiner Assistentin schon anfangen wollen? Angeschwiegen hatten sie sich bisher zur Genüge, und mehr als reden war sowieso nicht drin.
Bernadette enthob ihn jedoch einer Entscheidung, denn sie sagte plötzlich mit fester Stimme: „Ich will noch nicht nach Hause, Herr Hauptkommissar. Könnten wir vielleicht noch irgendwohin gehen? Hunger hätte ich auch. Es hat doch länger gedauert, als ich erwartet hatte.“
Der Kommissar war angenehm überrascht. Das wäre auch sein Vorschlag gewesen. Eine weitere erfreuliche Seite, die er an seiner offenbar durchaus wandlungsfähigen Mitarbeiterin entdecken durfte. Und, soweit er sich erinnern konnte, ihre erste Bitte!
Er antwortete rasch: „Natürlich, Bernadette, eine sehr gute Idee“, damit sie nicht, aus Furcht, etwas Falsches gesagt zu haben, wieder errötete und womöglich einen Rückzieher machte.
Das Franziskaner hatte schon geschlossen, aber im Spatenhaus fanden sie im hintersten Eck einen Zweiertisch. Der Oberkellner kannte ihn und meinte, als der Kommissar um die Speisekarte bat, die Küche würde sicher „noch ein paar Reste zusammenkratzen, zur Stärkung von Seele und Leib!“
Bei „Leib“ zwinkerte der „Service Guide“, wie das Personal neuerdings in den bevorzugt von internationaler Klientel besuchten Häusern hieß, mit den Augen und schielte zu Bernadette hinüber.
Oberlin ärgerte das. Einerseits fand er die plumpe Vertraulichkeit unangemessen, zum anderen war er empört über die halbseidene Andeutung. Denn obwohl er für seine einundsechzig Jahre noch ganz passabel aussah – er hatte etwas Beschwingtes an sich und die langen Haare erinnerten an den in München vergötterten Barkeeper Charles Schumann (die Körpersilhouette leider nicht, wie er zugeben musste) – würde er nicht im Traum daran denken, sich mit einer jungen Frau von…
Er hielt inne. Wie alt war seine Assistentin eigentlich? Im Dienst wirkte sie irgendwie alterslos, heute Abend dagegen hätte er sie auf höchstens zweiundzwanzig geschätzt. Wie auch immer, er musste zur Kenntnis nehmen, dass Frauen wie Bernadette Rösler nicht zu seinem Beuteschema zählten. Falls er überhaupt noch eines hatte.
Bernadette unterbrach seine Grübeleien, indem sie ihn bat, ein Glas Wein, roten, wenn es einen gab, und die Entenbrust für sie zu bestellen, statt Kroketten einen Salat dazu. Sie wolle sich etwas frisch machen, wenn er gestatte.
Er gestattete, erhob sich sogar, als sie den Tisch verließ, und gab dem Kellner ein Zeichen.
„Zweimal die Ente“, diktierte er, „ein Viertel Blaufränkisch von Heinrich, aber den guten, und ein Helles. Ach ja, und einmal statt Kroketten den Spinatsalat, mit Kürbiskernöl.“
Und nach einer kleinen Pause fügte er noch an: „Wenn es keine Mühe macht.“ Das musste er dem aufdringlichen Kellner noch hinreiben.
Es machte keine Mühe, wie die inzwischen wieder devot dienernde Servicekraft versicherte, und als Bernadette von der Toilette zurückkam, stand bereits die gesamte Bestellung auf dem Tisch.
Sie aßen und schwiegen sich an, aber das waren sie ja gewohnt. Es schmeckte trotz der späten Stunde überraschend gut, wie frisch zubereitet. Bernadette wollte, nachdem die Teller abgeräumt worden waren, noch ein Achtel Blaufränkisch, trank einen großen Schluck und leckte sich leicht über die Lippen. Oberlin sah, dass sie mit seiner Wahl zufrieden war, räusperte sich dann, um zu fragen, ob man nicht allmählich aufbrechen sollte. Bernadette schien auch daran zu denken, denn sie hob ihr Glas. Um es auszutrinken, wie der Kommissar vermutete.
Doch erneut verblüffte ihn seine Assistentin, denn sie begleitete ihre Geste mit einer kleinen Rede.
„Lieber Herr Hauptkommissar!“, sagte sie, „Sie haben mir einen unvergesslichen Abend geschenkt. Dafür werde ich Ihnen ewig dankbar sein. Die Musik, die festliche Stimmung! Ich fühle mich, ich weiß nicht wie.“
Sie war wieder rot geworden und Oberlin wollte schon geschmeichelt abwehren, doch sie war noch nicht fertig.
„Aber entschuldigen Sie“, fuhr sie fort, „es ist vielleicht dumm von mir, aber diese Frau, diese Lucia, die ist doch so lächerlich, so unglaubwürdig, finden Sie nicht? Liebt einen Mann, heiratet einen anderen, bringt den um und, statt froh zu sein, ihn zum Glück rasch wieder loszuwerden, wird sie wahnsinnig? Der das Drehbuch geschrieben hat…“
„Libretto“, warf Oberlin ein, eine Besserwisserei, die ihm sofort unangenehm war.
„…Libretto, verzeihen Sie, also der das Libretto geschrieben hat, hatte echt keine Ahnung von Frauen. Und die arme Sängerin, die die Rolle spielen musste, hat zwar so getan, als würde sie diesen ganzen Blödsinn durchschauen, könnte aber leider nichts dagegen tun, denn so steht es halt im Dreh …, äh, Libretto!“
„Das ist eben eine Oper, die vor fast zweihundert Jahren…“, wollte Oberlin beschwichtigend einwerfen, doch Bernadette ließ ihn nicht ausreden.
„Die Theaterstücke über Antigone, Elektra oder Medea sind vor über zweitausend Jahren geschrieben worden, und die sind kein bisschen verstaubt oder lächerlich. Diese Frauen wurden von den Dichtern ernst genommen. Lucia ist dagegen nur ein Zerrbild, eine Fantasievorstellung – wie man sich die Frau als Mann halt wünscht: gefühlvoll, damit sie sich verliebt; gehorsam, damit sie den Wünschen der Männer auch brav nachkommt; und wenn sie mal konsequent handelt, erklärt man sie für wahnsinnig und räumt sie aus dem Weg. Oder idealerweise tut sie es gleich selber.“
„Darf ich Ihnen noch ein Glas Wasser bestellen, Bernadette?“
Oberlin klang besorgt, obwohl eigentlich kein Anlass dazu bestand, aber die junge Frau beruhigte ihn und sagte, es sei alles in Ordnung, und ja, Wasser wäre nett, vielleicht eine Flasche, wenn es nichts ausmache? Es könne auch Leitungswasser sein.
„Finden Sie, ich übertreibe?“, nahm Bernadette das Gespräch wieder auf, nachdem sie die Flasche in einem Zug zur Hälfte geleert hatte.
„Nun, wissen Sie…“. Oberlin zögerte, die Rede seiner Assistentin hatte ihn sprachlos gemacht, alles an ihr machte ihn sprachlos, so dass er nicht recht weiterwusste.
„Ich habe natürlich keine Ahnung“, unterbrach ihn Bernadette, bevor er mit seinem Gestotter zu einem sinnvollen Ende gekommen war, „das war die erste Oper, die ich besuchen durfte, und vielleicht müssen die Personen in Opern so sein, so künstlich und unglaubwürdig. Denn schließlich singt im echten Leben auch keiner, wenn er wahnsinnig wird, und wenn, dann jedenfalls nicht so schön. Obwohl, „schön“ gesungen hat die Sängerin eigentlich nicht, sondern irgendwie „passend“, finden Sie nicht auch?“
Bernadette schaute ihr verdattertes Gegenüber erwartungsvoll an, doch von Oberlin kam weiterhin nichts. Das war aber nicht schlimm, denn Bernadette hatte sich noch eine letzte Pointe für ihn aufgespart:
„Da Sie ein Mann sind, Herr Hauptkommissar, müsste es Ihnen doch gegen den Strich gehen, dass auch die Männer als hirnlose Vollidioten hingestellt werden. Gut, das trifft vielleicht die Wirklichkeit schon eher, ich will da nichts ausschließen, aber…, upps…“
Sie hielt sich die Hand vor den Mund, errötete zum letzten Mal an diesem Abend und schaute schuldbewusst auf ihren Vorgesetzten.
„Ich glaube“, sagte sie kichernd, „ich rede mich gerade um
Kopf und Kragen. Den Wein bin ich nämlich auch nicht gewöhnt, nicht nur die Oper.“
Oberlin beeilte sich zu versichern, dass alles gut sei und er ihre Gedanken äußerst anregend finde. Es sei nun allerdings schon kurz vor zwei und selbst hier, im Spatenhaus, wolle man irgendwann schließen. Ein Taxi stehe für sie bereit, das sie nach Hause bringen werde.
Draußen wünschte er ihr eine gute Nacht und sagte zum Abschluss dieses denkwürdigen Abends:
„Liebe Frau Rösler. Wir treffen uns morgen, also heute, um halb, oder sagen wir um zehn, keinesfalls früher. Und bitte“, fügte er nach kurzem Zögern hinzu, „bitte bringen Sie die Bernadette von heute Abend mit!“
3
Es wurde fünf nach zwölf. Der Kommissar hatte verschlafen. Mit dem Rad fuhr er durch den Eisregen, in den sich der gestrige Schneefall verwandelt hatte, zur Ettstraße und kam gerade rechtzeitig, um Bernadette abzufangen. Sie wollte gerade die Mittagspause antreten, die echte, und eine Runde um den Block gehen, wie sie das meistens tat. Oberlin lud sie in ein Café am Lenbachplatz ein, „zum Frühstück“, wie er zugeben musste, denn zu Frau Anni hatte er es nicht mehr geschafft.
„Außerdem muss ich mich aufwärmen, Radeln im März ist nicht unbedingt das reinste Vergnügen.“
Er lachte, obwohl seine Hose fast bis zu den Knien aufgeweicht war. Und da er ohne Kopfbedeckung losgefahren war, tropfte das Wasser von seinen nassen Haaren in den Hemdkragen hinein.
Oberlin bemerkte, dass Bernadette ihn interessiert ansah. Vermutlich denkt sie sich ihr Teil, was meine Alltagstauglichkeit betrifft, glaubte er ihrem Blick zu entnehmen. Sie jedenfalls trug eine rote Wetterjacke und in der dick gepolsterten Kapuze verschwand ihr Kopf fast vollständig. Die Brille, die sie am Vorabend ebenfalls nicht getragen hatte, schien sie vergessen zu haben.
Sie hatte „zur Sicherheit“ einen kleinen Schirm mitgenommen, der bei diesem Wetter auf jeden Fall praktischer war als ein Fahrrad, wie Oberlin, als er ihn entgegennahm, dankbar feststellte, denn es regnete inzwischen buchstäblich in Strömen.
„Das könnte eine schöne Gewohnheit werden“, begann der Kommissar, nachdem er seinen nassen Mantel aufgehängt hatte. Er ließ sich neben Bernadette auf der Eckbank nieder, wobei er peinlich darauf bedacht war, dass sie nicht mit der triefenden Hose in Berührung kam.
„Die schöne Gewohnheit, sich ohne Frühstück vollregnen zu lassen?“, fragte sie und lächelte ihn unschuldig an.
Schon wieder ein neuer Zug an ihr, dachte Oberlin, witzig, schlagfertig, und er freute sich darauf, was es noch alles an ihr zu entdecken geben würde.
„Das könnte Ihnen so passen“, antwortete er, „ich als armes Opfer der widrigen Umstände, und Sie spielen hier die fürsorgliche Mutter, die dem Kleinen die Nase putzt und ihn trockenlegt…äh, Pardon,…abtrocknet, natürlich.“
Sein Versprecher war ihm peinlich, doch Bernadette ging lachend darüber hinweg und sagte:
„Für mütterliche Gefühle bin ich nicht zuständig, und das nächste Mal entlasse ich Sie einfach früher ins Bett, damit Sie nicht unausgeschlafen Ihren schweren Dienst antreten müssen.“
Erschrocken hielt sie inne. „Tut mir leid“, sagte sie und legte ihm leicht die Hand auf den Arm. „Das war gedankenlos, und außerdem geschmacklos. Bitte entschuldigen Sie, Herr Hauptkommissar.“
„Wenn Sie wüssten, wie recht Sie haben, Bernadette“, entgegnete Oberlin, „diese Art von Dienst ist wirklich schwer und belastend. Und apropos „Hauptkommissar“, könnten wir bitte auf derartige Förmlichkeiten verzichten? Oberlin, das muss reichen.“
Und nach einem Räuspern sagte er noch: „Auch ich muss mich entschuldigen.“
„Aber…“
„Doch, doch“, unterbrach er sie, „ich entschuldige mich, dass ich Sie immer mit Ihrem Vornamen angeredet habe, als wären Sie eine Schülerin oder eine irgendwie untergeordnete Person. Ich habe Sie respektlos behandelt, und das tut mir leid.“
„Entschuldigung angenommen“, sagte sie lächelnd. „Aber, bitte, bleiben Sie bei „Bernadette“. Denn für meine bisherigen Kollegen war ich immer nur „die Rösler“, oder „die dumme Rösler“, wenn sie glaubten, dass ich es nicht mitkriege. Wenn Sie mich dagegen mit „Bernadette“ anreden, fühle ich mich wie jemand, der gemocht wird. Wie jemand, um den man sich kümmern will. Und das wollen Sie doch, Herr Haupt…, äh, Herr Oberlin?“
Der Kommissar schluckte. Er konnte sich genau vorstellen, wie die jungen Schnösel vom Typ Petrik mit dieser reizlosen jungen Frau, als die sie sich bisher ausgegeben hatte, umgesprungen waren. Wie sie sie gnadenlos auflaufen ließen und mit anzüglichen Bemerkungen blöd anmachten.
Er selbst hatte sie zwar nicht bewusst herabgesetzt oder gar gedemütigt, zumindest erinnerte er sich nicht. Aber seine nur halb interessierte, gönnerhafte Fragerei, oder dass er sie einfach wegschickte, wie gestern, wenn er keine Lust zum Reden hatte und sich lieber in dem Unrecht, das man ihm antat, suhlen wollte – das war schon „unterste Schublade“ gewesen. So etwas hätte ihm nicht passieren dürfen.
„Ja, Bernadette. Ich werde mich um Sie kümmern“, sagte er und schaute sie an. Besser jedenfalls als bisher, ergänzte er in Gedanken, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen.
Sie nahm sein Versprechen mit leicht skeptischem Blick zur Kenntnis und bestellte sich einen Tee. Abwarten und Tee trinken, fiel ihm dazu automatisch ein. Und er dachte: Kluges Mädchen.
Sie aber lächelte, als hätte sie in seinen Gedanken gelesen.
Sie blieben, bis sämtliche Kleidungsstücke des Kommissars trocken waren. In diesen knapp zwei Stunden breitete Bernadette ihr Leben vor ihm aus: die vierköpfige Familie mit Hund; der kleine Ort in der Nähe von Landsberg; ihre mehr oder weniger ereignislose Schulzeit, der sich ein Jahr als Au-Pair-Mädchen in Kanada anschloss; das tragische Schicksal einer Freundin, das zu ihrem Entschluss, zur Polizei zu gehen, führte; die drei Jahre Ausbildung in Nürnberg, wo sie Triathlon als große Leidenschaft entdeckte; Abschluss als Jahrgangsbeste (damit rückte sie aber erst heraus, als Oberlin nachfragte). Außerdem betrieb sie diverse asiatische Kampfsportarten, gar nicht mal so schlecht, wie sie zugab. Aktuell kein Freund, das verriet sie auch noch, dafür zwei gute Freundinnen hier in München; eine war Kindergärtnerin, mit der wohnte sie zusammen. Die andere war IT-Entwicklerin, eine coole junge Frau, die ihr bei Recherchen helfen konnte.
Sie hatte eine kleine Wohnung in der Au gefunden, in der Lilienstraße. „Ein süßes Viertel“, so ihre Worte. Sie aß gern Chinesisch, Vietnamesisch, mit Vorliebe scharf. Dazu Jasmintee. Alkohol selten, wenn, dann Rotwein, „aber noch nie so guten wie gestern“, fügte sie hinzu.
„Und auch hier, im Café, mit Ihnen zu sitzen, finde ich schön. So, mehr fällt mir zu meiner Person nicht ein, und es reicht Ihnen vermutlich auch“, sagte sie, lachte und lehnte sich zurück.
Sie hatte, während sie die Stationen ihres vierundzwanzigjährigen Lebens durchgegangen war, die Tischdecke von sämtlichen Krümeln gereinigt, mehrmals, und das Tuch wieder und wieder glattgestrichen, so dass es nun wie neu aussah.
„Aber, Herr Oberlin“, setzte sie erneut an, „eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass Sie auch mir eine Frage gestatten, wenigstens eine, und zwar zu Ihrem sicher abwechslungsreichen und vielleicht sogar hochdramatischen Berufsleben.“
„Gestatten allemal, ob auch beantworten, hängt von der Frage ab“, entgegnete Oberlin und schob den Apfelstrudel, den er sich eben bestellt hatte, zur Seite. Der Appetit war ihm vergangen, denn er ahnte natürlich, was nun kommen würde. Die Frage aller Fragen. Sie war ihm von den wenigen Freunden und Bekannten, von Fremden wie Vertrauten gestellt worden.
Seine Standardantworten waren: „Ich bin noch nicht so weit, darüber zu reden.“ Dann: „Du bist der Erste, der es erfährt.“ Schließlich: „Ich kann die Frage nicht mehr hören!“
Seit einem Jahr ging das jetzt so, und er hätte alle Antworten, die er sich zurechtgelegt hatte, wie von einem Tonband abspulen können. Doch keinem hatte er bisher die Wahrheit anvertraut. Er war noch nicht bereit gewesen, sich jemandem zu öffnen.
Mit nachdenklichem Blick betrachtete er Bernadette. Ob sie vielleicht die Richtige wäre?, fragte er sich. Doch mal angenommen, sie stellte jetzt gleich diese ominöse Frage: „Was ist passiert, dass man Sie so mies behandelt, und warum lassen Sie sich diese miese Behandlung überhaupt gefallen?“ Würde dann nicht alles wie ein Sturzbach sich nach draußen ergießen? Würde nicht diese seit einem Jahr aufgestaute Enttäuschung, Empörung und Wut ungehemmt aus ihm herausplatzen? Und Bernadette würde das alles ungefiltert abkriegen!
Bevor er mit seinen Überlegungen zu Ende war, stellte Bernadette ihre Frage. Und sie überraschte ihn schon wieder. Sie hatte sich zu ihm herüber gebeugt und fragte dann mit gesenkter Stimme: „Gibt es einen Fall, den Sie nicht aufklären konnten? Oder mit dessen Aufklärung Sie nicht zufrieden waren? Und der Sie bis heute nicht loslässt?“
Um seine zunächst durchaus freudige Überraschung zu verbergen, setzte er eine nachdenkliche Miene auf und strich sich mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger über das Kinn; wie man das so tat, wenn man sich mit der Antwort Zeit lassen wollte.
In Wahrheit hatte er natürlich die Antwort parat. Es gab so einen Fall, was aber nichts Besonderes war. Denn jeder Ermittler hatte solch eine „Leiche im Keller“. Mindestens eine. Und jeder hütete sich, daran zu rühren. Manche Fälle konnten einfach nicht gelöst werden. Es gab keine verwertbaren Spuren. Motive oder Beweise fehlten. Mögliche Täter schieden aus, einer nach dem anderen, bis keiner mehr übrig blieb. Dann geht man die möglichen Täter ein weiteres Mal durch, nimmt ein paar unmögliche dazu. Die Hälfte stirbt in der Zwischenzeit, weil sich der Fall ewig hinzieht, bis er kein Fall mehr ist. Er wird zum cold case, wie es im TV-Krimisprech heißt, „kalter Käse“ im Kollegenjargon.
Sein Fall war anders gewesen. Es gab Spuren, Beweise, Aussagen. Was es nicht gegeben hatte, war ein plausibles Motiv. Doch als sogar ein Geständnis aufgetaucht war, hatte es für den Staatsanwalt kein Halten mehr gegeben: Hurra! Der Täter war gefunden!
Als „Zugabe“ hatte der sich dann noch selbst getötet. Das perfekte Szenario. Alles war „sonnenklar“ gewesen, so wörtlich Dr. Edgar Mangold, der zuständige Staatsanwalt, und das konnte selbst Oberlin nicht abstreiten. Logisch, dass die Akte geschlossen wurde und man weitere Ermittlungen für „nicht notwendig“ erachtete.
Die Ehefrau des Täters war von der Schuld ihres Mannes keineswegs überzeugt gewesen. Allerdings hatte sie das Alibi, das sie ihrem Mann zunächst gegeben hatte, wieder zurückgezogen. Merkwürdig, dass ihm das gerade einfiel. Eine hübsche Frau, sie hatte ihn buchstäblich auf Knien angefleht, ihr zu glauben. Und einige Zeit nach dem Selbstmord war sie plötzlich verschwunden gewesen. Geradezu unauffindbar. Oberlin hatte ein ungutes Gefühl gehabt, aber was sollte er machen? Sie musste allein mit diesem Schicksalsschlag zurechtkommen, zum Seelsorger fühlte er sich nicht berufen. Und schließlich war die Sachlage eindeutig gewesen, das musste man irgendwann einsehen, auch als trauernde Ehefrau.
Ein gewisses Unbehagen jedoch war geblieben. Ihm, Oberlin, war das alles irgendwie zu glatt gegangen, irgendwie zu stereotyp, und das hatte er auch versucht, seinen Leuten klarzumachen.
„Irgendwie, irgendwie“, hatte man ihn nachgeäfft, so dass er seine Zweifel schließlich exklusiv gehabt hatte. Und man schnitt ihm jedes Mal mit einem halb belustigten, halb angesäuerten „Oberlin, du nervst!“ das Wort ab, wenn er wieder damit anfangen wollte.
Ein, zwei Wochen später war dann ohnehin keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen, denn das mysteriöse Attentat auf den bayerischen Ministerpräsidenten hatte natürlich absolute Priorität. Und nach der raschen Aufklärung wartete wieder das Tagesgeschäft. Ein Mord jagte gewissermaßen den nächsten, es schien, als hätte sich die ganze Welt zu einem einzigen Mordkomplott verschworen.
So vergaß er den „sonnenklaren Fall“ allmählich und begrub „seine Leiche“ im Keller. Bis heute. Bis zu der Frage, die seine Assistentin ihm gerade in aller Unschuld gestellt hatte.