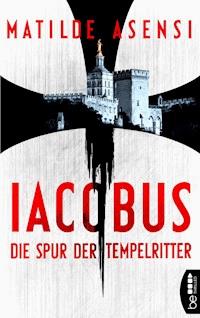9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer die Wahrheit sucht, läuft Gefahr, sie zu finden ...
Nach Überzeugung des Vatikans kann und darf es sie nicht geben: die sterblichen Überreste Jesu Christi. Doch genau danach sucht die Paläographin Ottavia Salina gemeinsam mit ihrem Mann Farag Boswell und ihrem alten Freund Kaspar Glauser-Röist. Die Spur führt das Trio von der Mongolei über Istanbul bis nach Israel. In den Katakomben des Berges Meron erwarten sie neun mörderische Prüfungen, alle mit Bezug auf die Seligpreisungen der Bergpredigt. Wird es Ottavia und ihren Mitstreitern gelingen, bis ins Innerste des Berges vorzudringen? Und was werden sie dort finden?
Ein packender Thriller um das größte Mysterium des Christentums
Platz 1 der spanischen Bestsellerliste
Die lang ersehnte Fortsetzung des internationalen Bestsellers "Wächter des Kreuzes"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
EPILOG
QUELLENNACHWEIS
Leseprobe
Über das Buch
Nach Überzeugung des Vatikan kann und darf es sie nicht geben: die sterblichen Überreste von Jesus Christus. Doch genau danach suchen Ottavia Salina, Farag Boswell und Kaspar Glauser-Röist. Die Spur führt von der Mongolei über Istanbul bis nach Israel. In den Katakomben des Berges Meron warten neun mörderische Prüfungen, die sich alle auf die Seligpreisungen der Bergpredigt beziehen. Wird es Ottavia und ihren Mitstreitern gelingen, ins Innerste des Berges vorzudringen? Und was werden sie dort finden?
Über die Autorin
Matilde Asensi, 1962 in Alicante geboren, arbeitete nach dem Journalismusstudium für Rundfunk und Printmedien. Ihr Roman Wächter des Kreuzes aus dem Jahr 2001 entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller, der von Kritikern hochgelobt wurde. Inzwischen ist ihre Leserschaft auf mehr als 20 Millionen Menschen weltweit angewachsen. Für ihre literarische Arbeit wurde Matilde Asensi mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 2015 erschien mit Die Jesus-Verschwörung die lang ersehnte Fortsetzung ihres Erfolgsromans Wächter des Kreuzes.
MATILDE ASENSI
DIE JESUS-VERSCHWÖRUNG
THRILLER
Aus dem Spanischen von Sybille Martin
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Matilde Asensi/Editorial Planeta, S.A.This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essenand Bookbank Literary Agency, Madrid
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Sven-Eric Wehmeyer, BielefeldAlle Bibelzitate stammen aus folgender Ausgabe:Die Bibel, Altes und Neues Testament, Einheitsübersetzung, Herder 1980.Umschlaggestaltung: www.buerosued.deEinband-/Umschlagmotiv: © getty-images, Christopher Chan; © www.buerosued.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4772-2
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für meinen Neffen Gonzalo, den Seemann, und meine Nichten, die Tänzerin Almudena und die Leichtathletin Berta. Danke für euer Springen, Tanzen, Klavierspielen, Singen und lautstarkes Streiten über meinem Arbeitszimmer, während ich dieses Buch und andere Bücher schrieb. Zum Glück werdet ihr langsam erwachsen, und mein Leben wird zusehends ruhiger. Ich verrate euch etwas, das niemand erfahren wird: Ich liebe euch.
EINS
Wie hinlänglich bekannt ist, wird die Geschichte von den Siegern geschrieben, und die Sieger erlangen mit der Zeit die Macht, uns glauben zu lassen, was sie geschrieben haben, und uns vergessen zu lassen, was nicht niedergeschrieben wurde, und uns Angst einzuflößen vor dem, was nie hätte geschehen dürfen. Und das alles nur, um weiterhin ihre Macht demonstrieren zu können, sei es religiöse Macht, politische Macht oder wirtschaftliche Macht. Das ist egal. Sie, die Sieger, interessiert die Wahrheit nicht mehr, und uns, die Menschen, auch nicht mehr. Von dem Moment an schreiben wir die Vergangenheit alle zusammen neu, wir machen uns zu Komplizen derjenigen, die uns täuschten, einschüchterten und beherrschten. Aber die Geschichte ist nicht unverrückbar, die Geschichte ist nicht in Stein gemeißelt, es gibt weder eine einzige Version noch eine einzige Interpretation, obwohl man uns das glauben macht und, was noch schlimmer ist, obwohl man uns die Geschichte mit unserem Leben, unserer Hingabe oder unserem Geld rechtfertigen lässt. So entstehen Orthodoxien, große Wahrheiten, aber auch Kriege, Konflikte und Teilungen. Und dann haben sie uns für immer besiegt. Dennoch, sobald wir uns mit Mut wappnen, einen Schritt zurücktreten und die Welt zur Abwechslung einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, werden wir die wichtigste aller Lektionen erkennen und begreifen: die Ungewissheit. Die Wahrheit wird euch freimachen, sagte Jesus. Schön, aber die Wahrheit schreiben die Sieger, sodass uns nur Ungewissheit, Misstrauen und Zweifel bleiben, um wirklich frei zu sein. Und auch ein kleiner Kunstgriff, den anzuwenden mir lange schwerfiel: sich immer bewusst zu machen, dass die Häretiker – welcher Couleur auch immer, nicht nur die religiösen – ebenso wenig zu leugnen sind wie die Orthodoxien und dass sie außerdem nie versuchten, sich gewaltsam durchzusetzen oder durch Einschüchterung die Oberhand zu gewinnen. Deshalb sind sie die Verlierer.
»Mein Gott! Endlich!«, stöhnte ich an jenem Spätnachmittag, als wir nach Hause kamen, wobei ich meine verhassten Stöckelschuhe von mir schleuderte.
»Schon zurück?«, rief Isabella aus dem Wohnzimmer.
»Ottavia, sie werden gleich da sein«, erinnerte mich Farag klugerweise, als er sein Jackett in den Garderobenschrank hängte.
»Wieso?«, protestierte ich. »Wieso müssen wir nach diesem blöden Fest auch noch Besuch bekommen?«
Farag antwortete nicht. Er kam mit einem geduldigen Lächeln näher und drückte mir energisch einen Kuss auf die Lippen, der eher nach Versiegelung als nach Leidenschaft schmeckte. Ich erwiderte ihn gleichermaßen energisch, und wir mussten lachen. Immerhin ein Kuss, oder?, dachte ich zufrieden, wandte mich mit einem amüsierten Blick von ihm ab und ging ins Wohnzimmer.
Meine unverschämt junge und schöne Nichte Isabella, unerhörte neunzehn Jahre alt und Informatikstudentin der UofT, der Universität von Toronto, an der Farag und ich seit einem knappen Jahr arbeiteten, lümmelte auf dem Sofa und schaute fern. Ich ging um den Tisch herum und stieg über ihre Hausschuhe und eine leere Tüte dieser Schweinereien, die sie ständig in sich hineinstopfte und die sie zu allem Überfluss weder dick machten noch ihr den Appetit verdarben. Sie reckte den Hals, um sich von mir auf die Wange küssen zu lassen, und schob mich dann sanft zur Seite, weil ich ihr den Blick auf den Fernseher verstellte.
»Los, räum das weg und schließ dich in dein Zimmer ein«, sagte ich, als ich mir rasch ihr Tablet, ihr Smartphone und ihre Hausschuhe schnappte. »Gleich kommt Präsident Macalister mit wichtigen Mäzenen der Universität.«
»Aber ihr kommt doch gerade von Macalister?«, fragte sie überrascht, sprang auf und half mir, ihr Chaos zu beseitigen.
Isabella war eine typische Salina, so rebellisch wie gehorsam. Nachdem sie das Abitur gemacht und zum größten Missfallen ihrer Mutter beschlossen hatte, nichts von den Familiengeschäften wissen und auch nicht länger in Sizilien leben zu wollen, war sie letztes Jahr zu uns gezogen. Isabella war – von den fünfundzwanzig Kindern meiner acht Geschwister – von Geburt an meine Lieblingsnichte, und weil sie das ganz genau wusste, war sie eine Expertin darin, mich zu manipulieren und alles von mir zu bekommen, wonach ihr gerade der Sinn stand. Ganz zu schweigen davon, dass sie für ihren Onkel Farag schlichtweg das größte Wunder der Schöpfung, die intelligenteste Hochbegabte und als erwachsene Frau das erlesenste Kunstwerk war (wenngleich auch als Kind die Schönste der Welt).
Während Isabella mit der Fernbedienung den Fernseher ausschaltete, reckte sie erneut den Hals und hielt ihrem Onkel die Wange zum Kuss hin. So war sie eben, ausgesprochen liebevoll, einen Meter achtzig groß und gertenschlank, mit wunderschönen, von langen Wimpern umrahmten schwarzen Augen sowie aufsehenerregendem kastanienbraunen Haar, das sie als Pferdeschwanz trug. Mit anderen Worten: Dem Aussehen nach ähnelte sie mir nicht im Geringsten.
»Stimmt, wir kommen von Macalister«, bestätigte ich und drückte ihr den ganzen Krempel samt Hausschuhen in die Arme. »Aber der Herr Präsident hat uns eröffnet, dass er uns Punkt sieben Uhr in Begleitung wichtiger Persönlichkeiten in unserem bescheidenen Heim aufsuchen wird, weil die uns kennenlernen wollen.«
»Schon wieder Konstantin …?«, fragte sie gelangweilt und bereits auf dem Weg zur Treppe, die nach oben zu ihrem Zimmer führte.
»Du darfst nicht vergessen«, erwiderte ihr Onkel, als er sich auf den Platz sinken ließ, auf dem Isabella bis eben gesessen hatte, »dass wir die großartigen und berühmten Entdecker des Grabes von Konstantin dem Großen sind. Unser Ruf und unsere Reputation eilen uns voraus.«
»Ist ja gut«, schnaubte sie verächtlich und verschwand im oberen Flur. Obwohl wir von der englischen Sprache umzingelt waren, sprachen wir zu Hause Italienisch. »Viel Spaß, bis morgen.«
»Gute Nacht!«, rief ich und setzte mich zu Farag, der den Arm über meine Schulter legte und mich an sich zog. »Nur über meine Leiche, ich habe keine Lust mehr, von Konstantin dem Großen zu reden«, maulte ich und seufzte resigniert.
»Wie ich schon sagte, Basileia1, unser großer Ruf und unsere Repu…«
»Oh, sei endlich still, Professor!«, unterbrach ich ihn und biss ihn scherzhaft in den Hals.
»Aua!«
In dem Augenblick klingelte es an der Tür. Wir zuckten zusammen.
»Wie spät ist es?«, fragte Farag mit hektischem Blick auf seine Armbanduhr. »Es ist doch erst zehn vor sieben!«
»Versteck meine Stöckelschuhe« war das Einzige, was mir einfiel, als ich in unser Schlafzimmer flitzte, um flache Schuhe anzuziehen, die gut zu meinem schönen blauen ägyptischen Blazer und dem schwarzen Rock passten.
Ich schaffte es rechtzeitig an die Haustür, um mit strahlendem und freudigem Gesicht den Präsidenten der UofT, Stewart Macalister, und ein reizendes achtzigjähriges (oder neunzigjähriges) Ehepaar mit offenem und sympathischem Lächeln zu begrüßen. Tatsächlich kam mir das Gesicht des Mannes irgendwie bekannt vor, ich wusste aber nicht, woher.
»Guten Abend, Ottavia«, begrüßte mich Macalister. »Farag … Guten Abend. Erlauben Sie mir, Ihnen Becky und Jake Simonson vorzustellen, alte Freunde von mir und große Förderer unserer Universität.«
»Simonson …?«, riefen Farag und ich unisono und blickten das achtzigjährige (oder neunzigjährige) Ehepaar überrascht an, das uns breit anlächelte und von Macalister in unser Haus geschoben wurde.
Jake Simonson, mit weißem Spitzbart und Altersflecken auf der Pergamenthaut, ergriff meine Hand und führte sie mit einer höflichen Verneigung an seine Lippen, während Farag es ihm mit der hageren, eleganten Becky gleichtat.
Wer hatte noch nie von den Simonsons gehört …? Es waren Flüsse aus Tinte über sie, ihre Familie und ihren unermesslichen Reichtum vergossen worden; es wurden Bücher geschrieben über ihre Zugehörigkeit zu hochgefährlichen Geheimbünden, über ihr Faible für Verschwörungen, um die Welt zu beherrschen, und über ihre unangefochtene Abstammung von Außerirdischen. Natürlich wirkten sie in meinem Haus in Toronto wie ein ganz gewöhnliches, wohlhabendes altes Ehepaar, und sollten ihre Vorfahren wirklich von einem anderen Planeten stammen, war ihnen das nicht anzusehen. Eine ganz andere Sache war, dass sie die Welt beherrschen wollten; vielleicht stimmte das sogar, aber wozu, wenn sie doch mit ihren Geschäften und Ölkonzernen schon alles besaßen? Jetzt begriff ich, welche Art der Förderung sie der UofT angedeihen ließen: Geldmittel. Und vermutlich in beträchtlichen Mengen.
Als wäre Macalister der Hausherr (was er tatsächlich auch war, denn das Haus gehörte zum Universitätscampus), führte er Becky und Jake zu den Sofas und begann, Getränke einzuschenken (Bourbon für die Herren, Gin für Becky und ein Erfrischungsgetränk für mich, denn für mich schmeckte Alkohol immer nach Medizin). Zum Glück beeilte sich Farag, die Mäntel der Simonsons in die Garderobe zu hängen, und gesellte sich rechtzeitig zu uns, um Macalister die Eiswürfel für die Drinks zu reichen. In den ersten Minuten war das Gespräch ziemlich banal. Becky Simonson erzählte mir, wie traurig sie über die Rückkehr in ihre Heimatstadt Toronto sei, weil dieser Mai so verregnet und bewölkt war, und beklagte sich nebenbei über die Kälte, die in meinem Wohnzimmer herrschte. Es stimmte zwar, dass wir grässliches Wetter hatten, passender zum Winter als zum Frühling in Kanada – bestimmt der Klimawandel –, doch ich fand die Wohnzimmertemperatur ideal. Trotzdem drehte ich die Heizung höher, weil auch Jake sich verstohlen die Hände rieb, um warm zu werden, während Macalister ihm gerade erzählte, welch große Bedeutung es für die Universität hatte, die beiden Entdecker des Mausoleums von Konstantin dem Großen zu ihren Professoren zählen zu können. Offensichtlich waren sie gerade von einem deutlich wärmeren Ort zurückgekehrt, wahrscheinlich verbrachten sie den Winter auf irgendeiner Kanarischen Insel. Ich hätte nicht gedacht, dass die Simonsons Kanadier sind. Wegen ihres unermesslichen Reichtums hätte ich eher auf eine britische oder nordamerikanische Herkunft getippt.
Eigentlich hatten Farag und ich nie die Absicht gehabt, an der Universität von Toronto zu arbeiten oder in Kanada zu leben. Nachdem wir Alexandria verlassen hatten, um das Grab von Konstantin zu entdecken, sahen wir uns aufgrund der weltweiten Aufregung und des Drucks der türkischen Regierung gezwungen, acht Jahre in Istanbul zu leben. Wir arbeiteten sehr viel, veröffentlichten unzählige Artikel, hielten massenhaft Vorträge, erhielten mehrere internationale Preise, gaben Interviews, drehten Dokumentarfilme fürs Fernsehen und erhielten Angebote von sämtlichen Universitäten der Welt. Doch wir wollten eigentlich immer nach Alexandria zurück, nach Hause. Unglücklicherweise starb in diesen Jahren Farags Vater Butros Boswell, und Farag, der ziemlich besorgt die zunehmende Islamisierung Ägyptens und die Terroranschläge auf die Kopten verfolgte, brauchte nur den geeigneten Anlass – die Proteste gegen die Regierung der Moslembrüder im November 2012 und den Militärputsch 2013 –, um unseren gesamten Besitz einzupacken, die Häuser zu verschließen und diesen Lebensabschnitt für beendet zu erklären.
Die letzten Monate des Jahres 2013 verbrachten wir in Rom und versuchten zu entscheiden, welche der vielen Universitäten, die uns haben wollten, unseren beruflichen Plänen am besten entgegenkäme. Die 2008 einsetzende globale Wirtschaftskrise erlaubte uns nicht, die Entscheidung allzu lange hinauszuzögern, aber wir hatten ein wenig Erspartes, mit dem wir noch ein paar Monate ohne Einschränkungen unsere Wohnung in Rom halten sowie das Unterstellen unserer Möbel aus Alexandria bezahlen konnten. Und dann kam wie eine erlösende Erscheinung der Präsident der Universität von Toronto, Stewart Macalister, auf seinem weißen Pferd angeritten (wie man so sagt), ein Mann in den Siebzigern, allerdings noch ausgesprochen attraktiv und mit dichtem grauen Haar, der Farag den Posten als Direktor des renommierten Fachbereichs für Archäologie der Universität Toronto und mir das fabelhafte Owen-Alexandre-Stipendium für wissenschaftliche Forschung offerierte, damit ich im Gegenzug für ein paar Stunden Unterricht in byzantinischer Paläographie im Fachbereich Mittelalter-Studien eine meiner wichtigsten Arbeiten weiterführen konnte: anhand mehrerer Codizes den berühmten, verlorengegangenen Text des Panegyrikon des heiligen Nikephoros zu rekonstruieren, woran ich schon seit über zehn Jahren arbeitete, diese Arbeit jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder unterbrechen musste und deshalb noch nicht fertiggestellt hatte. Es war perfekt. Doch da in dem Sommer Isabella zu uns gezogen war und der Präsident sah, dass sie zum Gesamtpaket gehörte, machte er ihr das Angebot, ein Studium ihrer Wahl an der Universität aufzunehmen, woraufhin sie sich, dem Vorbild vieler älterer Cousins folgend, für Informatik entschied, ein Studienfach, für das die Uni Toronto zu den zehn besten weltweit zählt.
In wenigen Monaten würden wir bereits ein Jahr hier leben, und wir fühlten uns wirklich wohl in diesem hübschen Haus. Nach der irrwitzigen Zeit in der Türkei und in Rom war dieses Heim eine Oase des Friedens, des Studiums und der Ruhe, mal abgesehen von meiner neunzehnjährigen Nichte mit ihrem übergroßen Selbstwertgefühl und ihrer ausgeprägten Neigung zur Tyrannei.
»Gefällt es Ihnen in Kanada, Frau Doktor Boswell?«, fragte Jake Simonson liebenswürdig und riss mich damit aus meinen Gedanken.
Ich sah den Multimillionär lächelnd an.
»Frau Doktor Salina, Mister Simonson, Salina«, stellte ich richtig. »Nicht Boswell.«
Mein Gott, was für eine Unart der Angelsachsen, uns Frauen den Familiennamen wegzunehmen!
»Ja, es gefällt mir«, antwortete ich auf seine triviale Frage. »Farag und mir gefällt es hier sehr gut. Kanada hat zwar nichts mit unseren Heimatländern Italien und Ägypten zu tun, aber wir mögen die hiesige Kulturvielfalt und schätzen die Toleranz und den Respekt der Kanadier.«
»Aber Sie müssen mir doch recht geben, dass das Wetter und diese Kälte grauenhaft sind«, merkte Becky Simonson mit entschuldigendem Lächeln an. Obwohl es im Wohnzimmer schon ziemlich warm war, ging Farag zum Thermostat und drehte ihn noch ein wenig höher.
Die oberflächliche, für meinen Geschmack ziemlich langweilige Unterhaltung plätscherte dahin, und ich begann mich langsam zu fragen, was zum Teufel die Simonsons um diese Uhrzeit in meinem Haus verloren hatten. Noch hatten sie die wunderbare Sache mit dem Mausoleum von Konstantin nicht mal ansatzweise zur Sprache gebracht, obwohl der Universitätspräsident es schon erwähnt hatte, was sehr, sehr merkwürdig war. Jake und Becky Simonson schienen an unserer großen archäologischen, historischen und akademischen Leistung überhaupt nicht interessiert zu sein. Ich kannte die Dynamik solcher Besuche ziemlich gut und wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie waren eindeutig nicht wegen des ersten christlichen Kaisers gekommen. Farag warf mir verstohlen einen Blick zu, und ich wusste, dass er dasselbe dachte wie ich. Das war dem alten Simonson nicht entgangen.
»Sie fragen sich wahrscheinlich nach dem Grund dieses unverhofften Besuchs«, sagte er leise, »und zu einer so unpassenden Zeit.«
»Um Gottes willen, Jake, nein!«, rief Macalister, wobei er die Beine übereinanderschlug und mit beiden Händen sein Glas Bourbon umschloss. »Direktor Boswell und Frau Doktor Salina freuen sich über euren Besuch und wissen, dass Leute wie ihr nur wenig Zeit haben.«
Noch nie hatte ich Macalister so rücksichtsvoll (oder so anbiedernd) mit jemandem umgehen sehen. Klar, es handelte sich um die Simonsons, trotzdem wirkte sein Verhalten etwas übertrieben. Mister Simonson war klein, hager, hässlich und fast glatzköpfig, hatte aber ein freundliches, redliches Gesicht, und sein weißer, perfekt gestutzter Spitzbart verlieh ihm einen Anflug von mittelalterlichem Ritter. Seine Frau Becky war eine ausgesprochen attraktive alte Dame, bei deren Anblick man sofort wusste, was für eine aufregende Schönheit sie in ihrer Jugend gewesen war. Jetzt hingegen hatte sie eine so durchsichtige Haut, dass man darunter den Verlauf der Adern sehen konnte, und silbergraues Haar, das ein eigenes Licht auszustrahlen schien. Obwohl das auch an ihrem Schmuck liegen konnte, dessen Wert jegliche Summe, die ich mir vorstellen konnte, weit übersteigen dürfte.
Jake machte dem Präsidenten ein Zeichen der Dankbarkeit für seine Worte und dann auch uns. Anschließend lehnte er sich neben seiner Frau gemütlich im Sofa zurück und sagte zu ihr:
»Becky, könntest du mir bitte den Reliquienschrein geben?«
Becky öffnete ihre sagenhafte Krokodilledertasche von Hermès und holte vorsichtig ein rechteckiges Silberkästchen heraus, das genau in ihre gepflegte Hand passte. Jake ergriff es, ohne auch nur eine Sekunde den Blick davon abzuwenden, und hob dann den Kopf, um uns neugierig anzusehen, als wäre er ein Anthropologe, der die Reaktion zweier Aborigines beim Anblick eines Raumschiffes studiert. Erst da wurde mir bewusst, welches Wort er benutzt hatte, als er seine Frau um das Kästchen bat: Reliquienschrein, er hatte es Reliquienschrein genannt, und soweit mir bekannt war, diente ein Reliquienschrein nur einem einzigen Zweck. Mir blieb fast das Herz stehen. Welche Art von Reliquie beherbergte dieser Schrein? Und noch wichtiger, was hatte eine Reliquie in meinem Haus verloren? Ich begann, aus allen Poren zu schwitzen, redete mir jedoch ein, dass es an der verdammten Heizung lag.
Ich war dreizehn Jahre lang Nonne gewesen, Schwester der Kongregation der Glückseligen Jungfrau Maria in Italien, und leitete als solche von 1991 bis 2000 das Labor für Restaurierung und Paläographie des Vatikanischen Geheimarchivs; im Jahr 2000 erhielt ich zusammen mit Farag (in den ich mich nebenbei verliebte und seinetwegen schließlich das Ordenskleid und andere Dinge ablegte) von der höchsten Instanz der katholischen Kirche den Auftrag, die Reliquien des Heiligen Kreuzes zu suchen – das Holzkreuz, an dem Jesus von Nazareth gestorben war, wie man seit seinem Auffinden im IV. Jahrhundert glaubt –, Reliquien, die damals aus allen möglichen christlichen Kirchen der Welt gestohlen wurden. Weil wir bei dieser Suche gescheitert waren und die Diebe nie festgenommen wurden, hatte man uns vier lange Jahre vom Militär und der Vatikanpolizei überwachen lassen, was so weit ging, dass man in Rom bereits wusste, wenn wir in Alexandria einen Seufzer ausstießen, noch bevor er ausgestoßen war.
Aufgrund meiner Erziehung und meiner Liebe zu Gott war ich eine glühende Katholikin, weshalb ich nicht an Reliquien glaubte und sie auch nicht mochte, und seit unserer Suche nach dem Heiligen Kreuz verursachten sie mir zudem Ausschlag und Atemnot. Zu allem Unglück befand sich jetzt nach vierzehn Jahren eine davon ausgerechnet in meinem Wohnzimmer, weshalb sämtliche Alarmglocken und -lichter in meinem Kopf gleichzeitig anschlugen. Mein armer Mann schwitzte genauso stark wie ich, aber im Gegensatz zu mir, die ich meinen Blazer abgelegt hatte, hatte er wieder in sein Jackett schlüpfen müssen, um den Gästen die Tür zu öffnen. Die Hitze und die Reliquie ließen mich unvermittelt wieder an die rot glühende Eisenplatte auf dem Boden der Katakomben in Syrakus und an den Glutteppich denken, den wir in Antioch barfuß überwinden mussten. Diese alten Erinnerungen waren der schlagende Beweis für mein Gefühl, dass Gefahr drohte.
Jake Simonson stellte den Reliquienschrein auf den Tisch und schob ihn vorsichtig zu uns herüber. Mein Sachverstand der promovierten Paläographin und Kunsthistorikerin ließ mich unwillkürlich die außergewöhnliche Schönheit des Kästchens bewundern. Es stellte einen kleinen silbernen Sarkophag mit Glasdeckel dar, dessen Beinchen aus vier winzigen Adlern bestanden und dessen Seiten wunderschöne Emailarbeiten in Blau und Gold aufwiesen.
»Könnten Sie dieses Stück datieren?«, fragte uns der alte Simonson.
Stellte er uns auf die Probe?, fragte ich mich überrascht, denn sollte dem so sein, bliebe mir trotz meiner Selbstschutzmechanismen nichts anderes übrig, als auf die Provokation einzugehen. Ich trug es in den Genen, ich konnte nichts dagegen tun. Ob ich wollte oder nicht, ich war eine Salina aus Sizilien, und wenn man die Salinas herausforderte, stürzten sie sich kopfüber ins Abenteuer, auch wenn es sie das Leben kosten könnte.
»Eindeutig 13. Jahrhundert«, sagte ich im Brustton der Überzeugung. »Frankreich. Limonsiner Email.«
Jake Simonson versuchte erst gar nicht, seine Bewunderung zu verhehlen.
»In weniger als einer Minute«, sagte er überrascht. »Und ohne es genauer untersucht zu haben. Sie hat es nicht mal angerührt. Sie sind zweifelsohne noch besser als Ihr Ruf, Frau Doktor Salina, und das will einiges besagen.«
Fast hätte ich mich von seinen Schmeicheleien einlullen lassen, doch dank meines genuinen Misstrauens schoss mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf, dass das Ganze überhaupt nicht natürlich war, dass die Herausforderung möglicherweise der Gewissheit geschuldet war, dass ich sie annehmen würde, und dass das eigentliche Ziel darin bestand, meine ausgeprägte – und offensichtlich bekannte – berufliche Eitelkeit anzustacheln, um mich weichzuklopfen oder zumindest auf das einzustimmen, was Jake wirklich wollte und bestimmt gleich folgen würde.
»Nehmen Sie es bitte in die Hand«, bat er mit sanfter Stimme, »und schauen Sie es sich genau an.«
Ich rührte mich nicht. Wenn in diesem Kästchen eine Reliquie lag, wollte ich nichts davon wissen und sie schon gar nicht anrühren. Aber Farag beugte sich vor und nahm das Kästchen in die Hand. Sein Gesicht verdüsterte sich, und er blinzelte nervös, als seine wunderschönen blauen Augen hinter der kleinen, altmodischen Nickelbrille, die er so liebte, beim Anblick des Reliquienschreins unruhig hin und her hüpften.
»Was ist?«, fragte ich ihn.
Er wollte den Mund öffnen und mir antworten, brachte aber keinen Ton heraus. Stattdessen drehte er sich mir zu und reichte mir das Kästchen weiter. Meine Beklemmung war verflogen, aber trotz meiner großen Fähigkeit, immer das Schlimmste zu befürchten, katapultierte mich der Anblick unter dem Glasdeckel des verfluchten Kästchens ins Abseits. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.
»Erkennen Sie die Reliquie?«, fragte Becky Simonson ausgesucht höflich.
Ich hätte sie umbringen können, würde ein solches Verbrechen nicht gegen mein Gewissen verstoßen. Wozu es auch leugnen: Vor vierzehn Jahren waren wir verantwortlich für eine groß angelegte weltweite Operation, um diese winzigen Holzsplitter zu suchen und zu finden, die im ersten Jahrtausend unserer Ära von Pilgern und Königen aus dem Kreuz gebrochen, gestohlen und verschenkt worden waren, weshalb wir ganz genau wussten, was wir gerade in Händen hielten. Es handelte sich ohne jeden Zweifel um einen Splitter des Heiligen Kreuzes. Und das Merkwürdigste daran war, dass er auf keinen Fall echt sein konnte, denn Farag und ich wussten als Einzige (außer den Betroffenen, die nur allzu gern schwiegen), dass es auf der Welt keine echten Reliquien des Heiligen Kreuzes mehr gab, dass sie allesamt Fälschungen der katholischen Kirche waren, um die Gläubigen bei der Stange zu halten. Doch hier handelte es sich um die Simonsons, und was wäre Leuten mit diesem Namen nicht möglich? Aber nein, sagte ich mir, nicht einmal sie konnten so mächtig sein, um den hochintelligenten Dieben der LignaCrucis – Plural des lateinischen Lignum Crucis, Holz des Kreuzes –, die wir kennengelernt hatten, zu entkommen.
»Ist das ein Dorn aus Jesus’ Dornenkrone?«, scherzte Farag ausweichend.
»Möglich«, bestätigte der alte Jake. »Die Analysen mit der Radiokarbonmethode datieren ihn auf das 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Aber wenn Sie genau hinschauen, Direktor Boswell, werden Sie erkennen, dass es kein Dorn, sondern ein Holzsplitter ist. Es ist eine Reliquie des Heiligen Kreuzes.«
Ich konnte mich nicht mehr beherrschen.
»Woher wissen Sie das? Sie könnten sich irren!«
Der alte Simonson sah seine Frau an, und beide lächelten gefällig.
»Wie Sie bestimmt wissen, Frau Doktor Salina, finanzieren wir weltweit zahlreiche archäologische Ausgrabungen, das gehört zu den kulturellen Aktivitäten unserer Museen und Universitäten«, erklärte er lächelnd und streckte die Hand nach der Reliquie aus. Nichts wünschte ich mehr, also gab ich sie ihm zurück und strich mir den Rock glatt, eine unbewusste Geste des Händesäuberns. »Ich versichere Ihnen, dass der Ort, an dem sie bei den Ausgrabungen gefunden wurde, keinen Zweifel an seiner Echtheit aufkommen lässt, ebenso wenig der Brief von Ludwig IX. von Frankreich an Güyük Khan, dem Großkhan der Mongolen von 1246 bis 1248, in dem er unter anderem diese Reliquie und ihren schönen Reliquienschrein als Geschenk zu Güyüks angeblicher Konvertierung zum Christentum erwähnt.« Sein Mund verzog sich ironisch. »Der Dominikanermönch André de Longjumeau war beauftragt, den Brief und die Geschenke zu überbringen, aber als der gute Mönch nach der einjährigen Reise in Karakorum, der Hauptstadt der Mongolei, eintraf, war Güyük ärgerlicherweise gerade gestorben, und zwar, ohne je Christ geworden zu sein, weshalb er die Geschenke zu seinem großen Bedauern der Witwe Güyüks, Kaiserin Ogul Qaimish, übergeben musste, wegen seiner tiefen Frömmigkeit das heilige Holz aber einfach behielt.«
»Er konnte es doch nicht diesen Heiden aushändigen!«, erklärte Becky aufgebracht, wohl eher in der Absicht, uns begreiflich zu machen, wie unangenehm die Situation für Longjumeau gewesen sein musste, als die Mongolen beleidigen oder herabwürdigen zu wollen. »Bruder André sah sich genötigt, die Reliquie zu retten, als er Ogul Qaimish die anderen Geschenke aushändigen musste, die zwar auch wertvoll, aber zu ersetzen waren.«
»Wir wissen nicht, wie ihm das gelang«, fuhr ihr Mann fort und strich dabei über die Seiten des Kästchens. »Aber er hatte sie auf dem Rückweg bei sich und traf mit ihr in Palästina ein. Faktisch gab er sie auch König Ludwig IX. nicht zurück, als er ihn in Caesarea traf und über das Ergebnis seiner Mission informierte. Ludwig befand sich als ranghöchster Monarch des siebten Kreuzzuges auf heiligem Boden und war gerade nach Zahlung eines beträchtlichen Lösegelds von den Mamelucken befreit worden. Ich fürchte, dass Bruder André entweder Gefallen an der Reliquie gefunden hat,« betonte Jake lächelnd, »oder Ludwig misstraute und befürchtete, er könnte sie wieder einem Heiden schenken oder als Lösegeld einsetzen. Die Reliquie wurde in Longjumeaus Grabstätte gefunden, die man kürzlich bei Ausgrabungen in der Kathedrale St. Peter des alten Caesarea zwischen Tel Aviv und Haifa in Israel entdeckte.«
Nach Jakes letzten Worten erfüllte Schweigen den Raum. Farag ergriff meine Hand und drückte sie fest. Wir mussten uns irgendwie ohne Worte verständigen und die Gedanken, die uns durch den Kopf schossen, austauschen, ohne dass Macalister oder die Simonsons etwas davon mitbekamen. Der Händedruck bestätigte mir, dass Farag ebenso verblüfft und überrascht war wie ich und dieser Splitter vor uns auf dem Tisch zweifellos das letzte echte Lignum Crucis auf der ganzen Welt sein musste.
Becky ließ uns mit ihrem reizenden Lachen hochschrecken.
»Oh Jake, du hast sie zu Stein erstarren lassen!«, sagte sie äußerst amüsiert.
»Ich sehe es, meine Liebe, ich sehe es«, antwortete er ebenfalls lachend. »Ich hoffe, die Bemerkung meiner Frau hat Sie nicht beleidigt.«
Da meldete sich Macalister zu Wort. Er wirkte sichtlich irritiert und schien zu spüren, dass hier etwas vor sich ging, von dem er keine Ahnung hatte.
»Sei unbesorgt, Jake«, stammelte er und versuchte, ein natürliches Lächeln aufzusetzen. »Die Boswells werden doch wegen eures Scherzes nicht beleidigt sein.«
Ich war versucht zu rufen: Doch, das sind wir!, aber Becky hatte wirklich recht: Farag und ich waren wie versteinert. Allerdings ahnten wir noch nicht, dass es noch eine Steigerung geben würde.
»Schön«, sagte der alte Simonson und stellte das Kästchen wieder auf den Tisch. »Und was halten Sie davon, wenn wir jetzt ein wenig über die Staurophylakes und Ihren guten Freund reden, den derzeitigen Cato und früheren Hauptmann der Schweizergarde im Vatikan, Kaspar Glauser-Röist?«
1 Bezeichnung für Kaiserin oder Prinzessin im alten Byzanz.
ZWEI
Ich habe an Farag immer seine Fähigkeit bewundert, sich in komplizierten Situationen schnell wieder zu fangen und die Zügel geschickt und entschlossen in die Hand zu nehmen. Ich konnte das nie. Bei mir schlägt immer die Emotionalität, mein mediterranes Temperament durch. Ich neige eher dazu, die Krallen auszufahren und dem Gegner die Augen auszukratzen (natürlich nicht im wörtlichen Sinne). Aus diesem Grund hatte mir Glauser-Röist vor Jahren – wie ich später erfuhr – einen unschönen Spitznamen verpasst, den zu erinnern ich mich standhaft weigere. Ich hatte ihn nämlich wegen seines sagenhaft sympathischen und höflichen Verhaltens »den Felsen« getauft. Doch in meinem Fall erlaubte es mir eine Art göttliche Gerechtigkeit, ihn so zu nennen, denn der Spitzname war absolut passend. Welche schwerwiegenden Gründe hatte er gehabt, mich hinterrücks derart zu beleidigen, und das, obwohl ich damals sogar noch Nonne war? Keinen, auch wenn er am Ende der einflussreiche Cato oder geistige Anführer einer jahrtausendealten Sekte geworden ist. Und warum, fragte ich mich mit herausforderndem Blick auf unsere Gäste, wagte es Jake Simonson, Glauser-Röist einfach so zu erwähnen? Wer war er denn, abgesehen von einem gewöhnlichen Multimillionär, um derart leichthin das ehrwürdige, tausendsechshundert Jahre alte Geheimnis anzusprechen, mit dem Kaspar ins Amt eingeführt wurde? Wie schon gesagt, zum Glück für mich konnte mein Mann mit schwierigen Situationen viel diplomatischer umgehen.
»Wovon reden Sie, Mister Simonson?«, fragte er den Alten mit gefährlicher Kälte in der Stimme, während er fest meine Hand drückte, um jedweden Kommentar oder auch nur die leiseste Regung meinerseits zu unterbinden. »Unser Freund Kaspar Glauser-Röist starb vor vielen Jahren, und es ist für meinen Geschmack nicht sehr respektvoll, wie Sie über ihn sprechen.«
Statt einer Antwort wandte sich der gewöhnliche Multimillionär an Präsident Macalister.
»Stewart, würdest du bitte Becky und mich mit Frau Doktor Salina und Direktor Boswell allein lassen? Ich weiß, eine solche Bitte ist nicht sehr höflich, aber ich versichere dir, es ist notwendig.«
Auch wenn seine Worte anders klangen, enthielt Simonsons Tonfall keinerlei Anflug von Bitte oder Rücksicht. Er klang eher nach Befehl, und Macalister erfasste das sofort. Eigentlich war er schon seit einem Weilchen fehl am Platze und sich dessen wohl bewusst. Er sah und hörte Dinge, die er nicht sehen und hören sollte.
»Selbstverständlich, Jake, keine Sorge«, erwiderte er, stellte seinen Bourbon auf den Tisch und stand auf. »Ein kleiner Spaziergang nach Hause wird mir guttun. Es war ein harter Tag.«
»Unser Wagen kann dich bringen, Stewart«, schlug Becky höflich vor, die eine derartige Brüskierung des Präsidenten der Universität von Toronto ungerührt hinnahm, als wäre sie von Kindesbeinen an solches Verhalten gewöhnt.
»Nein, nein«, sagte er ablehnend und legte Farag, als er auf dem Weg zur Haustür hinter dem Sofa entlangging, kurz die Hand auf die Schulter. »Bleibt bitte sitzen. Ich weiß, ihr habt wichtige Dinge zu besprechen, und ich möchte mir noch die Beine vertreten und ein wenig frische Luft schnappen.«
Wie recht er hatte. Auch ich hätte sehr gern ein wenig frische Luft geschnappt, weil in unserem Wohnzimmer unerträgliche Hitze herrschte, aber ich konnte weder gehen noch mich beklagen, denn obwohl ich mir wünschte, diese beiden Achtzigjährigen (oder Neunzigjährigen) auf Nimmerwiedersehen aus dem Haus zu werfen, war die Angelegenheit mit Glauser-Röist viel zu heikel, um sie zu ignorieren, und zu gefährlich, um den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Zum Wohle der geheimen Bruderschaft der Staurophylakes und vor allem zum Wohle des Cato CCLVIII. (dem zweihundertachtundfünfzigsten) mussten wir erfahren, worauf das alles hinauslaufen sollte. Schwierig war nur, den Simonsons Informationen zu entlocken, ohne ihnen im Gegenzug irgendetwas anzubieten.
In absoluter Stille hörten wir Macalister das Haus verlassen und die Tür dumpf ins Schloss fallen. Es wurde langsam Zeit, dass unsere Gäste ihre Karten auf den Tisch legten.
»Nun gut, Mister Simonson«, sagte Farag mit verhaltener Gereiztheit. »Erklären Sie uns bitte, was das alles soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das soeben Erlebte ausgesprochen unhöflich gegenüber dem Präsidenten der Universität war oder das gerade in meinem Haus Geschehene eine Angelegenheit zwischen Ihnen beiden ist, der ich keine Wichtigkeit beimessen sollte.«
»Machen Sie sich wegen Stewart keine Sorgen, Direktor Boswell!«, beschwichtigte der Multimillionär Farag mit einer Geste, die der Sache ihre Brisanz nehmen sollte. »Wir kennen ihn seit seiner Kindheit. Seine Großeltern und seine Eltern waren Freunde von uns.«
Seine Großeltern und seine Eltern? Aber wie alt waren diese Leute eigentlich? Offensichtlich konnte man sich mit viel Geld irgendwo ein längeres Leben kaufen.
»Dann kommen Sie bitte direkt zur Sache«, sagte Farag mit gerunzelter Stirn, »denn es ist schon spät, und Sie wollen bestimmt auch nach Hause.«
Ich glaube nicht, dass Jake Simonson daran gewöhnt war, dass jemand so mit ihm sprach, das konnte ich seinem Gesichtsausdruck entnehmen, und auch nicht, dass man ihn irgendwo rauswarf.
»Zuallererst«, kam Becky Jake zuvor, der mit offenem Mund dasaß, »möchte ich mich bei Ihnen für das brüske Verhalten meines Mannes entschuldigen. Wenn ihm etwas wichtig ist, zeichnet er sich nicht gerade durch gute Umgangsformen aus. Und es ist ihm wichtig, die Staurophylakes zu finden. Das müssen Sie verstehen.«
»Alles, was wir vor vierzehn Jahren im Auftrag des Vatikans über die Staurophylakes herausfinden konnten«, erklärte Farag mit müder Stimme, wobei sein fast verschwundener arabischer Akzent wieder anklang, »haben wir damals schon der Kirche und der Polizei erklärt.« Er holte Luft und begann ihnen eine Kurzfassung der vom ständigen Wiederholen auswendig gelernten Lektion über die Ereignisse jener zurückliegenden und gescheiterten Nachforschungen vorzutragen. »Als wir am ersten Junitag 2000 in den Katakomben von Kom el-Shoqafa in Alexandria forschten, wurden wir brutal zusammengeschlagen, entführt und zur Oase Al-Farafra in der ägyptischen Wüste verschleppt. Unsere Entführer, die Staurophylakes, die wir über die halbe Welt verfolgt hatten, sagten uns, dass Hauptmann Glauser-Röist schwer verletzt wurde und gestorben sei, obwohl wir seine Leiche nie gesehen haben. Einen Monat lang brachte uns ein Beduine namens Bahari dreimal täglich Essen in die Zelle, in die wir eingesperrt waren, bis man uns Anfang Juli schließlich unter Drogen setzte und wir das Bewusstsein verloren. Als wir im Eingang eines alten Tunnels zum Mariutsee in Alexandria aufwachten, erinnerten wir uns an nichts. Daraufhin wollten wir die Nachforschungen nicht weiterführen, und der Vatikan hat ein anderes Team auf die Reliquienräuber des Heiligen Kreuzes angesetzt. Wie das Ganze ausging, wissen wir nicht.«
Die Simonsons wechselten einen Blick, der besagte, dass sie Farag kein Wort glaubten.
»Ja, das alles wussten wir schon«, räumte Jake ein, und Becky nickte schweigend. »Und ich muss zugeben, es ist wirklich eine gute Geschichte. Gewiss haben die Staurophylakes Ihnen geholfen, sie zu erfinden, oder? Ich studiere diese Bruderschaft schon mein halbes Leben lang und weiß, wozu sie fähig ist. Becky und ich haben Ihr Abenteuer im Jahr 2000 mit großer …«
»Unmöglich«, unterbrach ich ihn.
»Nein, meine Liebe«, erwiderte Becky beschwichtigend. »Jake sagt Ihnen die Wahrheit. Wir haben gute Freunde im Vatikan und auch in anderen Glaubensgemeinschaften. Als bekannt wurde, dass überall auf der Welt Reliquien des Heiligen Kreuzes gestohlen wurden, war Jake und mir klar, dass die Bruderschaft der Staurophylakes endlich aktiv geworden, dass der Zeitpunkt gekommen war, auf den sie seit Jahrhunderten gewartet hatten, und dass sie nicht aufzuhalten wären. Wir erfuhren ganz genau, was Sie gerade taten und was Sie entdeckten, wir ließen parallel zu Ihnen ein Expertenteam arbeiten, das jedes Detail, jede Spur und jede Prüfung von Dantes Kreisen des Fegefeuers bestätigte …«
»Und wozu?«, wollte Farag mit eisiger Stimme wissen. Wir schützten etwas ausgesprochen Wichtiges, das auf keinen Fall in die Hände von ein paar verrückten Fanatikern gelangen durfte, so reich sie auch sein und so viel Einfluss sie auch haben mochten.
»Weil es das erste Mal war«, gestand Jake mit Rührung in der Stimme, »dass die Staurophylakes zum Greifen nah waren, und ich konnte nicht zulassen, dass sie mir entwischten.«
»Sie sind Ihnen entwischt, Mister Simonson?«, fragte ich naiv.
Im Gesicht des Greises stand großes Bedauern.
»Ja, sie sind mir entwischt. Und nicht nur das. Sie haben auch die Prüfungen der Kreise des Fegefeuers entfernt, und wir konnten den Eingang nicht mehr finden.«
»Deshalb sind wir hier«, erklärte Becky mit einem besorgten Blick auf ihren Mann. »Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir haben darauf gewartet, dass irgendwo eine letzte echte Kreuzreliquie auftaucht«, sagte sie seufzend. »Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig das war. Wie Sie ja wissen, sind alle Kreuzreliquien auf der Welt gut gemachte Fälschungen«, sagte sie lächelnd. »Aber diese hier ist echt. Die letzte echte. Weshalb ihr Wert für sie … die Staurophylakes natürlich, unermesslich ist. Es fehlt ihnen nur dieses eine Fragment, dann ist ihr Kreuz vollständig. Und uns ist natürlich klar, dass es unsere letzte Chance ist.«
Farags Hand drückte meine fester. Was wollte ein altes Paar von Multimillionären von einer fanatischen religiösen Sekte, die von dem Kreuz, an dem Jesus starb, besessen war? Irgendwas wussten wir noch nicht, es fehlte noch ein wichtiges Teilchen der Geschichte.
»Ihr Freund Kaspar hätte diese Reliquie bestimmt gern, oder?«, fragte Jake mit schelmischem Blick.
»Kaspar ist tot«, wiederholte Farag schroff.
»Wenn Sie das sagen, Direktor Boswell.«
»Wir haben seine Leiche nicht gesehen, aber so wurde es uns gesagt«, fügte ich schnell hinzu. Wir mussten hartnäckig bei der Version bleiben, die wir über lange Zeit immer wieder erzählt hatten, ebenso wie bei unserem Schweigegelübde gegenüber der Bruderschaft. »Wir haben seit vierzehn Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, einen besseren Beweis für seinen Tod gibt es nicht.«
»Wie dem auch sei, Mr. und Mrs. Simonson«, sagte Farag scharf, wobei er sich vorbeugte. »Warum wollen Sie die Staurophylakes aufspüren? Haben Sie etwa die Absicht, sie Ihrer Sammlung von archäologischen Trophäen hinzuzufügen? Wir konnten sie nicht finden und hatten die größtmögliche Hilfe. Ich kann Ihnen versichern, dass wir unser Bestes getan haben, sie uns aber trotzdem besiegten. Das alles ist Schnee von gestern.«
Jake Simonson blickte Farag schweigend an. Es war ein sehr langer Blick und ein sehr vielsagendes Schweigen. Dann fuhr er sich mit seiner arthritischen Hand über den fast kahlen Schädel und stieß ein Grunzen aus.
»Lügen und mehr Lügen!«, rief er schließlich, und ich riss überrascht die Augen auf, denn als der Achtzigjährige (oder Neunzigjährige) uns der Lüge bezichtigte, lächelte er uns zufrieden an. »Dennoch hätte mich jede andere Antwort enttäuscht«, fügte er hinzu. »Sie sind gut, Becky! Genau die Art von Mensch, die wir suchen, stimmt’s?«
Seine Frau nickte, wobei das wunderschöne schwarze Perlenkollier an ihrem Hals funkelte. Jake fuhr fort:
»Schön, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wir brauchen Hilfe. Sie müssen verstehen, dass Becky und ich …« Er verstummte kurz, als suchte er nach den richtigen Worten. »Sie müssen verstehen, dass diese Sache sehr wichtig für uns ist. Es handelt sich um ganz besondere, sehr heikle Nachforschungen … Eine Sache, die man nicht irgendjemandem anvertrauen kann.«
Becky öffnete erneut ihre schöne Hermès-Tasche und nahm ein Lederetui (oder die Hülle eines Taschenknirpses, je nach Blickwinkel) heraus, aus dem sie ein paar eingerollte Bögen, etwas größer als ein Blatt Papier, zog und mir überreichte. Es handelte sich um zwei Fotos. Die Qualität der Bilder war fantastisch, es waren Vergrößerungen von alten Pergamenten, damit sie besser lesbar waren, und man konnte noch die kleinsten Details erkennen … Was es war? Natürlich ein griechischer Text. Die Originalpergamente hatten ausgefranste und eingerissene Ränder sowie eine dunkelbraune Farbe, die ihr Alter und ihre sichere Aufbewahrung über lange Zeit an einem verschlossenen Ort mit hohen Temperaturen bezeugte. Als Paläographin hatte ich solche Schriftstücke schon oft gesehen, daher wusste ich das. Alles in allem konnte man die mit schwarzer Tinte geschriebenen Buchstaben sehr gut erkennen.
»Können Sie das lesen, Frau Doktor Salina?«, fragte Becky.
Obwohl Farag ein Pokerface zog, konnte er seine Neugier nicht länger bezwingen und beugte sich zu mir herüber, um einen Blick auf die Fotos zu werfen. Auch er konnte Griechisch (neben etlichen anderen lebenden und toten Sprachen), und wir stritten uns gelegentlich heftig über Feinheiten bei Transkriptionen, weil er sich immer darauf versteifte, absolut wörtlich zu übersetzen, was man aus meinem Blickwinkel der Expertin beim Übertragen eines Textes niemals tun sollte.
»Einige Buchstaben sind schwer zu entziffern«, murmelte ich. »Aber ja, ich kann es lesen.«
»Dann tun Sie es bitte«, bat Jake mich freundlich.
»Ich brauche meine Brille«, sagte ich, reichte Farag die Fotos und stand auf, um sie zu holen. Sie musste in greifbarer Nähe sein, denn ich legte sie immer auf ein Möbel im Wohnzimmer oder auf den Nachttisch im Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch fand ich sie auch und eilte zurück. Doch da las Farag gerade laut vor:
»Is to onoma t0u Christou tou Estavromenou …«
Im Namen des gekreuzigten Jesus Christus …, übersetzte ich in Gedanken. Ich sank auf das Sofa, setzte die Brille auf und beugte mich dann über Farag und die Fotografien, die nebeneinander auf dem Tisch lagen, um sie besser lesen zu können. Ε ς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τοῦ ᾽Εσταυρομένου …
Es handelte sich um einen alten Brief von einem gewissen Dositheus, dem orthodoxen Patriarchen von Jerusalem, an einen gewissen Nicetas, dem orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel.
Farag übersetzte weiter laut, wobei sein gestelztes Griechisch ein wahrer Ohrenschmaus war, während ich eilig den Text überflog, ihn entschlüsselte und mich daran verschluckte:
»Im Namen des gekreuzigten Jesus Christus wünsche ich, Dositheus, Patriarch von Jerusalem, dir, Nicetas, Heiligster Patriarch von Konstantinopel, Gesundheit, Segen und Frieden. Du musst wissen, Heiligster, dass am Sonntag, am sechsten Tag der Theophanie unseres Herrgotts und Erlösers Jesus Christus im Jahr des Herrn 1187, in der Umgebung von Nazareth in einer Höhle eine sehr große und reich geschmückte alte jüdische Grabstätte gefunden wurde. In ihrem Innern fanden sich vierundzwanzig steinerne Ossuarien, die alle mehrere Körper beinhalten, doch in einer Nische fand man weitere neun Ossuarien mit nur je einem Körper darin und seinem Namen in den Stein gemeißelt, und diese neun hatten als einzige Grabinschriften. Da in Nazareth sofort Gerüchte laut wurden, dass es sich um das Grab unseres Herrn Jesus und der Heiligen Familie handelt, ließ Letard, der lateinische Erzbischof von Nazareth, die Grabstätte verschließen, verbot die Anbetung und Verehrung der Höhle und befahl, die Gerüchte gewaltsam zu unterbinden. Aber unsere Gläubigen vor Ort haben uns darüber unterrichtet, dass Letard einen Priester namens Aloysius mit der Übersetzung der Inschriften der neun Ossuarien beauftragt hat, die in den Sprachen Hebräisch und Aramäisch verfasst sind. Letard hat diese Übersetzung dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Heraclius von Caesarea, zukommen lassen, ein Mann von großer Tugend und Klugheit, wie ich von Männern unseres Vertrauens weiß, der gestern, am 26. Januar, dem Festtag des heiligen Apostels Thimotheus, einen Geheimbotschafter mit einem Eilbrief an den lateinischen Papst Urban III. nach Rom geschickt hat. Dank besagter Männer unseres Vertrauens habe ich auch erfahren, dass diesem Eilbrief die Übersetzung beiliegt, die Aloysius von den Inschriften der neun Ossuarien angefertigt hat. Und hiermit lasse ich sie dir ebenfalls zukommen:
Yeshua ha-Mashiahh ben Yehosef, Jesus der Messias, Sohn von Josef
Yehosef ben Yaakov, Josef, Sohn von Jakob
Yehosef ben Yehosef akhuy d’Yeshua ha-Mashiahh, Josef, Sohn von Josef, Bruder von Jesus der Messias
Yaakov ben Yehosef akhuy d’Yeshua ha-Mashiahh, Jakob, Sohn von Josef, Bruder von Jesus der Messias
Shimeon ben Yehosef akhuy d’Yeshua ha-Mashiahh, Simon, Sohn von Josef, Bruder von Jesus der Messias
Yehuda ben Yehosef akhuy d’Yeshua ha-Mashiahh, Judas, Sohn von Josef, Bruder von Jesus der Messias
Miryam bat Yehoyakim, Maria, Tochter von Joachim
Salome bat Yehosef, Salome, Tochter von Josef
Miryam bat Yehosef, Maria, Tochter von Josef
Ich kann mir deine Überraschung und dein Missfallen vorstellen, Heiligster, denn mir erging es ebenso. Der Teufel will in seinem Eifer, die Christenheit irrezuführen, den Schwachgläubigen einreden, dass unser Herr Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dass die Heilige Jungfrau Maria keine Jungfrau war und noch weitere Kinder mit ihrem Mann Josef hatte und dass auch sie nicht mit Körper und Seele zum Himmel aufgefahren ist. Es gibt keine größere Abscheulichkeit. Mich beruhigt lediglich die Gewissheit, dass Patriarch Heraclius, den ich gut kenne, höchstselbst die neun Ossuarien zerstören lassen würde, wenn es nach ihm ginge, er dafür aber die Erlaubnis des Papstes benötigt. Dennoch, wie Urban auch immer entscheidet, diese Ossuarien müssen zerstört werden, weil sie das Werk des Bösen sind, und wenn die Lateiner es nicht tun, werden wir es tun. Ich weiß, dass du damit einverstanden sein wirst. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich empfehle mich dir, Heiligster, möge dich Gott für immer schützen. Verbleibe in der heiligen, süßen Liebe Gottes.«
Ich zuckte zurück, um mich körperlich von diesem Brief zu entfernen, als handle es sich um einen Infektionsherd. Wie bitte …? Gütiger Gott, in meinem ganzen Leben hatte ich noch keine solche Ungeheuerlichkeit gehört. Ich fühlte mich zutiefst verletzt, als hätte man mich geohrfeigt und mir eine Lanze ins Herz gebohrt. Ich verspürte den dringenden Wunsch, Jesus um Verzeihung zu bitten dafür, mit dieser Blasphemie in Berührung gekommen zu sein. Natürlich zweifelte ich keinen Augenblick daran, dass diese neun Ossuarien, sollten sie denn wirklich existiert haben, gewiss nur erbärmliche und respektlose Fälschungen waren: Im 12. Jahrhundert, mitten in den Kreuzzügen, war es eher wahrscheinlich, dass irgendein erzürnter Emir oder Sultan – auch wenn ich Muslime nicht gern bezichtige (schon gar nicht nach achthundert Jahren) – die Idee hatte, auf diese Weise ordentlich Verwirrung in der Christenheit zu stiften, denn abgesehen von der zweifelhaften Beteiligung des Teufels schien mir der Gedanke schwer vorstellbar, dass die Christen jener Zeit, seien es lateinische, griechische oder syrische, genügend Mut aufgebracht hätten, so etwas zu tun. Wie geschmacklos, mein Gott, und was für ein Mangel an Respekt!
Ein jeder dieser Gedanken schien mir unmittelbar ins Gesicht geschrieben zu stehen, denn als ich aus meiner Bestürzung herausfand, merkte ich, dass Jake und Becky mich irritiert anblickten.
»Ist etwas mit Ihnen, Frau Doktor Salina?«, fragte Becky wie eine besorgte Großmutter.
Farag wandte den Kopf und sah mich an.
»Das hat dich getroffen, was?«, sagte er zärtlich.
Er kannte mich besser als irgendwer und wusste ganz genau, dass ich auf die Sache mit den Ossuarien sehr persönlich reagierte. Über lange Zeit hatte ich mit unendlicher Geduld und Respekt, wenn auch vergeblich, versucht, wenigstens seinen Glauben an Gott zu wecken, denn mir war inzwischen klar, dass er unmöglich Vertrauen zu irgendeiner Kirche fassen würde. Sein Atheismus schmerzte mich wie eine Wunde, und obwohl ich ihn liebte und gelernt hatte, mit einem Ungläubigen zusammenzuleben, bedeutete das nicht, dass es mir leichtfiel. Natürlich war es auch für einen Heimat- und Gottlosen wie ihn nicht leicht, mit einer gläubigen Katholikin zusammenzuleben, das behauptete er zumindest, aber ich war davon überzeugt, dass es nicht stimmte. Weshalb sollten ihn mein Glaube und meine Liebe zu Gott stören oder schmerzen? Das konnte nicht sein. Doch jedes Mal, wenn ich auf seine verdrängten religiösen Gefühle zu sprechen kam, behauptete er starrsinnig das Gegenteil, also vertieften wir das Thema nicht weiter. Farag hatte also meine Überraschung und tiefe Abneigung bezüglich der Sache mit den verdammten Ossuarien aus dem 12. Jahrhundert sofort erfasst.
»Schön«, sagte ich im Versuch, mich zusammenzureißen. »Das hat mich wirklich getroffen, klar, aber es ist und bleibt ein historisches Dokument, das aus christlichem Blickwinkel keinerlei Relevanz hat.«
»Da irren Sie gewaltig, Frau Doktor Salina«, erwiderte Jake derart trocken, dass es wie ein Peitschenhieb klang. »Es ist von größter Relevanz. Tatsächlich handelt es sich bei den Nachforschungen, von denen ich vorhin sprach, genau darum, diese neun Ossuarien zu finden.«
Leichenblass. Ich wurde leichenblass. Unmöglich zu glauben, was ich da hörte. Ich war vollkommen versteinert.
Farag legte die Fotografien auf den Tisch neben das Kästchen mit dem Holzsplitter und ergriff meine Hände, diesmal im Versuch, mir wieder Leben einzuhauchen.
Ich konnte verstehen, dass sich die Simonsons – trotz des offensichtlichen Schwindels von dieser angeblich heiligen Familie – einer religiösen, historischen und archäologischen Herausforderung von solcher Größenordnung stellen wollten, aber es war trotzdem völlig absurd: Wozu neun falsche Ossuarien aus dem 12. Jahrhundert suchen, von denen nicht mal mehr ein Steinchen übrig sein dürfte? Und selbst im unwahrscheinlichsten hypothetischen Fall, dass sie noch existierten und wir sie fänden, wem würde diese Entdeckung nutzen? Niemandem! Höchstens Atheisten wie Farag. Für gläubige Christen wie mich wäre es schlicht ein Affront, ganz zu schweigen von dem Hohngelächter, wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um Fälschungen handelte.
»Warum wollen Sie die Ossuarien finden? Welchen Wert hätten solche falschen Reliquien für Sie?«, fragte Farag und klopfte mir beruhigend auf den Handrücken.
»Wert, Direktor Boswell?«, fragte Becky erstaunt. »Ihr Wert interessiert uns nicht. Diese neun Ossuarien sind echt, und wir wollen, dass Sie sie finden.«
Um Himmels willen! Jetzt begriff ich, warum diese Achtzigjährigen (oder Neunzig- oder Hundertjährigen) vollkommen verrückt waren. Sie mixten Heiliges Kreuz, Staurophylakes und falsche Ossuarien in denselben Cocktail. Sie sollten schleunigst einen guten Arzt konsultieren.
»Sie wollen, dass wir die Ossuarien suchen?«, fragte Farag überrascht.
»Nun ja, nicht Sie beide allein.« Jake fuhr sich wieder mit seiner arthritischen Hand über den Schädel. »Das ist keine leichte Aufgabe, das versichere ich Ihnen. Sie brauchen Hilfe von den Staurophylakes und Ihrem Freund Kaspar. Sie verfügen über Ressourcen, die nicht jedem zur Verfügung stehen, weshalb wir uns gezwungen sahen zu warten, bis die Reliquie gefunden wurde. Andererseits können wir diesen Auftrag niemand anderem als Ihnen erteilen, denn wir sind wirklich davon überzeugt, dass Sie ein spezielles Augenmerk für die Wahrheit haben, so verborgen sie auch sein mag.«
Ich stieß einen lauten Seufzer aus. Im Grunde hatte ich Mitleid mit den Simonsons. Sie waren alt, und ihr privilegierter Status ließ sie offensichtlich glauben, über Superkräfte zu verfügen.
»Na schön.« Ich wollte es kurz machen. »Wir werden es nicht tun. Als gläubige Katholikin fühle ich mich von Ihrem Vorschlag beleidigt und verletzt. Es ist sinnlos, weiter darüber zu reden. Außerdem ist es schon sehr spät. Wir könnten noch stundenlang darüber diskutieren, aber wozu? Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie an uns gedacht haben, aber die Antwort lautet Nein.«
Ich spürte, wie Farags Hände sich anspannten, aber er schwieg. Es geschah selten, dass wir vor anderen Menschen unterschiedlicher Meinung waren; wir besprachen die Dinge lieber unter vier Augen. Jedenfalls schien es höchst unwahrscheinlich, dass Farag anderer Meinung war, dachte ich, auch wenn wir DIE Simonsons vor uns hatten. Die Vorstellung, nach falschen mittelalterlichen Ossuarien zu suchen, war einfach lächerlich, und wir würden nicht unseren Sommerurlaub dafür opfern, um in Zeit und Raum verlorengegangenen Chimären hinterherzujagen.
»Sehen Sie, Frau Doktor Salina«, sagte der alte Jake Simonson mit einem traurigen Lächeln. »Wir können zweierlei tun: Als Erstes könnten wir gleich morgen die Entdeckung des Grabes von Bruder Andrè de Longjumeau und des Kreuzsplitters bekanntgeben. Ich kann Ihnen versichern, dass die Kammer schon bereitsteht, in der diese Reliquie für alle Ewigkeit vor Ihren Freunden, den Staurophylakes, sicher sein wird. Und ich versichere Ihnen auch, dass sie sich diese nicht aneignen können wie all die anderen Reliquien auf der Welt. Nein, diesmal nicht, das können Sie mir glauben. Und glauben Sie mir auch, wenn ich Ihnen versichere, dass die zweite Möglichkeit noch viel besser ist. Dieser Splitter des Heiligen Kreuzes wird unser Geschenk an die Bruderschaft sein, ein Geschenk, das selbstverständlich Sie beide … wem auch immer übergeben werden, im Austausch für ihre Mithilfe bei unserer Suche. Auf diese Weise können die Staurophylakes ihr Heiliges Kreuz vervollständigen, was ja den Grund ihres Daseins ausmacht, und Sie hätten ihnen dabei geholfen. Wie finden Sie das?«
»Selbst wenn wir diese Ossuarien finden würden«, erwiderte Farag und ließ mich bei seiner anschließenden Frage zusammenzucken. »Wer hätte den wissenschaftlichen Fund gemacht, Sie oder wir?«
Die Simonsons blickten sich strahlend an.
»Wir, Direktor Boswell«, rief Becky, die immer weniger Umstände machte. »Aber ich kann Ihnen versichern, dass er nie an die Öffentlichkeit gelangen wird. Diese Suche soll nicht dazu dienen, uns Ruhm zu verschaffen, da können Sie ganz beruhigt sein. Sie ist privat, geheim und sehr persönlich. Sollten Sie sich dazu entschließen, müssten Sie vor den Nachforschungen natürlich eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Und obwohl sie nicht Ihr beträchtliches akademisches Prestige bereichern würden, kann ich Ihnen versprechen, dass Sie eine finanzielle Entschädigung erhalten werden, die Sie sehr zufriedenstellen wird, weil Sie die Summe selbst bestimmen können. Ohne Höchstgrenze.«
Das zu hören hatte gerade noch gefehlt. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen.
»Mein Mann hat nur einen Scherz gemacht, Mrs. Simonson«, erklärte ich. »Wir haben nicht die geringste Absicht, diese Ossuarien zu suchen.«
Farags Hände spannten sich wieder an.
»Befürchten Sie nicht«, fragte dieser unglaubliche Blödmann, obwohl ich ihm die Fingernägel in die Hand bohrte, »dass wir die Suche auf eigene Rechnung machen könnten, nachdem wir den Brief von Dositheus gelesen haben?«
»Meinen Sie damit, ohne die Staurophylakes über diese Reliquie zu informieren, Direktor Boswell?«, lautete Jakes ungerührte Gegenfrage. »Sie beide allein? Ohne uns?«
»Ja genau.«
»Nein, das fürchten wir nicht«, antwortete Becky. Das Gesprächsverhalten der Simonsons verlief immer synkopisch, obwohl Becky meinem Eindruck nach mehr redete. »Mit dem Brief von Dositheus würden Sie nicht weit kommen. Das ist eine Sackgasse. Man benötigt noch andere Dinge, von denen wir Ihnen natürlich noch nichts erzählt haben.«
Ich würde Farags Hand zum Bluten bringen, wenn ich ihm weiter so heftig die Fingernägel ins Fleisch bohrte, womit ich ihm zu verstehen geben wollte, dass er sich auf sehr dünnem Eis bewegte und Gefahr lief, in wilden Wassern zu ertrinken. Aber er reagierte gar nicht darauf. Er schien es geflissentlich zu überhören, dass ich schon zweimal zu den Simonsons gesagt hatte, dass unsere – unser beider – Antwort deutlich und unmissverständlich Nein lautete. Seit wir verheiratet waren, hatte er sich mir gegenüber vor anderen Menschen noch nie derart distanziert verhalten oder mich übergangen.
»Das heißt also«, fuhr er ungerührt fort, »dass wir zuerst einen Vertrag mit einer Verschwiegenheitsklausel unterschreiben müssten, bevor Sie uns die ganze Geschichte von den Ossuarien erzählen?« Seine Stimme klang neutral, aber ich spürte die Wellen der Erregung, die darin mitschwangen, für andere aber nicht wahrzunehmen waren.
»Genau«, bestätigte Jake breit grinsend. »Und da die Hilfe der Bruderschaft der Staurophylakes unverzichtbar ist, sichern wir Ihnen die Übergabe des einzigen noch existierenden echten Splitters des Heiligen Kreuzes vertraglich zu. Was halten Sie davon? Ich glaube, Cato Glauser-Röist wird unser Angebot gefallen.«
Das Ganze war vollkommen aus der Spur gelaufen und wirkte jetzt wie eine beschlossene Sache, die mir wie Säure die Eingeweide verätzte.
»Sie wissen gar nicht, was Sie da reden«, entfuhr es mir mit so tiefer Stimme, dass ich selbst erschrak. »Wenn Kaspar noch leben würde, wäre er nie im Leben daran interessiert, falsche Reliquien zu suchen, die gegen seinen Glauben, Gott und die Kirche verstoßen.«
Jake und Becky lächelten geheimnisvoll, erwiderten jedoch nichts. Jake nahm einfach die Fotografien und das Kästchen vom Tisch und reichte es Becky, die alles sorgfältig wieder in ihrer Tasche verstaute. Ich war sehr erleichtert, wirklich.
Die Simonsons erhoben sich gleichzeitig, um zu gehen, und Farag und ich standen ebenfalls auf, um sie zu verabschieden. Wenn Isabella erführe, wer an diesem Abend bei uns gewesen war, wäre sie bestimmt überrascht. Oder vielleicht auch nicht. Ihre Generation, die Generation mit der besten Ausbildung und der größten Informationsfülle der Menschheitsgeschichte, wusste ja nicht einmal, dass man früher mit dem Kugelschreiber geschrieben hatte und nicht mit den Daumen. Bestimmt hatte Isabella noch nie von den Simonsons gehört.
Kurz vor Verlassen des Wohnzimmers blieb der alte Jake unvermittelt stehen.
»Wie lange wird es dauern, bis Sie uns eine endgültige Antwort geben?«, fragte er, ohne jemanden dabei anzusehen.
Farags Hand drückte meinen Arm, damit ich den Mund hielt, aber es brauchte viel mehr als das, um eine Salina aus Sizilien zum Schweigen zu bringen. Nun ja, und weil Farag das wusste, drückte er so fest zu, dass ich vor Schmerz zusammenzuckte und ihm einen tödlichen Blick zuwarf, während er antwortete:
»Zwei Tage. Am Montag kriegen Sie unsere Antwort.«
Selbst wenn er so dumm wäre, es nicht zu bemerken, ließ er damit nicht nur mich schlecht dastehen, sondern hatte zudem das Schweigegelübde mit der Bruderschaft gebrochen und den Simonsons verraten, was nicht verraten werden durfte: dass Kaspar Glauser-Röist als Cato der Staurophylakes noch am Leben und glücklich war. Der Verrat war in seinem Versprechen einer Antwort in zwei Tagen enthalten. Ich sage ja immer, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Hätte es sie gegeben, hätte sich in genau dem Augenblick der Himmel aufgetan, und eine scharfe Axt hätte seinen dummen blonden Dickschädel in zwei Hälften geteilt wie eine Melone.
»Montag ist in Ordnung«, antwortete Becky und hängte sich ihre Tasche in die Armbeuge.
»Ach, Frau Doktor Salina«, fügte der alte Jake hinzu und blieb erneut stehen. »Erinnern Sie sich an den Bibelvers: Da rührte er ihre Augen an und sprach: ›Euch geschehe nach eurem Glauben.‹ Und ihre Augen wurden geöffnet.«
Ja, natürlich erinnerte ich mich daran. Das Evangelium nach Matthäus. Aber ich war so verärgert, dass ich weder diesen Wink mit dem Zaunpfahl erfasste noch mich fragte, warum dieser boshafte Multimillionär das Neue Testament zitierte. Ich beschränkte mich auf ein höfliches Lächeln und führte sie zur Tür. Wozu noch darauf antworten, wenn sie schon im Gehen begriffen waren?
Ich war wütend und fühlte mich von Farag verraten, ich war verwirrt wegen der Sache mit den Ossuarien, besorgt, weil ich nicht wusste, wie wir Kaspar erklären sollten, dass wir einem Paar achtzigjähriger (oder neunzigjähriger) Außerirdischer verraten hatten, dass er noch lebte, und vor allem schrecklich sauer über die grässliche Aussicht, meinen Urlaub mit der Suche nach nicht existenten, wertlosen und schmählichen archäologischen Funden zu vergeuden.
Aber ich wusste, wer ziemlich teuer dafür bezahlen würde. Direktor Boswell würde heute Nacht, sobald er die Haustür geschlossen hatte, sein blaues Wunder erleben. Gleich würde ein ordentliches Gewitter über ihn niedergehen.
DREI
Ich ließ ihm keine Zeit zu reagieren. Exakt null Komma null Sekunden später ging eine fürchterliche Ladung aus Vorwürfen und Verbalattacken über seinen Egoismus, seinen Narzissmus, seine Undankbarkeit, seinen Ehrgeiz, seinen Atheismus, seine Selbstüberschätzung, seine Heuchelei, seine Falschheit, seine Unwürdigkeit, seine Habsucht, seine Arroganz, seine Eitelkeit, seinen Dünkel und vieles mehr über ihn nieder. Es war mir egal, dass er völlig ungerührt blieb und es mit gesenktem Kopf und den Händen tief in den Jackentaschen seelenruhig über sich ergehen ließ. Auf dem Weg zu unserem Schlafzimmer attackierte ich ihn weiter mit scharfen Spitzen, weshalb ich gar nicht bemerkte, wie wir hineingelangt waren. Mein Blut kochte, und plötzlich hörte ich mich sagen, dass unsere Ehe am Ende sei, dass er die Koffer packen und sich einen anderen Ort zu leben suchen sollte.
»Aber du kannst dich doch gar nicht scheiden lassen«, rief er überrascht und brach damit endlich sein stoisches Schweigen. Die Angst in seinem Gesicht war unglaublich befriedigend.
»Wieso nicht?«, erwiderte ich wutschnaubend. »Wenn ich nicht mehr Nonne bin, kann ich auch nicht mehr verheiratet sein!«
»Aber nein!«, wiederholte er starrsinnig. »Hier kann man nicht jedes Jahr ein Gelübde ablegen! Die Ehe ist ein Sakrament und für ein ganzes Leben bestimmt.«
Jetzt war ich überrascht.
»Aber du glaubst doch gar nicht an diese Dinge!«, schnaubte ich empört.
»Nein, ich nicht«, räumte er mit einer besonnenen Geste ein. »Du aber schon. Deshalb kannst du dich nicht scheiden lassen. Ich schon, wenn ich will.«
Ich hätte ihn umbringen können, aber wir waren noch mitten im Streit, und erst musste ich gewinnen.
»Zu deiner Information«, sagte ich gedehnt, »ich bin keine radikale Katholikin, die Wort für Wort alles befolgt, was die Kirche vorschreibt. Ich habe eine eigene Meinung, das weißt du.« Ich zeigte mit meinem rechten Zeigefinger auf die Stelle zwischen seinen Augen. »Wenn ich mich scheiden lassen will, dann mache ich das und Schluss.«
»Wenn du also keine radikale Katholikin bist«, parierte er stur, »warum hast du dann so große Angst vor diesen Ossuarien mit den Namen von Jesus und seiner Familie?«
Er hatte mich kalt erwischt.
»Ich habe keine Angst vor ihnen. Ich finde sie nur geschmacklos. Sie beleidigen meinen Glauben.«
»Wie, sie beleidigen deinen Glauben? Ist es nicht eher so, dass sie deinen Glauben bedrohen?«
»Mein Glaube ist meine Angelegenheit, und nichts und niemand kann ihn bedrohen. Er ist unangreifbar, denn er ist bei mir in Sicherheit. Und mein Glaube sagt mir, dass Jesus kein sterblicher Mensch, sondern Gott war, der als Werk des Heiligen Geistes von der Jungfrau Maria geboren und als Sein einziger Sohn für unsere Sünden gekreuzigt wurde und am dritten Tag in den Himmel aufgefahren ist.«
»Das ist das katholische Credo.«
»Genau. Das Credo. Das, woran ich glaube. Woran wir Christen glauben.«