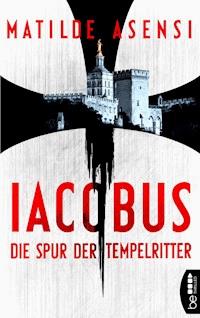9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sieben Städte, sieben Todsünden, sieben mörderische Prüfungen
Auf der ganzen Welt sind die Reliquien des Heiligen Kreuzes verschwunden. Im Auftrag des Vatikan soll ein dreiköpfiges Expertenteam diesen gewaltigen Reliquienraub aufklären: die Paläografin Ottavia Salina, der Archäologe Farag Boswell und der Schweizergardist Kaspar Glauser-Röist. Bald stoßen sie auf eine streng geheime Bruderschaft - die Wächter des Kreuzes. Um zu ihnen vorzudringen, muss das Trio einen uralten Initiationsritus meistern. Sieben lebensgefährliche Prüfungen, die alle mit Dantes Göttlicher Komödie zusammenhängen ...
Der internationale Bestseller in Neuauflage
Platz 1 der spanischen Bestsellerliste
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
EPILOG
Leseprobe
Über das Buch
Auf der ganzen Welt sind die Reliquien des Heiligen Kreuzes verschwunden. Im Auftrag des Vatikan soll ein dreiköpfiges Team diesen gewaltigen Reliquienraub aufklären: die Paläografin Ottavia Salina, der Archäologe Farag Boswell und der Schweizergardist Kaspar Glauser-Röist. Bald stoßen sie auf eine streng geheime Bruderschaft – die Wächter des Kreuzes. Doch es gibt nur einen Weg, zu ihnen zu gelangen: Sie müssen sieben lebensgefährliche Prüfungen meistern, die alle mit Dantes Göttlicher Komödie zusammenhängen ...
Über die Autorin
Matilde Asensi, 1962 in Alicante geboren, arbeitete nach dem Journalismusstudium für Rundfunk und Printmedien. Ihr Roman Wächter des Kreuzes aus dem Jahr 2001 entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller, der von Kritikern hochgelobt wurde. Inzwischen ist ihre Leserschaft auf mehr als 20 Millionen Menschen weltweit angewachsen. Für ihre literarische Arbeit wurde Matilde Asensi mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 2015 erschien mit Die Jesus-Verschwörung die lang ersehnte Fortsetzung ihres Erfolgsromans Wächter des Kreuzes.
MATILDE ASENSI
WÄCHTER DES KREUZES
THRILLER
Aus dem Spanischen von Silvia Schmid
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Matilde Asensi/Editorial Planeta, S.A.Titel der spanischen Originalausgabe: »El último Catón«This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen and Bookbank Literary Agency, Madrid
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnAlle deutschen Zitate aus Dantes »Die Göttliche Komödie« stammen aus folgender Ausgabe: Manesse Verlag, Zürich 1963, übersetzt von Ida und Walther von Wartburg.Titelillustration: © www.buerosued.deUmschlaggestaltung: www.buerosued.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4773-9
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Pascual, Andrés, Pablo und Javier
EINS
Alles Schöne, alles Kunstvolle, alles Sakrale spürt wie wir die unaufhaltsam verrinnende Zeit. Sei er sich der Eintracht mit dem Unendlichen bewusst oder nicht, sobald der Schöpfer sein Kunstwerk als vollendet betrachtet und seiner Bestimmung übergibt, beginnt für ebendieses Werk ein Dasein, das es im Laufe der Jahrhunderte auch immer dem Alter und dem Tod ein Stück näher bringt. Jedoch verleiht ihm die Zeit, die uns altern lässt und zugrunde richtet, eine neue Dimension von Schönheit, von welcher der Mensch nur träumen kann: Würde ich heute das Kolosseum mit all seinen Mauern und Stufen wiedererrichtet sehen wollen? Gäbe ich etwas für das Parthenon, in grellen Farben bemalt, oder für die Nike von Samothrake wieder mit Kopf? Nicht um alles in der Welt.
Derlei Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich mit den Fingerkuppen über die rauen Ecken des vor mir liegenden Pergaments strich. Ich war so in meine Arbeit vertieft, dass ich das Klopfen an der Tür gänzlich überhörte. Ebenso wenig nahm ich wahr, wie der Archivsekretär William Baker die Türklinke herunterdrückte und seinen Kopf hereinstreckte. Als ich ihn letztendlich dann doch bemerkte, stand er schon in der Tür meines Labors.
»Dottoressa Salina«, flüsterte Baker, hütete sich jedoch, über die Schwelle zu treten, »Hochwürden Pater Ramondino bat mich, Ihnen auszurichten, Sie mögen sofort in sein Büro kommen.«
Ich blickte von den Schriftstücken hoch und nahm meine Brille ab, um den Sekretär besser mustern zu können, in dessen ovalem Gesicht sich die gleiche Ungläubigkeit widerspiegelte wie in meinem. Mit seiner dicken Brille aus Schildpatt und dem schütteren, zwischen Blond und Grau changierenden Haar, das er peinlich genau so hingekämmt hatte, dass die größtmögliche Fläche seiner glänzenden Halbglatze verdeckt wurde, war Baker einer dieser kleinen, stämmigen Nordamerikaner, die unschwer auch als Südeuropäer durchgehen könnten.
»Entschuldigen Sie, Dr. Baker«, meinte ich mit weit aufgerissenen Augen, »könnten Sie mir bitte wiederholen, was Sie da soeben gesagt haben?«
»Hochwürden Pater Ramondino will Sie so schnell wie möglich in seinem Büro sehen.«
»Der Präfekt will mich sehen? … Mich?« Ich konnte der Botschaft keinen Glauben schenken; Guglielmo Ramondino, die Nummer zwei des Vatikanischen Geheimarchivs, war die oberste Instanz nach Seiner Exzellenz Monsignore Oliveira, und man konnte die wenigen Male an einer Hand abzählen, die er einen seiner Angestellten in sein Arbeitszimmer beordert hatte.
Ein verlegenes Lächeln huschte über Bakers Gesicht, als er nickte.
»Und haben Sie eine Ahnung, warum er mich sehen will?«, fragte ich ganz eingeschüchtert.
»Nein, Dottoressa Salina, doch wird es zweifellos wegen etwas sehr Wichtigem sein.«
Damit schloss er, noch immer ein Lächeln auf den Lippen, sacht die Tür hinter sich und war verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt plagten mich schon die Symptome dessen, was man gemeinhin als einen Anfall von Panik bezeichnet: schweißnasse Hände, ein trockener Mund, Herzrasen und zitternde Knie.
Irgendwie gelang es mir, mich von meinem Hocker zu erheben, die Schreibtischlampe zu löschen und einen letzten schmerzerfüllten Blick auf die beiden herrlichen byzantinischen Kodizes zu werfen, die vor mir ausgebreitet auf dem Tisch lagen. Ich hatte die vergangenen sechs Monate darauf verwandt, mit ihrer Hilfe das berühmte ›Panegyrikon‹ des heiligen Nikephoros zu rekonstruieren, und ich stand kurz vor seiner Fertigstellung. Resigniert seufzte ich … Um mich herum herrschte tiefe Stille. Mein kleines Labor – dessen ganzes Mobiliar aus einem alten Holztisch, ein paar langbeinigen Hockern, einem Kruzifix an der Wand und einer Vielzahl randvoller Bücherregale bestand – lag vier Ebenen unter der Erdoberfläche und gehörte zum Hypogäum, dem Teil des Vatikanischen Geheimarchivs, zu dem nur eine sehr beschränkte Anzahl von Menschen Zutritt hatte; es war die unsichtbare Abteilung des Vatikans, für die Welt wie die Geschichte nicht existent. Viele Journalisten und Gelehrte hätten ihr Leben dafür gegeben, auch nur eines der Dokumente einsehen zu können, die während der letzten acht Jahre durch meine Hände gegangen waren. Doch allein die Annahme, dass irgendein der Kirche nicht nahestehender Mensch die nötige Erlaubnis bekäme, bis dorthin vorzudringen, war reine Illusion; noch nie hatte ein Laie Zugang zum Hypogäum erhalten, und niemandem würde dies je gewährt werden.
Auf meinem Schreibtisch waren außer dem Lesepult, den vielen Notizbüchern und der Speziallampe – die Pergamente sollten sich nicht erwärmen – auch noch Radiermesser, Latexhandschuhe und Aktenmappen mit hochaufgelösten Reproduktionen der am schwersten beschädigten Blätter der byzantinischen Kodizes zu finden. Wie ein sich windender Wurm ragte an einer Seite des Tisches der lange Arm einer Lupe heraus, an der eine aus rotem Karton gefertigte Hand baumelte, auf der viele Sterne klebten: ein Andenken an den letzten – ihren fünften – Geburtstag der kleinen Isabella, meiner Lieblingsnichte unter den fünfundzwanzig Nachkommen, die sechs meiner acht Geschwister der Herde des Herrn beigesteuert hatten. Ein Lächeln erhellte mein Gesicht, als ich mich jetzt an das lustige kleine Mädchen erinnerte, wie sie rief: »Tante Ottavia, Tante Ottavia, lass mich dir mit dieser roten Hand ein paar herunterhauen!«
Der Präfekt! Mein Gott, der Präfekt erwartete mich, und ich stand hier wie angewurzelt und dachte an Isabella! Hastig zog ich den weißen Kittel aus, hängte ihn an seinen Haken an der Wand, und nachdem ich meinen Ausweis mit der Benutzer-ID, auf dem neben einem schrecklichen Porträtfoto ein großes C zu sehen war, an mich genommen hatte, trat ich hinaus auf den Flur und schloss hinter mir die Tür. Mein Mitarbeiterstab saß an einer langen Reihe von Tischen, die sich gute fünfzig Meter bis zu den Fahrstuhltüren erstreckte. Auf der anderen Seite der Stahlbetonwand katalogisierte und archivierte subalternes Personal Hunderte, Tausende von Verzeichnissen und Akten über die Kirche und ihre Geschichte, ihre Diplomatie und sämtliche sie betreffende Aktivitäten vom 2. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Die mehr als fünfundzwanzig Kilometer langen Bücherregale des Vatikanischen Geheimarchivs ließen das Ausmaß der erhaltenen Dokumentation erahnen. Offiziell verwahrte das Archiv nur Schriftstücke der letzten achthundert Jahre; doch auch die der tausend Jahre zuvor (jene, die nur im dritten und vierten Untergeschoss des Hochsicherheitstrakts zu finden waren) befanden sich in seiner Obhut. Seit sie aus den Pfarreien, Klöstern oder Kathedralen, von archäologischen Ausgrabungen oder aus den ehemaligen Archiven der Engelsburg und der Apostolischen Kammer hierher überführt worden waren, hatten diese wertvollen Dokumente das Sonnenlicht nicht mehr gesehen, welches sie neben anderen, gleichermaßen gefährlichen Dingen für alle Ewigkeit zerstören könnte.
Schnellen Schrittes ging ich zu den Aufzügen, blieb jedoch kurz an einem der Tische stehen, um die Arbeit Guido Buzzonettis, eines meiner Assistenten, zu begutachten, der sich mit einem Brief des mongolischen Großkhans Güyük abmühte, den dieser im Jahre 1246 an Papst Innozenz IV. geschickt hatte. Wenige Millimeter von seinem rechten Ellenbogen entfernt, genau neben einigen Fragmenten des Schreibens, stand ein kleines Gefäß mit alkalischer Lösung. Unverschlossen.
»Guido!«, rief ich erschrocken. »Keine Bewegung!«
Entsetzt starrte Guido mich an; er wagte nicht einmal mehr, Luft zu holen. Das Blut war aus seinem Gesicht gewichen und stieg langsam in seine Ohren, die wie zwei rote Tücher wirkten, die ein weißes Schweißtuch umrahmten. Mit der geringsten Bewegung seines Arms würde er die Lösung über die Fragmente verschütten und damit irreparable Schäden auf einem für die Historie einzigartigen Dokument anrichten. Um uns herum hatten alle in der Arbeit innegehalten. Es herrschte tiefes Schweigen. Ich nahm das Gefäß, stöpselte den Deckel darauf und stellte es ans andere Ende des Tischs.
»Buzzonetti«, zischte ich und sah ihn dabei mit durchdringendem Blick an, »packen Sie sofort Ihre Sachen zusammen und sprechen Sie beim Vizepräfekten vor.«
Nie hatte ich in meinem Labor ein derart fahrlässiges Verhalten geduldet. Buzzonetti war ein junger Dominikaner, der an der Vatikanischen Schule für Paläographie, Diplomatik und Archivistik studiert und sich auf orientalische Kodikologie spezialisiert hatte. Ich selbst hatte ihn zwei Jahre lang in griechischer und byzantinischer Paläographie unterrichtet, bevor ich den Vizepräfekten des Archivs, Hochwürden Pater Pietro Ponzio, darum gebeten hatte, ihm eine Stelle in meinem Team zu offerieren. So sehr ich Bruder Buzzonetti auch schätzte und um seinen großen Wert wusste, war ich dennoch nicht bereit, ihn weiterhin im Hypogäum zu beschäftigen. Unser Material war einzigartig, einfach unersetzlich, und wenn in tausend oder zweitausend Jahren irgendjemand den Brief Güyüks an Innozenz IV. einsehen wollte, musste ihm dies auch möglich sein. So einfach war das. Was wäre denn einem Restaurator des Louvre passiert, der einen Topf voll Farbe auf dem Rahmen der ›Mona Lisa‹ hätte stehenlassen? … Seit ich dem Labor für Restaurierung und Paläographie des Vatikanischen Geheimarchivs vorstand, hatte ich für derartige Verfehlungen meiner Mannschaft niemals Verständnis aufgebracht – alle wussten dies –, und heute würde ich es ebenso wenig aufbringen.
Während ich den Aufzug rief, war ich mir wieder einmal vollkommen im Klaren darüber, dass mich meine Mitarbeiter nicht sonderlich schätzten. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihre vorwurfsvollen Blicke in meinem Rücken spürte, weshalb ich mir nicht einmal zu denken gestattete, dass sie mir Hochachtung zollten. Nichtsdestotrotz dachte ich, dass man mir vor acht Jahren die Leitung des Labors nicht übertragen hatte, um die Zuneigung meiner Untergebenen oder Vorgesetzten zu gewinnen. Es bereitete mir großen Kummer, Bruder Buzzonetti entlassen zu müssen, und nur ich wusste, wie schlecht ich mich deswegen in den folgenden Monaten fühlen würde, doch war es gerade meine Entschiedenheit, die mir zu dieser Führungsposition verholfen hatte.
Leise hielt der Lift im vierten Untergeschoss. Vor mir gingen die Türen auf. Ich steckte den Sicherheitsschlüssel in die Schalttafel, zog meine Benutzer-ID durch den Scanner und drückte auf die Null. Augenblicke später durchbohrte die durch die großen Glasscheiben vom Damasushof hereinflutende Sonne meinen Kopf wie ein Messer, blendete und betäubte mich. Das künstliche Licht der unterirdischen Stockwerke verwirrte einem die Sinne, so dass man dort die Nacht nicht vom Tag unterscheiden konnte; bei mehr als einer Gelegenheit, wenn ich in irgendeine wichtige Arbeit vertieft war, hatte ich das Archivgebäude mit dem ersten Licht des neuen Tages verlassen, verblüfft, wie viel Zeit inzwischen verstrichen war. Noch immer blinzelnd blickte ich zerstreut auf meine Armbanduhr. Es war genau ein Uhr mittags.
Zu meiner Überraschung ging der Präfekt, Hochwürden Guglielmo Ramondino, im großen Vorzimmer voller Ungeduld auf und ab, statt mich gemächlich in seinem Büro zu erwarten, wie ich dies eigentlich vermutet hatte.
»Dottoressa Salina«, murmelte er, drückte mir die Hand und wandte sich gleich zum Ausgang, »kommen Sie bitte mit. Wir haben nur sehr wenig Zeit.«
An jenem Morgen Anfang März war es im Cortile del Belvedere sehr warm. Als wären wir exotische Tiere in einem extravaganten Zoo, starrten die Touristen von den großen Flurfenstern der Apostolischen Pinakothek gebannt auf uns herab. Ich kam mir immer sehr komisch vor, wenn ich durch die für den Publikumsverkehr geöffneten Teile der Vatikanstadt ging, und nichts ärgerte mich mehr, als wenn ich mitten in das auf mich gerichtete Objektiv eines Fotoapparats sah, sobald ich den Blick hob. Leider genossen es gewisse Prälaten sehr, ihren Status als Bewohner des kleinsten Staates der Welt zur Schau zu stellen. Pater Ramondino war einer von ihnen. Im typisch schwarzen Anzug mit Kollar, das Jackett offen, konnte man den plumpen Körper dieses lombardischen Bauern schon auf kilometerweite Entfernung ausmachen. Er bemühte sich, mich entlang der Touristenroute zu den Räumlichkeiten des Staatssekretariats im dritten Stock des Apostolischen Palasts zu geleiten, und während er mir erzählte, dass wir von Seiner Eminenz Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano persönlich empfangen würden (mit dem ihn anscheinend eine alte und innige Freundschaft verband), blickte er mit strahlendem Lächeln mal nach links, mal nach rechts, so als defiliere er inmitten einer provinzlerischen Osterprozession.
Die Schweizergardisten, die am Eingang der Diensträume des Heiligen Stuhls postiert waren, zuckten nicht einmal mit der Wimper, als wir an ihnen vorbeigingen. Ganz im Gegensatz zu dem Sekretär, der die Aufsicht darüber führte, wer dort ein und aus ging, und unsere Namen und Funktionen gewissenhaft in seinem Register vermerkte. Der Kardinalstaatssekretär würde uns erwarten, erklärte er, stand auf und führte uns durch einige lange Gänge, deren Fenster auf den Petersplatz hinausgingen.
Obwohl ich mir nichts anmerken ließ, lief ich neben dem Präfekten her mit dem Gefühl, als balle sich eine stählerne Faust um mein Herz: Auch wenn ich wusste, dass die Angelegenheit, die all diesen seltsamen Ereignissen zugrunde lag, nicht mit Fehlern in Zusammenhang stehen konnte, die mir bei meiner Arbeit unterlaufen waren, ging ich doch in Gedanken alles durch, was ich in den letzten Monaten getan hatte, forschte nach irgendeiner Verfehlung, die eine Rüge seitens der höchsten kirchlichen Hierarchie wert wäre.
Schließlich blieb der Sekretär in irgendeinem der vielen Säle stehen – er sah genauso aus wie alle anderen auch, mit den gleichen Ornamenten und Freskenmalereien – und bat uns, einen Augenblick zu warten, woraufhin er hinter einer der Flügeltüren verschwand, die so leicht und zerbrechlich wirkten, als seien sie aus Blattgold gemacht.
»Wissen Sie eigentlich, wo wir uns befinden, Dottoressa?«, fragte mich der Präfekt mit nervösem Gebaren und einem außerordentlich zufriedenen Lächeln auf den Lippen.
»Mehr oder weniger, Euer Hochwürden …«, erwiderte ich und blickte mich aufmerksam um. Es roch ganz eigenartig, wie nach frisch gebügelter Wäsche, vermischt mit Firnis und Wachs.
»Dies hier sind die Räumlichkeiten der Zweiten Sektion des Staatssekretariats« – mit dem Kinn beschrieb er einen allumfassenden Kreis – »der Abteilung, die sich mit den diplomatischen Beziehungen des Heiligen Stuhls zum Rest der Welt befasst. Geleitet wird sie von Erzbischof Monsignore François Tournier.«
»Ach ja, Monsignore Tournier!«, erklärte ich im Brustton der Überzeugung. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, auch wenn sein Name mir irgendwie bekannt vorkam.
»Hier, Dottoressa Salina, lässt sich mühelos nachweisen, dass die kirchliche Macht über sämtliche Regierungen und Staatsgrenzen erhaben ist.«
»Und warum hat man uns hierherbestellt, Euer Hochwürden? Unsere Arbeit hat damit doch nichts zu tun.«
Verlegen sah er mich an und senkte die Stimme.
»Ich darf Ihnen den Grund nicht nennen … Was ich Ihnen aber versichern kann, ist, dass es sich um eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit handelt.«
»Aber Euer Hochwürden«, bohrte ich starrköpfig nach, »ich bin eine ganz gewöhnliche Angestellte des Geheimarchivs. Jegliche Angelegenheit auf höchster Ebene müssen doch wohl Sie, als Präfekt, oder Seine Eminenz, Monsignore Oliveira, regeln. Aber ich, was mache ich hier?«
Er schaute mich an, als ob er nicht wüsste, was er darauf antworten sollte. Dann klopfte er mir ein paarmal aufmunternd auf die Schulter, wandte sich um und ging auf eine große Gruppe von Prälaten zu, die nahe den Fenstern standen, um ein paar wärmende Strahlen der Sonne zu erhaschen. In diesem Moment wusste ich, wo der Geruch nach frisch gebügelter Wäsche herkam: von ebenjenen Prälaten.
Es war beinahe Essenszeit, allerdings schien das hier niemanden zu kümmern; in den Fluren und Diensträumen herrschte nach wie vor fieberhafter Betrieb, Geistliche und Laien liefen geschäftig hin und her. Ich war noch nie hier gewesen, so dass ich die Gelegenheit beim Schopf packte und mir die Zeit damit vertrieb, die unglaubliche Pracht des Saals zu bestaunen, die Eleganz des Mobiliars, die unschätzbaren Gemälde und den wertvollen Zierat. Noch bis vor einer halben Stunde hatte ich in meinem weißen Kittel, die Brille auf der Nase, allein und in völliger Stille in meinem kleinen Labor über der Arbeit gesessen … und jetzt befand ich mich unversehens in einer der weltweit wichtigsten Schaltzentralen der Macht, umgeben von den höchsten internationalen Würdenträgern!
Plötzlich hörte man das Quietschen einer Tür und anschwellendes Stimmengewirr, so dass alle jäh den Kopf wandten. Unmittelbar darauf kam ein lärmender Pulk von Journalisten, einige mit Fernsehkameras oder Tonbandgeräten, den Hauptflur entlang. Schallendes Gelächter und lautes Geschrei waren zu vernehmen. Die meisten der Journalisten waren Ausländer, hauptsächlich Europäer und Afrikaner, aber es gab auch etliche Italiener darunter. Insgesamt waren es wohl an die vierzig, fünfzig Reporter, die innerhalb von Sekunden über unseren Saal hereinbrachen. Einige blieben stehen, um die Priester, Bischöfe und Kardinäle zu begrüßen, die wie ich dort herumspazierten, andere wiederum eilten zum Ausgang. Fast alle musterten mich verstohlen, überrascht vom ungewohnten Anblick einer Frau in diesen heiligen Hallen.
»Man hat Lehmann ohne langes Federlesen abblitzen lassen«, rief eben neben mir ein kahlköpfiger Journalist mit einer Brille für Kurzsichtige aus.
»Es ist doch ganz klar, dass Wojtyla nicht an Rücktritt denkt«, erklärte ein anderer und kratzte sich dabei an den Koteletten.
»Oder aber man lässt ihn nicht zurücktreten!«, urteilte ein dritter verwegen.
Ihre weiteren Worte verhallten, während sie sich über den Flur entfernten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, hatte ein paar Wochen zuvor eine gewagte Äußerung fallengelassen, wonach es wünschenswert wäre, dass Johannes Paul II. aus freien Stücken zurücktrete, falls er sich nicht mehr in der Lage sähe, die Kirche verantwortungsbewusst zu lenken. In den Kreisen, die dem Papst nahestanden, hatte der Mainzer Bischof, der in Anbetracht des schlechten Gesundheitszustands Seiner Heiligkeit nicht als Einziger eine solche Empfehlung ausgesprochen hatte, mit seiner Bemerkung Öl ins Feuer gegossen, und anscheinend hatte Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano soeben in einer stürmischen Pressekonferenz ein solches Ansinnen mit einer angemessenen Erklärung zurückgewiesen. Das Barometer steht auf Sturm, sagte ich mir besorgt; das würde nun so weitergehen, bis der Heilige Vater unter der Erde läge und ein neuer Hirte mit ruhiger Hand die kirchliche Weltherrschaft übernähme.
Von all den Angelegenheiten des Vatikans ist zweifellos die Wahl eines neuen Papstes diejenige, die am meisten Interesse hervorruft und für größte Faszination sorgt, offenbaren sich dabei doch nicht nur die niederträchtigsten Ambitionen der Kurie, sondern auch die alles andere als frommen Wesenszüge der göttlichen Stellvertreter. Leider schien ein solch aufsehenerregendes Ereignis unmittelbar bevorzustehen, und der Stadtstaat war der reinste Intrigenherd, da die verschiedenen Fraktionen allerhand Ränke schmiedeten, um den jeweilig bevorzugten Kandidaten auf den Petrusstuhl zu hieven. Offen gesagt hatte man im Vatikan schon seit geraumer Zeit das Gefühl, dass das Pontifikat seinem Ende zuging, und auch wenn mich diese Frage als Kind der Mutter Kirche und Ordensschwester überhaupt nicht berührte, so waren für mich als Forscherin unmittelbare Nachteile daraus erwachsen, weil die Bewilligung und Finanzierung mehrerer Projekte in der Schwebe blieben. Während des erzkonservativen Pontifikats Johannes Pauls II. war nicht daran zu denken gewesen, eine bestimmte Art von Forschung zu betreiben. In meinem tiefsten Inneren wünschte ich mir, dass der nächste Heilige Vater größeren Weitblick besäße und sich nicht so viele Gedanken darüber machte, wie man die offizielle Version der Kirchengeschichte zementieren könne (es gab so unendlich viel Material, welches unter »Streng vertraulich« archiviert war!). Allerdings hegte ich keine großen Hoffnungen auf einschneidende Reformen, da die Macht, welche die von Johannes Paul II. in den letzten zwanzig Jahren ernannten Kardinäle angehäuft hatten, den Sieg eines Papstes des fortschrittlichen Flügels beim Konklave unmöglich machte. Wenn nicht der Heilige Geist persönlich für einen Wandel eintrat und seinen Einfluss bei einer so wenig geistvollen Ernennung geltend machte, war es alles andere als wahrscheinlich, dass der neue Pontifex nicht konservativer Prägung war.
In diesem Moment trat ein in eine schwarze Soutane gekleideter Priester zu Hochwürden Ramondino und flüsterte ihm etwas ins Ohr, woraufhin dieser mir mit hochgezogenen Augenbrauen zu verstehen gab, dass ich mich wappnen sollte: Man erwartete uns.
Die fein gearbeiteten Türen öffneten sich leise. Ich ließ dem Präfekten den Vortritt, wie dies das Protokoll verlangte. Der Saal vor uns war von oben bis unten mit Spiegeln, vergoldeten Leisten und Freskenmalereien von Raffael dekoriert und dreimal so groß wie der, in dem man uns hatte warten lassen. Ganz hinten, für meine Augen schon fast unsichtbar, standen auf einem Teppich lediglich ein klassischer Schreibtisch und ein Stuhl mit hoher Lehne: Es war das größte Büro, das ich in meinem Leben gesehen hatte. An einer der Längsseiten unter den schmalen Fenstern, die das Licht von draußen hereinließen, unterhielt sich angeregt eine Gruppe von Kirchenmännern, die auf niedrigen, von den Soutanen verdeckten Schemeln saßen. Hinter einem der Prälaten stand ein Ausländer in Straßenkleidung, der sich an dem Gespräch nicht beteiligte und eine so offensichtlich martialische Haltung an den Tag legte, dass es sich zweifellos um einen Polizisten oder Soldaten handeln musste. Er war sehr groß, bestimmt über einen Meter neunzig, kräftig und so gestählt, als stemme er ständig Gewichte; das blonde Haar trug er so kurz, dass gerade einmal ein Schimmer davon im Nacken und über der Stirn zu entdecken war.
Einer der geistlichen Würdenträger stand sogleich auf, als er uns hereinkommen sah. Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano war von mittlerer Statur und schien weit über siebzig zu sein; unter dem Scheitelkäppchen aus purpurroter Seide war eine hohe Stirn zu sehen, die von einer beginnenden Glatze herrührte, und weißes, mit Brillantine gebändigtes Haar. Er trug eine altmodische erdfarbene Brille mit großen rechteckigen Gläsern, einen schwarzen Talar mit purpurnen Borten und Knöpfen, eine schillernde rote Schärpe und Socken gleicher Farbe. Über seiner Brust baumelte ein kleines goldenes Pektorale. Ein strahlendes Lächeln erhellte das Gesicht Seiner Eminenz, als er nun auf den Präfekten zutrat und ihn mit dem Bruderkuss begrüßte.
»Guglielmo!«, rief er aus. »Wie schön, dich zu sehen!«
»Eure Eminenz!«
Die beiderseitige Zufriedenheit über das Wiedersehen war offenkundig. Also hatte der Präfekt nicht phantasiert, als er mir von seiner alten Freundschaft mit dem wichtigsten Entscheidungsträger des Vatikans erzählt hatte. Meine Verwirrung wuchs; das Ganze kam mir immer mehr wie ein Traum denn wie greifbare Wirklichkeit vor. Was war geschehen, dass ich mich plötzlich im Staatssekretariat befand?
Die übrigen Anwesenden, welche die Szene aufmerksam und neugierig verfolgten, waren der Kardinalvikar von Rom und Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, Seine Eminenz Kardinal Carlo Colli, ein ruhiger Mann von umgänglichem Wesen; Erzbischof Monsignore François Tournier, der Sekretär der Zweiten Sektion (den ich daran erkannte, dass er ein violettes Scheitelkäppchen trug und kein purpurnes, welches den Kardinälen vorbehalten war); und der einsilbige blonde Recke, der seine durchscheinenden Augenbrauen runzelte, als ob er sich maßlos über das Geschehen ärgerte.
Plötzlich drehte sich der Präfekt zu mir um, fasste mich an den Schultern und schob mich vor den Kardinalstaatssekretär.
»Eure Eminenz, das ist Dottoressa Ottavia Salina.«
Kardinal Sodano musterte mich von Kopf bis Fuß. Zum Glück hatte ich mich an diesem Tag dezent gekleidet: Ich trug einen netten grauen Rock und ein lachsfarbenes Twinset. Vor seiner Eminenz stand eine etwa achtunddreißigjährige Frau von mittlerer Statur, die sich für ihr Alter gut gehalten hatte, mit einem freundlichen Gesicht, kurzem schwarzen Haar und dunklen Augen.
»Eure Eminenz …«, murmelte ich, beugte respektvoll den Kopf und das Knie und küsste den Ring, den der Staatssekretär mir entgegenstreckte.
»Sind Sie Nonne, Dottoressa?«, vernahm ich als einzige Begrüßung. Er hatte einen leichten piemontesischen Akzent.
»Schwester Ottavia, Eure Eminenz«, beeilte sich der Präfekt zu erklären, »gehört der Kongregation der Glückseligen Jungfrau Maria an.«
»Und warum tragen Sie dann keine Tracht?«, wollte der Sekretär der Zweiten Sektion, Erzbischof Monsignore François Tournier, wissen. »Hat Ihre Gemeinschaft etwa keine, Schwester?«
Sein Tonfall war äußerst angriffslustig, aber ich würde mich nicht einschüchtern lassen. Unzählige Male schon hatte ich in den letzten Jahren im Stadtstaat Ähnliches erlebt und tausendundeine Schlacht für meinen Orden geschlagen. Ich blickte ihm fest in die Augen.
»Nein, Monsignore. Meine Kongregation legte sie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ab.«
»Ach ja, das Konzil …«, brummte er mit offenkundigem Missfallen. Monsignore François Tournier war ein gutaussehender Mann, ein wahrer Kirchenfürst, einer dieser Gecken, die auf Fotografien immer gut wirkten. »Ziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet?«, fragte er sich nun laut, auf eine Stelle im ersten Brief des heiligen Paulus an die Korinther anspielend.
»Monsignore«, führte der Präfekt zu meiner Verteidigung an, »Schwester Ottavia hat in Paläographie und Kunstgeschichte promoviert und besitzt darüber hinaus noch weitere akademische Grade. Seit acht Jahren leitet sie das Labor für Restaurierung und Paläographie des Vatikanischen Geheimarchivs, außerdem lehrt sie an der Vatikanischen Schule für Paläographie, Diplomatik und Archivistik und hat für ihre Forschungen bereits zahlreiche internationale Preise erhalten, unter anderem 1992 und 1995 den renommierten Getty Prize.«
»Aha!« Der Kardinalstaatssekretär Sodano schien nun besänftigt und nahm wieder unbefangen neben Tournier Platz. »Also gut … nun, deshalb sind Sie auch hier, Schwester, aus diesem Grund haben wir Sie um Ihre Teilnahme bei dieser Versammlung ersucht.«
Alle blickten mich nun mit unverhohlener Neugier an. Doch ich sprach kein Wort, harrte erst einmal dessen, was da kommen sollte; nicht, dass der Erzbischof auch noch jene Passage des heiligen Paulus zitieren würde, die da lautete: »Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden.« Vermutlich hätte Monsignore Tournier wie auch der Rest der hier Versammelten lieber eine ihrer eigenen beflissenen Ordensschwestern (in ihren Diensten mussten jeweils mindestens drei oder vier davon stehen) vor sich gehabt oder eine der polnischen Schwestern der Liebe vom Kinde Maria, die sich in ihrem Habit mit der dachförmigen Haube um die Verköstigung Seiner Heiligkeit sowie die Reinigung und Pflege seiner Gemächer und Gewänder kümmerten; selbst einer Nonne der Congregazione delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro, der »Schwestern vom Göttlichen Meister«, die in der Telefonzentrale des Vatikans arbeiteten, hätten sie wahrscheinlich den Vorzug gegeben.
»Jetzt, Schwester«, fuhr Seine Eminenz Angelo Sodano fort, »wird Ihnen Erzbischof Monsignore Tournier erklären, warum wir Sie hierherbestellt haben. Guglielmo, komm«, sagte er zum Präfekten, »setz dich neben mich. Monsignore, Sie haben das Wort.«
Mit einer Selbstsicherheit, die nur besitzt, wer weiß, dass sein Äußeres ihm sämtliche Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, stand Monsignore Tournier gleichmütig von seinem Schemel auf und streckte, ohne sich umzublicken, eine Hand nach dem blonden Soldaten aus, der ihm gehorsam ein dickes, schwarz eingebundenes Dossier reichte. Mir blieb fast das Herz stehen, und einen Augenblick lang dachte ich, was auch immer ich falsch gemacht haben mochte, es musste ganz schrecklich sein. Sicherlich würde man mich aus diesem Büro hinauskomplimentieren, mit meinen Entlassungspapieren in Händen.
»In dieser Mappe, Schwester Ottavia«, begann Monsignore Tournier mit tiefer, nasaler Stimme, wobei er es jedoch vermied, mich anzusehen, »werden Sie einige Fotos finden, die man wohl als … nun ja, sagen wir, als ungewöhnlich bezeichnen darf. Bevor Sie sie aber in Augenschein nehmen, sollten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass darauf die Leiche eines erst kürzlich verstorbenen Mannes zu sehen ist, eines Äthiopiers, dessen Identität wir noch nicht mit absoluter Sicherheit kennen. Wie Sie feststellen werden, handelt es sich bei den Aufnahmen um Vergrößerungen verschiedener Körperteile.«
Ach … dann wollte man mich also gar nicht entlassen?
»Vielleicht sollten wir Schwester Ottavia zuerst fragen, ob sie mit solch unangenehmem Material auch arbeiten möchte«, mischte sich der Kardinalvikar von Rom, Seine Eminenz Carlo Colli, erstmals ein. Er schaute mich mit väterlicher Besorgnis an und fuhr dann fort: »Der arme Kerl starb bei einem fürchterlichen Unfall, wobei er entsetzlich verstümmelt wurde. Diese Bilder zu betrachten wird ziemlich widerwärtig sein. Glauben Sie, dass Sie das ertragen können? Falls nicht, brauchen Sie es nur zu sagen.«
Starr vor Staunen stand ich da und hatte das dumpfe Gefühl, dass man mich mit jemandem verwechselte.
»Verzeihung, Eure Eminenzen«, stammelte ich, »aber wäre es nicht ratsamer, einen Gerichtsmediziner zu konsultieren? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wobei ich nützlich sein könnte …«
»Schauen Sie, Schwester«, fiel mir Monsignore François Tournier ins Wort und schritt nun langsam den Kreis seiner Zuhörer ab, »der Mann auf den Fotos war in ein schweres Delikt gegen sämtliche christlichen Kirchen verwickelt. Leider dürfen wir Ihnen nicht mehr Details nennen. Was wir von Ihnen erwarten, ist, dass Sie mit größtmöglicher Diskretion gewisse Zeichen untersuchen, ungewöhnliche Narben, die man auf der Leiche entdeckt hat, als man die Obduktion vornahm. Skarifikation ist, glaube ich, der fachsprachliche Ausdruck für diese … wie soll man sie bezeichnen? … für diese rituellen Narbentätowierungen oder Klanmerkmale. Anscheinend ist es bei bestimmten alten Kulturen Brauch, die Körper mit zeremoniellen Hautritzungen zu schmücken. Die von diesem Unglücksraben hier …« – er schlug die Mappe auf und warf einen Blick auf die Fotografien – »… sind allerdings ziemlich sonderbar: Es sind griechische Buchstaben, Kreuze und andere gleichermaßen … wie soll man es nennen? … künstlerische Darstellungen … ja, zweifellos ist das der richtige Ausdruck dafür: künstlerisch.«
»Was Monsignore Ihnen zu vermitteln versucht«, unterbrach ihn plötzlich Seine Eminenz der Staatssekretär mit einem herzlichen Lächeln auf den Lippen, »ist, dass Sie alle diese Symbole unter die Lupe nehmen und analysieren sollen, um uns danach eine möglichst genaue und ausführliche Deutung davon zu geben. Selbstverständlich stehen Ihnen dafür sämtliche Mittel des Geheimarchivs zur Verfügung. Und natürlich auch die des Vatikans.«
»Auf alle Fälle kann Dottoressa Salina mit meiner uneingeschränkten Unterstützung rechnen«, erklärte der Präfekt des Archivs und blickte beifallheischend in die Runde.
»Wir danken dir für das Angebot, Guglielmo«, stellte Seine Eminenz jedoch klar, »aber Schwester Ottavia wird in diesem Fall nicht unter dir arbeiten. Ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt, aber bis sie ihr Gutachten abgegeben hat, wird sie dem Staatssekretariat unterstehen.«
»Keine Sorge, Euer Hochwürden«, fügte Monsignore Tournier sanft hinzu und vollführte mit der Hand eine Geste eleganter Gleichgültigkeit, »Schwester Ottavia wird ein unschätzbarer Mitarbeiter zur Seite stehen. Darf ich vorstellen: Hauptmann Kaspar Glauser-Röist von der Schweizergarde. Er ist einer der wertvollsten Beamten Seiner Heiligkeit und steht in Diensten der Sacra Rota Romana, des höchsten Kirchengerichts. Er hat die Fotos geschossen und koordiniert die laufende Untersuchung.«
»Eure Eminenzen …«
Es war meine zitternde Stimme, die da um Gehör bat. Die vier Prälaten und der Schweizergardist drehten sich zu mir um.
»Eure Eminenzen«, wiederholte ich mit all der Demut, derer ich fähig war, »ich bin Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet, dass Sie bei einer so wichtigen Mission an mich gedacht haben, aber ich fürchte, ich kann sie nicht übernehmen …« – ich wog jedes einzelne meiner Worte sorgsam ab, bevor ich fortfuhr – »nicht allein, weil ich momentan meine Arbeit nicht im Stich lassen kann, die meine ganze Zeit in Anspruch nimmt, sondern auch, weil mir die nötigen Grundkenntnisse fehlen, um mit der Datenbank des Geheimarchivs umgehen zu können. Zudem wäre ich auf die Hilfe eines Anthropologen angewiesen, um die wichtigsten Aspekte der Untersuchung zu bündeln. Was ich damit sagen will, Eure Eminenzen, … ich … ich fühle mich außerstande, diese Aufgabe zu erfüllen.«
Monsignore Tournier war der Einzige, der auf diese Worte eine Reaktion zeigte. Während die anderen vor Überraschung kein Wort herausbrachten, zeichnete sich auf seinen Lippen ein sarkastisches Lächeln ab, das mich seinen verbissenen Widerstand ahnen ließ, als es darum gegangen war, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich konnte ihn förmlich hören, wie er voller Verachtung protestierte: »Eine Frau …?« Gerade diese spöttische und bissige Art war es wohl, die mich urplötzlich eine Wendung um 180 Grad machen ließ.
»Obwohl, wenn ich es mir recht überlege … ich könnte sie vielleicht doch übernehmen, vorausgesetzt, man gibt mir genügend Zeit dafür.«
Monsignore Tourniers höhnische Grimasse war auf einmal wie weggezaubert, und die Gesichtszüge der anderen entspannten sich; sie seufzten erleichtert. Einer meiner größten Fehler ist mein Stolz, ich gebe es zu, der Stolz in all seinen Variationen von Arroganz über Eitelkeit, Überheblichkeit bis … so sehr ich das auch bereue und versuche, hinreichend Buße dafür zu tun, so bin ich doch nicht imstande, mich von einer Herausforderung, die meine Intelligenz oder mein Wissen in Zweifel stellt, einschüchtern zu lassen oder sie nicht anzunehmen.
»Großartig, dann ist es also beschlossene Sache!«, rief Seine Eminenz der Kardinalstaatssekretär jetzt aus und schlug sich auf die Schenkel. »Das Problem hätten wir gelöst, Gott sei Dank! Von nun an wird Hauptmann Glauser-Röist Ihnen also bei allem mit Rat und Tat zur Seite stehen, Schwester Ottavia. Jeden Morgen wird er Ihnen die Fotos aushändigen und sie bei Feierabend wieder an sich nehmen. Haben Sie noch Fragen, bevor Sie sich an die Arbeit machen?«
»Ja«, erwiderte ich befremdet. »Darf der Hauptmann denn mit in das Geheimarchiv? Unbefugten ist der Zutritt verboten, und er ist kein Geistlicher, und …«
»Natürlich darf er, Dottoressa!«, fiel mir der Präfekt Ramondino ins Wort. »Ich selbst werde ihm die Vollmacht ausstellen; noch heute Nachmittag wird sein Ausweis fertig sein.«
Ein Zinnsoldat (was sonst waren sie denn, diese Schweizergardisten?) war im Begriff, mit einer ehernen, jahrhundertealten Tradition zu brechen.
Ich aß in der Kantine des Archivs zu Mittag und verwendete den Rest des Tages darauf, alles, was sich auf meinem Labortisch befand, wegzuräumen. Meine Untersuchung des ›Panegyrikon‹ auf die lange Bank zu schieben, ärgerte mich mehr, als ich mir eingestehen wollte, doch war ich nun einmal in meine eigene Falle getappt. Nun denn, jedenfalls hätte ich mich einem direkten Befehl des Kardinalstaatssekretärs ohnehin nicht widersetzen können. Außerdem war ich schon so gespannt, was es mit dem Auftrag auf sich hatte, dass ich das leichte Kribbeln einer ruchlosen Neugier in den Fingern spürte.
Als alles so weit in Ordnung war, dass ich die neue Aufgabe am nächsten Morgen beruhigt angehen konnte, suchte ich meine Siebensachen zusammen und ging. Unter den Bernini-Kolonnaden hindurch schlenderte ich gedankenverloren über den Petersplatz zur Via di Porta Angelica, vorbei an den zahlreichen Souvenirläden, in denen sich noch immer die Touristenmassen drängten, welche wegen des Heiligen Jahrs nach Rom gekommen waren. Wir Angestellte des Vatikans kannten zwar fast alle Taschendiebe des Borgo, doch hatte sich ihre Zahl seit Beginn des Heiliges Jahres – allein in den ersten zehn Januartagen waren drei Millionen Menschen in die Stadt geströmt – sprunghaft erhöht; das Jubiläum hatte Gelegenheitsdiebe aus ganz Italien angelockt. Daher umklammerte ich meine Tasche fest und beschleunigte meine Schritte. Das Abendlicht wurde im Westen langsam schummrig, und da die Dämmerung mir von jeher etwas unheimlich war, hatte ich es eilig, nach Hause zu kommen. Es war nicht mehr weit, denn zum Glück war unsere Mutter Oberin der Auffassung gewesen, dass der Kauf einer Wohnung in der unmittelbaren Nähe des Vatikans sehr wohl gerechtfertigt sei, wenn eine ihrer Schwestern eine so hohe Position bekleidete. Daher teilte ich mit drei Mitschwestern ein winziges Appartement an der Piazza delle Vaschette, von dem aus man einen Blick auf den von Francesco Buffa geschaffenen Brunnen hatte, der vormals, als er noch an der Porta Angelica stand, von Engelswasser gespeist worden war, dem man bei Magenbeschwerden große Heilkraft zuschrieb.
Ferma, Margherita und Valeria unterrichteten an einer öffentlichen Schule in der Umgebung und waren kurz vor mir nach Hause gekommen. Sie standen in der Küche und bereiteten das Abendessen zu, während sie lebhaft über irgendwelche Nichtigkeiten plauderten. Ferma, mit ihren 55 Jahren die Älteste, hielt starrköpfig an einer einheitlichen Kleidung fest – weiße Bluse, marineblaue Strickjacke, einen bis unter die Knie reichenden Rock derselben Farbe und grobe schwarze Strümpfe –, die sie seit dem Ablegen der Ordenstracht trug. Margherita stand unserer kleinen Schwesterngemeinschaft vor und war die Direktorin der Schule, in der die drei arbeiteten. Sie war nur ein paar Jahre älter als ich, und im Laufe der Jahre hatte sich die anfängliche Distanz zwischen uns in Zuneigung und die Zuneigung in Freundschaft gewandelt, jedoch ohne allzu sehr in die Tiefe zu gehen. Und schließlich gab es noch die junge Valeria aus Mailand. Sie unterrichtete die Kleinsten in der Schule, die Vier- bis Fünfjährigen, bei denen allmählich die Kinder von arabischen und asiatischen Emigranten überhandnahmen, was im Klassenzimmer allerlei Verständigungsprobleme mit sich brachte. Erst neulich hatte ich sie einen dicken Wälzer über Sitten und Religionen anderer Kontinente lesen sehen.
Die drei nahmen auf meine Arbeit im Vatikan sehr viel Rücksicht. Allerdings wussten sie auch nicht so genau, womit ich mich dort eigentlich tagein, tagaus beschäftigte; sie wussten nur, dass sie mich nicht darüber ausfragen durften (ich vermute, dass unsere Mutter Oberin sie aufs Eindringlichste davor gewarnt hatte), da ich laut einer unmissverständlichen Klausel in meinem Arbeitsvertrag zum Stillschweigen gegenüber Unbefugten verpflichtet war und bei Zuwiderhandlung mit dem Ausschluss aus der Kirche bestraft würde. Hin und wieder erzählte ich ihnen trotzdem, wenn auch nicht im Detail, was wir über die ersten christlichen Gemeinden oder die Anfänge der Kirche herausgefunden hatten, da ich wusste, dass sie ihre Freude daran hatten. Natürlich offenbarte ich ihnen nur die positiven Dinge, das, was man preisgeben konnte, ohne die offizielle Geschichtsschreibung oder die Grundpfeiler des Glaubens zu unterminieren. Wozu sollte ich ihnen zum Beispiel schildern, dass Irenäus von Lyon, einer der Kirchenväter, in einem Schreiben aus dem Jahr 138 n.Chr. als ersten Papst Linus anführte und nicht Petrus, der nicht einmal erwähnt wurde? Oder dass im Catalogus Liberianus, dem sogenannten ›Chronographen vom Jahre 354‹, das Verzeichnis der Päpste gefälscht war und die darin aufgelisteten, vermeintlich ersten Pontifizes (Anaclet I., Clemens I., Evaristus, Alexander I.) nicht einmal existiert hatten? Wozu sollte ich ihnen das alles erzählen? Wozu ihnen beispielsweise erklären, dass die vier Evangelien erst nach den Paulus-Briefen entstanden waren und deshalb den Lehrmeinungen des wahrhaften Begründers unserer Kirche folgten und nicht umgekehrt, wie dies die ganze Welt annahm? Meine Zweifel und Ängste, die Ferma, Margherita und Valeria intuitiv erfassten, meine große Pein und mein Ringen mit mir waren ein Geheimnis, das ich nur mit meinem Beichtvater, Franziskanerpater Egilberto Pintonello, teilen durfte, zu dem alle gingen, die im dritten und vierten Untergeschoss des Vatikanischen Geheimarchivs arbeiteten.
Nachdem wir das Essen in den Ofen geschoben und den Tisch gedeckt hatten, ging ich mit meinen drei Mitschwestern in die Hauskapelle, wo wir uns auf die auf dem Boden verstreuten Kissen um das Tabernakel herum knieten, vor dem ein kleines Ewiges Licht brannte. Gemeinsam beteten wir die Schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes, und danach hing jede im stillen Gebet ihren Gedanken nach. Wir befanden uns mitten in der Fastenzeit, und auf Anraten von Pater Pintonello meditierte ich dieser Tage über die Stelle im Evangelium, derzufolge Jesus in der Wüste vierzig Tage gefastet und sich den Versuchungen des Teufels gestellt hatte. Die Passage gehörte nicht gerade zu meinen liebsten Bibelstellen, doch konnte ich mich von jeher am Riemen reißen, und nie wäre es mir in den Sinn gekommen, mich einer Anordnung meines Beichtvaters zu widersetzen.
Während ich betete, ging mir die Unterredung vom Mittag allerdings nicht aus dem Sinn. Ich fragte mich, ob ich eine Aufgabe meistern konnte, zu der man mir Informationen vorenthielt, zumal es eine ziemlich merkwürdige Geschichte war. Der Mann auf den Fotos, hatte Monsignore Tournier gesagt, war in ein schweres Delikt gegen sämtliche christlichen Kirchen verwickelt. Leider dürfen wir Ihnen nicht mehr Details nennen.
In dieser Nacht hatte ich schreckliche Alpträume, in denen ein übel zugerichteter Mann ohne Kopf – wohl die Reinkarnation des Bösen – mir an allen Ecken einer langen Straße auflauerte, die ich wie betrunken entlangstolperte, und mich mit der Macht und dem Ruhm aller Königreiche dieser Welt in Versuchung führen wollte.
Punkt acht Uhr morgens klingelte es stürmisch an unserer Haustür. Margherita ging in den Flur zur Gegensprechanlage und kam kurz darauf mit verdutztem Gesicht in die Küche zurück.
»Ottavia, unten wartet ein gewisser Kaspar Glauser auf dich.«
Ich war wie versteinert.
»Hauptmann Glauser-Röist?«, stammelte ich mit dem Mund voller Kekse.
»Ob er Hauptmann ist, hat er nicht gesagt«, stellte Margherita klar, »aber der Name stimmt.«
Ich schluckte den Keks hinunter und trank in einem Schluck meinen Milchkaffee leer.
»Das betrifft die Arbeit …«, entschuldigte ich mich und stürmte unter dem überraschten Blick meiner Mitschwestern aus der Küche.
Die Wohnung an der Piazza delle Vaschette war zum Glück so klein, dass ich im Handumdrehen mein Bett gemacht und das Zimmer aufgeräumt hatte und auch noch kurz Zeit fand, mich vor unserem Hausaltar zu bekreuzigen. In fliegender Hast riss ich dann in der Diele meinen Mantel und meine Tasche vom Haken und zog völlig verwirrt die Tür hinter mir zu. Warum wartete Hauptmann Glauser-Röist auf mich? War irgendetwas passiert?
Die Augen unergründlich hinter einer dunklen Brille verborgen, lehnte der stämmige Zinnsoldat gegen die Tür eines dunkelblauen Alfa Romeo. In Rom ist es üblich, den Wagen immer direkt vor der Tür zu parken, egal, ob man damit den Verkehr behindert oder nicht. Jeder gute Römer wird einem nachsichtig erklären, dass man so keine Zeit verliert. Wenn Hauptmann Glauser-Röist, der ja Schweizer Staatsbürger war – Voraussetzung für den Eintritt in das kleine vatikanische Korps –, die schlechtesten Angewohnheiten der Römer mit so viel Gelassenheit praktizierte, so musste er wohl schon etliche Jahre in der Stadt leben. Gleichgültig gegenüber dem Aufsehen, welches er bei den Nachbarn im Borgo erregt hatte, verzog der Hauptmann keine Miene, als ich endlich auf die Straße trat. Im unbarmherzigen Sonnenlicht freute es mich dann festzustellen, dass es mit der Muskelkraft des stattlichen Schweizer Soldaten doch nicht ganz so weit her war. Die Zeit hatte auch in seinem trügerisch jugendlichen Gesicht ihre Spuren hinterlassen, und in den Augenwinkeln zeichneten sich erste kleine Fältchen ab.
»Guten Morgen«, begrüßte ich ihn und knöpfte mir den Mantel zu. »Ist irgendetwas passiert?«
»Guten Morgen, Dottoressa«, entgegnete er in einwandfreiem Italienisch; die Aussprache des »R« verriet jedoch eine gewisse helvetische Färbung. »Seit sechs Uhr schon warte ich vor dem Archiv auf Sie.«
»Warum denn so früh, Herr Hauptmann?«
»Ich dachte, Sie würden um diese Zeit anfangen zu arbeiten.«
»Für gewöhnlich beginne ich um acht Uhr«, brummte ich unwillig.
Der Hauptmann warf einen gleichgültigen Blick auf seine Armbanduhr.
»Es ist bereits zehn nach acht«, verkündete er so kalt und sympathisch wie ein Felsklotz.
»Ach ja? … Na, dann lassen Sie uns fahren.«
Dieser Mann konnte einen zur Weißglut treiben! Wusste er etwa nicht, dass man als Vorgesetzter grundsätzlich immer zu spät kommt? Das war schließlich Teil unserer Privilegien.
Der Alfa Romeo raste durch die Gassen des Borgo, denn der Hauptmann hatte sich auch den selbstmörderischen Fahrstil der Römer zu eigen gemacht. Bevor ich noch ein Stoßgebet zum Himmel schicken konnte, fuhren wir auch schon durch die Porta Sant’Anna an den Kasernen der Schweizergarde vorbei. Dass ich nicht aufschrie und mich während der Fahrt aus dem Wagen stürzen wollte, verdankte ich einzig und allein meiner sizilianischen Herkunft, das heißt, der Tatsache, dass ich als junges Mädchen meinen Führerschein in Palermo gemacht hatte, wo die Verkehrszeichen bloß schmückendes Beiwerk waren und sich alles ausschließlich nach den Motorstärken, dem Gebrauch der Hupe und dem gesunden Menschenverstand richtete. Jäh bog der Hauptmann nun in einen Parkplatz ein, den ein Schild mit seinem Namen zierte, und stellte gutgelaunt den Motor ab. Es war der erste menschliche Zug, der mir an ihm auffiel: Offenbar machte ihm Autofahren Spaß. Auf dem Weg zum Archiv kamen wir dann an Orten vorbei, von deren Existenz ich nicht das Mindeste geahnt hatte, wie beispielsweise einem Fitnessraum mit den modernsten Kraftgeräten oder einem Schießplatz, und alle Schweizergardisten, denen wir begegneten, nahmen vor Glauser-Röist Haltung an und salutierten.
Eines der Dinge, die über die Jahre meine Neugier angestachelt hatten, war die Herkunft der auffällig bunten Uniformen der Schweizergarde. Leider fand sich in den im Geheimarchiv katalogisierten Dokumenten nichts, was bewies oder widerlegte, dass sie, wie allgemein behauptet, von Michelangelo entworfen worden waren, doch vertraute ich fest darauf, dass eines Tages, wenn man es am wenigsten erwartete, besagter Nachweis unter den Bergen noch unerforschter Archivalien zum Vorschein käme. In jedem Fall schien Glauser-Röist im Gegensatz zu seinen Kameraden nie Uniform zu tragen, denn beide Male war er bisher in Zivil und überdies sehr teuer gekleidet gewesen, meiner Ansicht nach zu teuer für den mageren Sold eines einfachen Schweizergardisten.
Vorbei am noch geschlossenen Büro des Präfekten, Hochwürden Ramondino, durchquerten wir schweigend den Eingangsbereich des Geheimarchivs und betraten dann gemeinsam den Fahrstuhl. Glauser-Röist steckte seinen nagelneuen Schlüssel in die Schalttafel.
»Haben Sie die Fotos dabei, Hauptmann?«, fragte ich neugierig, während wir zum Hypogäum hinabfuhren.
»Sicher, Dottoressa.« Er bekam für mich immer mehr Ähnlichkeit mit einem schroffen Felsen. Wo hatte der Vatikan wohl solch einen Kerl aufgegabelt?
»Dann fangen wir vermutlich gleich an zu arbeiten, nicht wahr?«
»Auf der Stelle.«
Meine Mitarbeiter sahen Glauser-Röist mit offenem Mund hinterher, als er durch den Flur zu meinem Labor schritt. Der Tisch von Guido Buzzonetti wirkte an jenem Morgen schrecklich leer.
»Guten Morgen«, rief ich laut.
»Guten Morgen, Dottoressa«, murmelte irgendjemand pflichtschuldig.
Zwar begleitete uns eisiges Schweigen bis zu meinem Büro, doch der Schrei, den ich ausstieß, als ich die Tür öffnete, war mindestens bis zum Forum Romanum zu hören.
»O mein Gott! Was ist denn hier passiert?«
Mein alter Schreibtisch war erbarmungslos in eine Ecke geschoben worden. An seiner Stelle stand nun ein Metalltisch mit einem riesigen Computer mitten im Raum. Noch mehr Computerkram hatte man auf kleine Acryltischchen gestellt, die aus irgendeinem unbenutzten Büro herbeigeschafft worden waren, und Dutzende von Kabeln liefen quer über den Boden zu den zahlreichen Mehrfachsteckern oder hingen von den Brettern meiner alten Regale herab.
Entsetzt schlug ich die Hände vor den Mund und betrat den Raum wie auf Eiern, als bewege ich mich zwischen lauter Schlangennestern.
»Wir werden diese ganze Ausrüstung zum Arbeiten brauchen«, verkündete der Felsen hinter mir.
»Das will ich hoffen, Hauptmann! Wer hat Ihnen eigentlich die Erlaubnis gegeben, in meinem Labor ein solches Chaos anzurichten?«
»Präfekt Ramondino.«
»Also, Sie hätten mich wirklich fragen können!«
»Wir haben die EDV-Anlage gestern Nacht aufgebaut, als Sie schon weg waren.« In seiner Stimme lag nicht einmal ein Hauch von Bedauern oder Zerknirschung; er beschränkte sich darauf, mich zu informieren und Punktum, als ob sein Handeln über jede Diskussion erhaben wäre.
»Wunderbar! Wirklich wunderbar!«, zischte ich grimmig.
»Wollen Sie nun anfangen oder nicht?«
Ich schnellte herum, als ob er mir eine schallende Ohrfeige gegeben hätte, und blickte ihn mit all der Verachtung an, derer ich fähig war.
»Je schneller wir es hinter uns bringen, umso besser.«
»Wie Sie wünschen«, brummte er. Er knöpfte sich das Sakko auf und zog aus einem mir völlig unverständlichen Ort das dicke Dossier mit den schwarzen Aktendeckeln heraus, das mir Monsignore Tournier am Tag zuvor gezeigt hatte. »Das hier gehört ganz Ihnen«, sagte er und streckte es mir hin.
»Und was tun Sie inzwischen?«
»Ich werde mich vor den Computer setzen.«
»Wozu?«, fragte ich befremdet. Was meine Computerkenntnisse betraf, so war ich die reinste Analphabetin. Mir war bewusst, dass ich dieses Problem eines Tages angehen musste, doch im Augenblick war mir als anständiger Gelehrten noch sehr wohl dabei, über das ganze Teufelszeug die Nase zu rümpfen.
»Um jeden aufkommenden Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und um Ihnen alle nötigen Informationen über jedes gewünschte Thema zu beschaffen.«
Und dabei blieb es.
Ich machte mich also daran, die Fotos zu sichten. Es waren etliche, dreißig, um genau zu sein, durchnummeriert und chronologisch geordnet von Anfang bis Ende der Obduktion. Nachdem ich sie alle einmal flüchtig durchgeblättert hatte, suchte ich diejenigen heraus, auf denen man die Leiche des Äthiopiers in Bauch- oder Rückenlage sehen konnte. Auf den ersten Blick sprang besonders der unnatürliche Winkel seiner Beine ins Auge, was auf einen Bruch der Beckenknochen hinwies, aber auch eine schreckliche Kopfverletzung am rechten Scheitelbein, welche zwischen Knochensplittern die graue Substanz des Gehirns freigelegt hatte. Die restlichen Bilder sonderte ich aus; zwar musste die Leiche zahlreiche innere Verletzungen haben, doch weder wusste ich sie zu diagnostizieren, noch schienen sie für meine Arbeit relevant zu sein. Mir entging jedoch nicht, dass er sich womöglich während des Aufpralls auf die Zunge gebissen hatte.
Der Tote wäre niemals als etwas anderes durchgegangen, als das, was er war. Seine Physiognomie ließ keine Zweifel aufkommen: Wie die meisten Äthiopier war er äußerst hager und lang aufgeschossen, sein Körper war straff und sehnig und von extrem dunkler Hautfarbe. Der untrügliche Beweis für seine abessinische Herkunft waren jedoch seine Gesichtszüge: hohe und stark ausgeprägte Wangenknochen, eingefallene Backen, große schwarze Augen – die auf den Fotos noch offenstanden, was sehr wirkungsvoll war –, eine breite, knochige Stirn, wulstige Lippen und eine feine Nase von fast griechischem Profil. Bevor man ihm den unversehrt gebliebenen Teil seines Kopfes rasiert hatte, war sein blutverkrustetes Haar spröde und kraus gewesen; nach der Rasur konnte man mitten auf dem Schädel eine feine Narbe entdecken in Form des griechischen Buchstabens Sigma: Σ.
An besagtem Vormittag tat ich nichts anderes, als ein ums andere Mal die schrecklichen Bilder zu betrachten und jedes Detail genauestens unter die Lupe zu nehmen, das mir bedeutsam erschien. Wie Straßen auf einer Landkarte hoben sich die seltsamen Narben von der Haut ab. Einige, sehr hässliche, waren fleischig und wulstig, andere wiederum kaum sichtbar, so filigran wie Seidenfäden, doch alle zeigten ohne Ausnahme eine rosige Färbung, die an einigen Stellen sogar ins Rötliche ging, so als ob weiße auf schwarze Haut verpflanzt worden wäre. Ein widerlicher Anblick.
Am frühen Abend rauchte mir der Kopf, und es war mir ganz flau im Magen. Auf dem Tisch häuften sich die Notizen und Skizzen zu den Narbentätowierungen des Toten. Noch sechs weitere griechische Buchstaben hatte ich über den Körper verteilt gefunden: auf dem Bizeps des rechten Arms ein Tau (Τ), auf dem linken ein Ypsilon (Y), mitten auf der Brust über dem Herzen ein Alpha (A), auf dem Unterleib ein Rho (P), auf dem rechten Oberschenkel über dem Quadrizeps ein Omikron (O) und auf dem linken an derselben Stelle ein zweites Sigma (Σ). Direkt unter dem Alpha und über dem Rho, etwa auf der Höhe des Magens, war ein großes Christusmonogramm zu sehen, wie man es von den Tympana und Altären mittelalterlicher Kirchen kannte. Wie üblich bestand es aus den beiden griechischen Anfangsbuchstaben von Christi Namen, Chi und Rho (X und P), allerdings wies dieses Christusmonogramm eine Besonderheit auf: Die beiden Buchstaben hatte man ineinandergefügt und dabei das Rho mit einem Längsbalken verlängert, so dass ein Kreuz entstanden war. Einmal abgesehen von den Händen, den Füßen, den Pobacken, dem Hals und dem Gesicht, war der übrige Körper voller Kreuze in den originellsten Formen, die ich je gesehen hatte.
Hauptmann Glauser-Röist verbrachte indessen viel Zeit vor seinem Computer und tippte unermüdlich mysteriöse Befehle ein. Hin und wieder rückte er seinen Stuhl an den meinen heran und verfolgte schweigend die Fortschritte meiner Untersuchung. Deshalb zuckte ich erschreckt zusammen, als er mich plötzlich fragte, ob mir der Umriss eines Menschen in Lebensgröße von Nutzen wäre, ich könne darauf die Narben einzeichnen. Um meine schmerzenden Nackenmuskeln zu lockern, bewegte ich den Kopf ein paarmal nach oben und unten, drehte ihn nach links und rechts.
»Das ist eine gute Idee. Ach übrigens, Hauptmann, inwieweit sind Sie eigentlich befugt, mir Auskünfte über diesen armen Kerl zu geben? Monsignore Tournier hat erzählt, dass Sie diese Fotos gemacht haben.«
Glauser-Röist stand auf und wandte sich wieder zu seinem Computer.
»Dazu darf ich Ihnen nichts sagen.«
Schnell drückte er auf ein paar Tasten, und augenblicklich begann der Drucker zu rattern und große Mengen Papier auszuspucken.
»Ich müsste schon etwas mehr wissen«, protestierte ich und rieb mir die Nasenwurzel unter der Brille. »Vielleicht kennen Sie ja Details, die mir die Arbeit erleichtern würden.«
Glauser-Röist ließ sich durch meine Bitten nicht erweichen. Mit den Zähnen riss er Streifen vom Tesafilm ab und klebte damit die Blätter aus dem Drucker hinten auf die Tür – der noch einzig freien Stelle in meinem kleinen Labor –, bis die gesamte Silhouette eines Menschen zusammengesetzt war.
»Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?«, fragte er dann und drehte sich zu mir um.
Ich sah ihn herablassend an.
»Können Sie von diesem Computer aus auch die Datenbank des Geheimarchivs einsehen?«
»Mit diesem Computer hier komme ich in sämtliche Datenbanken der Welt. Was wollen Sie wissen?«
»Alles, was Sie über Skarifikationen finden können.«
Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren, machte er sich ans Werk. Währenddessen holte ich eine Handvoll bunte Filzstifte aus meiner Schreibtischschublade und baute mich voller Tatendrang vor dem Umriss des Toten auf. Nach einer halben Stunde hatte ich darauf ziemlich genau die traurige Weltkarte seiner Narben rekonstruiert, wobei ich mich wiederholt fragte, warum ein gesunder, kräftiger Mann um die dreißig sich so hatte foltern lassen. Das war wirklich äußerst merkwürdig.
Außer den griechischen Buchstaben hatte ich sieben wunderschöne, völlig unterschiedliche Kreuze gefunden: ein Passionskreuz auf der Innenseite des rechten Unterarms, ein Griechisches Kreuz (mit dem Querbalken genau in der Mitte) auf dem linken Unterarm, ein Schächerkreuz im Nacken, ein ägyptisches Henkelkreuz auf der Wirbelsäule, ein Ankerkreuz in der Lendengegend und schließlich, um die Sieben vollzumachen, zwei sogenannte Andreaskreuze, die auf der Rückseite der Oberschenkel eintätowiert waren. Es war eine erstaunliche Vielfalt, dennoch hatten alle etwas gemeinsam: Alle waren von Rechtecken umrahmt, die wie kleine Fenster oder mittelalterliche Schießscharten aussahen, und darüber war eine kleine siebenzackige Krone zu sehen.
Gegen 21 Uhr waren wir hundemüde. Glauser-Röist hatte über Skarifikationen gerade mal ein paar dürftige Informationen gefunden. Er erläuterte mir kurz, dass es sich um eine rituelle Praxis handle, die vor allem in einer bestimmten Gegend von Zentralafrika verbreitet sei, das Äthiopien aber zu unserem Leidwesen nicht umfasse. Dort würden mit kleinen messerscharfen Knochen Schnitte in die Haut gesetzt. Allem Anschein nach rieben die Naturvölker die Wunden dann mit einer bestimmten Kräutertinktur ein und verlangsamten so den Heilungsprozess, damit sich an den Rändern dicke Wülste bilden konnten. Die dekorativen Muster könnten sehr kompliziert sein, erklärte er weiter, doch entsprächen sie im Wesentlichen geometrischen Formen aus der religiösen Symbologie und würden sich oftmals auf irgendeinen Ritus beziehen.
»Ist das alles?«, fragte ich enttäuscht, als er nach dem kärglichen Bericht verstummte.
»Also … es gibt da noch etwas, aber es ist nicht sonderlich bezeichnend. Die Keloide, das heißt die richtig dicken, wulstigen Narben, mit denen sich die Frauen oft schmücken, üben einen starken sexuellen Reiz auf die Männer aus.«
»Na so was«, meinte ich befremdet. »Sachen gibt’s! Darauf wäre ich nie gekommen!«
»Nun …«, fuhr er gleichgültig fort, »… wir wissen also nach wie vor nicht, wie der Tote zu den Narben auf seinem Körper gekommen ist.« Damals, glaube ich, war mir zum ersten Mal aufgefallen, dass seine Augen von einem verwaschenen Grau waren. »Es gibt da übrigens noch etwas, das zwar interessant, für unsere Arbeit allerdings genauso irrelevant ist: In letzter Zeit ist diese Art von Körperschmuck in vielen Ländern bei den Jugendlichen in Mode. Sie nennen es body art oder performance art, und einer ihrer größten Anhänger ist der Sänger und Schauspieler David Bowie.«
»Nicht zu fassen!«, seufzte ich, und ein Lächeln huschte über mein Gesicht. »Wollen Sie damit sagen, dass sie sich nur so aus Spaß an der Freude verunstalten lassen?«
»Also …«, murmelte er, wohl ähnlich verwirrt wie ich, »… es hat wohl etwas mit Erotik und Sinnlichkeit zu tun, doch wüsste ich es Ihnen nicht zu erklären.«
»Versuchen Sie es auch gar nicht erst …« Ich stand auf. »Lassen Sie uns schlafen gehen, Hauptmann. Morgen wird es wieder ein langer Tag werden.«
»Erlauben Sie, dass ich Sie nach Hause bringe? Um diese Zeit sollten Sie nicht mehr allein durch den Borgo spazieren.«
Ich war viel zu müde, um sein Angebot auszuschlagen, weshalb ich also erneut mein Leben in jenem spektakulären Schlitten aufs Spiel setzte. Vor unserer Haustür bedankte ich mich artig; ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn so schlecht behandelt hatte, doch war es gleich wieder verflogen. Höflich lehnte ich seinen Vorschlag ab, mich am nächsten Morgen wieder abzuholen. Da ich schon zwei Tage keine Messe mehr gehört hatte, war ich nicht gewillt, noch einen weiteren darüber verstreichen zu lassen. Ich würde eben früh aufstehen, um noch vor der Arbeit in die Kirche Santi Michele e Magno zu gehen.
Ferma, Margherita und Valeria sahen sich im Fernsehen gerade einen alten Film an, als ich hereinkam. Fürsorglich hatten sie mir das Abendessen in die Mikrowelle gestellt. Ich aß, wenn auch lustlos, einen Teller Suppe. Ich hatte an diesem Tag einfach zu viele Narben gesehen. Vor dem Schlafengehen zog ich mich noch kurz in die Hauskapelle zurück. Aber an diesem Abend konnte ich mich nicht auf das Gebet konzentrieren: nicht nur, weil ich viel zu müde war, sondern weil es just an diesem Abend dreien meiner acht Geschwister einfiel, mich aus Sizilien anzurufen und sich zu erkundigen, ob ich zu dem Fest kommen würde, das wir wie jedes Jahr am Josefstag, dem Namenstag unseres Vaters Giuseppe, für ihn ausrichteten. Ich sagte allen dreien zu und ging dann gereizt zu Bett.
In den folgenden Wochen arbeiteten Hauptmann Glauser-Röist und ich mit Hochdruck. Ohne einen Tag auszusetzen, gingen wir in meinem Labor von acht Uhr morgens bis neun Uhr abends immer wieder die spärlichen Informationen durch und werteten aus, was wir nach und nach aus den Archiven erhielten. Die griechischen Buchstaben und das Christusmonogramm zu entschlüsseln erwies sich dabei als relativ einfach im Vergleich zu der unendlich großen Mühe, die wir mit dem Rätsel um die sieben Kreuze hatten.
Kaum hatte ich am zweiten Tag mein Labor betreten und die Tür hinter mir geschlossen, um einmal mehr die Papiersilhouette zu betrachten, da sprang mir auch schon die Lösung der griechischen Buchstaben ins Auge. Heureka! Es war so offensichtlich, dass ich nicht glauben konnte, es nicht tags zuvor entdeckt zu haben, auch wenn es durchaus verständlich schien, wenn ich bedachte, wie müde ich gewesen war: Von oben nach unten und von rechts nach links gelesen, bildeten die sieben Buchstaben das griechische Wort STAUROS (ΣTAYPOΣ), was so viel hieß wie »Kreuz«. Nun war es unbestreitbar, dass alles, was auf unserer Leiche zu sehen war, miteinander in Beziehung stand.
Einige Tage später, nachdem wir etliche Male erfolglos die Geschichte des alten Abessiniens (und heutigen Äthiopiens) durchgearbeitet und die verschiedensten Unterlagen über die griechischen Einflüsse auf die Kultur und Religion jenes Landes studiert hatten, nachdem wir viele Stunden eifrig ausführliche Dossiers über Sekten aus den verschiedenen Abteilungen des Geheimarchivs und Dutzende von Kunstbüchern zu sämtlichen Epochen und Stilrichtungen gewälzt und schließlich auch noch die erschöpfenden Berichte über Christusmonogramme ausgewertet hatten, welche wir den Computerrecherchen des Hauptmanns verdankten, machten wir eine weitere bedeutsame Entdeckung: Das Christusmonogramm, das der Äthiopier auf seiner Brust trug, entsprach einer Variante, die man unter dem Namen »Konstantinisches Kreuz« kannte und die nach dem 6. Jahrhundert aus der christlichen Kunst verschwunden war.
So überraschend es auch klingen mag, das Kreuz war in den Anfängen des Christentums zunächst keineswegs verehrt worden. Für die sinnbildliche Darstellung ihrer Religion zogen die ersten Christen fröhlichere Dinge dem Symbol des Leidens Christi vor. Während der römischen Christenverfolgungen – die sich in Grenzen hielten, weil sie nicht systematisch durchgeführt wurden und sich im Großen und Ganzen auf die Ausschreitungen unter Nero nach dem Brand Roms im Jahr 64 und, dem Kirchenhistoriker Eusebius zufolge, auf die beiden Jahre der sogenannten großen Diokletianischen Christenverfolgung von 303/304 beschränkten – wäre die Zurschaustellung und Verehrung des Kreuzes zudem äußerst gefährlich gewesen. Darum waren auf den Wänden der Katakomben und Häuser, auf den Grabplatten, den persönlichen Gegenständen und den Altären lediglich Symbole wie das Lamm, der Fisch, der Anker oder die Taube zu finden.
Das wichtigste Symbol für sie war jedoch das Christusmonogramm, das aus den griechischen Anfangsbuchstaben gebildete Symbol für den Namen Christi, mit dem man häufig geweihte Orte verzierte. Es gab zahlreiche Varianten des Monogramms, je nachdem, was für eine religiöse Deutung man ihm geben wollte: So waren auf den Grabmälern der Märtyrer zum Beispiel Christusmonogramme mit einem Palmenzweig anstelle des Buchstabens P eingemeißelt, was den Sieg Christi symbolisieren sollte, und wenn sie in der Mitte ein Dreieck hatten, so stellte dies ein Sinnbild für die Heilige Dreifaltigkeit dar.
Im Jahr 312 unserer Zeitrechnung hatte Konstantin der Große in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht gegen Maxentius, seinen Hauptkontrahenten um den Kaiserthron, einen Traum: Darin erschien ihm Christus und befahl, die beiden Buchstaben XP auf die Schilder seines Heeres malen zu lassen. Die Legende lässt Konstantin – der eigentlich den Sonnengott anbetete – dann am folgenden Tag kurz vor dem Kampf über der blendenden Sonne erneut besagtes Christusmonogramm sehen und darunter das griechische EN-TOUTOI-NIKA, besser bekannt in der lateinischen Übersetzung In hoc signo vinces: »Mit diesem Zeichen wirst du siegen.« Nachdem Konstantin Maxentius bei der Schlacht an der Milvischen Brücke vernichtend geschlagen hatte, machte er dieses Christusmonogramm zu seinem Feldzeichen und kaiserlichen Banner, das man, umrahmt von einem aus Gold und Edelsteinen geflochtenen Kranz, vom Jahre 324 an Labarum