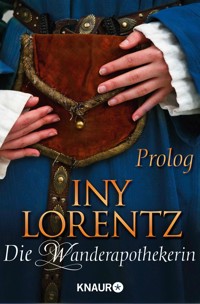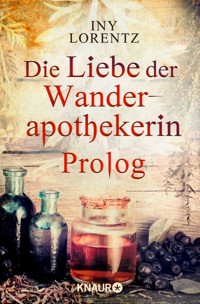9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Teil 9 der historischen Bestseller-Serie um die Wanderhure Marie: In Iny Lorentzʼ Mittelalter-Roman »Die junge Wanderhure« erfahren wir endlich, wie aus der hilflosen Kaufmannstochter Marie Schärer die mutige Frau wurde, die ihr Schicksal aus eigener Kraft wendet. Konstanz im Jahr 1410: Nach dem bitteren Verrat durch ihren adligen Verlobten, der nur an ihr Vermögen wollte, wird die schöne Kaufmannstochter Marie entehrt und schwer verletzt aus der Stadt gejagt. Die Wanderhure Hiltrud findet sie und nimmt sich ihrer an. Zunächst sehnt Marie den Tod herbei, um all die Not und das Elend hinter sich lassen zu können. Mit der Zeit begreift sie aber, dass ihr Tod den endgültigen Triumph ihrer Feinde bedeuten würde. Um sich die Hoffnung auf Vergeltung zu erhalten, beschließt Marie, nicht aufzugeben, auch wenn sie dafür ihren Körper verkaufen und ein Leben in Schande führen muss. In den drei Jahren, die nun folgen, geht Marie förmlich durch die Hölle. Ihr Lebenswille ist jedoch stark genug, um alles zu ertragen, denn sie weiß eines. Der Tag wird kommen, an dem sie ihren Peinigern erneut gegenübertreten und endlich Rache nehmen kann … »Die Wanderhuren-Reihe« ist die erfolgreichste historische Serie aus dem deutschen Mittelalter. Dramatisch, hochspannend und emotional lässt uns Bestseller-Autorin Iny Lorentz am Schicksal der Wanderhure Marie teilhaben. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Iny Lorentz
Die junge Wanderhure
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Konstanz im Jahr 1410: Nach dem bitteren Verrat durch ihren adligen Verlobten, der nur an ihr Vermögen wollte, wird die schöne Kaufmannstochter Marie entehrt und schwer verletzt aus der Stadt gejagt. Die Wanderhure Hiltrud findet sie und nimmt sich ihrer an. Zunächst sehnt Marie den Tod herbei, um all die Not und das Elend hinter sich lassen zu können. Mit der Zeit begreift sie aber, dass ihr Tod den endgültigen Triumph ihrer Feinde bedeuten würde. Um sich die Hoffnung auf Vergeltung zu erhalten, beschließt Marie, nicht aufzugeben, auch wenn sie dafür ihren Körper verkaufen und ein Leben in Schande führen muss.
In den drei Jahren, die nun folgen, geht Marie förmlich durch die Hölle. Ihr Lebenswille ist jedoch stark genug, um alles zu ertragen, denn sie weiß eines. Der Tag wird kommen, an dem sie ihren Peinigern erneut gegenübertreten und endlich Rache nehmen kann …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Zehnter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Nachbemerkung
Personen
Glossar
Erster Teil
Albträume
1.
Sie hörte die Rute durch die Luft pfeifen, spürte den Schlag und schrie auf. Der Schmerz war entsetzlich.
»Warum bestraft ihr mich so grausam?«, rief sie, während die Rute erneut ihren Rücken traf. »Ich habe doch gar nichts getan! Warum nur …«
Der nächste Schlag war noch härter und riss alles in ihr fort außer dem Schmerz, der vom Rücken ausgehend ihre Glieder erfasste.
Erst nach geraumer Zeit drang eine Stimme an ihre Ohren. »Ist es langsam nicht genug?«
»Ein Dutzend Hiebe bekommt sie noch. Oder sind es zwei Dutzend?«, fragte jemand höhnisch.
»Drei Dutzend, drei Dutzend, drei Dutzend«, johlten die Zuschauer.
»Da hörst du es. Also drei Dutzend!«, sagte der Mann.
Erneut pfiff die Rute durch die Luft und traf ihren Rücken mit einer Wucht, dass sie glaubte, Rückgrat und Rippen würden brechen.
»Die Ruten sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich brauche eine neue!«
Einen Augenblick blieb sie mit sich und ihrem Schmerz allein.
»Die ist genau richtig!«
Als sie den Kopf leicht drehte und die Rute sah, wurde ihr übel, denn der Stock war so dick wie ein Arm. Damit wird er mich erschlagen!, fuhr es ihr durch den Kopf. Gleichzeitig sehnte sie den Tod herbei, jenen dunklen Schatten, der allen Schmerz und alles Leid der Welt mit seinem Mantel zudeckte.
In die Hölle würde sie wohl nicht kommen! An den Gedanken klammerte sie sich. Im Himmel, so hoffte sie mit jeder Faser ihres Herzens, würde ihr die gütige Hand der Madonna über den Rücken streichen und allen Schmerz nehmen.
»Wieso ist das Weibsstück immer noch nicht tot?«
Die barsche Stimme entriss ihr einen Wutschrei. Das war er – ihr Verderber! Er hatte sie in den Ziegelturm werfen lassen, und dort war sie zum Opfer seiner schurkischen Helfer geworden. Während die Hiebe ihren Rücken trafen, spürte sie noch einmal die stinkenden Leiber, die sie niederdrückten, ihre hastigen Bewegungen und den Schmerz, den sie ihr an jener Stelle zufügten, die eine sittsame Jungfrau sorgfältig hüten sollte.
»Das waren die drei Dutzend! Es ist vorbei«, erklärte jemand.
»Hoffentlich ist sie tot!«, sagte ihr Verderber.
Jemand packte sie bei den Haaren und riss ihren Kopf hoch. »Es sieht so aus! Sollen wir sie in den See werfen?«
»Willst du die Fische vergiften? Bringt sie zum Schindanger! Der Abdecker soll sie dort verscharren.«
»Dann packt mit an!«
Sie spürte, wie mehrere Hände sie ergriffen und aufhoben. Warum bin ich nicht tot?, fragte sie sich enttäuscht. Sie hatte so sehr darauf gehofft, die helfende Hand der Gottesmutter würde sie ins Paradies führen. Stattdessen schleppte man sie zu einem öden Platz, auf dem kein einziger Grashalm wuchs. Ein paar Kuhhäute hingen zum Trocknen an einer Stange, und am Rand lag ein stinkender Tierkadaver. Der Schinder, ein Mann in schmieriger Kleidung, grub gerade ein Loch, um diesen zu entsorgen.
»Da hast du noch was, das du einbuddeln kannst!«, rief einer der Männer.
»Werft sie irgendwo hin! Ich kümmere mich später um sie«, antwortete der Abdecker und grub weiter.
Sie spürte noch, wie sie auf den Boden gelegt wurde, dann dämmerte sie weg. Ihr letzter Gedanke war, dass sie gleich vor der Himmelsjungfrau stehen und alles Elend vorbei sein würde.
Als sie erwachte, befand sie sich jedoch nicht im Himmel, sondern lag noch immer auf dem Schindanger, von dem Abdecker war nichts zu sehen. Er hat anscheinend bemerkt, dass ich noch lebe, und will warten, bis ich tot bin, dachte sie.
Sie richtete sich auf und sah sich verwirrt um. Irgendetwas stimmte nicht! Sie fühlte sich zwar elend, aber ihr Rücken tat nicht weh, und sie befand sich auch nicht unter freiem Himmel, sondern lag in einer Kammer in einem bequemen Bett.
Augenblicke später vernahm sie wieder die Stimmen ihrer Feinde.
»Die legen wir noch einmal auf den Rücken, und dann war das, was wir im Gefängnis mit ihr getrieben haben, nur der Vorgeschmack!«, rief der Büttel, der sie ausgepeitscht hatte.
»Ich hätte nichts dagegen«, erwiderte sein Kumpan. »Wir müssen sie nur finden.«
Sein Kumpan lachte. »Und zwar, bevor sie ganz verreckt ist! Wir wollen unseren Spaß mit ihr haben.«
Von Grauen erfüllt, wollte sie das Zimmer verlassen, um sich ein Versteck zu suchen, befand sich aber wieder auf dem Schindanger.
»Da ist sie ja!«, rief der Büttel triumphierend und griff sich in den Schritt, um die Verschnürung seines Hosenlatzes zu lösen.
Irgendwie kam sie auf die Beine und rannte los. Die Männer folgten ihr lachend, doch anfangs sah es so aus, als könnte sie entkommen. Da trat von der anderen Seite ihr Verderber auf sie zu und packte sie mit rauem Griff.
»Hiergeblieben! Du willst doch meinen Freunden ihre Freude nicht missgönnen?«
Sie spie in sein schmales, höhnisch verzogenes Gesicht.
»Das hast du nicht umsonst getan!«, sagte er mit seiner kalten, leicht heiseren Stimme und stieß sie zu Boden.
Im nächsten Augenblick war der Büttel bei ihr, wälzte sich auf sie und zwängte ihre Schenkel auseinander.
»Hiltrud, hilf mir!«, schrie sie voller Angst.
2.
So geht es schon die ganze Zeit«, sagte Margarete und hielt ihre sich windende Schwiegermutter fest, damit sie nicht aus dem Bett fallen konnte. »Ich weiß mir keinen Rat mehr, Alika. Nacht um Nacht schreit und jammert sie, wirft sich wild im Bett herum und fleht die Ziegenbäuerin um Hilfe an. Dabei ist Hiltrud doch schon einige Jahre tot. Ich habe Angst um sie! Wenn es so weitergeht, wird sie den Verstand verlieren. Es ist ein Elend, dass Falko nicht hier sein kann. Er musste nach Nürnberg, um den Kaiser zu treffen. Aber wenigstens konntest du kommen.«
»Maries Geist weilt nicht hier, sondern an einem Ort, an den wir ihr nicht folgen können«, sagte die zweite Frau im Raum nachdenklich. Sie war groß, schlank und von dunkler Hautfarbe. Zwar war sie nicht mehr jung, aber noch nicht so alt wie die Frau im Bett.
»Hiltrud, so hilf mir doch!«, schrie diese erneut.
»Tritt zur Seite!«, forderte Alika Margarete nun auf.
Sie tat es zögernd, war aber bereit, jederzeit einzugreifen, wenn ihre Schwiegermutter in Gefahr geriet, aus dem Bett zu fallen.
Alika holte mit der Rechten aus und versetzte der phantasierenden Frau eine schallende Ohrfeige. Für einen Augenblick sah es so aus, als würde diese erwachen, versank dann aber wieder in wirre Albträume und rief verzweifelt um Hilfe.
»Wenn eine Backpfeife nicht hilft, so hilft vielleicht eine zweite«, sagte Alika, und schlug noch einmal zu.
Die Frau im Bett stieß einen gurgelnden Schrei aus, öffnete die Augen und starrte sie an. »Alika, du? Wie kommst du hierher?«
»Dem Himmel sei Dank, Mutter! Du bist bei Sinnen.« Margarete fiel ein Stein vom Herzen. So brachial wie Alika hatte sie es nicht gewagt, ihre Schwiegermutter aus ihren Albträumen zu wecken. Doch es schien nötig zu sein.
»Ich habe Durst«, sagte Marie Adler auf Kibitzstein leise.
»Ich habe Wein mit Wasser für dich vermischt.« Margarete hielt ihr einen Becher an den Mund.
Während Marie durstig trank, fasste Alika nach ihrem Nachthemd. »Du solltest ein frisches anziehen! Das hier ist durchgeschwitzt.«
»Ich werde auch das Bett neu beziehen, denn es riecht stark nach Schweiß.« Margarete wandte sich ihrer Schwiegermutter zu. »Kannst du aufstehen, oder sollen wir dir helfen?«
»Es geht schon«, antwortete Marie, musste sich dann aber an Alika festhalten, weil ihre Beine sie nicht tragen wollten. »Was ist geschehen? Ich fühle mich so schwach.«
»Kurz nach Falkos Aufbruch bist du krank geworden. Zuerst dachte ich, es wäre nur eine Erkältung. Es wurde jedoch von Tag zu Tag schlimmer. Schließlich hast du hohes Fieber bekommen und in den Nächten fürchterlich geschrien. Auch hast du nach der Ziegenbäuerin gerufen!«, berichtete Margarete.
Alika legte die Hand auf Maries Stirn. »Du hast noch immer Fieber und brauchst Medizin.«
»Es ist schade, dass die Ziegenbäuerin nicht mehr lebt. Sie wüsste, was dir helfen würde«, sagte Margarete.
»Hiltrud ist tot?«, fragte Marie und schüttelte dann über sich selbst den Kopf. »Ja, natürlich. Das ist sie schon seit Jahren. Aber ich …« Sie brach ab und versuchte sich zu erinnern, konnte aber kaum zwischen ihren Albträumen und der Wirklichkeit unterscheiden.
»Ich fühle mich nicht gut!«, sagte sie leise. »Außerdem habe ich Angst, wieder einzuschlafen, denn ich träume so schrecklich.«
»Es ist etwas in dir, das dich nicht loslässt.« Alika atmete tief durch und überlegte. »Die Ziegenbäuerin kannte ein Mittel, das einen tief schlafen lässt. Vielleicht hilft es.«
»Tut es nicht«, antwortete Margarete. »Als es bei Mutter schlimmer geworden ist, habe ich es versucht. Danach wurden ihre Schreie noch entsetzlicher. Als ich mir nicht mehr zu helfen wusste, habe ich nach dir schicken lassen. Du kennst Mutter besser als ich.«
Alika nickte. »Ich kenne Marie seit vielen Jahren. Sie ist eine starke Frau. Aber es wühlt etwas in ihr, und das ist nichts Gutes.«
»Ich will nicht mehr schlafen!«, rief Marie angsterfüllt. Es graute ihr davor, erneut in jene Träume zu versinken, die so schrecklich waren, dass ihr Geist sie nicht mehr auszuhalten vermochte.
»Zieh jetzt ein anderes Nachthemd an, während Margarete dein Bett frisch macht. Ich sehe unterdessen nach, was an Arzneien vorhanden ist. Ein wenig weiß ich darüber Bescheid«, sagte Alika.
»Du hast dich stets mehr für Hiltruds Kräuter und Tränke interessiert als ich«, sagte Marie seufzend.
»Was ist mit dem Gesinde? Ich will nicht, dass die Mägde Marie so sehen.«
»Ich habe aus diesem Teil der Burg alle weggeschickt und Mutters Pflege selbst übernommen. Allein ist es allerdings nicht einfach, denn ihre Schreie gehen einem durch Mark und Bein. Auch spricht sie in ihrem Wahn, und ich ahne daher, welche Schrecken sie durchleben muss.« Margarete klang bedrückt. Unerträglich war die Vorstellung, ihre Schwiegermutter könnte durch diese Albträume den Verstand verlieren. Sie wagte sich gar nicht auszumalen, was ihr Mann dazu sagen würde, wenn er aus Nürnberg zurückkam.
»Ich sollte Falko holen lassen. Vielleicht wird Mutter ruhiger, wenn er bei ihr ist«, sagte sie hilflos.
Alika schüttelte den Kopf. »Das würde ich nicht tun! Bei dem, was Marie bedrückt, kann ihr kein Mann helfen, auch nicht ihr Sohn.«
»Was sollen wir sonst tun?«, fragte Margarete.
»Nicht verzweifeln! Mach du das Bett, und ich sehe nach den Arzneien. Außerdem sollte Marie viel trinken. Sie schwitzt stark, und das schwächt sie zusätzlich. Keine Sorge, es wird schon wieder alles gut.«
Alika lächelte beruhigend, doch ihre Augen blickten ernst. Sie kannte Marie länger und besser als deren Schwiegertochter und wusste, dass ihre Freundin in ihrer Jugend ein hartes Leben hatte führen müssen. Lange Zeit war sie der Erinnerung daran entkommen. Doch nun schienen die Dämonen der Vergangenheit erwacht zu sein und quälten sie auf grausame Weise.
3.
Als Alika zurückkehrte, hatte Margarete das Bett frisch überzogen.
»Mutter kann sich wieder hinlegen«, sagte sie, da Marie in einem sauberen Nachthemd steckte.
Alika schüttelte den Kopf. »Marie soll das Hemd noch einmal ablegen. Ich halte es für besser, ihr den Schweiß abzuwaschen. Vielleicht waschen wir damit auch die bösen Träume ab.«
»Schön wäre es.« Marie fühlte sich schwach und müde, hatte aber Angst davor, wieder einzuschlafen. Daher ließ sie sich von Margarete aus dem Nachthemd helfen und setzte sich auf einen Stuhl.
Alika stellte eine Schüssel mit warmem Wasser bereit und machte sich daran, ihre alte Freundin mit einem Schwamm zu waschen. Da es nun angenehm nach Kräutern roch, atmete Marie tief ein. Sofort bekam sie einen Hustenanfall, der Margarete beinahe in die Panik trieb.
Alika hingegen hob die Hand. »Hab keine Sorge! Der Husten sorgt dafür, dass der Schleim aus der Lunge kommt. Marie muss erst die Krankheit des Leibes überwinden. Nur dann wird sie die Kraft aufbringen können, sich ihren Dämonen zu stellen und sie zu vertreiben.«
Wie aufs Wort würgte Marie und spie einiges aus.
»So ist es gut!«, lobte Alika. »Damit wirst du freier atmen können. Aber jetzt solltest du aufstehen, denn wir wollen nun deine Rückseite waschen.«
Marie versuchte zu lachen, es endete jedoch in einem weiteren Hustenanfall. Diesmal kam weniger Schleim, und der Anfall war deutlich weniger heftig. Nachdem Alika und Margarete sie gewaschen und trocken gerieben hatten, rieb Alika ihr die Brust und den Rücken mit einer scharf riechenden Salbe ein. Zu Maries Erleichterung unterblieb der befürchtete Hustenanfall. Dafür musste sie auf Alikas Anweisung einen Becher mit einem entsetzlichen Gebräu trinken, das ihr schier den Magen umdrehte. Sie stieß fürchterlich auf, würgte übel riechende Luft aus dem Magen und sah Alika danach verzweifelt an. »Wenn ich früher krank gewesen bin, ist Hiltrud sanfter mit mir umgegangen!«
»Da ich nicht weiß, wie schlimm deine Krankheit ist, habe ich alles genommen, von dem Hiltrud mir einst sagte, es könnte helfen«, erklärte Alika und brachte zuletzt eine Räucherschale mit glimmenden Holzkohlen, auf die sie getrocknete Kräuter und kleine Stücke Harz streute. Ein würziger Duft erfüllte den Raum und ließ für alle drei das Atmen leichter werden.
»Jetzt solltest du dich wieder hinlegen. So die Götter – ich meine die Heiligen Blasius, Pantaleon und Rochus – uns gnädig sind, wirst du besser schlafen als vorher«, erklärte Alika.
»Vergiss die heilige Maria Magdalena nicht!«, mahnte Marie und bewies damit, dass es ihr etwas besser ging als in den letzten Tagen. Sie legte sich hin und schloss die Augen.
Neben ihr sang Alika leise ein Lied in einer Marie unbekannten Sprache. Es war wohl jene, die ihre Freundin in ihrer Jugend gesprochen hatte. Vielleicht hatte Alikas Mutter dieses Lied gesungen. Marie erinnerte sich an die Herkunft ihrer Freundin. In einem fernen Land in Afrika geboren, war sie ihrem Volk geraubt und als Sklavin verkauft worden. Auf einem Schiff, das nach Osten fuhr, hatten sich ihre Wege getroffen. Sie selbst war schwer krank gewesen und hatte es dem damals noch sehr jungen dunkelhäutigen Mädchen zu verdanken, dass sie jene üble Zeit überlebt hatte. Seitdem war fast ein ganzes Leben vergangen. Alika hatte inzwischen geheiratet und Kinder geboren. Ihre Heimat hatte sie niemals wiedergesehen.
Marie fragte sich, was ihre Freundin manchmal bewegen mochte. Empfand sie nach so vielen Jahren immer noch Heimweh? Vermisste sie ihre Herkunftsfamilie? Sie wusste es nicht. Als sie jedoch in sich hineinhorchte, spürte sie, dass es bei ihr so wäre. Marie fühlte mit der Freundin, sagte sich aber auch, dass diese ihr Schicksal auf eine bewundernswerte Weise gemeistert hatte. Nur wenige Frauen wären ähnlich stark gewesen.
Langsam dämmerte Marie weg und fand sich in einem dichten Wald wieder, in dem uralte Baumriesen in den Himmel ragten. Von deren Zweigen hingen Moosbärte herab, und zu ihren Füßen wuchsen Heidelbeersträucher, an denen kleine, blaue Früchte dicht an dicht hingen. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, und sie bückte sich, um die Heidelbeeren zu pflücken.
Da packte jemand sie an der Schulter und schüttelte sie. »Komm, Marie! Wir müssen uns rasch verstecken.«
Hiltrud! Doch sie wirkte so jung, wie in jener Zeit, als sie einander erstmals begegnet waren. Marie schüttelte den Kopf. »Aber du bist doch tot!«
»Wie kommst du auf diesen seltsamen Gedanken?«, fragte Hiltrud und zerrte sie hinter sich her. »Wenn wir uns nicht irgendwo verbergen und so leise sind wie Mäuschen, werden wir bald beide tot sein«, flüsterte sie.
Marie begriff nichts mehr, folgte Hiltrud aber aus alter Gewohnheit. Die Freundin führte sie zu einem Dickicht und kroch hinein. Marie folgte ihr und stöhnte, als die Dornenranken ihre Haut aufrissen.
»Sei still!«, wisperte Hiltrud. »Sie sind ganz nahe. Und gib acht, dass kein Stofffetzen an den Dornen hängen bleibt und uns verrät.«
Marie presste die Lippen zusammen und kroch weiter. Nur einmal hielt sie kurz inne, um zu sehen, ob die Dornen ein Stück aus ihrem schäbigen Kleid gerissen hatten. Sie entdeckte eines der gelben Hurenbänder, das lustig an einer Ranke flatterte. Rasch holte Marie es und riss sich dabei die Hände blutig.
»Gut aufgepasst!«, lobte Hiltrud sie. »Dort vorne kauern wir uns hin. Ich will keinen Mucks hören! Verstanden?«
Marie nickte, obwohl sie noch immer nicht verstand, weshalb sie hier war. Eben hatte sie in ihrem Zimmer gelegen und sich mit Alika und Margarete unterhalten. Nun aber kauerte sie neben Hiltrud auf der nackten Erde und wagte kaum zu atmen. Schritte waren zu hören, und sie glaubte, keine zehn Schritte entfernt einen Schatten zu sehen.
»Was meint ihr? Können die Weiber hier ins Gebüsch gekrochen sein?«, fragte eine heisere Stimme. »Sie sind in diese Richtung gelaufen!«
»Dort vorne sehe ich etwas!«, rief ein Zweiter und rannte los. Zwei Männer folgten ihm, während einer noch zögerte und dabei das Gestrüpp misstrauisch beäugte. Er griff in die Dornen und fluchte auf. Unwirsch brummend saugte er an seinem blutigen Finger und achtete nicht auf die Blutstropfen, die nur eine Handspanne weiter an der Ranke hingen, an der Marie sich ihre Finger aufgerissen hatte.
»Um in dieses Gestrüpp hineinzukommen, müssten die Huren eine Hornhaut am ganzen Körper haben«, sagte er mürrisch und trabte hinter seinen Kumpanen her.
»Wer sind die?«, fragte Marie leise.
Hiltrud sah sie erstaunt an. »Was ist denn mit dir los? Wir laufen doch schon seit gestern Nacht vor diesen Söldnern davon, und jetzt fragst du, wer sie sind.«
»Mein Kopf ist wie leer gesaugt! Ich weiß nicht mehr, was gestern war«, gestand Marie.
Hiltrud musterte sie besorgt. »Das Leben einer Hure ist hart, und nicht jede hält es aus. Ich habe schon einige erlebt, die den Verstand verloren haben. Du wirst doch hoffentlich nicht dazugehören?«
»Manchmal habe ich das Gefühl, als wäre es so«, sagte Marie bedrückt. »Ich habe fürchterliche Angst!«
»Die ist bei den Kerlen auch angebracht. Weißt du, wie eine Frau aussieht, wenn sie von einem ganzen Fähnlein vergewaltigt wurde? Ich habe Huren gekannt, die waren davor munter und fidel. Als wir sie hinterher gefunden haben, war die Hälfte von ihnen tot und die anderen so schwer verletzt, dass wir um ihr Leben bangen mussten.«
Marie schüttelte es. Wie um Hiltruds Bericht zu bestätigen, hörten sie plötzlich mehrere Frauen schreien und kreischen.
»Wie es aussieht, haben sie ein paar der anderen Huren erwischt. Lass uns für die armen Dinger beten«, sagte Hiltrud. Ihr Gesicht wurde starr. »Es ist nicht christlich gedacht, und ich schäme mich dafür. Trotzdem bin ich froh, dass nicht wir diesen Schurken zum Opfer gefallen sind.«
»Können wir denn gar nichts für sie tun?«, fragte Marie, da das Schreien immer entsetzlicher klang.
»Nur wenn du eine Schar wackerer und uns treu ergebener Waffenknechte herbeizaubern kannst, die diese Schurken zusammenschlagen«, antwortete Hiltrud leise und sah Marie fragend an. »Du bist heute wirklich seltsam! So kenne ich dich gar nicht.« Sie legte eine Hand auf Maries Schulter. »Wir führen ein hartes Leben, dennoch darfst du nicht verzweifeln. Auf jede Nacht folgt ein Morgen, und solange wir halbwegs durchkommen, ist es gut.«
Marie nickte, presste dann aber die Hände gegen die Ohren, um das Schreien und Flehen der anderen Frauen nicht mehr hören zu müssen. Sie hätte nicht zu sagen vermocht, wie lange es dauerte, bis Hiltrud sie anstupste und in den Wald zeigte.
»Wir können jetzt raus! Ich habe schon seit Stunden nichts mehr gehört.«
»Ich höre noch etwas!«, wisperte Marie ängstlich.
»Das sind ein paar der Frauen, die wegen ihrer Schmerzen jammern. Die Söldner allerdings sind verschwunden.« Mit diesen Worten kämpfte sich Hiltrud durch das Dornengestrüpp ins Freie.
Marie folgte ihr und bezahlte es mit blutigen Rissen an Armen, Beinen und im Gesicht. »Der Teufel soll diese Schufte holen!«
Hiltrud drehte sich zu ihr um. »Diese paar Schrammen sind ein geringer Preis dafür, dass wir entkommen sind.«
»Du hast ja recht!«, antwortete Marie bedrückt.
»Wir sollten jetzt nach den armen Frauen schauen. Vielleicht können wir ihnen noch helfen«, schlug Hiltrud vor und schritt in die Richtung los, aus der sie die Schreie gehört hatten.
Mit einem seltsamen Gefühl folgte Marie ihr. Zum einen konnte sie nicht glauben, dies wirklich zu erleben, zum anderen aber war es ihr, als wäre sie an dieses Leben gewöhnt.
Sie hatten weiter zu gehen, als sie es erwartet hatten. Schließlich erreichten sie eine kleine Senke. Hier hatten die Söldner offenbar gelagert, denn es waren die Reste eines Lagerfeuers und ein paar weggeworfene Gegenstände zu erkennen. Nach den Huren hielten sie jedoch vergebens Ausschau.
»Seltsam!«, sagte Marie. »Wir haben sie doch eben noch gehört.«
Im nächsten Augenblick vernahm sie ein lautes Stöhnen und ging darauf zu.
Nur zwei Dutzend Schritte entfernt entdeckte sie die Huren. Es waren drei. Noch lebten sie, doch Marie glaubte nicht, dass auch nur eine von ihnen es auch noch am nächsten Tag tun würde.
»Da ist ja das Vögelchen, das wir gesucht haben!«, hörte sie da eine höhnische Männerstimme und fuhr herum.
Ein Dutzend zerlumpter Kerle standen hinter ihr und sahen sie grinsend an. »Jetzt machen wir bei dir weiter, wo wir bei den anderen aufgehört haben«, meinte einer und leckte sich erwartungsvoll die Lippen.
Marie wich zurück und prallte gegen weitere Männer, die hinter ihrem Rücken aufgetaucht waren. Sie wurde gepackt und zu Boden gerissen.
»Hiltrud, hilf mir!«, schrie sie und wusste doch selbst, dass ihr niemand mehr helfen konnte.
4.
Mit einem Mal waren der Wald und die üblen Kerle verschwunden. Dafür brannte ihre Wange, und sie sah Alika vor sich, die eben erneut ausholte.
»Halt, lass das!«, rief sie keuchend und rieb sich das schmerzende Gesicht.
»Endlich bist du aufgewacht«, sagte Alika erleichtert. »Jetzt nimm deine Medizin, setz dich auf den Nachttopf und trink einen Becher Wein.«
»Aber nicht mehr diesen entsetzlichen Kräuteraufguss, den du mir vorhin eingeflößt hast«, antwortete Marie und mühte sich, aufzustehen.
»Vorhin?« Alika lachte hart auf. »Das war vor drei Tagen! So lange hast du geschlafen und wirr geträumt. Zu Beginn schien es nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Schließlich aber musste ich zusehen, dass ich dich wieder wach bekomme. Du hast so geschrien und gejammert, dass selbst ein Stein Mitleid mit dir empfunden hätte.«
»Drei Tage? So lange habe ich geschlafen?« Marie wollte es nicht glauben. Sie spürte jedoch brennenden Durst und war froh um den Weinbecher, den Alika ihr reichte. Dankbar, das Gefäß selbst halten zu können, trank sie und schüttelte den Kopf. »Weiß der Himmel, weshalb mich so grauenhafte Träume quälen! Zwar hatte ich schon in früheren Jahren gelegentlich Albträume, aber die habe ich weitaus leichter überstanden.«
»Vielleicht könnte einer der hochgelehrten Herren Doctores sagen, weshalb das so ist. Ich vermag es nicht«, erwiderte Alika.
»Bleib mir mit den Ärzten vom Leib! Hiltrud war eine einfache Frau, doch sie wusste die Krankheiten besser zu heilen als diese studierten Herren. Die wissen nicht einmal, wie man eine kleine Wunde verpflastert.« Marie schnaubte leise und fragte dann, ob sie etwas zu essen bekommen könne.
»Tut es ein Stück Brot mit Butter? Käse und Wurst sind noch zu schwer für dich. Oder soll ich die Köchin wecken, damit sie eine Hühnersuppe für dich zubereitet?«, fragte Alika.
Marie bemerkte erst jetzt, dass es Nacht war. Irgendwie bin ich früher aufmerksamer gewesen, dachte sie. »Ein Butterbrot reicht! Das Hühnchen möchte ich dann zum Frühstück.«
»Es war von einer Hühnersuppe die Rede, nicht von einem ganzen Huhn«, wandte Alika ein. Dennoch lächelte sie erleichtert, weil es Marie besser zu gehen schien. »Ich hole dir dein Butterbrot. Bleib aber bitte im Bett!«
Während Alika den Raum verließ, sank Marie auf das Kissen zurück und schloss die Augen. Sofort stiegen wieder die Bilder der übel zugerichteten Huren in ihren Gedanken auf. Schaudernd richtete sie sich auf und schlang sich die Arme um die Knie. Zwar wusste sie nicht, was in ihr vorging, begriff aber, dass die Last der Vergangenheit immer schwerer wog und sie in Gefahr schwebte, sich darin zu verlieren. Die Vorstellung, im Traum immer und immer wieder die übelsten Dinge zu erleben, war so schrecklich, dass sie sich fragte, ob der Tod nicht gnädiger sein würde.
Als Alika mit dem Brot zurückkehrte, war Margarete an ihrer Seite. »Gott sei Dank, du bist wieder wach, Mutter! Was habe ich mir für Sorgen um dich gemacht. Alika hat wohl etwas zu viel von den Kräutern der Ziegenbäuerin genommen.« Es schwang ein gewisser Vorwurf mit, den Maries Freundin mit einer ärgerlichen Handbewegung abtat.
»Ich nahm so viel, wie mir nötig schien. Es war auch gut so, denn Marie ist kräftiger als zuletzt und scheint langsam gesund zu werden.«
»Das hoffe ich sehr«, sagte Marie und seufzte tief. Auch wenn sie sich nicht mehr ganz so schwach fühlte wie vor drei Tagen und sie das Butterbrot ohne Schwierigkeiten essen konnte, so graute ihr vor den Erinnerungen, die sie zu erdrücken drohten.
Als sie dies wenig später Alika anvertraute, sah die Freundin sie besorgt an. »Ist es so schlimm?«
Marie nickte. »Bis vor kurzem haben mich die schlimmen Träume aus ihren Klauen gelassen, wenn ich wach wurde. Mittlerweile verfolgen sie mich selbst am Tag. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich alles vor mir, und zwar noch viel schlimmer, als ich es in Erinnerung habe.«
»Wenn ich nur wüsste, wie ich dir helfen kann!« Alika schüttelte mit wachsender Verzweiflung den Kopf.
»Ich wünschte mir auch guten Rat«, sagte Marie. »Doch gegen die Albträume, so glaube ich, werden auch Hiltruds Arzneien nicht helfen, zumal nicht mehr sie die Sachen zubereitet, sondern die Frau ihres Sohnes.«
»Die neue Ziegenbäuerin!«, sagte Alika.
»Man nennt sie aber nicht so. Für uns war Hiltrud die Ziegenbäuerin. Jetzt heißt der Hof anders. Ihr Sohn Dietmar hält Kühe und Pferde und will daher nicht nach Ziegen benannt werden.«
Alika schüttelte den Kopf. »Es ist seltsam zu sehen, wie Menschen sich verändern können. Früher war Dietmar stolz darauf, der Sohn der Ziegenbäuerin zu sein. Nun will er als etwas Besseres gelten!«
»Das will eher seine Frau! Das Einzige, was ich ihr zugutehalte, ist, dass sie von Hiltrud gelernt hat, welche Kräuter gegen welche Krankheit helfen. So gut wie Hiltrud ist sie aber nicht.« Marie seufzte und fand, dass die Zeit die Menschen wirklich veränderte. »Kannst du mir noch einen Becher Wein geben? Mische ihn aber mit Wasser. Danach versuche ich wieder zu schlafen. Vielleicht bleiben die üblen Träume diesmal fern.«
Viel Hoffnung hatte Marie zwar nicht, allerdings fühlte sie sich so müde, dass sie die Augen kaum mehr aufhalten konnte.
Alika reichte ihr etwas zu trinken, richtete das Bett und sah sorgenvoll zu, wie ihre Freundin die Augen schloss und rasch einschlief.
5.
Marie riss die Augen auf und schüttelte sich. »Oh Gott, ich dachte, ich würde ertrinken!«
»Diesmal bist du von selbst wach geworden«, sagte Alika.
»Das ist mir auch lieber, als von dir andauernd mit Ohrfeigen geweckt zu werden. Du hast einen kräftigen Schlag«, sagte Marie stöhnend und griff sich an den Kopf. »Geträumt habe ich trotzdem – und nicht weniger übel!«
Margarete kam mit einem Napf Hühnersuppe herein. »Kannst du selbst essen, oder soll ich dich füttern?«, fragte sie.
»Ich will es selbst versuchen.«
Während ihrer Krankheit hatte Marie nur wenig zu sich genommen und fühlte sich schwach. Die Suppe belebte sie jedoch, zumal die Köchin etliche schöne Stücke Fleisch mitgekocht hatte, und die waren so zart, dass sie ihr auf der Zunge zergingen.
Im nächsten Augenblick fand sie sich auf einer Waldlichtung wieder und sah ein kleines Lagerfeuer vor sich, um das Hiltrud und weitere Frauen saßen. Die kannte sie, konnte sich aber nicht an ihre Namen erinnern. Wie die anderen hielt auch sie eine hölzerne Schüssel in der Hand und führte einen Löffel zum Mund.
»Ein bisschen Salz hätte schon in die Suppe gehört«, sagte sie.
»Wenn du welches hast, dann her damit!«, rief eine pummelige Frau in einem schmutzigen Kleid.
Ich habe doch erst vor kurzem Salz gekauft, wollte Marie schon sagen, als ihr klar wurde, dass Wahn und Wirklichkeit sich erneut vermischten. Das Nächste, was sie spürte, war eine scharfe Ohrfeige. Sie riss die Augen auf und sah Alika vor sich.
»Kam es schon wieder?«, fragte diese mit ernster Miene.
Marie nickte. »Ja! Du hast mich aber daraus geweckt, bevor es schlimm werden konnte. Ich habe nur einen entsetzlich schmeckenden Eintopf essen müssen.«
»Dabei war die Hühnersuppe wirklich gut«, sagte Alika und nahm Marie den leeren Napf aus der Hand.
Marie begriff, dass sie trotz ihrer Vision weitergegessen und die Schüssel geleert hatte. Geschmeckt hatte sie jedoch nur jenen Eintopf, der mit der Bezeichnung »Fraß« noch gut bedient war.
»Heilige Maria Magdalena, hilf mir! Wie soll das nur enden?«, stöhnte sie und versuchte, noch ein wenig von der Hühnersuppe zu schmecken. Die Erinnerung an den Eintopf war jedoch stärker.
»Etwas wühlt in dir, Mutter!«, sagte Margarete. »Wenn ich nur wüsste, wie wir dir helfen könnten.«
»Es sind die Dämonen der Vergangenheit! Sie haben sich in Marie eingenistet und werden sie so lange quälen, bis wir sie vertreiben können«, erklärte Alika.
»Aber wie soll das gehen?«, fragte Margarete besorgt.
»Vielleicht gibt es eine Möglichkeit.« Alika klang nachdenklich. »Ich kannte eine Frau, die in ihrer Jugend schlimme Dinge getan hatte. Viele Jahre danach wurde sie von ihren Dämonen der Vergangenheit auf eine so üble Weise gequält, dass sie mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist und sich blutig gestoßen hat.«
»Was ich hoffentlich nicht tun werde!«, rief Marie erschrocken.
»Aber du meinst, der Frau konnte geholfen werden?«, fragte Margarete hoffnungsvoll.
Alika nickte. »So habe ich es gehört! Die Frau soll sich alles, das so schwer auf ihr gelastet hat, von der Seele geredet haben. Sie tat es vor einem Priester aus ihrer Verwandtschaft …«
Marie schnitt ihr das Wort ab. »Nein, ich will keinen Pfaffen!«
»Das sollst du auch nicht!«, erklärte Alika. »Ich wollte nur sagen, dass es der Frau geholfen hat. Sie war danach ruhiger, hat aber auf Anweisung des Pfarrers viel gebetet und Almosen gegeben, und er versprach ihr, dass Gott ihr verzeihen und sie nach einer angemessenen Zeit im Fegefeuer in sein Himmelreich aufnehmen werde.«
»Ich habe zwar gesündigt, aber gewiss keine üblen Taten vollbracht«, antwortete Marie leise. »Gott hat mir nichts zu verzeihen, denn an dem, was aus mir geworden ist, bin ich schuldlos.«
»Das weiß ich!«, antwortete Alika sanft. »Doch gerade jene Taten, die an dir verübt wurden, quälen dich. Vielleicht wird es leichter, wenn du darüber sprichst und damit die Dämonen der Vergangenheit vertreibst.«
»Du meinst, es hilft?«, fragte Margarete besorgt.
»Ich hoffe es!«, sagte Alika und sah Marie aufmunternd an.
Marie schloss kurz die Augen und wagte einen Blick in die Vergangenheit. Soll ich wirklich darüber sprechen?, fragte sie sich. Und mit wem?
»Vielleicht hat Alika recht, und es ist klug, es zu tun«, sagte sie mit einem letzten Zweifel in der Stimme.
»Wir sollten Trudi und Lisa hinzuholen und vielleicht auch Hildegard«, schlug Margarete vor. »Falko würde ich nicht nehmen. Männer verstehen nichts von Frauensachen.«
»Nein, nicht Trudi und die anderen Mädchen!«, wehrte Marie ab. Sie sah ihre Tochter und die beiden Ziehtöchter als Kinder vor sich. Und auf gar keinen Fall wollte sie, dass die drei mehr von dem erfuhren, was sie hatte erleben müssen, als sie bereits wussten.
»Aber du brauchst Zuhörer«, erklärte Alika. »Wir beide haben viel zusammen erlebt. Wenn du magst, kannst du es mir erzählen.«
Marie nickte. Nach dem Tod der Ziegenbäuerin stand Alika ihr von allen am nächsten. Sie würde ihr zuhören und vor allem über das schweigen, was sie erfuhr.
»Es sollte mehr als eine Person sein«, sagte Margarete. »Mutter weiß, dass ich keine Schwätzerin bin. Außerdem bewundere ich ihren Mut, mit dem sie ihr Leben gemeistert hat. In ihrer Jugend ist ihr schweres Unrecht zugefügt worden, und sie konnte nur mit der Hilfe meines leider bereits verstorbenen Schwiegervaters ihre Rechte wieder geltend machen.«
So wurde die Geschichte heute erzählt, und Marie hatte sich nie genötigt gesehen, sie zu korrigieren. Die Anspielungen, sie könne die Mätresse mehrerer hoher Herren gewesen sein und dadurch Recht erlangt haben, gab es zwar noch vereinzelt, doch jene Zeit lag schon so viele Jahre zurück, dass kaum noch jemand lebte, der damals dabei gewesen war.
Marie fragte sich, ob sie ihrer Schwiegertochter diese schlimmen Dinge offenbaren sollte. Andererseits war Margarete eine ruhige, zuverlässige Frau und – wie sie selbst gesagt hatte – keine Schwätzerin. Wenn ihr angeraten wurde, sie müsse etwas für sich behalten, dann tat sie das auch.
»Vielleicht sollten wir drei wirklich miteinander reden«, sagte Marie nachdenklich. »Aber nicht hier, wo uns alles an meine Krankheit erinnert, sondern auf dem Söller bei hellem Sonnenschein, damit die Schatten fernbleiben, die mich hier bedrohen.«
»Das ist ein guter Entschluss!«, sagte Alika und nahm die Hände ihrer langjährigen Freundin in die ihren. »Die Sonne soll alles vertreiben, was dir Kummer macht.«
»So soll es sein«, stimmte Margarete ihr zu. »Sobald Mutter dazu in der Lage ist, werden wir es tun.«
»Dafür geht es mir gut genug!«, behauptete Marie. »Ich will auch nicht mehr warten, denn dafür sind die Träume zu schrecklich. Vorhin haben wir bereits gesehen, wie sehr ich darin gefangen sein kann. Ich habe immer noch den Geschmack jener scheußlichen Suppe im Mund. Damals haben wir, wie ich glaube, einen Igel gekocht. So früh im Jahr hatten wir nur wenige Kräuter, und Salz besaßen wir ebenfalls keines. Aber das ist eine Geschichte, die erst später kommt. Zu Beginn will ich euch von Konstanz erzählen und von der Zeit, in der ich dort als Tochter des Tuchhändlers Matthis Schärer glücklich war.«
6.
Margarete hatte sich selbst übertroffen. Für Marie stand ein bequemer Korbsessel zur Verfügung, und damit sie nicht fror, hatte ihre Schwiegertochter sie in eine weiche Decke gewickelt. Neben ihr stand ein Tisch mit Wein, Bier und den Leckereien, die sie gerne mochte. Margarete und Alika hatten sich für einfache Stühle entschieden, doch auch für sie lagen Decken bereit, falls ihnen kalt werden sollte. Im Augenblick sah es jedoch nicht so aus. Es war ein warmer Tag und die Sonne gerade weit genug über den Himmel gewandert, um den Söller zu bescheinen.
Es war auch niemand in der Nähe, der zufällig etwas hätte hören können. Dafür hatte Margarete gesorgt. Sie füllte nun den Becher für Marie und nötigte sie, einen Schluck zu trinken. »Danach rutschen die Worte besser.«
Marie lächelte dankbar und nickte dann. »Bis ich mit allem fertig bin, was ich zu erzählen habe, wird ein Krug Wein nicht reichen.«
»Dann hoffe ich nur, dass du danach keinen schweren Kopf bekommst«, sagte Alika lächelnd.
»So viel Kraft, alles auf einmal zu erzählen, habe ich nicht. Wir werden uns wohl einige Tage hierhersetzen müssen«, antwortete Marie und nahm den Becher zur Hand. »Langsam schmeckt mir der Wein auch wieder«, erklärte sie, nachdem sie getrunken hatte.
»Wenigstens hat dir die Erinnerung nicht den Geschmack am Wein verdorben«, sagte Alika, die an die die Igelsuppe denken musste.
»Das hat sie nicht«, bestätigte Marie. »Ich hatte heute bereits zwei Wachträume. In dem einen Augenblick bin ich noch hier und dann plötzlich ganz woanders. Dort habe ich Leute um mich, die ich einmal gekannt haben muss, aber in der Zwischenzeit wohl vergessen habe. Ich bin nicht mehr hier, aber auch nicht ganz dort, und versuche verzweifelt, wieder zurückzukommen.«
»Bis jetzt ist es dir auch gelungen«, meinte Alika.
»Dank deiner Ohrfeigen!« Marie schüttelte sich bei der Erinnerung. Auch wenn ihre Freundin dieses rabiate Mittel bei ihren letzten Albträumen nicht mehr hatte anwenden müssen, empfand sie doch Angst davor, sich irgendwann in diesen Träumen zu verlieren und nicht mehr herauszufinden.
»Möchtest du etwas essen?«, fragte Margarete.
»Ein Stück Kuchen, mit etwas Wein beträufelt, damit er besser rutscht«, antwortete Marie und blickte übers Land.
Ein Stück entfernt konnte sie Volkach im hellen Licht schimmern sehen. Ihr Sohn Falko hoffte, dort Vogteirechte zu erhalten, und das war einer der Gründe, die ihn nach Nürnberg geführt hatten. Dort wollte er diese Rechte einzuhandeln versuchen. Marie war nun froh, dass er nicht zu Hause war, denn er hätte sich zu große Sorgen um sie gemacht. Wahrscheinlich hätte er den Burgbewohnern keine ruhige Minute mehr gegönnt, nur um sie gut versorgt zu wissen.
Daher gefiel es ihr so, wie Margarete es einrichtete, am besten. Ihre Schwiegertochter reichte ihr Kuchen, und Marie aß ihn mit Genuss. Dabei bemühte sie sich, die Schatten der Vergangenheit fernzuhalten, damit sie ihr dieses harmlose Vergnügen nicht verdarben.
»Wie soll ich anfangen?«, fragte sie danach mehr sich selbst als die anderen. »Ach ja, in Konstanz! Mein Großvater war als entflohener Leibeigener in die Stadt gekommen und hatte es dort durch harte Arbeit und Geschick zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Er war Leinweber und wurde dann Tuchhändler, wie auch mein Vater nach ihm einer war. Mein Vater handelte noch erfolgreicher mit Tuchen als mein Großvater und wurde dadurch so vermögend, dass er selbst hinter den reichen Patriziern nicht zurückstehen musste. Diese hatten ihm jedoch eines voraus: Sie entstammten angesehenen Geschlechtern, die seit Generationen die Geschicke von Konstanz lenkten. Auf den Sohn eines ehemaligen Leibeigenen sahen sie hochmütig herab.
Ihre Verachtung kränkte meinen Vater und machte ihn verwundbar für diejenigen, die dies auszunutzen vermochten. Dazu aber kommen wir erst später. Zuerst will ich von den schönen Tagen berichten.« Marie legte eine Pause ein, um zu trinken, und schien bereits so in Gedanken versunken, dass Alika bereits den Arm hob, um sie anzustupsen.
Da sprach Marie weiter. »Meine Mutter starb im Kindbett, und an ihrer statt übernahm Wina meine Pflege und Erziehung. Sie war eine treue Seele! Ich habe sie Tante genannt, obwohl sie nur entfernt mit uns verwandt war. Eine gewisse Zeit lang erwartete sie, mein Vater würde wieder heiraten, da er gewiss einen Sohn haben wollte.
Ich war noch jung damals und kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob er an eine neue Ehe gedacht hat oder nicht. Wahrscheinlich hat er es zumindest versucht. Er wird wohl bei den hohen Familien an die Tür gepocht haben, doch wie diese zu ihm standen, habe ich bereits erwähnt. Sie konnten ihren Neid, dass der Emporkömmling so reich geworden war, nicht verbergen. Daher wollten sie ihn durch die Mitgift einer Tochter nicht noch reicher werden lassen.
Jedenfalls gab es keine Hochzeit. Die einzige Frau, die meinen Vater hatte heiraten wollen, war unsere Nachbarin Euphemia, die Witwe eines Schusters. Die aber wollte mein Vater nicht. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn er sie geheiratet und ich noch einen Bruder oder mehrere Geschwister bekommen hätte. Doch so war es nun einmal nicht!«
Erneut legte Marie eine Pause ein und blickte traurig übers Land. Die Schatten der Vergangenheit waren nahe, wurden aber durch ihren Willen gebändigt, alles zu berichten, was damals geschehen war.
»Mein Vater war reich, und er achtete darauf, dass die Leute dies auch sahen. Wir hatten ein großes Haus in Konstanz für den Tuchhandel und ein kleineres in Meersburg auf der anderen Seite des Bodensees. Dort in der Nähe lagen die Weingärten, die mein Vater gekauft hatte, um eigenen Wein trinken zu können, wie es bei den großen Familien in der Stadt der Brauch war. Jetzt im Nachhinein ist mir klar, dass Vater ihnen so demonstrieren wollte, dass er sich nicht geringer fühlte als sie.
Damals habe ich das alles nicht begriffen. Ich durchlebte eine schöne Kindheit und hatte einige Freundinnen und Freunde. Am liebsten mochte ich Michel, den Sohn des Bierschenks Guntram Adler.«
»Meinen Schwiegervater«, ergänzte Margarete ihre Worte.
Marie nickte. »Ich habe Michel später geheiratet – oder, besser gesagt, wir wurden verheiratet. Das ist aber eine andere Geschichte und steht erst am Ende jenes langen Berichts, an dessen Anfang ich stehe. Jedenfalls hat Michel mir beigebracht, wie man im Bodensee Fische mit den Händen fängt. Er hat sie gebraten, und wir haben sie zusammen verzehrt. Von ihm habe ich auch schwimmen gelernt. Es war eine schöne Zeit.
Als ich zwölf Jahre alt war, wurde mir verboten, mich weiterhin mit Michel zu treffen. Nachdem ich mich dem ein paarmal widersetzt hatte, sperrte man mich so lange in mein Zimmer ein, bis ich versprach, es nicht mehr zu tun. Michel und ich sahen uns dann nur noch an den Sonntagen in der Kirche, konnten aber kein unbeobachtetes Wort mehr miteinander sprechen.«
Marie sah ihre beiden Zuhörerinnen kurz an. »Ich will nicht behaupten, dass ich todtraurig darüber war, Michel nicht mehr treffen zu dürfen. Wina brachte mir bei, dass ein Mädchen wie ich auf seinen Ruf zu achten hatte. Mit zwölf war ich kein Kind mehr und sollte daher nicht mehr mit einem Jungen in meinem Alter gesehen werden.«
»Ich halte das Verbot für kleinlich. Auf dem Markt hättet Schwiegervater und du euch trotzdem treffen und miteinander reden können«, wandte Margarete ein.
Marie lächelte nachsichtig. Für Margarete war Michel Adler der Reichsritter auf Kibitzstein gewesen. Dieses Wissen erhöhte ihn in deren Augen auch in seiner Jugend. Als Jüngster einer ganzen Reihe von Söhnen eines Bierschenks war Michel damals tatsächlich nicht mehr als ein Knecht gewesen und damit nicht gerade die Bekanntschaft, die sich ein reicher Tuchhändler für seine einzige Tochter wünschte.
»Gelegentlich sahen Michel und ich uns wieder. Er musste jedoch für seinen Vater arbeiten, und ich stand unter Winas Aufsicht – und sie hatte scharfe Augen!«, erklärte Marie. »Es waren trotzdem schöne Jahre. Vaters Geschäfte gingen gut, und ich bin mir gewiss, dass er sich bereits Gedanken gemacht hatte, mit wem er mich verheiraten sollte. Zwar war ich dafür noch zu jung, denn ein Bürgermädchen heiratet selten vor ihrem zwanzigsten Geburtstag. Anders als beim Adel, wo es eher Sitte ist, jüngere Mädchen zu verheiraten. Ich finde das jedoch nicht gut. Ein Mädchen, das zur Braut wird, sollte ausgewachsen sein und mehrere Jahre gelernt haben, einen Haushalt zu führen.«
Marie merkte selbst, dass sie belehrend wurde und ihre Geschichte aus den Augen zu verlieren drohte. Daher richtete sie ihre Gedanken wieder auf die Vergangenheit. »Ich habe euch bereits geschildert, dass Vater sich mehr als alles andere nach Anerkennung sehnte. Deshalb wollte er auch eine glänzende Heirat für mich ausrichten. Als ich siebzehn war, wurde ihm ein Bräutigam für mich angetragen. Es handelte sich um einen Bastard des Keilburgers. Graf Heinrich von Keilburg war im Schwarzwald und Umgebung gut begütert und setzte alles daran, die Habsburger, die Württemberger und die Zähringer in Baden zu übertreffen und der mächtigste Herr im alten Herzogtum Schwaben zu werden.
Ein junger Mann adeliger Herkunft, zudem ein gelehrter Magister – das stach meinem Vater ins Auge. Als Kaufmann war er klug und geschickt, aber in dieser Angelegenheit ließ er sich wie blind am Nasenring führen. Ehe ich michs versah, hatte er trotz meiner Jugend der Heirat zugestimmt und stellte mir Ruppertus Splendidus als meinen Bräutigam vor. Ich muss gestehen, ich hatte Angst vor dem Mann. Er war kalt und zeigte keinerlei Zuneigung zu mir, sondern behandelte mich wie einen Gegenstand, den er mit erwerben musste, um in den Genuss meines Erbes zu gelangen. Aber das war noch viel zu gut von ihm gedacht!«
Die Erinnerung ließ Marie zittern, und sie hielt sich eine Zeit lang schweigend an ihrem Becher fest. Danach trank sie langsam einen Schluck Wein und erklärte Alika und Margarete, sie sei zu erschöpft, um weitersprechen zu können.
»Lasst uns morgen fortfahren«, setzte sie hinzu und sagte nach einem tiefen Atemzug, dass sie ein wenig auf dem Söller schlafen wolle.
7.
Am nächsten Vormittag erledigte Margarete rasch ihre Pflichten als Burgherrin und eilte dann zu ihrer Schwiegermutter. Zu ihrer Erleichterung fand sie Marie wach und auf einem Stuhl sitzend vor. Alika hatte ihr beim Anziehen geholfen und auch für ein Frühstück gesorgt, das Marie zwar kräftigte, ihr aber nicht zu schwer im Magen lag.
»Und wie ist es? Konntest du schlafen, ohne dass dich Albträume gequält haben?«, fragte Margarete.
Maries Miene wurde ernst. »Ich hatte Albträume, schlimme sogar! Aber ich bin von selbst wach geworden, noch bevor Alika zu mir gekommen ist.«
»Fühlst du dich in der Lage, uns heute Weiteres zu berichten?«, fragte Margarete weiter.
»Das tue ich«, antwortete Marie mit dem Versuch, zu lächeln. »Es wird mir nicht leichtfallen, doch ich spüre, dass ich es tun muss, wenn ich nicht von den Erinnerungen erdrückt werden will.«
»Dann wollen wir auf den Söller steigen!«, sagte Alika und half Marie vom Stuhl, da ihre Freundin noch schwach auf den Beinen war.
Margarete und sie führten Marie zum Söller, packten sie warm ein und sorgten dafür, dass Getränke und ein paar Bissen für den Hunger zwischendurch bereitstanden. Dann setzten sie sich zu Marie und sahen sie erwartungsvoll an.
»Wo war ich gestern stehen geblieben?«, fragte sie und gab sich selbst die Antwort. »Ach ja, bei der Werbung des Keilburger Bastards Ruppertus Splendidus. Während ich vor dem Mann Angst hatte, war mein Vater entzückt. Mit einem solchen Schwiegersohn, so dachte er, könne er nicht nur zu den ehrenwerten Geschlechtern von Konstanz aufschließen, sondern die meisten von ihnen sogar übertreffen.
Und so ging auf einmal alles sehr schnell. Ehe ich michs versah, war die Verlobung geschlossen und der Tag der Hochzeit festgelegt. Am Abend zuvor kam Michel in unser Haus. Er brachte das Fass mit dem Hochzeitsbier, das am nächsten Tag ausgeschenkt werden sollte, und wollte mich vor Ruppertus warnen. Er habe Dinge über diesen Mann gehört, behauptete er, die einem die Haare zu Berge stehen ließen.
Ich habe ihm nicht geglaubt – oder, besser gesagt, ich wollte ihm nicht glauben. Doch so oder so hätten seine Erklärungen nichts an dem geändert, was nun geschah. Ruppertus tauchte kurz danach auf, um den Heiratsvertrag von meinem Vater unterzeichnen zu lassen. Den Text der Urkunde hatte er selbst entworfen! Oh ja, er konnte Verträge aufsetzen, die so heimtückisch waren, dass man die Fallen erst viel zu spät bemerkte. Auch meinem Vater fielen gewisse Formulierungen nicht auf, da es für ihn keinen Grund dafür gab, misstrauisch zu sein.«
Marie seufzte. Ihre beiden Zuhörerinnen spürten, dass sie das, was damals geschehen war, noch einmal in Gedanken erlebte, und wagten es nicht, sie zu stören. Schließlich schüttelte Marie sich, trank einen Schluck Wein und setzte ihren Bericht mit angespannter Miene fort.
»Ich lag bereits im Bett, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und der Ratsherr Jörg Wölfling und der Leinweber Gero Linner ins Zimmer traten und mich der Hurerei beschuldigten. Die beiden hatten den Heiratsvertrag als Zeugen unterzeichnet – und doch hatte Magister Ruppertus sie dazu ausersehen, mich zu verderben!«
»Zu verderben?«, rief Margarete entsetzt. »Weshalb eigentlich? Du hättest ihm doch ein reiches Erbe gebracht!«
Marie lachte bitter. »Es war ein teuflischer Plan, wie ihn nur ein Mann wie Magister Ruppertus ersinnen konnte. Hundert andere an seiner Stelle wären gescheitert. Ihm jedoch gelang es, denn er hatte seine Fäden geschickt gewoben. Kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags ist der Fuhrmann Utz Käffli erschienen und hat mich beschuldigt, mit ihm Unzucht getrieben zu haben. Er war eine von Ruppertus’ Kreaturen und diese Untat wohl eine der geringsten, die er im Auftrag des Magisters beging.
Mein Vater verwahrte sich natürlich dagegen. Da behauptete auf einmal unser Handelsgehilfe Linhard Merk, ich hätte mich auch ihm bereits heimlich hingegeben. Der Magister hatte ihn ebenfalls dazu gebracht, mich zu beschuldigen, denn Linhard hatte gehofft, mich später einmal heiraten und der Nachfolger meines Vaters werden zu können. Dies aber hatte mein Vater ihm mit harten Worten abgeschlagen. Doch ich verzettle mich … Lasst mich also berichten, wie es weiterging!
Wölfling und Linner kamen also in meine Kammer und erklärten, ich wäre beschuldigt worden, eine Hure zu sein. Beide waren betrunken, und daher hatte Ruppertus sie leicht zu Dingen überreden können, die sie nüchtern niemals getan hätten. Sie durchsuchten meine Kammer und fanden ein Schmuckstück, das der Fuhrmann Utz Käffli mir angeblich für die Gewährung meines Leibes gegeben haben wollte – einen geschnitzten Schmetterling aus Perlmutt.
Damit galt ich als überführt und wurde von dem hinzugerufenen Stadtbüttel Hunold in den Ziegelturm gebracht. Ich konnte dies alles nicht begreifen und fragte mich, weshalb mein Vater sich nicht für mich einsetzte und den Magister in seine Schranken verwies. Erst viel später habe ich von meinem Onkel Mombert erfahren, dass meinen Vater aufgrund der üblen Beschuldigung der Schlag gerührt hatte und er nicht mehr dazu in der Lage gewesen war.«
Marie machte erneut eine Pause, und ihr Gesicht nahm einen Ausdruck an, der selbst nach so vielen Jahrzehnten noch die Verzweiflung spiegelte, die sie damals gepackt hatte. Sie überlegte sogar, ob sie wirklich von dem sprechen sollte, was danach geschehen war. Da sie jedoch erklärt hatte, auch das Schlimmste aus ihrem Leben zu berichten, würde sie nichts verschweigen. »Ich wurde also in einer Kammer im Ziegelturm eingesperrt und hoffte, es wäre alles nur ein Albtraum und ich würde bald in meinem Bett erwachen«, berichtete sie mit leiser Stimme. »Es war jedoch kein Traum, sondern grausame Wirklichkeit. In der Nacht tauchten Hunold – auch er ein williges Werkzeug des Magisters! –, der Fuhrmann Utz und Linhard Merk in der Kammer auf und haben mir Gewalt angetan, um am nächsten Tag vor Gericht bei Gott schwören zu können, mit mir Unzucht getrieben zu haben.«
»Oh Gott, nein!«, rief Margarete entsetzt.
»Ruppertus’ Plan war noch viel infamer«, fuhr Marie fort. »Ich habe euch bereits von der Witwe des Schusters erzählt. Euphemia hatte darauf gehofft, meinen Vater heiraten zu können, doch er wies sie ab. Wie bei Linhard war es für Magister Ruppertus auch bei ihr ein Leichtes, sie für seine Pläne zu gewinnen. Sie kam mit dem Auftrag, mich zu untersuchen, und ich flehte sie an, zu beschwören, dass ich vergewaltigt worden war. Sie lachte mich jedoch nur aus und schwor am nächsten Tag vor Gericht, sie hätte mich nicht mehr als Jungfrau vorgefunden. Da auch Linhard und der Fuhrmann die Hand zum Schwur hoben, erklärte der Richter meine Schuld als erwiesen. Ich wurde zu dreißig Rutenhieben und zur lebenslangen Verbannung aus Konstanz verurteilt. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Derjenige, der die Rute führte, war Hunold, und dem lag sehr viel daran, mich so zuschanden zu schlagen, dass ich wie ein Tier krepieren sollte.«
»Daher rühren also die Narben auf deinem Rücken«, rief Margarete.
»Sie sind aber gut verheilt«, sagte Alika. »Ich habe schon schlimmere Narben gesehen.«
»Das ist Hiltruds Verdienst. Aber dazu später! Nachdem ich ausgepeitscht worden war, wurde ich zur Stadt hinausgeschleift. Ich bestand nur noch aus Scham, Schmerz und Verzweiflung, klammerte mich aber an die Hoffnung, mein Vater würde mir folgen und mir helfen. Es war eine Hoffnung, die erst nach Wochen schwand. Viel später habe ich erfahren, dass mein Vater tatsächlich die Absicht hatte, mir zu folgen und mich irgendwo unterzubringen, wo ich in Frieden hätte leben können. Da er durch den erlebten Schrecken krank geworden war, sollte Onkel Mombert ihn begleiten. Doch beide hatten nicht mit Ruppertus’ Heimtücke gerechnet. Als Advocatus hatte dieser den Heiratsvertrag so aufgesetzt, dass ihm Vaters Vermögen auch ohne Heirat zufallen würde, wenn ich keine ehrengeachtete Jungfrau wäre. Durch den Schuldspruch war ich das natürlich nicht mehr. Daher erhielt Ruppertus alles, was meinem Vater gehört hatte, und Matthis Schärer war damit zu einem Bettler geworden, der nicht einmal mehr sich selbst, geschweige denn mir helfen konnte. Ruppertus muss ihn gefangen gehalten haben, denn mein Vater wurde wenige Wochen später in aller Heimlichkeit auf dem Armenfriedhof verscharrt.«
Marie war nicht anzusehen, ob sie nun Trauer empfand oder Wut über das, was damals passiert war. Sie richtete den Blick auf einen weit entfernten Punkt am Horizont, und ihre Gedanken weilten offensichtlich in jener Zeit. Es war, als spüre sie die Verzweiflung von damals erneut, und es kostete sie Kraft, weiterzusprechen. Sie berichtete nun nicht über sich selbst, sondern über Ruppertus’ schrecklichen Plan und den Prozess.
»Es ging alles so schnell, dass ich bereits weit außerhalb der Stadt war, bis man dort begriff, dass meine Verurteilung gegen das Recht und das Gesetz von Konstanz verstoßen hatte. Ruppertus hatte mich vor ein kirchliches Gericht gebracht, mit dessen Richtern er gut bekannt war. Als Tochter eines Konstanzer Bürgers hätte jedoch nur das städtische Gericht eine Strafe über mich verhängen dürfen.
Bis die Ratsherren erkannten, dass man die Rechte der Stadt schmählich übergangen hatte, war es für meinen Vater und mich zu spät. Magister Ruppertus legte zudem unanfechtbare Verträge vor, die ihm den Besitz meines Vaters sicherten. Allerdings verlor Jörg Wölfling seinen Sitz im Rat, weil er gegen mich als Zeuge ausgesagt hatte, anstatt auf die Rechte der Stadt zu pochen.«
Marie rieb sich übers Gesicht und bat um einen Schluck Wein. Mit einem verkrampften Lächeln nahm sie ihn entgegen, trank und sah Margarete und Alika nachdenklich an. »Was nun folgt, ist nicht mehr nur meine Geschichte, sondern auch die anderer Menschen. Da ich auch von fremden Schicksalen berichten will, werde ich von nun an so erzählen, als hätte ich alles von jemandem gehört.«
»Mir soll es recht sein! Aber willst du es nicht auf morgen verschieben? Du bist gewiss erschöpft«, wandte Margarete ein.
»Es ist schon gut«, wehrte Marie ab. »Diese eine Geschichte will ich euch heute noch erzählen. Auch wenn sie nicht mich betrifft, ist sie doch wichtig für das, was noch folgen wird.«
8.
Es war ein nebliger Tag, und die Luft zog feucht und kalt durch das vergitterte Fenster herein. Linetta fröstelte und kämpfte mit den Tränen. Bald sollte sie sterben. Dabei war sie erst zehn Jahre alt und mehr als neun davon von den Eltern geliebt und verhätschelt worden. Was der Tod war, wusste sie, seit man ihren Vater vor wenigen Wochen stumm und starr im Bett gefunden hatte und er wenige Tage später in der Gruft der Grabkapelle von Hohenstein beigesetzt worden war.
Ein zweites Mal hatte sie den Tod aufs Entsetzlichste kennengelernt, als ihre Mutter nur kurze Zeit später als Hexe beschuldigt und zum Tode durch Ertränken verurteilt worden war. Ausgerechnet der Bruder ihres Vaters, ihr Onkel Karl, hatte diese Anklage vorgebracht. Linetta hatte es kaum glauben können, denn nur wenige Tage zuvor hatte der Onkel ihrer Mutter und ihr versichert, er würde alles tun, damit der Verlust des Mannes und des Vaters sie nicht zu sehr bedrücken würde.
Doch plötzlich hatte er behauptet, die Mutter hätte seinen Bruder verhext, weil dieser der Tochter den Besitz vererbt hätte und nicht ihm, dem Bruder, wie es bei ihnen Sitte sei, da das Erbe stets im Mannesstamme weitergegeben werden müsse.
Die Mutter hatte ihn zuerst nicht ernst genommen. Schließlich gab es ein gesiegeltes und von Zeugen beglaubigtes Testament. Doch die Bewohner hatten dem Onkel zu leicht und zu gerne geglaubt. In ihren Augen war die Mutter eine Fremde geblieben, eine, deren Muttersprache anders war als die ihre und deren Sitten und Gebräuche nicht den ihren entsprachen.
Bis die Mutter die Gefahr erkannt hatte, war es zu spät gewesen. Das Urteil wurde gefällt, und zwei Tage später hatte Linetta mit ansehen müssen, wie die in ein härenes Kleid gehüllte und gefesselte Mutter in einen Sack gesteckt und in den Teich geworfen worden war. Eine halbe Stunde später hatte der Abdecker sie tot aus dem Wasser gezogen und auf dem Schindanger vergraben. Linetta hatte nicht einmal an ihrem Grab beten dürfen.
Nun würde sie den gleichen Weg gehen müssen wie ihre Mutter. Linetta hatte dabei weniger Angst vor dem Ertränken, als die Leute glauben mochten. Wenn sie tot war, würde sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater vereint sein, und die Muttergottes würde ihre Tränen trocknen.
Linetta hörte Schritte und wich bis ans andere Ende des Kerkers zurück. Trotz stieg in ihr auf. Sollte ihr Onkel unter ihnen sein, würde sie ihm ins Gesicht sagen, was sie von ihm hielt. Er war ein Mörder, denn er hatte ihre Mutter umgebracht. Womöglich hatte er sogar ihren Vater getötet. Johann von Hohenstein war erst Mitte dreißig gewesen und ein bärenstarker Mann, der mit einem einzigen Faustschlag einen Ochsen hatte betäuben können. Und doch war er ganz plötzlich gestorben.
Nun würde nicht die Mutter und auch nicht sie selbst sein Erbe antreten, sondern ihr Onkel Karl. Um es für die Familie zu erhalten, wie er behauptet hatte. Dabei war das eine Lüge. Er war ein Kirchenmann, und laut Gesetz fiel ein Besitz, den einer von ihnen erbte, nach dessen Tod der Kirche zu und nicht anderen Verwandten.
Die Tür wurde geöffnet, und zwei Männer kamen herein. Linetta biss die Lippen aufeinander, um sie nicht anzuschreien, denn sowohl Robert wie auch Sigi hatten als treue Gefolgsleute ihres Vaters gegolten. Jetzt würden sie sie ins Wasser werfen, in dem sie den Tod finden würde.
»Hast du den Sack bei dir?«, fragte Sigi.
Robert schüttelte den Kopf. »Ich dachte, den bringst du mit.«
»Jetzt muss einer von uns gehen und ihn holen. Mach du das – und beeile dich! Der Herr sagte, es soll schnell gehen.«
»Das kostet dich aber ein Bier!«, erwiderte Robert. »Und der Herr hat hier wahrlich christlich gedacht, denn damit muss das Mädchen nicht so lange Todesangst erleiden.«
Linetta wäre am liebsten in ein höhnisches Lachen ausgebrochen, denn sie hielt ihren Onkel für so christlich, wie ein Auerochse sanft war. Nun sah sie, dass Robert hastig davoneilte. Auch Sigi blickte ihm nach und kam auf sie zu.