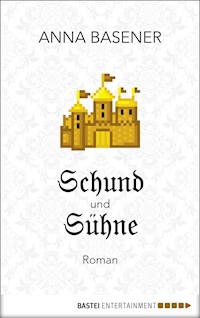9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die juten Sitten
- Sprache: Deutsch
Sex und Lust, Prunk und Schmutz – willkommen im verruchtesten Bordell der deutschen Kaiserzeit!
Berlin, 1935: Schweren Herzens schließt Minna ihr geliebtes Bordell »Ritze«, um in Frankreich ein neues Leben zu beginnen. Auf der Zugfahrt nach Nizza erzählt sie dem jungen Stricher Emil und ihrem alten Konkurrenten Gustav, wie alles begann – damals zur Kaiserzeit: Wie sie es von der mittellosen Arbeiterin zur Lieblingsdirne eines Herzogs brachte, sich Hals über Kopf in den Zeremonienmeister des Kaisers verliebte und schließlich ihr eigenes Bordell eröffnete. Und wie eine Orgie im Jagdschloss Grunewald zu einem Duell mit verheerenden Folgen führte ...
Der dekadente Glanz der Jahrhundertwende – der Roman zum erfolgreichen Audible-Hörspiel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Berlin 1935: Schweren Herzens schließt Minna ihr geliebtes Bordell »Ritze«, um in Frankreich ein neues Leben zu beginnen. Auf der Zugfahrt nach Nizza erzählt sie dem jungen Stricher Emil, wie alles begann: Wie sie es von der armen Arbeiterin zur Lieblingsdirne eines Herzogs brachte, sich Hals über Kopf in den Zeremonienmeister des Kaisers verliebte und schließlich ihr eigenes Bordell eröffnete. Mit Herzenswärme und ein bisschen Wehmut lässt Minna den längst vergangenen Prunk der Jahrhundertwende auferstehen. Noch ahnt sie nicht, dass ein weiterer Mann sie auf ihrer Reise begleiten und nie wieder von ihrer Seite weichen wird …
Autorin
Anna Basener schreibt Bücher und Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Ihr Debütroman »Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte« gewann 2018 den Putlitzer Preis und hatte 2019 als musikalische Komödie Premiere am Schauspiel Dortmund. Essays, Kolumnen, Nachrufe und Reportagen von Anna Basener erschienen bei NEON, Business Punk und auf ZEIT ONLINE. Ihre beiden Hörspiele »Die juten Sitten – Goldene Zwanziger. Dreckige Wahrheiten« und »Die juten Sitten – Kaiserwetter in der Gosse« waren bei Audible Riesenerfolge.
Weitere Informationen unter www.annabasener.de
Anna Basener
Die juten Sitten
Kaiserwetter in der Gosse
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Dieser Roman basiert auf dem gleichnamigen Hörspiel, das bei Audible erschienen ist.
Originalausgabe Juli 2021
Copyright © 2021 by Anna Basener
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotive: FinePic®, München
Redaktion: Bärbel Brands
LS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26096-5V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Abends um halb neune,
Wenn Hulda ganz alleine,
Fängt ihr Herzchen an zu puppern,
Nach dem Bräut’gam tut sie schnuppern.
Wenn sie endlich ihn erblickt,
Schreit sie laut und ist entzückt:
»Siehste wohl, da kimmt er,
Jroße Schritte nimmt er,
Komm doch an mein Herze schon,
Fipps, mein oller Kronensohn!«
Berliner Kreuzpolka
Frauenarbeit
Berlin, 1935
Sieht aus wie eine Kirche, der Bahnhof. Lange Fenster mit Rundbögen, dahinter blauer Himmel. Ein Maihimmel in Berlin, und um Minna herum dampfende Ungeheuer, die sie aus der Stadt entführen wollen, als wär sie eine Jungfer in Gefahr. Sie steht in ihrem braunen Cordkostüm am Bahnsteig und drückt den Sommermantel an die Brust. Die Gleishalle ist aus Sandstein. Sie wölbt sich über den Reisenden, umschließt sie wie ein dicker Bauch. Minna fühlt sich verschluckt. Um sie herum wuseln Kofferträger durch diesen Bauch wie Bläschen im Champagner. Minna wuselt nicht. Sie ist mehr eine Bulette, die hier reingeplumpst ist. Ihr ist nicht nach wuseln, sie könnte sich auch einfach hier hinlegen. Hat’s ja eh kaum aus dem Bett geschafft, heute Morgen. Aufstehen mit diesen Knochen? … Da wünschst du dir fast, du wärst doch wieder im horizontalen Gewerbe, da könnteste wenigstens liegen bleiben. Einfach immer liegen bleiben. Aber liegen ist ja kein Leben.
»Minna!«, ruft Emil. »Jetzt komm, wir müssen einsteigen.«
Durch die Kirchenfenster fällt goldenes Licht auf seinen Sonnenschopf. Der Junge strahlt über beide Ohren. Minna darf ihn nicht mehr Junge nennen, er ist jetzt ein Mann, sagt er. Er hat immer noch dieses Milchgesicht. Aber er macht sich, also sollte sie ihm den Gefallen wohl tun. Sie will auch. Vergisst es nur immer wieder.
»Minna!«
»Wat zur Hölle soll ick in Frankreich?«, fragt sie sich leise.
»Denkst du, ich trag dich da rein?« Emil steht plötzlich vor ihr. In seinem Alter ist man noch flink, ein tanzendes Champagnerbläschen. Minna sieht ihn an mit seinen geröteten Wangen. Könnte glatt auf ne Kekspackung, das Gesicht.
»Vielleicht war det doch keine jute Idee«, sagt sie.
»Minna, wir haben das hundert Mal besprochen. Außerdem: Du kannst nicht zurück in die Ritze. Du hast sie verkauft.«
»Det mein ick. Schlechte Idee.«
»Minna, das war eine gut überlegte Entscheidung«, doziert der Junge, der jetzt ein Mann ist. »Du hast ne feine Summe dafür bekommen. Und jetzt geht’s nach Paris für dich.« Emil strahlt. »Stadt der Liebe.«
Minna schaut zu dem dampfenden Zug, als fürchte sie, von ihm verdaut zu werden. »Die Sache ist mulmich.«
»Du bist nur aufgeregt, weil es deine erste Reise ist.« Emil schaut verständnisvoll. »Ich war schon weg, und ich bin trotzdem aufgeregt.«
»Det sieht man.«
»Der Siebzehndreißig nach Nizza über Paris. Einsteigen, bitte …«, ruft der Schaffner, und Emil nimmt Minnas Hand.
»Minna, jetzt komm schon.«
»Du kannst auch alleine fahren«, sagt sie und hält seine Hand fest.
»Du kannst nicht hierbleiben.« Er sieht ihr tief in die Augen. »Das ist nicht mehr das Berlin, das du kennst.«
»Ick kenn viele Berlins, Emil.«
Er schüttelt den Kopf. »Aber keins davon war wie dieses. Jetzt komm, dein Gepäck ist doch schon drin.«
Minna schaut auf ihre Füße, sie wollen sich nicht bewegen. Sie wollen den Berliner Boden nicht verlassen. Sie sind tonnenschwer.
»Hedwig ist in Paris«, sagt Emil jetzt. »Willst du sie wiedersehen oder nicht?«
Minna geht einen kleinen Schritt vorwärts, dann noch einen.
»Na also.«
Emil greift Minnas Arm und zieht sie zum Zug. Sie stolpert aufs Trittbett und dann rein in das Ungeheuer. Die Wände sind aus glänzendem Kirschbaumholz, selbst die Tür zum Lokus ist poliert. Nachtzug erste Klasse, weil Emil einen reichen Liebhaber hat. Wo auch immer der das Geld herhat. Weißt du ja nie so genau bei Doktor Magnus Hirschfeld. Behandelt wahrscheinlich eine sehr reiche, sehr heimliche Transe. Oder mehrere. Wahrscheinlich mehrere.
»Komm, unser Abteil ist da vorn«, sagt Emil und wird vom Pfeifen des Schaffners übertönt. Er führt Minna durch Mitreisende und Gepäck zu einer Glastür mit dunkelroten Vorhängen. Dunkelrote Vorhänge, das kennt sie gut von früher. Aber die damals waren schwerer und teurer. Bessere Qualität, verglichen hiermit. Sieht Minna sofort.
Der Zug setzt sich mit einem Ruck in Bewegung. Minna fällt gegen Emil und dann gegen das Fenster. Sie fahren aus dem Sandsteinbauch hinaus, durch majestätische Steinbögen und dann durch Kreuzberg. Minna hat noch keine Nacht außerhalb dieser Stadt verbracht, und schon gar nicht in einem Zug. Aber Berlin wird heute zum ersten Mal seit zweiundsechzig Jahren ohne sie ins Bett gehen. Sie schaut aus dem Fenster.
»Schlaf rund«, flüstert Minna, »dette nicht eckig wirst.«
Emil öffnet eine Schiebetür und fragt sie, welche Seite sie wolle. Sie sieht es aus dem Augenwinkel und schaut auf die Stadt. Seiten interessieren sie nicht. Von was überhaupt?
»Minna?« Emil kommt zu ihr ans Fenster und guckt auch raus auf die rußbraunen Mietshäuser und die grünen Bäume. »Kein Wunder, dass das hier nicht die Stadt der Liebe ist.«
»Halt die Klappe«, brummt sie.
Sie schweigen, während der Zug schnauft und schnauft und es offensichtlich gar nicht erwarten kann, diese Stadt zu verlassen.
»Mir wird Berlin auch fehlen«, gibt Emil schließlich zu.
Minna nickt und wendet sich ab. Zwei Schritte über den Gang in das kleine Abteil, rechts eine Sitzbank, links eine Sitzbank, beide dunkelrot, dazwischen ein Klapptisch. Auf der einen Seite über der Rückenlehne ist ein schmaler goldgerahmter Spiegel, der von der Glaswand bis zum Fenster reicht. Schlichter Rahmen, keine Schnörkel. Ist Minna unerklärlich, warum man dann überhaupt Gold nimmt. Wenn schon Prunk, dann doch richtig, oder? Aber gut, hat halt nicht jeder gesehen, was sie gesehen hat. Auf der anderen Seite die Gepäckablage und ein kleines Regalbrett. Emil legt seinen Hut drauf und schiebt die Tür hinter ihnen zu. Er trägt jetzt Filzhut im City-Stil, wenn er nicht im Dienst ist und Geld damit macht, auszusehen wie ein Kind.
»Aus den Bänken machen wir nachher die Betten«, erklärt er. »Welche Seite willst du?«
Minna ist es Jacke wie Hose. Sie zeigt auf die rechte Bank, während er seine Lederjacke an den Haken hängt. Er setzt sich ans Fenster, sie bleibt stehen.
»Soll ich dir den Mantel abnehmen?«
Minna hebt eine Augenbraue. »Det wär ja det erste Mal.«
Emil zuckt mit den Schultern. »Dann halt ihn eben fest.«
»Nee.« Sie hängt den Mantel auf und legt ihren Hut neben Emils. Sie setzt sich ihm gegenüber und ächzt leise.
»Was ist denn so toll an Berlin?«, fragt Emil.
»Jeht ja gar nicht um die Stadt.«
»Nicht?«
»Dir fällt’s vielleicht leicht, die Ritze zu verlassen. Für euch war det immer nur ’n Haus wie jedet andere …«
Emil lacht. »Kein Haus ist wie die Ritze, Minna. Es ist das kleinste Haus der Welt.«
»Ja … Aber es war meins, Emil.«
»Und jetzt hast du genug, um in Paris ein neues Leben anzufangen.«
Minna schaut aus dem Fenster. »Ick dachte immer, die Ritze ist det Haus, in dem ick sterben werde, Emil. Ick bin die Ritze, und die Ritze ist icke! Solange ick lebe, wird kein anderer Name im Grundbrief stehen als meiner! Det dachte ick …« Die Stadt verschwimmt vor ihren Augen, sie ist kaum noch Wirklichkeit.
»Gut, verstehe.«
Minna winkt ab. »Du verstehst jar nüscht.«
»Dann erklär’s mir.«
»Wenn du in den letzten acht Jahren nicht begriffen hast, wat dieses Haus für mich bedeutet, dann kann ick dir nicht helfen.«
Er runzelt die Stirn. »Aber …«
»Ick hatte die Ritze vierzig Jahre lang«, unterbricht sie ihn. »Vierzig. So weit kannst du gar nicht denken.«
»Zurück nicht, nein.«
»Jut, waren nur neununddreißig Jahre, aber ick hab mehr Lebenszeit in diesem Loch verbracht als irgendwo anders. Ick fühl mir, als hätte man mir den Arm amputiert.«
»Das geht aber doch vorbei. Und es tut dir auch mal gut, dich ein bisschen auszuruhen.«
»Fühl mich wie ne Schildkröte, die man aus ihrem Panzer jerissen hat.«
»Aber du hast doch auch schon vor der Ritze gelebt. Wenn das damals ging, geht es jetzt auch, Minna.«
»Damals …« Sie schnaubt. »Da war ick ’n anderer Mensch. Wo sind eigentlich meine Zigarillos?«
Minna sucht in ihrer Jackentasche, dann in ihrer Handtasche. Sie findet die Schachtel und nimmt sich einen raus. Emil beugt sich mit seinem Feuerzeug zu ihr. Geschenk von Magnus natürlich.
»Wie warst du denn vorher?«, fragt er.
»Jung und schön.«
»Und wie bist du an das kleinste Haus Berlins überhaupt drangekommen?«
Sie füllt das Abteil mit Rauch und wischt mit der Hand durch die Schwaden. »Ach, ick will eigentlich nicht drüber reden.«
»Gut, ich …«
»Det waren janz andere Zeiten damals«, unterbricht sie ihn wieder. »Und ick hatte janz andere Träume. Oder zumindest hab ick mir nicht die Ritze erträumt.«
»Wir müssen auch nicht …«
Weiter kommt er nicht.
»Es ist ne sehr lange Geschichte, und ick kann mir auch jar nicht an allet erinnern. Und ick bin wahrlich nicht stolz auf det, wat ick jetan habe, damals. Also zumindest nicht auf diese eine Sache.«
»Klar, ich …«
»Also«, unterbricht Minna ihn, »det Jahr war 1895 …«
Berlin, 1895
Minna sitzt seit Stunden aufm Lokus. Ihre Finger sind schon ganz blau, zumindest soweit sie das im Licht der Gaslaterne sehen kann, die sie an die Tür gehängt hat. Der Holzboden unter ihren Stiefeln ist mit einer dünnen Eisschicht überzogen. In ihrer Hand hält sie das letzte Stück Zeitung. Sie hatte einen ganzen Stapel Zeitungspapier dabei, um sich sauber zu wischen, aber es war so viel Blut, dass sie ihn schon aufgebraucht hat. Sie streicht über die Zeichnung auf dem letzten Blatt der Gazette. Eine Karikatur von zwei feinen Damen mit prächtigen Hüten, für deren Schmuck ein Dutzend Vögel sein Leben gelassen hat, mindestens. Die Damen sitzen in einem Café und spreizen den kleinen Finger von der Tasse ab. Ihre Stühle bestehen aus aufeinandergestapelten Arbeitern. Kleine dreckige Figuren, die sich gegenseitig zerquetschen, nur damit die Damen auf ihnen in Ruhe ihre grotesk fettige Torte essen können.
Minna weiß, dass das eine Kritik an der Gesellschaft ist, dass sie wütend über die Ungerechtigkeit der Welt werden soll und alles daransetzen, diesen Damen ihren Reichtum zu nehmen. Aber alles, was sie denken kann, ist, wie gern sie jetzt auf diesem Stuhl säße. Wie gern sie von solchen Männern – sie kennt solche Männer, und ungefähr drei von denen könnten für das ganze Schlamassel hier verantwortlich sein –, wie gern sie jedenfalls von denen durch die Welt getragen würde, anstatt immer nur unter ihnen zu liegen. Die Zeitung denkt, dass diese Männer ganz unten sind, aber bevor die sich gegenseitig zerquetschen, zerquetschen sie die Frauen. An die Frauen haben die feinen Herren bei der Zeitung nicht gedacht.
Minna schreit auf. Es zerreißt ihr Innerstes. Es ist gut, sagt sie sich. Was willst du mit einem Blag? Du weißt nicht mal so genau, wer der Vater ist, und du willst ihn schon gar nicht heiraten. Und das müsstest du. Leider. Kriegst die Kerle ja sonst nicht dazu, das Kleine mit durchzufüttern. Musst sie schon an dich binden, damit sie Verantwortung übernehmen. Ob du willst oder nicht. Und Minna will nicht. Nicht mal, wenn es Willi ist, und den mag sie. Ist ein Lieber. Kurt auch. Kurt wäre auch eine Möglichkeit und ein feiner Kerl. Beide hübsch, haben auch einmal um sie gekämpft. Kleine Prügelei vorm Pankower Eck. Denn Minna hat die schönsten Haare in der Straße, und das gefällt. Und Kurt hat schöne Augen und Willi diese tolle Stimme. Erlaubt ist, was gefällt, klar. Aber deshalb gleich heiraten?
Dass es besser so ist, sagt Minna sich, aber diese Worte erreichen ihren Unterleib nicht. Da unten ist nichts »besser«, nicht mal gut. Dort schlachtet ihr Körper sich selbst. In ihrer Unterhose ist ein Blutfleck so groß wie eine Faust. Lächerlich gegen das, was unter ihr in den Lokus fließt. Im Schwall. Minnas Muschi ist ganz heiß davon, sie ist ein Schmerzsommer, während ihre Füße Winter sind. Seit einer Stunde fühlt Minna da unten in den Stiefeln gar nichts mehr. Die ganze Nacht auf dem Lokus. Hoffentlich hat sie noch alle Zehen, wenn das hier vorbei ist. Opa hat letzten Winter zwei verloren, und der dritte ist seit zwei Wochen auch schwarz. Bald hat er mehr Zähne als Zehen. Dabei braucht der weder Zehen noch Zähne, um ihnen die Haare vom Kopf zu saufen. Er trinkt eher mehr, je weniger er wird.
Minna stöhnt. Blut fließt in den Abort. Jetzt muss ick aber wirklich leer sein, denkt sie. Es klopft an der Tür.
»Ey! Wird det heut noch wat, meine Schicht fängt gleich an.«
Statt einer Antwort schreit Minna auf. Draußen Stille, drinnen keucht sie. Ihre Finger zittern.
Als sie aufsteht, schwankt der Boden unter ihr, aber sie schätzt, dass es vorbei ist. Sie schaut auf ihre Unterhose. Vielleicht ist das gar kein Blutfleck, vielleicht ist es da drin. Man weiß ja nie, wann genau es rausrutscht. Minna richtet ihr Kleid, wickelt das Tuch wieder eng um ihren Oberkörper und greift nach Wassereimer und Gaslaterne. Sie erlischt, als Minna die Tür öffnet. Wie nett, dass die Laterne so lange durchgehalten hat.
Draußen steht eine Schlange, finstere Augen starren Minna an, sie verschwimmen etwas, sodass sie nicht zählen kann, wie viele Paare es sind.
»Wat war ’n det für ’n Jeschrei?«, fragt einer ihrer Nachbarn und lacht. »Wir dachten schon, du bist vielleicht jar nicht allein.«
»Doch, jetzt schon«, murmelt Minna im Vorbeigehen. »Jetzt bin ick wieder alleine.«
Minna öffnet die Wohnungstür, hängt die Gaslaterne zurück an den Haken und kippt das mitgebrachte Wasser aus dem Eimer zur Hälfte in den Wasserkessel. Im Ofen knistert ein Feuer, ihr Bruder steht an der kleinen Spiegelscherbe und rasiert sich mit dem Rest Wasser von gestern.
»Haste nur einen Eimer jeholt?«, fragt Peter.
»Kannst froh sein, det ick den überhaupt hochjeschafft hab«, antwortet sie.
»Sei du lieber froh, det ick schon mal Feuer jemacht hab.«
»Jaja.«
Opa dreht sich auf der Küchenbank um und schnarcht weiter. Minna zwängt sich an ihm und Peter vorbei in die Ecke, in der der Einweicheimer steht, nimmt den Deckel ab und gießt die andere Hälfte Wasser rein.
Peter lässt das Rasiermesser sinken und starrt sie an. »Ey, wat soll’n dette? Ick brauch det janze Wasser.«
»Dann musste noch welchet holen gehen«, sagt sie ruhig. Erschöpfung bringt auch Gelassenheit.
»Ist det meine Aufgabe?
»Nee, du hast keine Aufgaben«, antwortet sie.
»Schütte det sofort alles in den Kessel, Minna«, verlangt er.
Minna starrt zurück, hebt ihren Rock und bindet ihre Unterhose auf. Sie zieht sie aus, knüllt sie zusammen und wirft sie in den Eimer. Die weiße Baumwolle saugt sich voll, das Blut schwimmt bereits davon.
»Wirklich?«, fragt sie. »Soll det in den Kessel für Kaffee?«
»Du blöde Schlampe.«
Minna zuckt mit den Achseln, öffnet die Salzdose und gibt eine Schüppe Salz in den Eimer. Sie legt den Deckel drauf und schiebt alles in die Nische zwischen Herd und Küchenbank zurück.
»Haste wieder die Beine breit jemacht, wa?«
Sie sieht ihn an. »Peter, es jeht mir nicht so jut.«
»Und wessen Schuld ist dette? Glaubst du, ick hatte ’n schönen Morgen? Papa hat Opa eine runterjehauen, bevor er zur Schicht ist. Opa hat ihn dann jebissen.«
Das kann sich mit diesen Zähnen natürlich schnell entzünden. Alles kann sich immer schnell entzünden. Minna geht zur Tür. Peter redet weiter, als bekäme er das gar nicht mit. Er redet von dem Gezeter der beiden Alten, das ihm den Tag versaut hat, und dass auf ihn ja eh keine Rücksicht genommen wird.
Ja. Er ist arm dran.
Auf dem Weg nach unten kommen Minna die Schlafgänger entgegen, die tagsüber, während sie und ihre Familie und eigentlich alle im Haus auf Arbeit sind, in ihren freien Betten schlafen. Haben alle Schlafgänger hier. Sie kommen vom Land, machen die Nachtschichten und denken am Anfang immer, dass sie was nach Hause schicken können. Aber Nachhauseschicken ist ein Mythos, den sie sich in der Provinz erzählen, um einander loszuwerden. Vielleicht haben sie auch wirklich Hoffnung …
Wenn du Glück hast, dann furzt dein Schlafgänger nur in deine Kissen, wenn du Pech hast, holt der sich auf deinen Geruch einen runter, sodass deine Decke abends ganz steif ist von seinem inzwischen harten, milchig weißen Geschnodder. Hast du als Frau nur Leid mit. Und dann gehst du ohne Unterhose zur Arbeit. Die Frauen in der Zeitung mit ihren fetten Torten haben bestimmt eine zweite Unterhose, wenn sie die erste waschen müssen. Vielleicht sogar eine dritte. Glücksschweine.
Die Tür von den Webers fliegt auf, und eine Schlange aus Kindern läuft Minna vor die Füße, als hätte diese Wohnung einen unerschöpflichen Vorrat an Kindern. Wie die Orgelpfeifen, alle in Kleidern, die ihnen entweder zu groß oder zu klein sind. Die drei Kleinen gehen in die Schule, die zwei Großen in die Fabrik. Wo auch immer die Orgelpfeifen hinmüssen, wollen tut keiner. Aber die Weber will ihre Blagen auch nicht dabehalten. Sie hat ein Kleines am Rockzipfel und wiegt ein noch Kleineres im Arm, das kurz davor ist loszubrüllen.
»Ick will euch hier nicht wiedersehen, solange det draußen noch hell ist, verstanden?!«, schreit die Weber, und ihr Baby brüllt mit.
Minna schwankt gegen das Geländer, ihre Knie sind noch immer wackelig, und das Brüllen sägt in ihrem Kopf jeden halbwegs klaren Gedanken mittendurch. Ein kleines Webermädchen bleibt vor ihr stehen – sie weiß nicht welches, die sehen alle gleich aus in der Familie, und es sind so viele. Es sieht Minna mit großen Augen an.
»Du hast schöne Haare«, sagt das Mädchen und streckt die Hand nach ihrem Kopf aus. »Darf ick mal anfassen?«
Noch während Minna überlegt, ob sie es schafft, sich dem Kind entgegenzustrecken, ohne umzufallen, holt die Mutter aus und klatscht ihrer Tochter eine. »Verschwinde!«
Das Kind hält sich die geohrfeigte Wange und läuft weinend davon. Alles weint und schreit. Orgelpfeifen des Gebrülls. Wenigstens hat Minna ihre eigenen Schreie vorhin aus sich rausgebrüllt. Wenigstens ist dieser Kelch an ihr vorübergegangen. Dieses Geschrei, dieses markerschütternde Geschrei …
Auf dem Weg in die Fabrik kommt sie am Friedhof vorbei. Es dämmert schon, aber die Gaslaternen flimmern noch. Durch den schmiedeeisernen Zaun sieht sie im grauen Licht die grauen Steine, Namen und Jahreszahlen. Sie hat ihre Mutter geliebt, ihre Schwester auch, aber danach hat keiner gefragt.
Sie haben mehr Platz, seit die beiden tot sind. Sie kaufen einmal die Woche Fleisch, seit sie keine Medikamente mehr bezahlen müssen für zwei Frauen, die nicht arbeiten können. Krankheit frisst Geld, der Tod kostet nichts. Außer natürlich, du willst ein Begräbnis und einen Platz hier auf dem Friedhof. Klar, dann musst du blechen. Aber wenn du die Toten von der Charité abholen lässt, dann gibt es die Wochen drauf sogar zwei Mal Fleisch. Oder einfach mehr Schnaps für Opa. Und du stehst allein am Friedhofszaun und kannst deine Mutter nirgendwo mehr besuchen. Oder deine Schwester. Sie sind einfach von der Welt verschwunden.
Eine Frau mit zwei Kindern geht vorbei. Zwillinge. Sie sind nicht glücklich. Es ist, als brülle die ganze Welt, und das tut sie ja auch. Die Welt der Frauen zumindest. Wenn du eine Frau bist, bist du ein Schrei.
Leberecht von Kotze war heute drei Mal beim Barbier. Und wofür? Dafür, dass er nun niedergeschlagen auf ein Mäuerchen sinkt. Im Rücken der verschnörkelte Zaun eines bürgerlichen Wohnhauses und gegenüber auf der anderen Straßenseite die hell erleuchteten Fenster der Wohnung der Spitzenbergs. Beletage, zwei Marmorsäulen im Salon und Schatten von Menschen, deren Welt soeben nicht zutiefst erschüttert wurde.
Sie will ihn nicht. Rosalinde von Spitzenberg will ihn nicht. Kotze sitzt in seinem braunen Anzug mit den goldenen Knöpfen und der türkisen Krawatte auf der Mauer wie ein Schuljunge, der nicht nach Hause möchte. Dafür hätten zwei Mal Barbier gereicht. Für diese Schmach hätte er sich nicht drei Mal rasieren lassen müssen, oder überhaupt rasieren. Oder ankleiden.
Er war besser angezogen als Rosalinde in ihrem schlichten blauen Kleid. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht hat sie sich neben seinem stattlichen Putz geschämt … Und wenn er in seiner langweiligen schwarzen Uniform noch einmal wiederkäme? Nein, sagt er sich. Nein. Rosalinde ist klug. Sie hat ihn nicht wegen einer bunten Krawatte abgelehnt. Sie hat ihm einen Korb gegeben, weil sie nicht fühlt, was er fühlt. Sie will ihn nicht, und jetzt leidet sie nicht. Leberecht von Kotze leidet allein.
Lauer Herbstwind fegt über den Bürgersteig. Ein paar Blätter tanzen an Kotzes Schuhen vorbei und dann weiter auf das Kopfsteinpflaster der Straße. Sie schimmert golden im Licht der Gaslaternen und hell erleuchteten Salonfenster. Irgendwo spielt jemand Klavier.
Dieser Abend hätte ihn retten sollen, hätte alles wieder gutmachen sollen. Kotze fröstelt. Er hatte große Hoffnungen. Aber dieser Abend hat alles nur schlimmer gemacht. Er setzt dieser schrecklichen Woche die Krone auf. Erst lässt der Kaiser am Dienstag kein Wort davon verlauten, dass Kotze in seiner neuen Stellung als Zeremonienmeister nun endlich auch mit Zeremonien – oder wenigstens einer einzigen – betraut wird. Es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben. Oberhofmarschall Schmittelberg wird natürlich weiterhin die Bälle machen. Das nimmt der Kaiser ihm nicht weg, egal, was für Schnarchfeste Schmittelberg schmeißt. Nur weil man dem Orchester Clownsnasen aufsetzt, ist der Abend noch lange kein rauschender Kostümball, aber gut, Seniorität ist Seniorität. Die Audienzen liegen bei Frams und die Beerdigungen bei Hollmer.
Kotze hatte auf die Hochzeiten gehofft. Er hat diese Woche auf einige Hochzeiten gehofft, die bei Hofe und seine eigene. Aber nichts. Er ist ein Zeremonienmeister ohne Zeremonien – und ein Mann ohne Frau.
Dann hätte er auch Kammerdiener bleiben können. Wozu ein Aufstieg, wenn Rosalinde ihn doch nicht nimmt? Wozu das alles?
Damit er dem Kaiser Klatschgeschichten erzählt. Mehr scheint Seine Majestät von Kotze nicht zu wollen. Bei der letzten Neujahrscour hat Gräfin Hohenau ihre Brüste entblößt, was Seine Majestät nur durch Kotze erfahren hat. Es hat den Kaiser sehr amüsiert. Seitdem will er immer mehr. Wer mit wem was am Hof tut, brühwarm und saftig erzählt. Aber Kotze ist doch kein Berichterstatter. Er ist …
Kotze weiß eigentlich nicht, was er ist. Ungeliebt, ungewollt und ohne Aufgabe. Das ist er. Er kann doch nicht ewig Junggeselle bleiben. Oben in Rosalindes Zimmer geht das Licht an. Sie tritt ans Fenster und zieht die Gardine zu. Sie sieht ihn nicht. Sein Herz bricht noch einmal. Ihr Lachen perlt in seinen Ohren, ihre Augen funkeln vor seinem inneren Auge, aber sie funkeln nicht für ihn. Kotze weiß nicht, wie lange er schon hier sitzt oder wo er hinsoll. Dennoch entschließt er, sich aufzuraffen. Gerade als er aufstehen will, hört er eine Kutsche. Hufgetrappel auf Kopfsteinpflaster. Das Gefährt biegt in die Straße und hält vor Rosalindes Haus. Ein Mann steigt aus, geht durch das schmiedeeiserne Tor und tritt ans Portal. Über ihm hängt eine Laterne, und als die Kutsche sich entfernt, erkennt Kotze den blonden Mann, der den Türklopfer betätigt.
Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Kotze runzelt die Stirn. Was will der Rammler in Rosalindes Haus? Gut, die Spitzenbergs bewohnen nicht alle Etagen, vielleicht möchte er zum Geheimrat in der zweiten …
Der Herzog verschwindet im Hauseingang. Kotze will gehen, doch etwas hält ihn zurück. Rosalinde ist allein zu Hause, der Baron und die Baronin sind in der Oper. In der Wohnung der Spitzenbergs löscht das Hausmädchen die Lichter in den Salons. Das in Rosalindes Zimmer bleibt an. Und wenig später sieht Kotze hinter den Gardinen zwei Schatten, die einander in die Arme fallen. Er sieht Küsse und Kleidungsstücke, die zu Boden segeln. Kotze schluckt. Und dann sieht er den Grund, aus dem der ganze Hof den Herzog »Rammler« nennt. Er sieht, wie Rosalinde sich an einer Kommode abstützt und der Herzog hinter ihr das Kaninchen gibt. Kotze ballt die Hände zu Fäusten. Er ist Hass und Schmerz und ein gebrochenes Herz. Aber er kann nicht wegsehen. Rosalinde legt den Kopf in den Nacken, die Umrisse ihrer runden Brüste schaukeln. Kotze atmet schwer. Und er schaut und schaut.
Minna ordnet den Tabak in der linken Hand, legt ihn auf das Umblatt und wickelt den Tabak darin ein. Sie rollt, während die Neue neben ihr plaudert. Sie kommt aus Vlotho. Sie hat Zigarrenrollen in Vlotho gelernt und verspricht sich viel von Berlin. Minna ist nur froh, dass sie ihr nichts zeigen muss. Vlotho weiß schon alles, so bringt der Tag wenigstens eine gute Sache. Von ihrem Lohn heute Abend muss Minna ins Wirtshaus und Fleisch essen, damit sie es morgen aus dem Bett schafft. Es ist noch nicht mal acht, noch über zehn Stunden auf diesem Hocker, auf dem ihre rohe Muschi sitzt wie eine Wunde. Zwischen ihr und dem Hocker ein paar Röcke, keine Unterhose.
Vlotho hat schon vier Wickel mehr gerollt als Minna. Drauf geschissen, sie hat einen schlechten Tag. Unter anderen Umständen sähe Vlotho alt aus.
Unterm Tisch tauen Minnas Füße auf. In der Fabrik ist es immer heiß, weil die Wickel Wärme brauchen, bevor sie rüber zu den Männern kommen. Die Arbeiterinnen kriegen was ab von der Wärme, ist im Sommer eine Zumutung, im Winter ein Segen. Wenigstens ein Segen.
Minna hat ihren Schwindel mit in die Fabrik genommen. Und jetzt sitzen sie beide hier, er malt ihr schwarze Flecken ins Sichtfeld und schaukelt sie auf ihrem Stuhl. Heute kommt es ihr heißer vor als sonst. Ein Schweißtropfen fällt von ihrer Stirn, sie bemerkt ihn zu spät, er tropft auf den Tabak. Schnell wickelt sie ihn ein und rollt, damit der Vorarbeiter es nicht bemerkt. Schmitt überwacht die Arbeiterinnen mit kleinen Augen, von denen du glaubst, dass sie nichts sehen. Aber sie sehen alles. Er kommt schon näher, schwarze Flecken überall, Minna rollt schneller. Sie rutscht ab, und der Wickel rollt von dem Tisch, zwischen Vlotho und ihr hindurch vor Schmitts Füße.
»Kacke«, sagt Minna.
Schmitt beugt sich runter und hebt ihren Wickel mit spitzen Fingern auf. Genussvoll dreht er ihn zwischen den Fingern. »Den hier zieh ich dir vom Lohn ab.«
Minna hält sich am Tisch fest, um es dem Wickel nicht nachzutun, und nickt knapp. Ist der dritte diese Woche. Schmitt freut so was. Seinen Tag hat Minna schon mal versüßt. Ihrer gehört dem Schwindel. Eine Hälfte von ihr ist unten in dem Abort bei ihr zu Hause. Die andere Hälfte ist schwach.
»Macht er das öfter?«, fragt Vlotho.
»Ja«, antwortet Minna.
»Na ja.« Vlotho zuckt leichthin mit den Schultern. »Ist wahrscheinlich sein gutes Recht.«
»Und det freut dir?«
»Nein, aber du musst zugeben, dass wir es hier gut getroffen haben.«
Minna wischt sich mit dem Ärmel kalten Schweiß aus dem Nacken.
»Meine Kusine arbeitet in einer Sodafabrik und hat sich schon drei Mal verbrannt«, erzählt Vlotho jetzt. »Oder wenn ich nur an die Frauen am Bahnhof denke … Als ich angekommen bin, bin ich zwei Mal angesprochen worden, ob ich Arbeit suche.«
Minna wendet sich wieder ihrem Tabak und den Umblättern zu. Aber Vlotho redet weiter auf sie ein, als wisse sie nicht, was eine kalte Schulter ist. Währenddessen rollt sie genug Wickel, um drei Männer drüben in der anderen Halle zu beschäftigen.
»Aber so eine Arbeit such ich nicht, hab ich diesen Kupplerinnen gesagt, denn ich hab genau verstanden, was die wollen. Sie wollen uns Mädchen vom Land in … in …« Jetzt spricht sie leise: »In ein Bordell schleppen. Hab ich das Kinn hochgemacht und gesagt, dass ich das nicht nötig hab. Und ich hab es auch nicht nötig.«
»Gut so«, stimmt Marie von gegenüber ihr zu. »Das macht man nicht für Geld.«
»Warum eigentlich?«, fragt Minna erschöpft.
»Du bist gut.« Marie lacht. »Sich an feine Herren verkaufen. Tss …«
Minna hebt den Kopf. »Feine Herren?«
Vlotho nickt. »Das hat die Kupplerin auch gesagt, dass nur die feinsten Herren Kunden wären.«
»Wie fein jenau?«, fragt Minna.
»Aber nicht mit mir«, sagt Vlotho statt einer Antwort. »Und mir ist egal, ob ich für eine … eineNummer mehr Geld kriege als den ganzen Tag hier und ob die sich kümmern, wenn es mal schiefgeht. Und ob ich neue Wäsche kriege und was nicht alles.«
Minnas Augen werden größer. »Neue Wäsche?«
»Für Geld ist echt das Letzte«, sagt Marie und rollt empört ihren Tabak über den Tisch.
»Die versprechen einem das Blaue vom Himmel«, stimmt Vlotho ihr zu.
Das Blaue vom Himmel ist immer eine Lüge. Keiner schenkt dir irgendwas, du musst dir alles selbst nehmen, solange du kannst. In der Schlange zur Lohnauszahlung fällt Minna später zwei Mal fast in Ohnmacht. Aber sie hält durch, denn wenn sie geht, bevor sie den Lohn verteilen, kriegt sie keinen, und dann kriegt sie auch kein Fleisch.
Minna hält sich an der Lohntüte fest. Gut, dass die leicht ist, Minna kann heute nicht schwer tragen. Sie dreht sich um und steht vor Vlotho und Marie, ihren grauen Gesichtern und ihren grauen Arbeitskitteln. Sie sehen heute sicher besser aus als Minna, aber sie rollen sich alle gleichermaßen die Jugend aus dem Leib. Mit jedem Tag wird ihr Leben grauer. Minna schaut in ihre Tüte. Elf Mark für eine Woche. Sechs Tage. Vierzehn Stunden am Tag. Elf Mark.
Brandenburg, 1895
Lottka schiebt die Nadel durch die Masche, nimmt den Faden auf und zieht ihn zurück. Und dann von vorn. Nadel durch die Masche, Faden holen und zurück. Rein, raus, rein, raus … Verdammte Ödnis. Vielleicht wollen die Ärzte sie verhöhnen mit diesem faden Ersatz.
Lottka sitzt am Fenster mit Blick auf den Park. Sie ist eine Frau mit Rüschen. Gräfin Charlotte von Hohenau liebt es, wenn ihre Manschetten sich kräuseln, und das Gleiche gilt für die Kragen ihrer Blusen – und für ihre Haare. Sie hat einen kurzen Pony voller kleiner wilder Locken. Um sie herum plaudern die nervenkranken Damen der besten Gesellschaft und besticken Taschentücher – sofern sie sticken können. Lottka kann nicht mal stricken. Häkeln ist das Einfachste, hat die Pflegerin gesagt und es ihr beigebracht.
»Nennst du das einen Topflappen?«
Lottka hebt den Blick von ihrer Handarbeit und schaut zu dem Sessel gegenüber. Vicka hält sich mit einer Hand an der Rückenlehne fest, die andere ruht auf ihrem Stock. Sie schaut auf Lottkas Hände. »Die arme Wolle.«
Sie stützt sich schwer auf den Knauf ihres Stocks und setzt sich langsam. »Sie wäre bestimmt lieber eine Monatsbinde geworden als ein Topflappen von dir.«
»Du hast alles verpasst, Vicka«, sagt Lottka.
»Das Geschrei heute Morgen?« Vicka verzieht das Gesicht. »Davon hab ich noch zu viel mitbekommen, glaub mir.«
»Die Kamischek hat das Essen, das extra nach ihrem Rezept gekocht wird, Saufutter genannt und die Oberwärterin geohrfeigt.«
Vickas Mundwinkel hängen reglos herunter, aber in ihren grauen Augen blitzt so etwas wie Anerkennung auf. »Mir wäre lieber, sie würde leiser um sich schlagen.«
»Das wäre wirklich nur halb so interessant«, sagt Lottka und blickt sehnsüchtig zur Kamischek hinüber, die nun sediert auf einer Récamiere liegt und niemanden mehr unterhält.
Vicka schüttelt langsam den Kopf. »Du bist zu leicht zu begeistern.«
Lottka betrachtet die alte Freundin, deren Erscheinung keinen Zweifel daran lässt, dass wir alle endlich sind. »Warum fährst du nicht nach Hause, Vicka?«
»Damit der Hurenbock mir beim Sterben zusehen kann? Den Gefallen tu ich ihm nicht.«
»Aber du könntest dir einen Gefallen tun … Du musst doch nicht hierbleiben, wenn du es hasst …«
»Hassen? Ich schätze diesen Ort sehr, Lottka.«
Lottka hebt eine Augenbraue. »Wirklich?«
Vicka sieht sich um. »Ich hasse die Ärzte, die Wärter und alle anderen Patientinnen. Und Brandenburg. Und den Wald. Und diese schrecklichen Häuser. Den Rest schätze ich.«
»Da bleibt doch nichts übrig.«
»Doch, die Syphilis.«
Lottka lacht. »Du schätzt deine Syphilis?«
Vicka seufzt müde. »Das war eine Lüge. Aber wenn mein Hurensohn von Ehemann mich schon wegen Lügen einweist, kann ich damit auch weitermachen.«
Lottka nimmt ihre Häkelarbeit wieder auf. »Wenn du meinst.«
»Ich hab Willes übrigens gesagt, dass dein Mann in Zukunft weder deine Behandlung bezahlen noch die angedachte Summe für das Sanatorium spenden wird, wenn du weiter ins Eiswasser musst.«
Lottka hebt den Kopf. »Welche Spende?«
Vicka verdreht die Augen. »Lottka, die Wahrheit hat auch noch keinen geheilt.«
Lottka runzelt die Stirn und betrachtet Vickas bittere Gesichtszüge. Wer hätte gedacht, dass hinter dieser Fassade ein mitfühlender Mensch steckt, der verhindert, dass Lottka weiter diese schrecklichen Eisbäder nehmen muss. Sie hasst Eisbäder.
»Danke, Vicka.« Lottka lächelt und wickelt sich den Faden um den Zeigefinger.
»Das kann man ja nicht mit ansehen.« Vicka zeigt auf die Häkelarbeit. »Dieser Lappen da heilt auch niemanden. Ich hoffe, deine Massagekuren zeigen einen größeren Erfolg.
»Aber ja. Sie helfen sehr …«
»Ich würde ja die Douche nehmen. Hammer, wie das schon klingt …«
Lottka zwinkert. »Hart und fest …«
Vicka hat beide Hände auf ihren Stock gelegt und sieht sie forschend an. »Und du bist sicher, dass die Douche nicht besser ist?«
»Ja, der Wasserstrahl fühlt sich scharf an. Etwas schneidend …«
Vicka presst die dünnen Lippen aufeinander, nickt und schaut aus dem Fenster in den Brandenburger Herbst. Beide Hände liegen noch immer auf dem Knauf. Sie krallen sich ineinander.
»Es tut mir leid, dass die Behandlung für dich nicht infrage kommt«, sagt Lottka.
Vicka wischt mit der Hand durch die Luft und sieht weiter hinaus.
»Wie geht es deinem Mann?«, fragt Lottka.
»Jede Woche schlechter.«
»Gut.«
»Ich wünschte, er würde endlich sterben«, sagt Vicka.
»Weil du dann auch … gehen kannst?«, fragt Lottka.
»Er wird mich nicht überleben.« Sie hebt ihren knöchernen Zeigefinger. »Der nicht.«
»Und was wird dann aus mir? Ohne dich?«
»Du musst deine Probleme dann selbst lösen, Lottka.«
»Ach, vergiss meine Probleme, Vicka. Mir geht es um deine Gesellschaft.«
»Du bist die Erste, der es darum geht.«
»Weil du alle anderen ständig anlügst.«
»Dich doch auch.«
»Aber ich bin weniger empfindlich.«
Vicka betrachtet sie. Sie reckt ihr Kinn. Obwohl Vicka klein und eingefallen ist, schaut sie auf Lottka hinab. Nach einer kleinen Weile schüttelt sie den Kopf. »Bist du nicht.«
»Wie steht es um die Wette deines Mannes?«
»Sie hält ihn am Leben.« Vicka lehnt sich zurück. »Sei froh, dass du keinen Architekten geheiratet hast. Arbeit ist ein Lebenszweck. Dieses vermaledeite Haus hält den Hurenbock davon ab, endlich den Löffel abzugeben.«
»Ist es denn schon fertig?«
»Nein. Ich hasse das Haus.«
»Du kennst es doch gar nicht.«
»Gott bewahre mich davor, je einen Fuß in dieses Loch in der Mulackstraße zu setzen. Mein Ankleidezimmer ist größer als diese Hütte.«
»Das schmalste Haus der Stadt … Ich finde, das klingt interessant.«
Vicka sieht wieder aus dem Fenster. »Wie gesagt, du bist zu leicht zu begeistern.«
Nervensache
Im Zug, 1935
»Ach, hier seid ihr. Hab schon den janzen Zug abjesucht«, sagt Gustav, dessen Kopf plötzlich durch die Schiebetür lugt.
Minna starrt ihn an. »Justav?«
»Tach auch«, sagt er und schiebt die Tür komplett auf.
»Justav?«, fragt Minna wieder.
»Minna.« Er lächelt sie an. »Wie jeht’s?«
»Es muss so lange gut gehen, bis es besser wird«, sagt Emil.
Gustav steht mit seinem struppigen Bart und den hochgekrempelten Ärmeln in der Tür zu ihrem Abteil. Es klemmt kein Küchentuch in seinen Hosenträgern, aber ansonsten könnte er auch hinter dem Tresen stehen. Er weiß natürlich nicht, wie man sich für so eine Reise kleidet. Er stemmt die Arme in die Hüften, lässt seinen Blick über die dunkelroten Polster gleiten und grinst.
»Picobello habt ihr det hier, wa?«
»Wat machst du hier?«, fragt Minna.
»Det Gleiche wie ihr. Fahr nach Frankreich.«
»Setz dich doch«, sagt Emil, rückt zur Seite und macht Gustav Platz. Der setzt sich, bevor Minna überhaupt verstanden hat, dass er hier ist.
»Guck nicht so, Minna«, sagt Emil. »Er hat doch nur einen Zweite-Klasse-Fahrschein.«
Minna runzelt die Stirn. »Woher weißt’n dette?«
»Weil ick’s ihm jesacht hab«, erklärt Gustav.
Minna sieht von einem zum anderen. »Warum? Wann?«
»Nachdem Emil mir erzählt hat, det er nach Nizza fährt, um seinen jeliebten Magnus zum Jeburtstach zu überraschen.«
»Und du willst auch nach Nizza, oder wat?«
»Wusstest du nicht, dass Gustav auch aufgehört hat mit seinem Bordell?«, fragt Emil.
»Doch, aber …«, beginnt sie und weiß nicht weiter.
»Zeit für die Rente, Minna.«
Minna runzelt die Stirn und betrachtet die beiden. Der Hundegustav hat dichtgemacht. Noch ein Grund mehr, in Berlin zu bleiben. Keine Konkurrenz mehr die Straße runter. Die Ritze wär jetzt das einzige Bordell in der Mulackstraße. Wenn es sie noch gäbe …
Gustav sieht sich mit glänzenden Augen im Abteil um. Minnas Blick fixiert den Jungen. »Haste dem auch jesacht, welchen Zug wir nehmen?«
»Ist doch lustiger, wenn wir zusammen fahren.« Gustav strahlt.
»Wieso zusammen?«, fragt Minna. »Du fährst doch Holzklasse.«
»Zweite Klasse«, verbessert er.
Emil wendet sich an ihn. »Minna erzählt mir gerade, wie sie an die Ritze gekommen ist.«
Gustav sieht sie an. »Ja, wie haste det damals eigentlich hingekriegt?«
»Indem ick netter zu Frauen war als du.«
»Nee, es hat mit dem Kaiser zu tun«, sagt Emil ehrfürchtig.
Gustav lacht. »Quatsch. Kaiser … Da hört sich dann doch Verschiedenes auf.« Er tippt sich an die Stirn. »Kaiser …«
»Neidisch?«, fragt Minna.
»Auf deine Lügen?«, fragt er zurück, und Emil lacht.
Diese Eintracht auf der Bank gegenüber gefällt Minna gar nicht. »Wann seid ihr zwei beide eigentlich so dicke Freunde jeworden?«
»Aufm Friedhof«, antwortet Gustav.
»Aha«, brummt Minna.
»Hey, mich hat det allet auch tief erschüttert damals«, verteidigt er sich.
»Du Armer.«
»Det hätte so nicht enden dürfen«, sagt Gustav. »Det waren jute Mädchen.«
Minna presst die Lippen aufeinander und sieht aus dem Fenster. Jetzt nicht weinen. Nicht vor dem. Das fehlte noch.
»Colette war die schönste Hure, die ick je …« Gustav schluckt, »die war doch noch so jung. Und Natalia …«, er weint, »jeder Mann hatte Angst vor der … jeder … und jetzt …« Er schluchzt.
Emil steht auf und tastet seine Jacke ab. Er sieht zu Minna runter, während er ein Taschentuch rausholt. »Du bist nicht die Einzige, die in Trauer war, Minna.«
»Aber ick bin die Einzige, die noch immer in Trauer ist«, sagt Minna mit Seitenblick auf den jaulenden Hund mit Schnauzbart gegenüber. Colette und Natalia waren ihre Huren, ihre Freundinnen, ihre Familie … Nicht Gustavs. Die konnten den genauso wenig leiden wie Minna. Und wenn die beiden noch leben würden, dann würde Minna nicht in diesem Zug sitzen.
Emil reicht Gustav sein Tuch. »Hier.« Er wendet sich an Minna. »Ja, du hast recht. Gustav weint einfach nur gern. Du weißt ja, wie wir Männer sind.«
»Der kannte die doch kaum«, begehrt Minna auf.
»Jeder kannte Natalia und Colette«, widerspricht Emil. »Zumindest jeder im Scheunenviertel.«
Minna runzelt die Stirn. »Aber nach acht Jahren hier noch rumflennen wie ’n Blach aufm Spielplatz.«
Emil sieht sie an. »Das Leben ist kein Spielplatz.«
»Wat du nicht sagst.«
Acht Jahre ist es her, dass Colette Blausäure kaufte, die Natalia aus Versehen trank. Acht Jahre, seitdem die schöne blonde Colette sich vom Dach der Ritze in den Tod stürzte, weil Minnas Sohn ihr das Herz brach. Acht Jahre, seit Minna an einem kalten Wintermorgen die Leichen ihrer besten Freundinnen fand und nichts mehr für sie tun konnte. Minna konnte sonst immer irgendwas tun, ändern, voranbringen, aber an diesem Morgen war sie zum ersten Mal in ihrem Leben machtlos. Oft fühlt sie sich noch immer so. Die beiden Freundinnen sind weg, dafür ist dieses Gefühl der Ohnmacht jetzt da.
Gustav reibt sich übers Gesicht und lässt das Taschentuch sinken. Seine Augen sind rot. In seinem Schnäuzer hängt Schnodder. »Danke, Emil.«
Der Junge lächelt. »Gern.«
»Det mit dem Kaiser glaub ick dir trotzdem nicht, Minna.«
»Ob du mir glaubst, ist Jacke wie Hose, Justav. Kannst gern zurück in die Holzklasse gehen.«
»Zweite Klasse«, verbessert Gustav.
Minna zuckt mit den Schultern. »Wer’s glaubt.«
Emil verdreht die Augen. »Wie ging es denn jetzt weiter, Minna? Bist du einfach in ein Bordell gegangen?«
Berlin, 1895
Das alles wäre ja vielleicht noch zu ertragen, wenn Wilhelm der Männlichkeit zur Ehre gereichen würde. Aber dieser Invalide hier auf dem Podest im Ankleidezimmer würde vom Pferd fallen, wenn die Tiere nicht extra für ihn zugeritten wären. Und so was will Kaiser sein …
Herzog Ernst Günther steht stramm und wartet. Die Welt geht vor die Hunde, wenn Stärke nichts mehr wert ist. Wenn Krüppel über echte Männer entscheiden … Und deshalb möchte der Herzog Rosalinde heiraten, mit ihr wird er nur gesunde Kinder bekommen und nicht so eine Schande mit Perücke wie der Vogel vor ihm auf dem Podest.
»Wilhelm, ich möchte heiraten«, sagt der Herzog.
»Mhm, ja. Ich hörte davon.«
»Tatsächlich?«, fragt der Herzog.
Der Kaiser setzt den Dreispitz auf und rückt ihn mit der rechten Hand auf der weißen Perücke zurecht. Er fährt auf seinem Podest herum und präsentiert sich dem Herzog als Friedrich der Große. Die Kammerdiener stehen stramm zwischen den Spiegeln und rühren sich nicht.
»Was denkt du?«, fragt der Kaiser.
»Formidables Kostüm«, lobt der Herzog. »Der Alte Fritz, wie er leibt und lebt.«
»Bin noch unentschlossen, was den Bart betrifft.« Der Kaiser streicht über seinen Schnäuzer, der an den Mundwinkeln nach oben abbiegt wie eine mit dem Lineal gezogene Schlachtenformation. Kein Gezwirbel, keine kokette Locke am Ende. Nur eine Ecke wie aus einem Schulbuch der Geometrie. Friedrich der Große hingegen hatte gar keinen Bart. Er hat allerdings auch nicht sechs Mal am Tag die Uniform gewechselt. Dafür war er tatsächlich im Krieg. Und zwar siegreich. Das Schlachtfeld des Kaisers, der heute, knapp zweihundert Jahre später, seine Uniform trägt, ist eines von vielen Faschingsfesten.
»Rasiere mich ungern.«
Würde auch nichts ändern, denkt der Herzog. Bart oder nicht, Friedrich der Große war ein siegreicher Kriegsherr. Kaiser Wilhelm II. ist ein Krüppel in Kostüm.
»Aber es geht auch weniger darum, den Alten Fritz zu kopieren, als ihm etwas von meiner eigenen Größe hinzuzufügen«, erklärt Seine Majestät. »Ein Symbol meiner humanistischen Weltsicht zum Beispiel. Ich denke, dafür eignet sich der Bart.«
»Natürlich, Wilhelm«, pflichtet der Herzog bei.
»Wobei ich nichts weiter als ein König der Bettler bin.«
»Natürlich.«
»Mit einer Marine.«
»Du sagst es, Wilhelm.«
Keine Marine der Welt ist groß genug, um den lahmen linken Arm wettzumachen, denkt der Herzog. Er knetet die Hände hinter dem Rücken und betrachtet seinen Schwager, der sich vor dem Spiegel dreht und wendet, als gehöre ihm ganz Europa. Kann sich nicht mal die Schuhe selber zubinden, der armselige Wurm.
Wenn Wilhelm auch nicht der Herr über ganz Europa ist, ist er doch das Oberhaupt der Familie. Der Herzog muss den Kaiser fragen, ob er heiraten darf. Der Kaiser entscheidet, ob der Herzog vor den Altar treten darf, und er entscheidet auch mit wem.