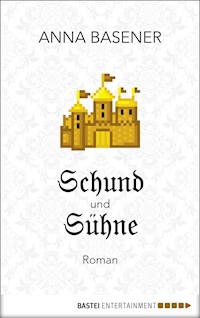
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Mitte dreißig ist Kat die erfolgreichste deutsche Groschenromanautorin - und hat genug von erbaulicher Fließbandromantik. Sie will ihren letzten Roman schreiben. Ausgerechnet dafür erhält sie ein adliges Literaturstipendium und wird nach Schloss Rosenbrunn eingeladen. Dort lebt eine Fürstenfamilie, die zwar keinen Titel mehr trägt, dafür aber umso mehr Vergangenheit mit sich herumschleppt.
Kat trifft auf einen schwulen Prinzen, der für Nachkommen sorgen muss, eine depressive Fürstin, die nicht an Depressionen glaubt, einen Rosenkavalier, der die Welt retten will, und eine Prinzessin mit gebrochenem Herzen und Jagdgewehr. Für vier von ihnen brechen herrliche Zeiten an. Der Fünfte wird diesen Herbst nicht überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitatPrinzenblut und RosenstolzSchloss der VersuchungBallsaal der SehnsuchtHeile Welt – wehes HerzUnd alle Herzen schreien nach LiebeDankÜber dieses Buch
Mit Mitte dreißig ist Kat die erfolgreichste deutsche Groschenromanautorin – und hat genug von erbaulicher Fließbandromantik. Sie will ihren letzten Roman schreiben. Ausgerechnet dafür erhält sie ein adliges Literaturstipendium und wird nach Schloss Rosenbrunn eingeladen. Dort lebt eine Fürstenfamilie, die zwar keinen Titel mehr trägt, dafür aber umso mehr Vergangenheit mit sich herumschleppt. Kat trifft auf einen schwulen Prinzen, der für Nachkommen sorgen muss, eine depressive Fürstin, die nicht an Depressionen glaubt, einen Rosenkavalier, der die Welt retten will, und eine Prinzessin mit gebrochenem Herzen und Jagdgewehr. Für vier von ihnen brechen herrliche Zeiten an. Der Fünfte wird diesen Herbst nicht überleben.
Über die Autorin
Anna Basener hat ihr Studium in Hildesheim mit Romanheften finanziert. Sie hat Dutzende Fürstenheftchen geschrieben und war laut ZEIT die »erfolgreichste deutsche Groschenromanautorin«. Sie ist die Adelsexpertin der Podcast-Welt und Moderatorin der GALA Royals. Ihr Debütroman »ALS DIE OMMA MIT DEN HUREN NOCH TAUBENSUPPE KOCHTE« gewann den Putlitzer Preis, ist im Schauspiel Dortmund auf der Bühne zu sehen und wird fürs Kino verfilmt.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Bärbel Brands, Berlin
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © derGriza/shutterstock;© Smash338/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7187-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
I want your love and all your lovers’ revengeYou and me could write a bad romance
Lady Gaga
Prinzenblut und Rosenstolz
Zauberhafter Romananfang aus dem Hochadel
Der Brautstrauß hebt ab. Er fliegt durch den Saal und dreht Pirouetten, Seidenbänder wirbeln durch die Luft. Mit einem Eifer, als wäre er der erste Brautstrauß auf der ganzen Welt, der erste, der je geworfen wurde. Dabei ist er der achte in diesem Jahr.
Am Boden wird das Gedränge dichter. Ballrobe presst sich an Ballrobe, steife Stoffe rascheln, keiner atmet. Ein erhitzter Pulk in pastellfarbenen Reifröcken, der die Luft anhält. Brillanten blitzen auf wie Sterne.
Der Brautstrauß verliert an Höhe. Überall Hände, die nach ihm greifen. Hände aus den besten Familien: Gräfinnen, Baronessen, Vons … Eine Prinzessin schnappt ihn sich.
Die anderen geben nicht auf. Sie strecken ihre Hände aus, greifen noch immer nach der Beute. Sie grapschen, sie haben lange, spitze Fingernägel. Sie kratzen der Prinzessin über den Handrücken. Eine brennende Spur zieht sich über ihren Unterarm. Die Prinzessin blickt vom Brautstrauß auf den Kratzer – er färbt sich rot –, als ihr von rechts ein Ellbogen entgegenfliegt und mitten in ihrem Gesicht landet. Der Kopf der Prinzessin wird zur Seite geschleudert. Die Frisur hält.
Die Damen zögern. Erschrockene Blicke. Die Prinzessin steht in der Mitte, krümmt sich und drückt den Strauß an ihre Brust. Sie sieht Blut, das auf den Boden tropft. Rot und glänzend. Eine Blutlache liegt ihr zu Füßen.
Es war einmal ein Königreich, dieses Land. Es war einmal der Stoff, aus dem die Märchen sind. Königreich, Kaiserreich, Weltmacht? Krieg! Viele Prinzen starben. Peng, peng in Mayerling, peng, peng in Jekaterinburg, peng, peng in Sarajevo. Es ist alles sehr kompliziert. Und am traurigsten ist sowieso Bäume fällen im Exil in Holland. Es ist wenig geblieben. Es war einmal: mehr.
»Wer war das?«, fragt die Prinzessin. »Wessen Ellbogen war das?«
Ihr Blick wandert von Abend-Make-up zu Abend-Make-up. Sie nimmt den Strauß in die Rechte, marschiert auf das erstbeste Pastellkleid zu und greift mit der Linken ins Diamanten-Collier. Als wäre der Schmuck ein speckiger Hemdkragen und sie alle eine Rotte junger wütender Männer auf einer dreckigen Straße in einer großen Stadt. Die Prinzessin starrt in ein ängstliches Augenpaar, packt die Konkurrentin am Wickel und schiebt sie durch den Saal.
»Warst du das?« Sie hebt die Faust mit dem Strauß.
Keine Antwort.
Es will keiner gewesen sein. Weniger, weil Gewalt diesen jungen Damen peinlich wäre. Verzweiflung ist es, Hochzeitsbedürftigkeit ist es. Darfst du haben, haben hier alle, darfst du aber nicht zeigen.
»Wer war das?«, fragt die Prinzessin wieder. Ihr Name ist Josephina Prinzessin Schell von Ohlen, und ihr Blick ist der einer Amazone. Sie funkelt die anderen an wie eine Kriegerin, die in ihr Land einmarschieren und keine Gefangenen machen wird. Die Pastellmädchen weichen noch ein Stück zurück. Es will immer noch keiner gewesen sein, es will jetzt erst recht keiner gewesen sein.
Noch bevor die Prinzessin zuschlägt, jemanden womöglich wegen eines Blumenbouquets massakriert und diese Hochzeit zu einem Kriegsschauplatz macht, löst sich eine Dame aus der Schar der Gäste. Auf ihrem Kopf wippen lange Federn, das Rot ihres Kleides schreit: Sieh mich an! Die Federdame legt einen Arm um die Hüfte der Prinzessin, lächelt entschuldigend in die Runde und führt sie davon. Sie schiebt die Prinzessin aufs Damenklo und schließt hinter ihnen ab.
»Durchatmen«, sagt die Dame streng. »Schau mal in den Spiegel.«
»Verdammt.«
»Mach das weg und gib mir den Strauß.«
Die Prinzessin starrt in den Spiegel. Ihre Rehaugen sprechen von Unschuld, das Blutbad gleich darunter nicht. Sie sieht aus, als hätte sie mit bloßen Zähnen einen Hirsch gerissen.
»Der Strauß, Seph«, sagt die Dame wieder.
Die Prinzessin wendet ihr den Kopf langsam zu. Sie ist keine Jo oder Josie, sie ist eine Fürstentochter. Guter Stall, 1A Hochadel. Natürlich gibt es keine Adelstitel mehr, das sind jetzt alles Nachnamen, aber was die Demokratie dem Adel eben nicht nehmen konnte, sind die Spitznamen. In diesem Fall: Seph.
Die Federdame lehnt sich an das Marmorwaschbecken und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie ist die Tante der Prinzessin, mütterlicherseits.
»Drei Monate«, sagt sie jetzt, »die Hochzeit ist drei Monate her, Seph.«
Die Prinzessin nickt. »Drei Monate Ehe.«
»Und es kommen vermutlich noch viele Monate dazu. So ist das mit Ehen. Da sammelt sich Zeit an.«
Seph zeigt mit dem Finger auf ihre Tante. »Sie ist die Falsche für ihn.«
»Das schon wieder.«
»Hast du gerade die Augen verdreht?«
»Seph, er hat sich für sie entschieden. Du kannst so viele Brautsträuße fangen, wie du willst. Für diese eine Hochzeit ist es zu spät.«
»Das hätte meine Hochzeit sein sollen.«
»War es aber nicht.«
»Ich sollte überhaupt keine Sträuße mehr fangen, ich sollte gar nicht mehr bei den Unverheirateten stehen.« Die Prinzessin presst ihre Lippen aufeinander.
»Man gewöhnt sich dran.«
Seph schnaubt. »Gratzi, nur, weil du nie heiraten wolltest, heißt das nicht, dass ich als Ehefrau nicht glücklich wäre.«
»Wärst du das?«
»Was soll das denn heißen? Du gehst nur von dir selbst aus.«
»Eigentlich nicht«, sagt Gratzi. »Und du kannst deinen Liebeskummer nicht an jedem Brautstrauß auslassen, der des Weges kommt.«
Seph senkt den Kopf, darüber will sie nicht reden. Sie will sich auch gar nicht die Schuld geben, aber es ist schwer. Sie drückt ihrer Tante den Brautstrauß an die Brust. Grazia Gräfin von Montgerlach, kurz die Gratzi, nimmt die Blumen an sich. Die Federn auf ihrem Kopf streichen an der Toilettendecke entlang. Sie ist die Schwester von Sephs Mutter. Und während diese einen Fürsten geheiratet und ein funkelndes Diadem bekommen hat, ist Tante Gratzi allein und Gräfin geblieben. Sie braucht kein Diadem. Sie setzt sich alles auf den Kopf, was ihr in die Finger kommt: Rokokoperücken, Vorhangquasten oder eine komplette Familie aus Schrumpfköpfen. Es waren nur Imitate, und es war Karneval. Aber so oder so ist ein Ensemble aus achtzig Zentimeter langen Pfauenfedern eine durchaus unauffällige Wahl für Sephs Tante.
Die Prinzessin tupft sich über Nase und Lippen und sieht auf das verschmierte Blut im Handtuch. Das goldene Emblem der Brautfamilie inmitten einer rosa Gewaltwolke. Sie lässt das Handtuch sinken. »Ich bin doch gar nicht so.« Sie zeigt Gratzi den Fleck. »So.«
Gratzi nickt und steckt Rosen in den Brautstrauß zurück, die sich gelöst haben. »Wir haben alle gedacht, dass er dich fragt.«
Seph wirft das Handtuch in den Korb unter dem Waschbecken und lehnt sich an die Wand. »Peinlich.«
»Mach dich nicht verrückt. Du wirst über ihn hinwegkommen. Und mach dir keine Gedanken wegen heute Abend. Es ist doch eigentlich ganz witzig. Ein bisschen Exzentrik hat noch keinem von uns geschadet.«
Die Prinzessin wirft einen Blick auf die Tante, den wippenden Kopfschmuck, den pfauenfedergrünen Lidschatten und die walnussgroßen Perlen um ihren Hals, und wiegt den Kopf hin und her. Die Gräfin zieht sich die Lippen in Schwarzrot nach.
»Ich bin nicht exzentrisch, ich bin zu alt für Exzentrik«, sagt Seph und stößt sich von der Wand ab. »Exzentrik kann ich nicht ernst nehmen.«
Gratzi äfft sie belustigt nach. Sie hat diesen Satz von ihrer Nichte schon oft gehört. Seph war schon mit fünf zu alt für Verkleidungen oder kindliche Rollenspiele und trägt, seit sie sechs ist, Knopf im Ohr. Immer. Komme, was wolle, Seph trägt Perlohrstecker, selbst zu dem Abendkleid heute. Die Prinzessin hat dunkle Haare, die oft rötlich schimmern. In ihren braunen Augen tanzen goldene Punkte. Aber von Weitem kann man die hübsche Prinzessin schon mal übersehen. Gratzi wünscht sich etwas anderes für ihre Nichte. Gratzi will, dass alle Menschen, die sie liebt, gesehen werden. Auch auf einen Kilometer Entfernung. Aber damit ist sie allein in der Familie, und deshalb sticht sie als Einzige heraus. Was ihr nun auch wieder gefällt. Sie steckt die Kappe auf den Lippenstift und schiebt den Strauß lachend über den Marmorwaschtisch. »Hier, deine Beute.«
Sie verlassen die Toilette. Gratzi verschwindet in der Menge und lässt ihre Federn über die Köpfe hinwegtanzen. Ihr Lachen perlt noch in Sephs Ohren, als sie sich abwendet. Sie schlendert mit ihrer Trophäe zur Bar und bestellt ein Glas Weißwein. Von der Sorte, den die Brautfamilie seit Jahrhunderten keltert und vertreibt.
»Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Strauß gefangen«, sagt eine Männerstimme neben ihr, während die Prinzessin am Wein nippt. Sie dreht sich um und betrachtet den Mann. Der Smoking ist neu, keine Schweißperlen auf Stirn oder Schläfen. Er hat nicht getanzt. Also kann er nicht tanzen. Ein Ungeborener. Die Adeligen meinen es nicht böse, wenn sie die Nichtadeligen so nennen. Sie wissen, dass auch alle anderen Menschen rein technisch geboren werden. Sie müssen ja auch in die Schule und zum Biounterricht. Sie gehen nur einfach trotzdem davon aus, dass geboren zu sein bedeutet, in eine adelige Familie hineingeboren zu sein. Der Rest ist ungeboren. Punkt. So wie Sephs Gegenüber. Er kommt ihr gerade recht. Er wird sie nicht auffordern. Adelige machen das nämlich. Auffordern, tanzen, auffordern, tanzen … 1818, 1918, 2018 … Wann auch immer, in welcher Staatsform auch immer, sie tanzen. Ein Wunder eigentlich, dass nicht mehr von ihnen auf der Tanzfläche sterben. Seph wäre bereit dazu. Aber jetzt möchte sie sich noch ein bisschen ausruhen, bevor sie den Sonnenaufgang auf dem Parkett erleben wird.
Sie sieht zu den weißen Rosen in der weißen Manschette, die neben ihrem Wein liegen. »Ja, der Strauß«, sagt sie, als wäre er nicht der Rede wert.
»Heißt das, Sie sind die Nächste?«
Sie schiebt das Gesicht vor ihrem inneren Auge beiseite, die blauen Augen und das strahlende Lächeln, das ansteckender ist, als die Pest es je war. Sie atmet durch. »Dazu brauch ich erst mal einen Mann.«
»Ach so?«, fragt er und richtet sich auf seinem Barhocker etwas auf. Er räuspert sich.
»Ja«, antwortet sie. »So.«
»Und?«, fragt er lässig angelehnt und mit blitzenden Augen. »Würden Sie auch einen ohne Titel nehmen?«
»Wenn mein Vater es erlaubt.«
Er schweigt.
»Das war ein Scherz«, sagt sie und setzt sich auf den Hocker neben ihn. Ihr Ballkleid raschelt um sie herum, sie stopft den Rock zwischen die Bar und den Hocker.
Der Mann lacht und gibt ihr die Hand. »Ich bin Thomas Blank.«
»Josephine Schell.«
»Ich baue Fertighäuser.«
»Wie bitte?«
»Das ist mein Beruf.«
»Wollen Sie mir ein Haus verkaufen?«
»Nein, ich wollte Konversation betreiben.«
Sie runzelt die Stirn. »Mit Ihrem Beruf? Das ist ein wenig langweilig, oder nicht?«
Er lächelt und nickt langsam. »Ja, das höre ich oft, aber ich liebe, was ich tue.«
»Wie schön.« Sie lächelt zurück und trinkt Wein.
Er legt ihr seine Visitenkarte hin. »Aber wenn Sie wirklich mal ein Haus kaufen wollen …«
Sie sieht auf die Karte, als hätte er einen toten Frosch auf den Tresen geworfen.
»Herr Blank, vielleicht sollten Sie Ihre Karte besser jemandem geben, dessen Familie nicht seit Jahrhunderten all ihre Energie darauf ausgerichtet hat, alte Bausubstanz zu bewahren.«
Er sieht sich um. »Also keinem hier?«
»Ganz genau.« Jetzt muss sie doch lachen. »Wie lange dauert es, bis eins Ihrer Häuser steht?«
»Zwei Tage.«
Sie schüttelt leicht den Kopf. Zwanzig Jahre haben ihre Vorfahren an Rosenbrunn gebaut. Zwanzig Jahre. Der Fürst, der es in Auftrag gegeben hat, hat das Richtfest nicht mehr erlebt. »Und wie lange hält so ein Haus dann?«
»Bis zu hundert Jahren«, sagt er, als habe er soeben verkündet, er besiedle aktuell den Mars.
»Hundert Jahre? Für ein Haus? Wir haben ein Schaukelpferd, das älter ist.« Sie schüttelt den Kopf und trinkt Wein. »Alle hundert Jahre ein Haus wegschmeißen. Kein Wunder, dass die Wälder sterben.«
»Also, so einfach ist das nicht. Besitzen Sie Immobilien? Sie selbst?«
»Ja, in England. Ein kleines Cottage. Ich hab’s von meinem Großvater.«
»Und das wollen Sie behalten?«
»Natürlich.« Es liegt ein Krächzen in ihrer Stimme. Sie räuspert sich. Natürlich will sie das Cottage bewahren, und jetzt erst recht, da jemand versucht, ihr ein Billighaus schmackhaft zu machen, das keine Geschichte hat und keine Geschichte schreiben wird. Und das nicht in England steht, wo sie so glücklich war.
»Und was ist mit den Menschen, die keine Häuser erben?«
Sie trinkt einen Schluck. »Die kaufen oder mieten oder bauen.«
»Letzteres im Idealfall mit mir. Dann hält es eben nicht vier Generationen lang. Und? Es will doch nicht jeder das Zeug von seinen Eltern erben. Und wenn doch, dann sind alle Geschwister in null Komma nichts zerstritten, und jeder hasst jeden. Für die Sozialhygiene ist es nicht schlecht, wenn ein Haus nur eine Generation hält.«
Sie lacht. »Sozialhygiene?«
»Ja, warten Sie mal ab, bis Ihre Kinder sich von Ihnen und voneinander entfernen. Dann sprechen wir noch mal.«
»Meine Kinder?«
»Ja«, antwortet er und zeigt auf den Brautstrauß, »wenn Sie das da gegen einen Mann getauscht und welche haben.«
»Entschuldigen Sie mich.« Seph rutscht vom Stuhl, leert ihr Glas und stellt es ab. Sie schenkt ihm noch ein knappes Lächeln, bahnt sich einen Weg durch den Saal und hofft, dass er ihr nicht folgt. Er tut es nicht, und sie tritt hinaus auf die Terrasse. Hinter ihr feiert das Schloss, vor ihr liegt der Park. In den Bäumen hängen bunte Lampions und erhellen die geharkten Wege. Sie blickt auf den Strauß in ihrer Hand.
Warum wollte sie den eigentlich unbedingt fangen?
Um den anderen zu beweisen, dass sie nicht traurig ist? Seht her, seine Traumhochzeit mit der anderen hat mich nicht getroffen. Kleinigkeit, es hat nicht sollen sein, das Leben geht weiter.
Oder um sich selbst zu beweisen, dass sie Heiratsmaterial ist? Trotz allem. Ist das nicht das Einzige, was sie tut? Dich kann man noch heiraten, Seph. Das geht noch, Seph. Strauß für Strauß, den sie mit zurück nach Rosenbrunn bringt: Trophäen der Einsamkeit.
Ihr Bauch schmerzt. Korsettstäbe pieken in ihre Haut. Gratzi hat darauf bestanden, dass sie neben dem pfirsichfarbenen Givenchy-Rock auch noch Uromis Kleid benutzen, um Seph daraus ein neues zu schneidern. Jetzt rutschen die Stangen raus, und Fischbein bohrt sich in ihr Fleisch.
Seph ruckelt am Korsett. Der Anhänger ihrer Kette rutscht dabei aus ihrem Dekolleté. Die Prinzessin schiebt ihre Brüste zurecht, nimmt die Wundertätige Medaille zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtet sie. Sie ist oval, aus Gold und zeigt die Muttergottes mit ausgebreiteten Armen. Maria schwebt in einem wallenden Mantel und strahlt, als wäre sie selbst die Sonne. Um sie herum ein Kranz aus Diamanten.
»Gegrüßet seist du«, murmelt Seph, lächelt und streicht über die goldenen Lichtstrahlen. Sie betet schnell und leise. Der Brautstrauß fällt ihr aus der Hand, während ein paar Meter weiter eine fette Putte in den Springbrunnen pinkelt.
*
»Und was macht das Bier, Fredi? Hast du mir eins mitgebracht?«, fragt der alte Lettberg. Er lacht. Dann zieht er an seiner Zigarre und hustet. Dann lacht er wieder. Dann wieder Husten.
Der junge Prinz bestellt ein Glas Wasser bei einem der livrierten Kellner. Nur eine flüchtige Handbewegung. Seine Manschettenknöpfe funkeln im Widerschein des Kaminfeuers. Valerius Prinz Schell von Ohlen, kurz der Valu, ist nicht nur die Zukunft des Adels – er ist Mensch gewordener Adel. Hierbei kommt es nicht so sehr auf das maßgeschneiderte Hemd, die gepflegten Hände oder das Schloss an, in dem er lebt. Das sind Oberflächlichkeiten, die mit Geld zu kaufen sind. Das, was den Prinzen vom gemeinen Spießer trennt, ist die Synthese von Nachlässigkeit und Aufmerksamkeit. Unschlagbares Ensemble der Eleganz.
»Wir haben die Brauerei verkauft, Letti«, sagt der Fürst jetzt laut und beugt sich über die Armlehne. Seine silbergrauen Haare stehen in alle Richtungen, seine Brauen sind buschig. Früher waren sie so dunkel wie die seines Sohnes. Auch sein Hemd ist maßgeschneidert, aber er ist ein Naturbursche, egal, wie kostbar seine Manschettenknöpfe sind. Während der Prinz der Snob-Grenze gefährlich nahe kommt und für den ein oder anderen ein Pfau ist, ist der Vater ein Jagdhund. Groß, drahtig und struppig, aber stolz. Und natürlich reinrassig.
Der Prinz sieht zu ihm. »Du hast die Brauerei verkauft. Du ganz allein, Papi.«
»Schade, die Brauerei mochte ich an dir immer am liebsten, Fredi.« Lettberg gluckst vergnügt, hustet wieder und bekommt endlich Wasser von dem Kellner. Lettberg trinkt wie ein Verdurstender, gibt das Glas zurück und bestellt Rum.
»Letti«, beginnt der Prinz, »ich habe dem Papi damals schon gesagt, dass wir die Brauerei behalten sollen.«
Der Fürst sieht zum alten Lettberg. »Ich musste umstrukturieren. Erbschaftssteuer, du weißt schon.«
»Wir hätten die Bank verkaufen sollen«, sagt Valu. »Die Bank, die Porzellansammlung und das Diadem.«
»Mach dich nicht lächerlich.«
»Die Strukturen der Bank sind alt. Keiner will mehr an den Schalter, alle machen jetzt Online-Banking, Papi. Damit ist kein Geld mehr zu machen.«
»Mit Geld ist kein Geld mehr zu machen?«
»Nein. Nicht so, nicht mit dem Service, den die Schell Bank anbietet.«
»Ach, die neue Zeit«, brummt Lettberg, verzieht den Mund und winkt mit der Zigarre zwischen den Fingern ab.
»Neue Zeit?« Der Prinz rückt auf seinem Sessel vor und beugt sich zu den beiden Herren. »Das ist nicht neu. Online-Banking gibt es seit fast zehn Jahren.«
Der Fürst lacht. »Zehn Jahre? Was sind zehn Jahre?«
»Papi, es wäre sehr viel einfacher gewesen, mit der Brauerei auf Mixgetränke und Craftbeer umzusteigen, als den verstaubten Serviceschalter in unseren dreieinhalb Bankfilialen am Leben zu halten.«
»Valu, lass deinen Vater ausreden«, mahnt Lettberg.
Der Prinz presst die Lippen aufeinander und lehnt sich zurück. Er ist sich ziemlich sicher, dass der Fürst ausgeredet hatte. Er trinkt Rum, dessen Geschmack ihm bitter vorkommt.
»Und du hast wirklich das Bier abgestoßen, Fredi?«
»Erben ist kein Zuckerschlecken«, sagt der Fürst.
»Leben ist kein Zuckerschlecken«, erwidert Lettberg. »Besonders mit diesem Körper hier.« Er zeigt mit seiner Zigarre auf sich selbst.
»Ach, du wirst uns noch alle überdauern, Letti«, sagt Valu und prostet ihm zu.
Sie trinken Rum. Um sie herum Nebelschwaden von Zigarrenrauch, brauner Teppich, braune Möbel, braune Vorhänge. Während im Festsaal drüben die Hochzeit gefeiert wird, haben sich die Genossen katholischer Edelleute ins Kaminzimmer zurückgezogen. Klingt links, ist aber konservativ. Kaum dass der Adel 1919 abgeschafft wurde, sprossen Vereine wie dieser aus dem Boden, damit der Adel nicht im demokratischen Regen steht, damit er ein Dach über dem Kopf hat.
»Kein Bier mehr«, murmelt Lettberg zu sich selbst und lacht. Und hustet. Und lacht. Dann schläft er ein.
Das Rumglas droht ihm aus der Hand zu fallen. Der Prinz beugt sich vor und nimmt es an sich. Er stellt es auf den Tisch zwischen sich und seinen Vater. Der Fürst schluckt. Sein Sohn meint, Tränen in seinen Augen zu erkennen, aber so etwas spricht man nicht an. Nicht auf einer Hochzeit, nicht zu Hause, gar nicht. Valu dreht das Glas in der Hand und beobachtet den Vater. Werfried Prinz Schell von Ohlen, auch er heißt mit Nachnamen Prinz, ist aber der Fürst, was nichts und gleichzeitig alles bedeutet.
»Jedes Mal fragt er nach der Brauerei«, sagt der Fürst. »Jedes Mal. Als hätte ich gestern geerbt und nicht vor fünf Jahren. Seine Zeit läuft ab, Valu. Die Zeit läuft ab für die Lettbergs. Seit vierhundert Jahren sind unsere Familien verbunden, sechshundert Jahre lässt sich die Lettberg-Linie zurückverfolgen. Sie endet bald. Sehr bald. Und das Haus ist ja quasi schon ein Hotel.«
»Eine Schande«, sagt der Prinz und nippt am Rum. Er hasst Hotels. Hotels sind was für Menschen, die keine Verwandten in der Stadt haben. Und Valu hat überall Verwandte. Überall auf der ganzen Welt. Hotels sind was für Kaufleute und Vertreter. Sie sind immer traurig. Auch die Wellnesstempel. Lettbergs Schwiegersohn hat wohl so was in der Richtung mit der Lettburg vor. Wellness. Er hat keinen Namen, aber Geld. Lettbergs anderer Schwiegersohn hingegen hat einen sehr alten Namen, aber gar kein Geld. Unterm Strich bedeutet das: Beide Töchter heißen jetzt anders, ihre Kinder sowieso, und einen Lettberg junior gibt es nicht.
»Vierhundert Jahre«, wiederholt der Fürst, als wäre er nicht nur dabei gewesen, sondern als könne er sich auch an jedes einzelne dieser Jahre erinnern.
Er steht auf und stellt sein Glas ab. »Ich muss aus diesem Rauch raus.« Der Prinz nickt, Lettberg schnarcht. Der steife Hemdkragen hält den Kopf des alten Mannes. Der Fürst verlässt das Kaminzimmer, und der Prinz trinkt. Er lehnt sich zurück und schaut hoch zur Stuckdecke, als ein strahlendes Gesicht über ihm erscheint.
»Lust auf einen Spaziergang?«
Valu lacht. »Nein, Hano, heute nicht.«
Hano schwingt sich auf die Armlehne und nippt von Valus Rum. »Keine frische Luft? Bei dem ganzen Rauch?«
Valu nimmt sein Glas und stellt es außer Reichweite. Hanos Bein baumelt neben seinem Knie. Alles ist so beschwingt an dem jungen Baron, und Valu liegt im Sessel wie vierzehn Mühlsteine.
»Übernehmen ist scheiße«, sagt Hano.
»Wie bitte?«
»Wenn du nicht übernehmen müsstest, wärst du freier. Als Mann … Du könntest mich zum Beispiel mal anrufen.«
»Entschuldige, ich muss …«, sagt der Prinz und zwängt sich an Hanos gut gelauntem Bein vorbei. Er nimmt Lettberg die Zigarre aus der Hand, die mehr Asche als alles andere ist, und legt sie auf einem Aschenbecher ab.
Hanos älterer Bruder wird den Gutshof der Familie übernehmen und das Erbe in die nächste Generation tragen. Im Adel gibt es keine Unternehmer, es gibt Übernehmer. Verantwortung walzt sich von Generation zu Generation, aber den jungen Baron mit den lockigen Haaren wird sie kaum streifen. Hano lässt sich in den Sessel plumpsen.
Valu mustert seine Haltung, die keine ist. »Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich Rosenbrunn übernehmen werde.«
Hano trinkt und lacht. »Ja, klar.«
Valu runzelt die Stirn. »Ich liebe Rosenbrunn.«
Hano stellt das Glas ab und steht auf. Er geht einen Schritt auf den Prinzen zu und lächelt. »Und du liebst Spaziergänge«, raunt er. »Im Schatten.«
»Nicht so sehr wie Rosenbrunn!«
Hano zögert, aber Valu verzieht keine Miene mehr. Der Baron zuckt mit den Schultern. »Nichts für ungut.«
Und schon verschwindet er. Hano weiß wahrscheinlich, dass Valu ihm auf den Hintern schaut und sich fragt, ob er nicht doch, nur kurz, und was ihm dieses Nein eigentlich konkret bringt. Aber das Problem ist, dass Hano keine Antworten hat, sondern immer nur noch mehr Fragen aufwirft.
»Nein, nichts für ungut«, murmelt Valu, obwohl ihn niemand hört, und sinkt auf Lettbergs Armlehne, der in diesem Augenblick aufschreckt.
»Sind sie schon verheiratet?«
»Ja, Letti. Schon seit Stunden«, antwortet der Prinz, angelt den Aschenbecher vom Rauchtisch und hält ihn Lettberg hin. Der Alte greift seine Zigarre, pafft und sieht zum Prinzen auf.
»Valu, bist ein guter Junge. Deine Zeit wird kommen.«
»Wann?«, fragt der Prinz. »Ich bin fünfundzwanzig. Ich habe zwei Master in Betriebswirtschaft. Auf drei Sprachen. Wie alt muss ich denn noch werden, damit der Papi mir zuhört?«
»Ist weniger eine Frage des Alters«, antwortet Lettberg und hustet. »Ist eine Frage der Kinder. Wenn du einen Erben hast, hast du eine Stimme.«
»Ich muss erst Kinder kriegen?«
Lettberg grinst. »Du darfst.« Er drückt sich aus dem Sessel hoch und klopft Valu auf die Schulter. »Viel Spaß dabei.«
Ja, viel Spaß.
*
»Das ist alles?«, fragt die Gräfin und schaut auf meine Reisetasche. Sie runzelt die Stirn und sieht an mir vorbei. Ihre Augen suchen den Boden ab. Sie lehnt sich vor, um um das Heck des SUVs herumzuspähen, als könnte ich da noch ein bis drei Koffer versteckt haben. Der Bahnhof, an dem wir stehen, ist kaum größer als der fürstliche SUV. Ich bin mit dem Zug gekommen. Aus Berlin in die niedersächsische Provinz. Ich stehe neben Gräfin Gratzi am Kofferraum und nicke. Sie hat sich mir bereits mit Spitznamen vorgestellt, aber das ändert auch nichts daran, dass sie mehr von mir erwartet. Mehr Zeug. Sie betrachtet mitleidig die eine Tasche, die einsam auf der Ladefläche liegt. »Das ist Ihr Gepäck für drei Monate?«
»Ja«, antworte ich. »Ich brauch nicht viel.«
Die Gräfin beugt sich in den Kofferraum und hebt die Tasche an. Sie hält sie hoch. »Follie, guck mal«, sagt sie zu ihrer Schwester, die vorn im Auto sitzt, »das ist ihr ganzes Gepäck.«
Die Fürstin dreht sich auf dem Beifahrersitz herum und zieht ihre Brille die Nase runter. Sie schaut über die Sitze hinweg zu uns. »Da ist ein Ballkleid drin?«
»Nein«, sage ich. »Nein, ich dachte, ich geh einfach so.« Ich zeige auf meine Leggings und das dunkle Hemd. Es ist eigentlich das Oberteil eines Herrenschlafanzugs von Boss. Vintage. Es ist aus Seide.
Die Gräfin wirft den Kopf zurück und lacht.
»Ich wechsle die Schuhe«, sage ich schnell.
Sie schließt die Heckklappe und wischt sich eine Träne aus dem Auge. Sie steigt ein, ich klettere hinter sie auf die Rückbank, und die Gräfin lacht noch, als sie vom Parkplatz fährt. Ich drehe mich um und betrachte den kleinen Provinzbahnhof, an dem nur einmal die Stunde eine Regionalbahn hält. Er hat ein rotes Ziegeldach und eine große Bahnhofsuhr, die munter tickt, als würde die Zeit hier voranschreiten wie überall.
Die Fürstin auf dem Beifahrersitz trägt Beige. Beige Bluse, beige Brille, beige Weste, und die Haare sind auch irgendwie beige. Sie trägt sie wie Lady Di, und ähnlich wie Di hält sie das Kinn gern unten, während ihre Schwester den Kopf bei jeder Gelegenheit zurückreißt und laut lacht. Die Augen der Gräfin sind sehr groß, und die Perlen um ihren Hals sind es auch. Sie sitzt in einem Kleid mit roten und lila Rauten am Steuer und fährt uns zum Schloss.
Ich sollte gar nicht hier sein. Hunderte Autoren bewerben sich jährlich um Stipendien. Es gibt ein paar in ganz Deutschland, ausgeschrieben von Stiftungen, Vereinen und Kultursenaten. Ein Dutzend Autoren bekommt sie, fährt in die Provinz und schreibt traurige Nabelschauscheiße. Die Bewerber sind Literaten, die Monate oder Jahre für einen Roman brauchen. Ich brauche eine Woche.
Wir haben die Bewerbung nach der zweiten Flasche Wein abgeschickt. Mitten in der Nacht. Dann hatten wir Sex, dann habe ich seinen Namen vergessen. Aber er war cool. Witziger Typ.
Ich sehe aus dem Fenster. Felder, Weiden, dahinter ein Wald, der kein Ende nehmen will. Gehört alles den Schells. Schell von Ohlen. Mir gehört der Inhalt einer Einzimmerwohnung in Berlin Mitte. Es ist wenig Inhalt. Ich finde Kram belastend, und die meisten Gegenstände sind Kram.
Fürstin Follie holt Strickzeug aus ihrer Handtasche. Die Nadeln in ihren Händen klappern los, als würden sie um die Wette rennen.
»Sie müssen meine Schwester entschuldigen«, sagt Gratzi und sucht meinen Blick im Rückspiegel. »Sie strickt einfach immer.«
»Weil immer jemand in der Familie ein Kind bekommt«, erklärt die Fürstin. »Stricken Sie auch, Frau …?«
»Du kennst ihren Namen nicht, Follie?«
»Sie ist doch erst gestern nachgerückt.«
»Das ist Catharina Chrysander.«
»So heiße ich nicht«, sage ich. »Das ist ein Pseudonym.«
Die Gräfin strahlt. »Wie aufregend.«
»Wirklich?«, fragt die Fürstin und sieht zu mir. »Ist das aufregend?«
»Nein, eigentlich nicht. Nennen Sie mich einfach Kat. Und nein. Ich stricke nicht.«
Follie seufzt, ihre Nadeln klappern. »Wir freuen uns natürlich, Sie bei uns zu haben. Aber es ist etwas neu für mich. Eigentlich vergeben wir Literaturstipendien, Kat. Literatur.«
Weiß ich doch.
»Wir verstehen darunter eher … Also, so etwas wie Mariana Leky oder Saša Stanišić. Literatur eben.«
»Wenn es nach dir ginge, würden wir Strickstipendien vergeben.« Gratzi tritt aufs Gas.
»Mach dich nicht lächerlich, Gratzi. Und fahr langsamer.« Follie schluckt hörbar und rückt ihre Brille zurecht. »Egal, wie schnell du fährst, deine Jugend ist schon weg.«
»Ich bin gar nicht zu schnell.«
»Doch. Hier ist neuerdings siebzig.«
»Als könntest du auch nur ein einziges Verkehrsschild erkennen. Du kannst eine Hochzeitseinladung nicht von einer Todesanzeige unterscheiden, wenn man sie dir direkt unter die Nase hält.«
»Das war ein einziges Mal.« Follie wendet sich an mich. »Es war direkt nach einem Augenarzttermin. Er hatte getropft.«
»Du hast zwei geschlagene Stunden geglaubt, die Uggi wär tot.« Im Rückspiegel sehe ich, wie Gratzi die Augen aufreißt. »Tot! Es hätte nicht viel gefehlt, und du hättest dem Brautvater kondoliert.«
»Und jetzt stricke ich eine Mütze für sein drittes Enkelkind.«
»Besser wär, du würdest dir ’ne neue Netzhaut stricken.«
»Oder dir einen Ehemann.«
Solange sie mein Stipendium nicht stricken, soll mir alles recht sein. Solange ich kein Beige tragen muss. Oder Perlen. Gut, Perlen gingen vielleicht noch.
Die Fürstin lässt ihr Strickzeug sinken und dreht sich zu mir. »Kat, können Sie nicht einen Roman mit meiner Schwester in der Hauptrolle schreiben? Schreiben Sie ihr einen Ehemann, ja?«
»Das geht leider nicht, Fürstin. Sie ist zu alt.«
»Wie bitte?«, fragt die Gräfin, und ich sehe ihren erschrockenen Blick im Rückspiegel.
Die Fürstin lacht. »Zu alt. Hörst du das? Du bist zu alt für die Liebe.«
Ich beuge mich vor. »Na ja, nein. Nicht im echten Leben natürlich. Nur in meinen Romanen. Das ist so eine Heftromanregel für uns Autoren. In Groschenromanen verlieben sich immer junge Leute.«
Die Gräfin runzelt die Stirn. »Was heißt ›jung‹?«
»Zwischen siebzehn und siebenundvierzig«, sage ich und schiebe kleinlaut nach: »Wobei siebenundvierzig eher fünfundvierzig meint und auch eher für den Mann gilt.«
»Für den Mann …«, wiederholt die Fürstin und lacht strickend in sich hinein.
Ich wende mich an die Gräfin. »Ich finde das auch scheiße. Ich schreibe auch keine Texte, in denen alte Säcke Jungfrauen heiraten. Bei mir sind die immer gleich alt. Und beide haben Ziele und Karrieren und so. Aber ich muss das Zeug halt auch verkauft bekommen.«
»Ich verstehe, Kat. Ist doch im Film nicht anders. Liebe ist das Vorrecht der Jugend.« Die Gräfin lächelt mich im Rückspiegel an. »Lassen wir das Thema.«
»Warum?«, fragt die Fürstin.
»Was ist eigentlich mit meinem Vorgänger?«, frage ich schnell. »Warum bin ich nachgerückt?«
»Er ist krank«, antwortet die Gräfin.
»Was hatte er denn?«
»Depression«, antwortet die Fürstin und wendet sich an mich. »Haben Sie so was auch?«
»Ich?«
Sie nickt. »Als Künstlerin?«
»Nein. Meine Arbeit ist eher rational. Sie erfordert eher Struktur als Romantik.«
Die Fürstin lässt die Nadeln sinken und hebt eine Augenbraue. »Tatsächlich?«
»Ja, die große Liebe interessiert mich nur als dramatisches Element. Ich bin der unromantischste Mensch, den Sie je treffen werden.«
Die Gräfin lacht auf. »Unwahrscheinlich. Auf Rosenbrunn ist dieser Titel schon vergeben, nicht wahr, Follie?«
»Schau auf die Straße.«
»Vielleicht sollten wir ein Spiel daraus machen. Einen Wettstreit darum, wer weniger Herz hat.«
»Gratzi, jetzt beleidigst du unseren Gast.«
»Ach was. Du würdest eh gewinnen.«
Warum ich? Der Favorit ist krank geworden, gut. Aber ich weiß genau, dass da eine lange Liste von Bewerbern aus den Schreibschulen in Leipzig oder Hildesheim existiert, die näher an Leky oder Stanišić dran sind. Es gab doch Alternativen zu mir und meinem Schund. Vielleicht liegt es an der Menge meiner Publikationen? Hunderte Romane in zehn Jahren, da kann kein Suhrkamp-Autor mithalten. Vielleicht liegt es auch an der Presse, die man bekommt, wenn man die jüngste deutsche Groschenromanautorin ist. Oder daran, dass die übrigen Nabelschau-Genies so spontan nicht konnten. Die meisten von denen leben schließlich nicht vom Schreiben, die haben Brotjobs mit Anwesenheitspflicht.
Gräfin Gratzi plaudert derweil munter weiter. »Am Mittwoch ist die Rosentaufe. Hatte ich Ihnen das geschrieben, Kat? Das Fürstenhaus hat sich mit einem Rosenzüchter zusammengetan. Das Unternehmen hat eine wunderschöne Schnittrose gezüchtet, die auf den Namen meiner Nichte getauft wird. Von meiner Nichte.«
»Prinzessin Josephina«, ergänzt Follie.
»Nein, das hatten Sie nicht geschrieben. Das klingt hübsch.«
»Diverse Journalisten werden berichten.«
»Nur ein paar regionale Blätter, Follie.«
Die Fürstin dreht sich zu mir. »Regionale Medien werden von meiner Schwester nicht ernst genommen. Seit sie einmal bei Wetten, dass …? saß, ist sie Expertin in Sachen PR, müssen Sie wissen. Man hat sie Girlie-Gräfin genannt. Es war ein schrecklicher Auftritt.«
»Kat, Sie haben doch oft mit der Presse zu tun, nicht wahr?«, fragt Gratzi und redet weiter, bevor ich antworten kann: »There is no bad publicity, oder? There is only …«
»Du hattest ein Kätzchenkleid an«, fährt Follie dazwischen. »Da war ein ganzer Streichelzoo von Stofftieren an deinem Dekolleté!«
»Und am Saum«, ergänze ich, denn ich kenne den legendären Auftritt aus den Neunzigern. Magentafarbene Haare, blaue Augenbrauen? Wer das verrückt findet, hat nie Gräfin Gratzis pipigelben Irokesenschnitt gesehen. Ist alles auf YouTube.
»Kat versteht meinen Humor.« Gratzi zwinkert mir im Rückspiegel zu.
Die Fürstin strickt, ihre Nadeln nehmen Tempo auf. »Es ist keine Frage des Humors, sondern eine Frage des Egos. Wie kann man sich nur so wichtig nehmen, ohne eigenes Kunstwerk zu Thomas Gottschalk ins Fernsehen zu gehen?«
»Das schon wieder«, murmelt Gratzi.
»Das beleidigt doch jeden Künstler, der sich auf diese Couch setzt. Es beleidigt alle Künstler«, sagt Follie weiter. »Ein paar Stofftiere machen niemanden interessant, Gratzi. Niemanden. Wenn du wenigstens Blumen binden könntest.«
Die Gräfin sieht zu mir. »Meine Schwester bindet ganz zauberhafte Blumengestecke.«
»Und? Dränge ich mich damit in den Vordergrund? Nein!«
»Nein«, bestätigt Gratzi.





























