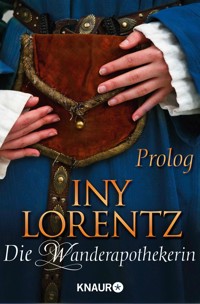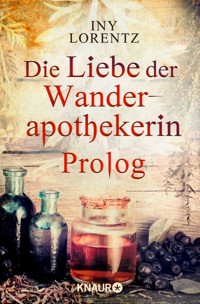Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sinnlich, lebensfroh und voller dramatischer Verwicklungen - die spannende Fortsetzung der »Wanderhure« von Iny Lorentz Marie und ihr Ehemann Michel Adler leben glücklich und voller Liebe zusammen. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind erwartet. Doch dann muss Michel in den Kampf gegen die aufständischen Hussiten ziehen. Zwar wird Michel aufgrund seiner Tapferkeit und seines Mutes zum Ritter geschlagen wird – doch verschwindet er zu Maries Entsetzen nach einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird, ist Marie ganz auf sich allein gestellt. Täglich wird sie neu gedemütigt und ihr bleibt letztlich nur ein Ausweg: Sie muss von ihrer Burg fliehen. Als Marketenderin schließt sie sich einem neuen Heerzug an. Da Marie an den Tod ihres Mannes nicht glaubt und im Herzen spürt, dass er noch lebt, möchte sie auf diese Weise ihren Mann suchen. Wird ihr Mut belohnt werden? Historisches Wissen gepaart mit Spannung und guter Unterhaltung, Iny Lorentz ist das »Königspaar der deutschen Bestsellerliste« (DIE ZEIT) »Die Wanderhure« markiert den fulminanten Auftakt zur berühmten »Wanderhuren-Reihe« von Iny Lorentz, einem Autorenduo, das mit diesem historischen Roman seinen großen Durchbruch feierte. Die fesselnde historische Saga erzählt die Geschichte der Hübschlerin Marie, die sich durch die Wirren des Mittelalters kämpft und dabei auf beeindruckende Weise Stärke und Unnachgiebigkeit demonstriert. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 46 min
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Kastellanin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Historischer Hintergrund
Erster Teil
Verraten
1.
Maries Blick schweifte kurz über die versammelten Jäger und kehrte wieder zu ihrem Mann zurück. Er saß auf seinem Pferd, als wäre er damit verwachsen, und führte den Zügel scheinbar achtlos mit der Linken, da er in der rechten Hand die zum Schuss gespannte Armbrust hielt. Neben ihm ritt ihr Gastgeber Konrad von Weilburg, ein ebenfalls stattlich zu nennender Mann. Beide waren mittelgroß und hatten breite, muskulöse Schultern, doch während der Weilburger bereits einen kräftigen Bauchansatz aufwies, hatte Michel immer noch die schlanke Taille und die schmalen Hüften eines jungen Mannes, und sein Gesicht mit der breiten Stirn unter den dunkelblonden Haaren, den hellen Falkenaugen und dem kräftigen Kinn wirkte energischer als das seines Gastgebers. Konrad von Weilburg verzichtete selbst bei der Jagd nicht auf hautenge Strumpfhosen und ein kunstvoll besticktes Wams, während Michel lange, bequeme Reithosen und eine einfache Lederweste mit halblangen Ärmeln über einem grünen Hemd trug. Seine Füße steckten in festen Stiefeln, und nur das mit zwei Fasanenfedern geschmückte Barett verriet dem Beobachter, dass er kein Knecht war, sondern der Ministrale eines hohen Herrn.
Michel musste Maries Blick gefühlt haben, denn er drehte sich noch einmal um, schwenkte übermütig die Armbrust und schenkte ihr ein verliebtes Lächeln, bevor er sein Pferd antrieb und hinter dem herbstbunten Laub des Waldes verschwand. Marie musste an jenen Tag vor zehn Jahren denken, an dem man sie mit ihrem Jugendfreund verheiratet hatte. Das »Ja, ich will!«, nach dem man sie bei der Trauung im Inselkloster noch nicht einmal gefragt hatte, würde sie heute zu jeder Tages- und Nachtzeit sprechen, so glücklich war sie mit Michel geworden.
Irmingard von Weilburg lenkte ihre Rappstute neben Maries Pferd und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Wir können mit unseren Männern wirklich zufrieden sein. Beide sehen gut aus und sind von angenehmer Gemütsart, und was die gemeinsamen Nächte betrifft, so hätte ich es mit meinem Konrad nicht besser treffen können. Aber nun kommt, lasst uns zum Sammelpunkt zurückkehren. Ich schieße ebenso ungern auf Tiere wie Ihr, Jagd ist in meinen Augen Männerwerk, genau wie der Krieg. Außerdem habe ich Appetit auf einen Schluck Würzwein, auch wenn er gewiss nicht so gut schmecken wird wie der, den Ihr uns letztes Jahr kredenzt habt.« Sie leckte sich noch in der Erinnerung daran die Lippen.
Marie lachte auf. »Oh ja, der ist wirklich gut gewesen. Die Kräuter hat mir meine Freundin Hiltrud, die Ziegenbäuerin, gemischt. Sie kennt die Geheimnisse vieler Pflanzen und weiß, welche von ihnen Krankheiten heilen können und welche einfach nur gut schmecken.«
»Ich kenne die Ziegenbäuerin. Als meine Schwarzmähne«, Frau Irmingard klopfte auf den Hals ihrer Stute, »letztens an einer schweren Kolik litt, habe ich unseren Stallknecht zu ihr geschickt, um mir einen Trank für mein Stutchen zubereiten zu lassen. Kaum hatte ich Schwarzmähne den Sud eingeflößt, ging es ihr auch schon besser, und sie ist über Nacht wieder gesund geworden.«
Marie freute sich über das Lob. Die Ziegenbäuerin war mehr als nur ihre beste Freundin, denn diese hatte sie einst halb tot am Straßenrand aufgesammelt, sie gesund gepflegt und ihr geholfen, die fünf schlimmsten Jahre ihres Lebens zu überstehen. Es gab nur einen einzigen Menschen, der ihr näher stand als Hiltrud, und das war ihr Michel, mit dem sie eine immer inniger gewordene Liebe verband.
Erst als ihr Reittier unwillig den Kopf hochwarf, bemerkte Marie, dass Frau Irmingard sie immer noch auffordernd anblickte, und nickte ihr zu. »Ich habe nichts dagegen, die Jagd vom Sammelplatz aus zu verfolgen, denn im Gegensatz zu Euch bin ich keine gute Reiterin und liebe es nicht, über Stock und Stein zu galoppieren.«
Das war noch eine Untertreibung, denn Marie zog es vor, mit der lammfrommen Stute, die Michel ihr besorgt hatte, im Schritt oder gemütlichen Trab über feste Straßen und Wege zu reiten. Im Sattel fühlte sie sich immer noch nicht besonders wohl. Sie war in Konstanz aufgewachsen, einer Stadt, in der man Markt und Kirche zu Fuß erreichen und die Orte der Umgebung mit einem Schiff besuchen konnte, und hatte dort nie auf einem Pferd gesessen. Später, in den Jahren ihrer Verbannung, war sie viele tausend Meilen weit zu Fuß gegangen, aber als Frau eines Burghauptmanns durfte sie nicht einfach herumspazieren wie eine Magd, sondern musste, wenn sie die Nachbarburgen oder den Ziegenhof ihrer Freundin Hiltrud besuchen wollte, entweder einen Wagen benutzen oder in den Sattel steigen. Da sie nicht jedes Mal anspannen lassen wollte, wenn sie die Sobernburg verließ, hatte sie Michel gebeten, ihr das Reiten beizubringen, aber ihr war nach kurzer Zeit schon klar geworden, dass sie nie eine solch unerschrockene Amazone werden würde wie Frau Irmingard, die diesjährige Gastgeberin der ersten Herbstjagd. Es war in diesem Landstrich Brauch, dass einer der Burgherren und seine Gemahlin die Zeit der Herbstjagden festlich eröffneten und dazu sämtliche Nachbarn von den Burgen der Umgebung einlud.
Während Marie ihren Gedanken nachhing, plauderte Frau Irmingard unentwegt weiter. Die Herrin der Weilburg stammte aus adligem Hause wie auch die anderen hier versammelten Burgherren und ihre Damen, während Marie und ihr Mann bürgerlicher Herkunft waren. Das hatte Ludwig von der Pfalz nicht gehindert, Michel als Vogt des Amtes Rheinsobern über die meisten der hier anwesenden Standesherren zu setzen. Irmingard und Konrad hatten dennoch mit ihnen Freundschaft geschlossen, und sie pflegten gutnachbarliche Beziehungen. Fast alle, die zum Rheinsoberner Amt gehörten, hatten Michels Position ebenfalls akzeptiert, und diejenigen, die sich über die nicht standesgemäße Herkunft des Paares auf der Sobernburg mokierten, zeigten ihre Ablehnung nicht offen, denn niemand wollte sich die Feindschaft eines Mannes zuziehen, der so hoch in der Gunst des Pfalzgrafen stand wie Michel Adler. Es konnte ja nur eine Frage der Zeit sein, bis Herr Ludwig seinen treuen Gefolgsmann zum Ritter schlagen würde.
Irmingard musterte Marie, die ihr doch etwas zu still geworden war. »Euer neues Gewand kleidet Euch prächtig. Wollt Ihr so gut sein, mir den Schnitt zu zeigen?«
»Gerne.« Marie tauchte aus ihrer Versunkenheit auf und lächelte ihrer geduldigen Gastgeberin dankbar zu. Nun gesellten sich noch andere Damen zu ihnen, die den Jagdtrupp bereits verlassen hatten. Jede kannte irgendwelchen neuen Klatsch, und so entspann sich eine lebhafte Unterhaltung, die auch nicht endete, als sie den unterhalb der Weilburg gelegenen Sammelplatz erreichten, auf dem bereits alles für den festlichen Umtrunk und ein reichlich bemessenes Mahl vorbereitet worden war. Marie und ihre Begleiterinnen waren kaum aus den Sätteln gestiegen, da reichten ihnen die Pagen, die in die Farben des Weilburgers gekleidet waren, Becher mit heißem Würzwein. Trotz des durch kaum eine Wolke getrübten Sonnenscheins war es jetzt, Ende Oktober, bereits empfindlich kühl und ein Trunk, der von innen wärmte, jedermann willkommen. Das Getränk war so heiß, dass Marie sich beinahe die Lippen verbrannt hätte, schmeckte jedoch besser, als Irmingard es prophezeit hatte.
»So ein Schluck tut immer gut«, sagte Frau Luitwine von Terlingen zufrieden und streckte einem Pagen auffordernd ihr leeres Trinkgefäß hin. Marie ließ es bei dem einen Becher bewenden und sah den Jagdknechten zu, die das erlegte Wild herbeibrachten und am Rand des Platzes aufreihten. Die Strecke, die den noch mit Eis aus dem letzten Winter gekühlten Vorratskeller auf der Weilburg füllen würde, war schon jetzt recht beachtlich.
Als die ersten Jäger zurückkehrten, war von Michel weit und breit noch nichts zu sehen, und Marie begann sich schon Sorgen zu machen, er könne zu viel riskiert und sich verletzt haben. Doch als er an der Seite seines Gastgebers auftauchte, wirkte er munter und guter Dinge. Marie lief ihm entgegen und umarmte ihn stürmisch, kaum dass er aus dem Sattel gestiegen war.
Michel ließ sich die Liebkosung lachend gefallen, schob seine Frau dann ein Stück von sich weg und kitzelte sie an der Nase. »Na, mein Schatz, wie viele Hirsche hast du heute erlegt?«
Marie schnaubte. »Keinen, und das weißt du genau!«
»Grämt Euch nicht, Frau Marie, Euer Gemahl hat dafür umso mehr geschossen. Es gibt keinen Zweifel, dass er heute unser Jagdkönig ist.« Konrad von Weilburg winkte den Jagdmeister herbei, ließ sich einen Kranz aus Tannenzweigen reichen und setzte ihn Michel auf den Kopf.
Inzwischen hatten die anderen Jäger bereits ihren ersten Becher Würzwein getrunken und ließen sich nachschenken. Michel trank sein Gefäß ebenfalls zum zweiten Mal leer, aber mehr aus Geselligkeit, als um die klammen Knochen zu wärmen. Dann zog er Marie an sich und küsste sie auf die Wange. »Lass ruhig andere Frauen Hirsche schießen. Ich liebe dich so, wie du bist.«
»Das nenne ich ein Männerwort.« Konrad von Weilburg zwinkerte Michel zu und drückte Frau Irmingard einen Kuss auf die Lippen. Sie ließ es sich kichernd gefallen, zeigte dabei aber auf die wohl gefüllten Tische.
»Du solltest lieber an deine Gäste denken als an dein Vergnügen. Jagen macht hungrig, und du willst doch nicht, dass es heißt, beim Weilburger wären die Mägen leer geblieben.«
»Das will ich wahrhaftig nicht. Kommt zu Tisch, Leute, und setzt euch! Alles, was Magen und Leber begehren, ist aufgetragen.« Herr Konrad umfasste seine Frau, hob sie hoch und trug sie zu ihrem Platz. »Und jetzt behaupte noch einmal, ich würde dich nicht auf Händen tragen«, erklärte er fröhlich.
»Für heute will ich es gelten lassen.« Frau Irmingard warf ihrem Mann eine Kusshand zu und forderte die Gäste auf, ordentlich zuzugreifen. Während die hungrigen Mägen gefüllt wurden, herrschte eine nur von Schmatzen und Rülpsen unterbrochene Stille. Doch kaum fühlten sich die Gäste halbwegs gesättigt, wurde eifrig Jägerlatein gesponnen. Man lobte die erfolgreichen Jäger oder spottete über das Missgeschick einiger Pechvögel. Nach einer Weile lenkten die Älteren das Gespräch auf die Politik.
Frau Luitwines Ehemann Gero blickte auf seinen leeren Teller, als käme von ihm alles Leid der Welt, und seufzte. »Ich hoffe, wir können uns im nächsten Jahr noch genauso fröhlich zusammensetzen und es uns gut gehen lassen.«
»Was sollte uns daran hindern?«, fragte der Gastgeber verblüfft.
»Na, dieser verfluchte Aufstand in Böhmen! Der Kaiser wird Herrn Ludwig auch diesmal wieder um Waffenhilfe bitten, und noch einmal wird der Pfalzgraf nicht Nein sagen können, denn es geht auch um die Obere Pfalz. Ich fürchte, so mancher von uns wird sich im nächsten Herbst in unsere schöne Heimat zurücksehnen.«
»Oder tot sein …«, warf ein anderer mit hohler Stimme ein. Der Mann war als Schwarzseher verschrien, und dennoch zuckten die meisten Gäste zusammen. Der böhmische Aufstand war nicht irgendeine Erhebung, die missgestimmte Adlige ausgelöst hatten, oder eine Bauernrevolte, die sich schnell niederschlagen ließ, sondern ein blutiger Krieg zwischen Kaiser Sigismund, der auch die Krone des Königreichs Böhmen trug, und den hussitischen Ketzern, die bislang fast jede Schlacht gewonnen hatten.
»Wollen wir hoffen, dass der Pfalzgraf so klug sein wird, nicht uns zur Heerfahrt aufzufordern, sondern Freiwillige nimmt, denen mehr an Ruhm und Beute gelegen ist als an einer fröhlichen Jagd in der Heimat.« Konrad von Weilburg hob seinen Becher und trank den anderen zu, in der Hoffung, den Schatten vertreiben zu können, der sich über die Gruppe gelegt hatte.
2.
Die Feier zog sich bis in den Abend hinein und ging im Rittersaal weiter, bis die Glocke Mitternacht läutete und etliche Gäste von Knechten und Mägden in die für sie geräumten Kammern getragen werden mussten. Marie und Michel hatten dem Wein weniger zugesprochen als die meisten und konnten sich am nächsten Vormittag einem ausgiebigen Frühstück widmen. Danach verabschiedeten sie sich von ihren Gastgebern, um nach Rheinsobern zurückzukehren.
»Besucht uns noch einmal, bevor der Schnee die Straßen unpassierbar macht«, forderte Ritter Konrad sie auf, während seine Frau Irmingard Marie bat, den Tuchhändler, von dem sie ihre Stoffe bezog, zur Weilburg zu schicken.
»Das werde ich gerne tun«, versprach Marie und ließ sich von Michel auf ihre sanfte braune Stute heben, die mit ihrem bedächtigen Gang ihrem Namen Häschen keine Ehre machte. Michel schwang sich ebenfalls in den Sattel, winkte den Weilburgern und den restlichen Gästen zu und ritt zum Tor hinaus. Marie folgte ihm dichtauf, während der narbige Timo, Michels Knecht, ein Stück hinter ihnen blieb, um ihre Zweisamkeit nicht zu stören.
Michel schlug ein gemächliches Tempo an, so dass Marie neben ihm reiten und sich mit ihm unterhalten konnte. Dennoch erreichten sie bereits nach kurzer Zeit die Rheinebene und sahen dann die Stadt Rheinsobern vor sich liegen, die sich an einem Ausläufer des Schwarzwalds hochzog und nun seit zehn Jahren ihre Heimat war. Unter ihrer Verwaltung war der Ort zu einem kleinen quirligen Handelszentrum geworden, dessen Kirchtürme die Reisenden bereits von weitem grüßten und das von einer festen Schutzmauer umgeben war, die Michel an zwei Stellen hatte erweitern lassen, um Raum für neue Häuser zu schaffen. Auf der Anhöhe, die in die Stadt hineinragte, lag Michels und Maries Heim, die Sobernburg. Auch hier waren in den letzten Jahren die Mauern verstärkt und neue Wehrtürme gebaut worden, doch noch immer glich die Festung einem grob behauenen, grauen Kasten, der so gar nicht in die sanfte, jetzt vom Herbst in gelbrotes Laub gehüllte Landschaft passte.
Maries Blick flog nach Norden, dorthin, wo inmitten einer Ansammlung kleinerer Bauernhöfe der stattliche Ziegenhof ihrer Freundin Hiltrud lag. Mit Häschen wäre sie in kurzer Zeit dort gewesen, und einige Augenblicke kämpfte sie gegen die Versuchung an, einfach dorthin zu reiten. Sie hätte gerne ein paar Stunden in Hiltruds gemütlicher Küche verbracht, köstlichen Tee getrunken und mit ihrer Freundin geschwatzt. Aber als Herrin der Sobernburg durfte sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen. Nach drei Tagen Abwesenheit musste sie zuerst dort nach dem Rechten sehen, bevor sie sich ihrem Vergnügen widmete.
Michel strich ihr sanft über den Rücken. »Du bist auf einmal so still.«
Marie schenkte ihm ein Lächeln. »Oh, bin ich das? Ich habe eben beschlossen, heute Nachmittag zu Hiltrud zu reiten.«
»Wenn du nichts dagegen hast, komme ich mit. Frau Irmingards Würzwein war nicht schlecht, aber der von Hiltrud schmeckt um einiges besser.« Michel beugte sich fröhlich lachend zu ihr hinüber und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich liebe dich, mein Schatz.«
»Ich dich auch.« Marie gab sich ganz dem wohligen Gefühl hin, das Michels Zärtlichkeiten in ihr ausgelöst hatten, und hätte ihn am liebsten aufgefordert, als Erstes in ihr Schlafgemach zu kommen. Ihr Gesinde, allen voran ihre Wirtschafterin Marga, würde sie zwar für schamlos halten, wenn sie sich am helllichten Tag mit Michel ins Bett zurückzog, aber sie hatte Lust auf eine vergnügliche Balgerei zwischen den Laken. Sie warf Michel einen auffordernden Blick zu, den er grinsend beantwortete, und trieb Häschen zu einer rascheren Gangart an.
Vorerst wurde jedoch nichts aus ihrem Vorhaben, denn kurz vor der Stadt entdeckte Marie ein eng umschlungenes Paar, das unweit des Weges unter einer mächtigen Buche stand und sich selbstvergessen küsste. Das Kleid des Mädchens und ihre Frisur kamen Marie bekannt vor, und sie zügelte unwillkürlich ihre Stute.
Michel wurde ebenfalls langsamer. »Was ist?«
Marie deutete auf das Paar, das in seiner Liebesseligkeit die Reiter nicht bemerkt hatte. »Ich frage mich, was Ischi sich dabei denkt, sich heimlich mit einem Burschen zu treffen.«
Michel lachte auf. »Heimlich kann man das wohl nicht nennen!«
Aber er verstand Marie auch ohne ihr empörtes Schnauben. Ischi war ihre Leibmagd und ihr erklärter Liebling unter dem Gesinde auf der Sobernburg, und bisher hatte das Mädchen ihr keinen Grund zur Klage gegeben. Es jetzt in den Armen eines jungen Mannes zu sehen schockierte seine Frau sichtlich, denn man machte die Herrin für das Wohlergehen und die Moral ihrer Mägde verantwortlich, und wenn eine von ihnen mit einem dicken Bauch herumlief, wurde sie mit Stockhieben bestraft und oft aus der Stadt getrieben. In diesem Fall redete der Priester aber auch der Hausfrau ins Gewissen und ließ sie ihre Unaufmerksamkeit mit Gebeten und Bußübungen bereuen.
Marie hieb verärgert mit der Reitgerte durch die Luft und machte Häschen damit nervös. Michel griff schnell nach den Zügeln, die sie achtlos hatte sinken lassen, und beruhigte die auskeilende Stute. »Du solltest dich zuallererst selbst im Zaum halten, wenn du im Sattel sitzt. Häschen ist zwar eine Seele von einem Pferd, aber trotz allem kein Strohsack, mit dem man machen kann, was man will.«
»Tut mir Leid.« Marie senkte zerknirscht den Kopf, starrte aber sofort wieder zu ihrer Leibmagd hinüber. Bisher war sie überzeugt gewesen, Ischis Loyalität gelte allein ihr, nun aber fragte sie sich, ob sie sich noch auf ein Mädchen verlassen konnte, das sich hinter ihrem Rücken mit Burschen herumtrieb.
»Ich muss das klären. Reite du schon mal voraus.« Vergessen war die angenehme Stunde, die sie mit Michel hatte verbringen wollen, und sie lenkte ihre Stute auf das Paar zu. Michel blickte ihr einen Augenblick kopfschüttelnd nach, winkte dann Timo, der in einigem Abstand stehen geblieben war, und trieb sein Pferd an. Seiner Meinung nach hätte Marie auch später mit Ischi reden können. Jetzt würde sie, wenn sie nach Hause kam, wohl kaum noch in der Stimmung sein, ihm ins Schlafgemach zu folgen.
Als Häschen auf das junge Paar zutrabte, schreckten die beiden hoch. Ischis Blick wirkte weniger schuldbewusst, als Marie erwartet hatte, und ihr Ärger richtete sich weniger gegen die Magd als den jungen Mann. Es handelte sich um Ludolf, den Sohn und künftigen Nachfolger des Rheinsoberner Drechslermeisters und Ratsherrn Elias Stemm, der zu den Honoratioren der Stadt gehörte. Der Bursche hatte gewiss keine ehrlichen Absichten, denn in seinen Kreisen galten Mägde höchstens als Zeitvertreib und wurden in der Regel nach kurzer Zeit sitzen gelassen, auch und besonders, wenn die Beziehung Folgen zeigte, für die dann nur das Mädchen hart bestraft wurde. Ischi war in Maries Augen zu schade, um von einem gewissenlosen Burschen verführt zu werden, daher nahm sie sich vor, den beiden gründlich den Kopf zurechtzusetzen.
Ein Teil ihrer Gedanken spiegelte sich wohl auf ihrem Gesicht, denn Ludolf starrte sie an, als müsse er einen von vorneherein aussichtslosen Kampf ausfechten. »Herrin, Ihr habt gewiss einen schlechten Eindruck von uns gewonnen, aber lasst Euch versichern, dass es nicht so ist, wie Ihr denkt.«
Ischi drängte sich vor ihn und ergriff Maries Steigbügel. »Herrin, bitte, seid uns nicht böse! Ludolf und ich lieben uns, und so Gott will, werden wir heiraten.«
»Hat er dir das versprochen, damit du dich ihm hingibst?«, fragte Marie spöttisch.
Ischi schüttelte wild den Kopf. »Nein, Herrin, Ludolf hat nichts dergleichen gefordert. Ich bin noch genauso unberührt wie bei meiner Geburt. Lasst mich von der Hebamme untersuchen, wenn Ihr mir nicht glaubt.«
Marie las keinen Falsch in den Augen des Mädchens, und so wurde ihre Miene weicher. Auf ihren Lippen erschien sogar der Anflug eines Lächelns. Ludolf nahm wahr, wie ihr Zorn wich, trat sichtlich aufatmend an Ischis Seite und legte den Arm um sie. »Herrin, ich schwöre Euch, Ischi erst zu berühren, wenn sie mein Weib geworden ist. Es wird nicht leicht sein, meinen Eltern die Zustimmung zu dieser Heirat abzuringen, aber wenn Ihr mit ihnen sprecht, werden sie einwilligen müssen.«
»Ja, bitte, Herrin, tut es für mich. Habe ich Euch nicht all die Jahre treu gedient?« Ischi stiegen die Tränen in die Augen, denn sie wusste, wie hoffnungslos ihre Liebe war.
Doch Marie fand, dass die beiden gut zusammenpassten. Ischi war klein und zierlich und besaß ein wohlgeformtes Gesicht mit großen blauen Augen und dunkelblondes Haar. Ludolf war nur einen halben Kopf größer als sie und noch recht schlank, auch wenn man jetzt schon sehen konnte, dass er später an Gewicht und Breite zulegen würde. Seine Hände aber, die auf der Drehbank wahre Meisterwerke zaubern konnten, würden wohl schmal und biegsam bleiben. Sein Gesicht wirkte eher ehrlich als schön, und in seinen hellen Augen lag ein Ausdruck, der auf Verlässlichkeit schließen ließ.
»Also gut, ich werde mich Eurer Sache annehmen, auch wenn es mich nicht freut, dass ich mich über kurz oder lang nach einer neuen Leibmagd umsehen muss.« Marie nickte, als wolle sie ihre Worte bestätigen, und sah sich durch die glücklich aufflammenden Gesichter des Pärchens belohnt. Zu leicht wollte sie es ihnen jedoch nicht machen.
»Zuerst aber will ich sichergehen, dass eure Zuneigung von Dauer ist. Wenn ihr übers Jahr noch immer heiraten wollt, so will ich euch die Hochzeit ausrichten. Bis dorthin aber werdet ihr euch in allen Ehren treffen, und ich will kein schlechtes Wort über euch hören, habt ihr mich verstanden?«
Ischi ergriff ihre Hand und führte sie an die Lippen. »Ich danke Euch, Herrin«, rief sie so überschwänglich, als hätte Marie ihr die sofortige Eheschließung erlaubt. Auch Ludolf bekundete wortreich seinen Dank und schwor, Maries Willen zu achten und Ischi nur mit ihrer Erlaubnis wieder zu sehen.
Marie schnitt den beiden mit einer heftigen Handbewegung das Wort ab. »Gebt euch noch einen Kuss und kehrt dann an eure Arbeit zurück. Ludolfs Vater wird einer Heirat gewiss geneigter sein, wenn sie die Hände seines Sohnes beflügelt.«
»Ihr habt Recht, Herrin. Ich muss mich tatsächlich sputen, wenn ich meine Aufgaben für heute erledigen will.« Ludolf zog Ischi kurz an sich, drückte ihr einen Kuss auf die Lippen und eilte mit langen Schritten Richtung Stadt.
Das Mädchen sah ihm einen Augenblick nach und blickte dann verlegen zu Marie auf. »Bitte verzeiht mir, Herrin, dass ich nicht früher mit Euch gesprochen habe. Ich weiß doch, wie gut Ihr seid.«usatz
»Oh, ich kann auch böse werden«, antwortete Marie lächelnd. »Doch nun komm, oder willst du, dass ich die Haken meines Reitkleids selbst lösen muss?« Im gleichen Augenblick fiel ihr ein, dass Michel sie hätte auskleiden können, und sie machte sich Vorwürfe, weil sie ihn nicht begleitet hatte.
Das Mädchen hielt sich am Steigbügel fest, um nicht zurückzubleiben, kam aber selbst auf dem ansteigenden Weg zur Sobernburg nicht außer Atem, denn Marie ließ Häschen im Schritt gehen. Als sie in den Burghof einbogen, sahen sie vier junge Mägde im Schatten des Torturms sitzen und herumalbern. Marie musterte eine nach der anderen und überlegte, welche von ihnen als Ischis Nachfolgerin in Frage kommen könnte. Die Wahl würde ihr schwer fallen, denn Ischi war ein Juwel, wie sie so schnell kein zweites finden würde, daher war sie froh, dass sie noch ein gutes Jahr Zeit hatte, eine andere auszuwählen und anzulernen.
»Na, ihr vier, ist mein Mann bereits angekommen?«, rief sie den Mägden zu, die immer noch kichernd die Köpfe zusammensteckten.
»Freilich ist er das, Herrin. Er lässt Euch sagen, er wartet im Schlafgemach auf Euch«, antwortete eines der Mädchen keck.
»Dann will ich ihn nicht warten lassen.« Marie lenkte Häschen zu einer Bank an der Mauer und stieg dort ohne Hilfe ab. Sie warf der Sprecherin die Zügel zu. »Führe meine Stute zum Stall und übergib sie einem der Knechte.«
Die Kleine knickste, nahm vorsichtig das Zügelende und starrte Häschen so misstrauisch an, als könne die Stute sie jeden Moment beißen. Marie wandte sich lachend ab und eilte die Treppe zum Hauptgebäude hinauf. Ischi folgte ihr auf dem Fuß, daher sahen beide nicht, dass eine dunkel gekleidete Frau mittleren Alters um die Ecke bog und schimpfend auf die erstarrenden Mägde losfuhr.
»Los, an die Arbeit, ihr faulen, pflichtvergessenen Dinger! Ihr habt wohl vergessen, was ich euch aufgetragen habe.«
Alle Fröhlichkeit war aus den Mienen der vier gewichen und hatte einem verschreckten Ausdruck Platz gemacht. »Nein, Frau Marga, wir …«, stotterte eine.
Die Wirtschafterin der Sobernburg hob die Hand, als wolle sie das Mädchen schlagen. »Du sollst hier nicht Maulaffen feilhalten, sondern arbeiten, sonst setzt es was. Und was soll der Gaul hier? Um den können sich doch die Stallknechte kümmern.«
»Die Herrin hat mir aufgetragen, Häschen zum Stall zu führen«, verteidigte sich die Magd, die das Pferd am Zügel hielt.
»Und warum stehst du dann noch hier herum?«, fragte die Wirtschafterin zornig. »Wenn ihr noch einmal auf dem Hof herumgackert, anstatt zu tun, was ich euch aufgetragen habe, werde ich euch durch fügsamere Mägde ersetzen!«
Während die vier Mädchen in alle Richtungen davoneilten, um der Wirtschafterin aus den Augen zu kommen, flog Margas Blick zu den Fenstern hoch, hinter denen die Gemächer des Burgherrn und seiner Frau lagen, und sie verzog die Lippen. Bei dem Lotterleben, das ihre Herrschaft führte, konnten die Mägde ja nur faul und widerspenstig werden.
Marie hatte unterdessen den Rittersaal erreicht und wollte zur Treppe hinübergehen, um zu ihren Gemächern hochzusteigen, als sie Michel mit nachdenklichem Gesicht auf seinem Stuhl an der Stirnseite der Tafel sitzen und auf einen Bogen Pergament starren sah.
»Was ist los? Schlechte Nachrichten?«
Michel stieß die angehaltene Luft aus und nickte. »Ich könnte mich auch geehrt fühlen. Gestern war ein Bote des Pfalzgrafen hier und hat diese Botschaft überbracht. Darin befiehlt mir Herr Ludwig, über den Winter einen Trupp Soldaten auszurüsten und im nächsten Frühjahr mit ihnen nach Böhmen aufzubrechen.«
3.
Marie lauschte den regelmäßigen Atemzügen an ihrer Seite und seufzte leise. Sie hätte Michel noch so viel sagen mögen, aber sie wollte ihn schlafen lassen, denn morgen musste er in den Krieg ziehen, und dafür benötigte er alle Kraft, die er noch sammeln konnte. Sie hingegen würde in dieser Nacht wohl kein Auge zumachen können, und sie sah noch viele weitere Nächte voller Sorgen und Angst vor sich. In den zehn Jahren ihrer Ehe waren sie nie länger als zwei, drei Nächte getrennt gewesen, und wenn Michel diesmal die Burg ohne sie verließ, würde es ein Aufbruch ins Ungewisse sein.
Der Mond schien durch das offene Fenster in ihre Kammer und leuchtete sie heller aus als ein Kienspan. Sein silbriger Schein spielte auf den großen, wohl gefüllten Truhen, die ihren Reichtum bekundeten, fiel aber nicht auf die holzgetäfelten Wände hinter ihnen, so dass diese nun dunkler wirkten als die Nacht. Schwarz wie der Tod, schoss es Marie durch den Kopf, und sie drehte sich unwillkürlich zu Michel um, dessen Umriss sich gegen das Fenster abzeichnete. Das Bett, in dem sie lagen, war groß genug für zwei Menschen, die viel Platz für sich beanspruchten. Sie hatten es gleich nach dem Einzug in die Burg Rheinsobern anfertigen lassen, weil Marie nicht gewohnt gewesen war, nahe bei einem anderen Menschen zu schlafen. In dieser Nacht aber wünschte sie, sie lägen eng aneinander gekuschelt wie andere Paare und nicht auf mehr als Armeslänge voneinander entfernt. Sie wagte es jedoch nicht, zu Michel hinüberzurücken, um ihn nicht zu wecken.
Gerade als sie sich vorsichtig wieder zurücklegen wollte, wurde er unruhig. Er schnarchte kurz und vernehmlich auf und erwachte dann von seinem eigenen Geräusch. Als er Marie neben sich sitzen sah, rutschte er zu ihr hin und legte die Hand auf ihren Unterschenkel. Die Berührung brannte wie Feuer auf ihrer Haut.
»Ich wollte dich nicht wecken, Michel«, flüsterte sie.
Er zog sie an sich, nahm eine ihrer langen Haarsträhnen und wickelte sie um seinen Zeigefinger. Obwohl ihre Locken seit ihren Wanderjahren dunkler geworden waren, leuchteten sie im Mondlicht so hell wie frisch geprägtes Gold, und ihr Gesicht war immer noch so sanft und lieblich, dass es jedem Bildnis der Heiligen Jungfrau zur Ehre gereicht hätte.
»Du warst nie schöner als heute, Marie, weißt du das?« Michels Augen leuchteten bei diesen Worten begehrlich auf. Sie war seine Frau, und er würde sie bei Sonnenaufgang verlassen, ohne zu wissen, wann er sie wieder in die Arme schließen würde.
Marie hob in einer bedauernden Geste die Hände. »Ich würde meine ganze Schönheit dafür hergeben, wenn du bei mir bleiben könntest.«
Michel schüttelte heftig den Kopf. »Damit wäre ich aber gar nicht einverstanden, denn ich will mich auf die Heimkehr zu meiner schönen Frau freuen können.«
Marie senkte traurig den Kopf. »Es tut mir Leid, dass ich nicht die Frau bin, die du verdient hast.«
»Wie kommst du denn darauf? Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Du hältst mein Haus in Ordnung, unterstützt mich bei meinen Aufgaben und schenkst mir im Bett Wonnen, von denen andere Männer nicht einmal zu träumen wagen. Wie könnte ich da unzufrieden sein?« Eine leichte Gereiztheit schwang in seinen Worten mit.
Marie bemerkte es nicht, sondern klammerte sich an ihn und versuchte, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten. »Ich bin traurig, weil ich dir keine Kinder schenken konnte, Michel. Aber wenn du zurückkommst, suche ich dir eine Magd aus, mit der du einen Erben zeugen kannst.«
»Als wenn ich je eine andere Frau ansehen würde als dich!« Michel lachte jungenhaft übermütig auf und küsste eine ihrer rosigen Brustwarzen, die sich vorwitzig aus dem Schlitz ihres Nachthemds hervorgestohlen hatte. Bevor Marie etwas darauf antworten konnte, wälzte er sich auf sie und drückte mit sanftem Zwang ihre Schenkel auseinander. »Komm, meine Schöne, schenk mir noch einmal deine Leidenschaft, damit ich weiß, auf was ich mich beim Zurückkommen freuen kann.«
»Warum muss der Pfalzgraf ausgerechnet dich losschicken?« Marie war nicht in Stimmung für eine Balgerei im Bett, aber als Michel zärtlich an ihrem rechten Ohrläppchen zu knabbern begann, brachte sie es nicht fertig, ihn zurückzuweisen. Sie wollte ihm diese Freude nicht missgönnen, und während er in sie eindrang, spürte sie ihre eigene Erregung wachsen. Es würde das letzte Mal für lange Zeit sein, sagte sie sich, und daher sollten sie beide den Liebesakt in guter Erinnerung behalten. Michel war ein starker und ausdauernder, aber auch sehr sanfter Liebhaber, der einer Frau Freude bereiten konnte. Marie klammerte sich an ihn, feuerte ihn mit leisen Rufen an und spürte, wie eine Woge der Lust sie durchrauschte, stärker, als sie sie je durchlebt zu haben glaubte.
Einige Zeit später lag er keuchend neben ihr, und sein Körper bebte im Nachhall der Erregung. Da packte ihn Marie und küsste ihn noch einmal. »Wie schade, dass du ausgerechnet jetzt fortmusst!«
»Es ist ein wichtiger Auftrag, Marie, und es gereicht mir zur Ehre, dass Ludwig von der Pfalz gerade mir das Kommando über diese Truppe erteilt hat. Selbst die adligen Ritter, die mich mit ihren Gefolgsleuten begleiten werden, müssen mich seinem Befehl zufolge als ihren Anführer akzeptieren.« Michel war mit seinen sechsunddreißig Jahren noch jung genug, um sich für den bevorstehenden Kriegszug begeistern zu können, und er dachte weniger an die harten, blutigen Schlachten, die vor ihm liegen mochten, als an Ruhm und Ehre. Zwar war der Feind, gegen den er ziehen musste, als hinterhältig und grausam verschrien, doch Michel vertraute der Macht des Kaisers und seines Pfalzgrafen.
»Wir werden es diesen böhmischen Ketzern schon zeigen! Spätestens im Herbst ist der Spuk vorbei, und dann kehre ich zu dir zurück«, versicherte er ihr.
Marie nickte ohne Überzeugung. »Sicher hast du Recht. Aber bis dahin werde ich dich sehr vermissen.«
Ihre Gedanken wanderten zurück zu dem Konzil, das vor zehn Jahren in ihrer Geburtsstadt Konstanz abgehalten worden war, und sie sah den Scheiterhaufen vor sich, auf dem der Kaiser und die Bischöfe den böhmischen Magister Jan Hus hatten verbrennen lassen. Durch dieses Feuer war ein weit größeres entfacht worden, aber das hatten die Mächtigen des Deutschen Reiches erst viel später begriffen. Kurz nach Jan Hus’ Tod war es in Böhmen zu einem schrecklichen Aufstand gekommen, in dessen Verlauf seine Anhänger die Ritterheere, die gegen sie gezogen waren, zersprengt und aufgerieben hatten. Durch ihre ersten Siege hatten die Hussiten so viel Zulauf bekommen, dass sie in der folgenden Zeit nicht nur jene Teile Böhmens, die dem Kaiser Sigismund, der ja auch König von Böhmen war, treu geblieben waren, mehr als einmal hatten verheeren können, sondern auch die angrenzenden Länder. Bisher war es niemandem gelungen, die Aufständischen in ihre Schranken zu weisen, und so wurden die Hussiten von Jahr zu Jahr kühner und hatten inzwischen ihrem König, der neben der Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches auch noch die ungarische Königskrone und etliche andere Herrschertitel trug, das Recht auf den böhmischen Thron abgesprochen.
Marie spürte, wie die Sorge um ihren Mann sich wie ein graues Tuch auf ihre Seele legte. »Sei vorsichtig, Michel! Kaiser Sigismund ist bereits mehrfach bei dem Versuch gescheitert, die Hussiten zu unterwerfen. Wer sagt dir, dass es ihm dieses Mal gelingt?«
Michel schob ihre Bedenken mit einem Lachen beiseite. »Wie kannst du daran zweifeln, mein Schatz? Schließlich bin ich nun dabei.« Es sprach so viel Selbstbewusstsein aus seinen Worten, dass Marie gegen ihren Willen lachen musste und ihr Herz ein wenig leichter wurde. Sie küsste ihn auf die Nasenspitze und bettete seinen Kopf an ihre Brust. »Schlaf jetzt, Michel, damit du morgen früh nicht zu müde bist, wenn du aufbrechen musst.«
»Ich hoffe, ich wache früh genug auf, um dich noch einmal unter mir zu spüren«, antwortete er fröhlich.
Als Michel am nächsten Morgen erwachte, stand die Sonne jedoch schon über dem Horizont, und von draußen scholl der Lärm der Knechte herein, die die Pferde sattelten und die Ochsen vor die Wagen spannten. Er lächelte Marie entschuldigend zu und scherzte mit ihr, während er sich Gesicht und Hände wusch. Als sie das Zimmer verlassen wollte, strich er ihr mit einem anzüglichen Lächeln über das Hinterteil. »Ich freue mich aufs Wiederkommen.«
»Ich mich auch.« Marie ging der Magd entgegen, die mit einem schweren Tablett die Treppe heraufkam, und servierte Michel eigenhändig das Frühstück. »Sei vorsichtig und gib auf dich Acht. Ich …« Sie schluckte ihre Tränen hinunter und versuchte, genauso munter zu lächeln wie er.
Michel gab ihr einen liebevollen Stups auf die Nase. »Das bin ich doch immer, mein Schatz. Außerdem ist die Gefahr nicht mehr so groß wie früher, denn Jan Ziska, der gefürchtete Kriegshauptmann der Hussiten, ist der Pest zum Opfer gefallen. Mit seinem Nachfolger, diesem ungeschlachten Prokop, werden wir schon fertig.«
Marie fand, dass ihr Mann den Kriegszug zu sehr auf die leichte Schulter nahm. Zwar lag Böhmen am anderen Ende des Reiches, aber es drangen laufend Gerüchte bis hierher in die Pfälzer Lande, und die waren nicht dazu angetan, ihre Ängste zu beschwichtigen. Es hieß, die Böhmen seien wahre Ungeheuer, die nicht einmal das Kind im Mutterleib schonten, und mehr als einmal hatten die Aufständischen die Heere, die gegen sie gezogen waren, zu Paaren getrieben und jeden niedergemetzelt, der ihnen in die Hände geriet. Als sie das und einiges andere Michel vorhielt, erntete sie ein nachsichtiges Lächeln. »Aus meiner tapferen Marie, die früher einmal so mächtigen Herren wie dem Reichsgrafen von Keilburg und sogar dem Kaiser getrotzt hat, ist ein zitterndes kleines Mädchen geworden! Ich komme zurück, das verspreche ich dir. Glaubst du, ich lasse mich von ein paar lumpigen Böhmen daran hindern? Wir reiten hin, schlagen sie zusammen, setzen Sigismund wieder auf seinen Thron, und ehe du dich versiehst, bin ich wieder zu Hause.«
»Hoffentlich hast du Recht.« Marie seufzte noch einmal auf und rang sich dann eine halbwegs zuversichtliche Miene ab. »Ich wünsche dir alles Glück der Welt, mein Schatz, und hoffe, du vergisst mich in der Ferne nicht.«
Michel blickte sie kopfschüttelnd an, küsste sie und streichelte zärtlich über ihre Stirn. »Dich zu vergessen ist unmöglich, mein Liebling. Aber nun muss ich mich beeilen, denn meine Leute sammeln sich wohl schon im Hof.«
Er trat ans Fenster und blickte hinaus. Tatsächlich nahmen seine Fußknechte bereits unten Aufstellung. Es handelte sich um kräftige, derbe Burschen, die Strapazen gewohnt waren. Sie waren in grob gewebte, graue Waffenröcke gekleidet, die knapp über die Taille reichten und sich von den plumpen Kitteln der Bauern nur durch das aufgenähte Wappen mit dem Pfälzer Löwen unterschieden. Darunter trugen sie Lederkoller, die zum Schutz gegen feindliche Hiebe und Stiche mit aufgenähten Eisenplatten besetzt waren. Einfach geschmiedete Hirnhauben, die stark an Kochkessel erinnerten, schützten ihre Köpfe.
Der Schmied, der die Helme hergestellt hatte, verdiente sein Brot normalerweise damit, Gegenstände des täglichen Gebrauchs anzufertigen und zu reparieren. Da es in Rheinsobern niemand gab, der Rüstungsteile und Waffen herstellen konnte, war Michel nichts anderes übrig geblieben, als auf den Mann zurückzugreifen. Mehr noch als das Unvermögen des Schmieds ärgerte Michel, dass er die Ausrüstung aus seiner und Maries privater Kasse hatte zahlen müssen, denn von Pfalzgraf Ludwig war nur der Befehl gekommen, die Truppe auszurüsten; die notwendigen Mittel hatte er ihm jedoch nicht zur Verfügung gestellt. Trotzdem wollte Michel alles daransetzen, um das Vertrauen seines Herrn nicht zu enttäuschen, auch wenn die Nachrichten, die er erhalten hatte, denkbar schlecht waren.
Gegen seine sonstige Gewohnheit hatte er Marie verschwiegen, wie schlimm es in den östlichen Reichsteilen wirklich aussah. Die Obere Pfalz an der Grenze Böhmens, die nominell seinem Herrn unterstand und von dessen Vettern Johann und Otto verwaltet wurde, stand dicht davor, ein weiteres Mal von den Hussiten überrannt und verwüstet zu werden, und auch in Sachsen, Franken und Österreich zitterten die Menschen vor den böhmischen Bauernkriegern, die ihren Märtyrer Jan Hus rächen und das Joch ihrer deutschen Barone und Grafen abwerfen wollten. Die Hussiten fielen wie Heusschreckenschwärme über die benachbarten Lande her und ließen nichts als verbrannte Erde zurück.
»Es wird Zeit, dass wir das abstellen!«
»Was?« Erst Maries Frage brachte Michel zu Bewusstsein, dass er seinen letzten Gedanken laut ausgesprochen hatte.
»Die böhmische Revolte!«, erwiderte er mit einem Lächeln, das seine Augen nicht erreichte. »Lass uns nach unten gehen.«
In der Kammer, in der seine Waffen aufbewahrt wurden, wartete sein Knecht Timo auf ihn, ein älterer, vierschrötiger Mann mit einer schneeweißen Narbe, die über Stirn und Nase bis über die rechte Wange verlief. Er sollte Michel als Feldwebel und Quartiermeister begleiten. Noch verrichtete er seine Dienste wie gewohnt, er hatte Michels Rüstung gebracht und half ihm, sie anzulegen. Marie griff ebenfalls zu, um Lederschnallen zu schließen und die Kleidung ihres Mannes zurechtzuzupfen. Als Burghauptmann von Rheinsobern war Michel das Recht verliehen worden, die Rüstung eines Ritters zu tragen. Für diesen Feldzug aber hatte er auf eine einengende Vollpanzerung verzichtet und sich für ein Kettenhemd mit stählerner Brustplatte entschieden, das ihm bis zu den Oberschenkeln reichte. Sein Lederwams und die ledernen Beinkleider waren mit aufgenieteten Stahlplatten versehen, die Arme und Beine schützen sollten, und auf dem Kopf trug er eine visierlose Sturmhaube mit Nackenschutz. Als er vollständig gerüstet war, schwang er seine Arme und ging ein paar Schritte hin und her, um seine Beweglichkeit zu prüfen. Marie betrachtete ihn mit schräg gelegtem Kopf, lächelte einen Augenblick versonnen und wurde sofort wieder ernst. In ihren Augen glich Michel einem jener sagenhaften Kriegshelden, von denen fahrende Sänger berichteten. In einer Schlacht kam es jedoch weniger auf die äußere Erscheinung und die Bewaffnung an, sondern auf Kampferfahrung, und die fehlte ihm trotz der Feldzüge, an denen er in jungen Jahren im Dienste des Pfalzgrafen teilgenommen hatte.
Rede deinen Mann nicht schlechter, als er ist, schalt sie sich in Gedanken. Um ihm das Herz nicht noch schwerer zu machen, legte sie ihre Hand in seine, lächelte ihm aufmunternd zu und begleitete ihn in die große Halle, in der sich die Ritter, die ihn begleiten sollten, und seine eigenen Unteranführer bereits versammelt hatten. In den letzten Jahren war aus dem schlichten, zugigen Raum ein repräsentativer und gleichzeitig wohnlich wirkender Rittersaal geworden, doch trotz der bestickten Wandbehänge, der Jagdtrophäen und der Webteppiche wirkte er in Maries Augen an diesem Tag besonders ungastlich und kalt. Daher war sie froh, als Michel alle aufforderte, nach draußen zu gehen. Im inneren Hof, der auf der einen Seite von dem an die Burgwand angebauten Zeughaus und auf der anderen vom Hauptgebäude der Burg begrenzt wurde, wimmelte es nun von Menschen, für die zwischen den fünf großen Wagen und den Pferden der Ritter kaum Platz blieb.
Die von Michel ausgerüsteten Fußknechte erhielten gerade die langen Spieße, die sie während des Marsches über der Schulter tragen würden. Michel winkte ihnen lächelnd zu. In den letzten Tagen hatte er mit jedem seiner Männer geredet und glaubte sich ihrer sicher sein zu können. Anders war es jedoch mit den vierzehn Rittern, die der Pfalzgraf ihm ausdrücklich unterstellt hatte, und deren Gefolge. Einige der adligen Herren hatten ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass es ihnen gegen den Strich ging, einem bürgerlichen Burghauptmann gehorchen zu müssen, und daher waren auch ihre Leute nicht gewillt, sich von ihm oder seinen Unteranführern etwas sagen zu lassen. Das war ein Problem, welches er auf dem Marsch würde lösen müssen, fuhr es Michel durch den Kopf. Er war stolz darauf, dass der Pfalzgraf ihn zum Anführer der Truppe bestimmt hatte, und daher nicht gewillt, sich das Heft aus der Hand nehmen zu lassen.
Während sein Blick über die Männer und Wagen glitt, trat Marie an seine Seite, klammerte sich an ihn und schenkte ihm ihr süßestes Lächeln. »Soll ich nicht ein Stück mitkommen, nur eine oder zwei Tagereisen weit?«
Michel schüttelte lächelnd den Kopf. »Es ist besser, du bleibst hier. Es wäre ungerecht gegenüber den anderen, die ihre Familien bereits zurücklassen mussten. Außerdem will ich mein Augenmerk mehr auf meine neuen Kameraden richten als auf deine Reize.«
Seine Worte klangen scherzhaft, doch Marie begriff, was Michel im Sinn hatte. Er wollte sich gleich zu Anfang die Störenfriede heraussuchen und sie zurechtstutzen, dabei durfte sie ihn nicht ablenken. Sie nickte mit einem bekümmerten Lächeln. »Du hast Recht. Es ist besser, wenn du die Leute gut im Auge behältst, denn nicht alle sind bereit, unter dir zu dienen.«
Ohne den Namen zu nennen, spielte Marie auf Falko von Hettenheim an, einen hochfahrenden und überstolzen Ritter, für den allein eine adlige Herkunft mit möglichst langer Ahnenreihe zählte. Schon am Tag seiner Ankunft hatte der Mann, als er sich nur unter seinesgleichen wähnte, über Michel gelästert und ihn einen Wirtsbalg und unfähigen Emporkömmling genannt. Marie hatte das gehört und sich beinahe mit Gewalt zurückhalten müssen, um nicht auf den eingebildeten Kerl loszugehen und ihm vor aller Augen recht undamenhaft die Meinung zu sagen. Es war kein Geheimnis, dass Michel als fünfter Sohn eines Konstanzer Gassenschenks zur Welt gekommen war und nicht als Sohn eines Ritters, aber er hatte dem Pfalzgrafen seinen Wert bewiesen und war für seine Verdienste mit seiner jetzigen Stellung belohnt worden.
Ritter Falko aber glaubte über jeden Menschen, der ihm nicht gleichrangig war, verfügen zu können wie über einen seiner Leibeigenen. Am Tag zuvor hatte er ihr in einem Korridor aufgelauert, sie wie eine beliebige Magd in eine leere Kammer gezerrt, ihr den Rock hochgezogen und seine Hüfte an ihrem Oberschenkel gerieben. Erst als er eine Hand benötigt hatte, um seine Hose zu öffnen, hatte sie sich losreißen und ihm entkommen können. Sein Fluch gellte ihr jetzt noch in den Ohren, ebenso wie seine Worte, dass eine Hure wie sie gefälligst stillzuhalten habe. Sie hatte eine Weile überlegt, ob sie Michel von dem Zwischenfall erzählen oder lieber den Mund halten sollte, und sich schließlich für das Schweigen entschieden. Da Michel und Falko von Hettenheim gemeinsam in den Krieg ziehen mussten, wollte sie keinen Streit zwischen ihnen provozieren.
Michel bemerkte Maries verkniffene Lippen und schloss sie in die Arme. »Es ist so weit, mein Schatz. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Wünsche du es mir auch.«
»Das tue ich von ganzem Herzen, und ich sehne mich jetzt schon nach dir!« Marie erwiderte seine Umarmung, küsste ihn auf den Mund und trat dann zurück. Timo brachte Michels Pferd, einen kräftigen braunen Wallach, der zwar etwas kleiner war als die Schlachtrosse der Ritter, dafür aber ausdauernder und schneller. Michel schwang sich mit Leichtigkeit in den Sattel, nahm den Zügel in die Rechte und streckte die Linke hoch, um die Aufmerksamkeit seiner Männer auf sich zu ziehen. »Wir brechen auf. Ein Hurra auf unseren Pfalzgrafen!«
Seine Pfälzer schwenkten ihre Spieße und schrien laut »Hurra!«, während von den anderen nur ein schwaches Echo kam.
Dann reihte sich einer nach dem anderen in den Zug ein, den Michel anführte. Falko von Hettenheim musste sich sichtlich dazu zwingen, dem nichtadligen Burghauptmann den Vortritt zu lassen, lenkte sein Pferd aber so, dass der Kopf des Tieres beinahe Michels Bein berührte. Als der Blick des Ritters Marie streifte und dann auf Michels Rücken hängen blieb, spiegelten sich Neid und Hass auf seinem Gesicht, denn unwillkürlich verglich er die schöne Burgherrin mit seiner plumpen und unscheinbaren Ehefrau, die ihn schon lange nicht mehr reizte. Er durfte seine Gemahlin jedoch nicht verstoßen, denn sie war die Tochter des Grafen Rumold von Lauenstein, eines hoch geschätzten Gefolgsmanns und engen Ratgebers des Pfalzgrafen.
Wäre der Wirtsbalg vor ihm ein beliebiger Bauer oder Kleinbürger gewesen, hätte er ihn auf der Stelle abgestochen, sich seine Frau genommen und so lange benutzt, bis er ihrer überdrüssig geworden wäre. So aber würde er sein Verlangen an Trosshuren und Bauernmägden stillen müssen, die er sich nach Belieben nehmen konnte, und sich nach den Schlachten an dem schadlos halten, was dem Sieger zufiel. Dem Vernehmen nach sollten die Frauen in Böhmen sehr schön sein, also würde er deren Reize bis zur Neige auskosten, ganz gleich, ob er sie zwingen musste oder ob sie sich ihm freiwillig unterwarfen.
Tief in seine Gedanken verstrickt hatte er die Zügel durchhängen lassen, und so fiel sein Pferd zurück, bis es neben dem Reittier Godewins von Berg einhertrottete.
Godewin, der schon Falkos Jugendfreund gewesen war, stieß diesen leicht an und grinste unter dem hochgeschobenen Visier. »So tief in Gedanken?«
»Ich habe an die Weiber gedacht, die ich unterwegs bespringen werde«, antwortete Ritter Falko wahrheitsgemäß.
»Hoffentlich finden wir genug für uns alle. Der Wirtsspross da vorne war sich ja zu fein, Trosshuren anzuwerben.« Godewin seufzte entsagungsvoll.
Falko lachte boshaft auf. »Vielleicht hatte Hauptmann Gossenratte Angst, sein Weib würde sich unter die käuflichen Weiber einreihen. Soviel man weiß, soll sie, bevor der Kerl sie heiratete, eine wandernde Hure gewesen sein. Mir ist immer noch ein Rätsel, wieso unser Pfalzgraf so ein schmutziges, ehrloses Pack auf die Rheinsoberner Vogtsburg gesetzt hat.«
»Vielleicht hat Frau Marie die Röcke bei den richtigen Leuten gehoben. Sie ist wohl ein Bissen, den man nicht alle Tage findet. Ich würde sie auch gern zwischen den Schenkeln besuchen.«
Godewins Worte steigerten Falkos Verlangen in einem Maße, dass die Schamkapsel ihn schmerzhaft drückte. »Am liebsten würde ich auf der Stelle umkehren und ihr mein härtestes Körperteil bis zum Schaft in den Unterleib rammen.«
Godewin warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Du willst doch nicht behaupten, du hättest einen Knochen an der Stelle, an der andere Männer ein Stück meist schlaffes Fleisch sitzen haben?«
»Auf alle Fälle habe ich dort mehr als du.« Ritter Falko fletschte die Zähne und spornte sein Pferd an, bis es wieder zu Michels Braunem aufgeschlossen hatte. In seinen Augen war Godewin ein Narr und ein Maulheld, der, wenn es hart auf hart kam, wie ein Hund vor diesem aufgeblasenen Burghauptmann ohne Rang und Namen kuschen würde. Der Grünschnabel hatte noch nicht begriffen, dass es im Krieg vor allem um den eigenen Ruhm ging, und den würde er, Falko von Hettenheim, nicht einem Wirtsbengel überlassen, auch wenn dieser hundertmal vom Pfalzgrafen zum Anführer gemacht worden war.
Als Michel den Schatten des Pferdes neben sich auftauchen sah, drehte er sich zu Falko um und las in dessen Gesicht wie in einem aufgeschlagenen Buch; besser sogar noch, denn Lesen und Schreiben hatte er erst von Marie gelernt, und es machte ihm immer noch Mühe, mehr als ein paar Zeilen zu entziffern. Falko zerfraß sich schier vor Wut, weil er einem Mann gehorchen sollte, der in seinen Augen kein Mensch war, sondern ein Niemand. Ändern konnte er die Situation jedoch nicht, denn er war mit seinem Knappen, zwei Reisigen und fünf schlecht ausgerüsteten Bogenschützen erst zur Truppe gestoßen, als der Pfalzgraf Michel bereits zu deren Anführer ernannt hatte. Daher blieb ihm zunächst einmal nichts anderes übrig, als sich unterzuordnen.
Michel war überzeugt, dass er sich bei dem Hettenheimer und den anderen Rittern würde durchsetzen können, aber er ahnte, dass es nicht leicht sein würde. Um seiner eigenen Sicherheit willen musste er seine Stellung spätestens dann gefestigt haben, wenn es zu den ersten Kämpfen kam. Ein anderer Umstand bereitete ihm ebenfalls Sorgen. Eine so große Streitmacht wie die seine hätte sich normalerweise auf einigen größeren Rheinbarken eingeschifft, wäre bis zur Mainmündung gesegelt und von dort mit kleinen, von Pferden getreidelten Prähmen flussaufwärts gefahren. Auf diese Weise hätten sie drei Viertel des Weges bequem auf dem Wasser zurücklegen und die Kräfte von Tier und Mensch schonen können. Der Weg hätte jedoch mehr als doppelt so viele Wochen in Anspruch genommen wie der, den er jetzt eingeschlagen hatte, und der Befehl des Pfalzgrafen lautete, sich auf dem schnellsten Wege Kaiser Sigismunds Truppen bei Nürnberg anzuschließen.
Trotz der Probleme, die der vor ihm liegende Marsch mit sich bringen würde, war Michel guten Mutes. Seine Trosswagen waren in bestem Zustand und so hoch mit Nahrungsmitteln und Ausrüstung beladen, dass er keine Zeit mit Furagieren zu verlieren brauchte. Die Vorräte waren eigentlich nur für ihn und seine Fußknechte bestimmt, aber er würde wohl oder übel auch die Ritter samt ihrem Gefolge ernähren müssen, denn diese führten zumeist nur ein oder zwei Packpferde mit sich, welche den persönlichen Besitz ihrer adligen Herren trugen. Die Hoffnung, seine Großzügigkeit würde es den Edelleuten leichter machen, sich mit seinem Kommando abzufinden, milderte seine Bedenken.
Unwillkürlich glitt sein Blick über seine adligen Begleiter, die ihm so ungeordnet folgten wie eine Schar Hühnerküken, ohne sich um ihr Fußvolk zu kümmern, und er fragte sich, welcher von den Männern als Erster nachgeben würde; Falko von Hettenheim gewiss nicht, eher schon Godewin von Berg, dessen Haltung und Miene verrieten, wie unsicher er sich fühlte. Michel nickte dem Junker fröhlich lächelnd zu und stellte fest, dass der junge Mann seinen Gruß beinahe scheu erwiderte.
4.
Marie blieb auf dem Burghof stehen, bis der letzte Wagen durch das Tor gerollt und das Knirschen der eisenbereiften Räder auf den Pflastersteinen verklungen war. Schließlich zeugten nur noch ein paar Pferdeäpfel auf dem Hof davon, dass zweihundert wackere Männer von hier aufgebrochen waren, um in den Krieg zu ziehen. Marie schlang die Arme um sich, denn sie fröstelte bei dem Gedanken an das, was Michel und seinen Leuten im fernen Böhmerland alles zustoßen konnte. Was für ein Schicksal mochte dort auf sie warten, ein kurzer, ruhmreicher Feldzug und eine glückliche Heimkehr – oder der Tod?
Sie schüttelte sich, um die düsteren Ahnungen zu vertreiben, die sich ihrer bemächtigen wollten, und kehrte mit einem gewissen Widerwillen in die zugigen Gemächer der Sobernburg zurück. Obwohl sie seit mehr als zehn Jahren hier lebte, spürte sie mehr denn je, dass sie in Rheinsobern niemals heimisch geworden war. Hätten Michel und sie nicht Freud und Leid miteinander geteilt und versucht, sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen, hätte sie es niemals so lange hier ausgehalten. Gemeinsam hatten sie sich Halt gegeben, und es war ihnen gelungen, das Städtchen am Fuß der Burg aufblühen zu lassen, so dass es dem Pfalzgrafen nun dreimal so viele Abgaben einbrachte wie unter dem früheren Vogt. Ihr eigener Reichtum war mit der Stadt gewachsen, und Marie vermochte nicht mehr aus dem Kopf zu sagen, welche Weinberge, Bauernhöfe und Häuser ihr gehörten. Die meisten Ritter, deren Stammsitze in der Nähe lagen, besaßen kaum ein Zehntel von dem, was sie und Michel ihr Eigen nennen durften. Auch jetzt, nachdem sie zwölf Beutel zu drei Dutzend Golddukaten, die gesamten Ersparnisse der letzen drei Jahre, für den Feldzug hatten aufwenden müssen, waren sie nicht arm geworden. Marie tat es um das Geld nicht Leid, das nun in Waffen, Kleidung, Mehl, Speck, Erbsen, Wein und anderer Ausrüstung steckte, denn es mochte dazu beitragen, dass Michel heil und gesund zu ihr zurückkehrte. Er war fest davon überzeugt gewesen, dass er diese Ausgaben und noch einiges mehr durch Kriegsbeute wieder hereinbringen würde. Marie glaubte nicht so ganz daran, und es interessierte sie auch nicht, ob er eines Tages mit vollen oder leeren Taschen vor ihr stehen würde, sie wünschte sich nur, ihn so bald wie möglich wieder zu sehen.
Nachdem sie eine Weile sinnend auf dem Hof gestanden und ins Nichts gestarrt hatte, besann sie sich auf ihre Pflichten. Sie nahm ihr Rechnungsbuch zur Hand und legte es kurz darauf wieder weg, denn sie kam zu keinem passenden Ergebnis. Dann ging sie in die Kammer, in der die Truhen mit Leib- und Bettwäsche, Geschirr und anderen für den Haushalt notwendigen Dingen standen, und versuchte, all das auszusortieren, was dringend ersetzt werden musste. Aber auch diese Arbeit ging ihr nicht wie gewohnt von der Hand. Zuletzt gab sie es auf, sich Normalität vorspiegeln zu wollen, und rief nach ihrer Beschließerin.
»Marga, sage Timo, er soll meine Stute satteln!« Noch während sie die Worte aussprach, fiel ihr ein, dass Timo Michel begleitete, und sie setzte rasch die Worte »oder einen anderen Knecht« hinzu.
Die Beschließerin nickte und verließ das Zimmer genauso schnell und stumm, wie sie es betreten hatte, und kurz darauf hörte Marie ihre Stimme über den Hof schallen. Marga war eine energische Frau, die sich mit wenigen, aber beredten Gesten und einem Organ durchzusetzen pflegte, dessen Lautstärke jeden Feldwebel mit Neid erfüllt hätte.
Die Frau hatte schon unter dem letzten Burgvogt als Beschließerin auf der Sobernburg gedient. Da sie sehr tüchtig war und sich in allen Belangen ihres Wirkungskreises gut auskannte, hatte Marie sie in ihren Diensten behalten, doch zu ihrem Leidwesen war ihr Verhältnis selbst nach all den Jahren noch immer unterkühlt zu nennen. Sie bedauerte es ein wenig, denn sie hätte sich jenes vertrauensvolle Miteinander gewünscht, das zwischen ihrer Freundin Mechthild von Arnstein und deren Beschließerin herrschte. Mit einer Frau wie Guda hätte sie nicht nur über die Dinge sprechen können, die den Haushalt betrafen, sondern auch über alles, was sie persönlich berührte, und sie hätte Kummer und Freude mit ihr teilen können.
Gerade jetzt brauchte Marie einen Menschen, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Der Aufstand dauerte nun schon mehr als sechs Jahre, und bisher hatte der Kaiser keinen einzigen nennenswerten Erfolg gegen die Hussiten erzielt trotz des Böhmenpfennigs, den Sigismund im Reich hatte erheben lassen, und trotz der Truppen, die er Jahr für Jahr sammelte und gegen die Aufständischen warf.
Margas Rückkehr riss Marie aus ihren sorgenvollen Betrachtungen. »Die Stute steht bereit.«
Die Beschließerin verbeugte sich, sah ihrer Herrin jedoch nicht ins Gesicht. Das tat sie nie, denn die Gerüchte, die sich um die Frau des Burghauptmanns und um diesen selbst rankten, hatten ihr eine unüberwindbare Abneigung gegen das Paar eingeflößt. Marie Adlerin war keine Dame von Stand – und schlimmer noch, sie war noch nicht einmal eine ehrbare Frau. Man sagte ihr nach, sie sei in ihrer Jugend von einem Gericht als Hure verurteilt und mit Ruten gestrichen worden. Marga selbst hatte die feinen Linien auf dem Rücken ihrer Herrin gesehen, die nur von einer Auspeitschung stammen konnten. Da auch der Burghauptmann nicht von edler Herkunft, sondern der Sohn eines gewöhnlichen Schankwirts war, haderte Marga nun schon seit zehn Jahren mit dem Schicksal, welches zwei so unwürdige Leute weit über ihren Stand hochgeschwemmt, sie mit Reichtümern überschüttet und auch noch als Herren über Rheinsobern eingesetzt hatte. Sie verachtete diese Emporkömmlinge aus tiefster Seele, sah sich jedoch gezwungen, ihren Grimm hinunterzuschlucken und den Nacken vor einer ehemaligen Hure zu beugen, denn andernfalls hätte sie eine Stellung verloren, die sie weit über das gewöhnliche Gesinde und sogar über die meisten Bürger von Rheinsobern hinaushob. Marie achtete nicht auf Margas verbissene Miene, sondern verließ erleichtert den Raum. Sie musste dieses Gemäuer, in dem jeder Stein und jedes Möbelstück sie an Michel erinnerten, wenigstens für eine Weile hinter sich lassen, und sie brauchte jemanden, mit dem sie reden konnte. Daher wollte sie den einzigen Menschen aufsuchen, der Verständnis für sie aufbrachte, nämlich ihre alte Freundin Hiltrud, die wegen der Vorliebe für ihre Geißen in Rheinsobern und Umgebung nur die Ziegenbäuerin genannt wurde. Marie hätte auch zu ihrer Base Hedwig gehen können, die als Frau des Böttchermeisters Wilmar Häftli in der Stadt unten lebte. Doch die beiden hielten sie für etwas Ähnliches wie eine Heilige und begriffen nicht, dass sie auch nur ein Mensch war, der von Sorgen und Nöten geplagt werden konnte. Im Gegensatz zu Hedwig würde Hiltrud ihr nicht nur zuhören, sondern auch Verständnis für ihre Situation haben und alles tun, um ihre Ängste zu vertreiben.
Marie stieg mithilfe einer Bank auf Häschen, ohne die Dienste des Knechts in Anspruch zu nehmen, und verließ die Burg. Als sie die Hauptstraße der Stadt entlangritt, verbeugten die Bürger sich vor ihr und grüßten sie ehrerbietig. Marie erwiderte die Grüße munterer, als ihr zumute war, und hielt Häschen zweimal sogar an, um die ihr entgegengestreckten Bittschriften an sich zu nehmen, war zuletzt aber froh, als sie das Stadttor endlich hinter sich lassen konnte.
Nicht weit vor der Stadt gab es eine Stelle, von der aus sie die Straße entlangblicken konnte, welche vom Rhein weg nach Osten führte. Sie zügelte Häschen und starrte in die Ferne, in der eine Staubwolke anzeigte, wo Michels Trupp gerade marschierte. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie ihm nicht doch nachreiten sollte, um ihn noch einmal in die Arme zu schließen. Dann aber sah sie ein, dass sie ihn damit zum Gespött der ihn begleitenden Ritter machen würde, und entschied sich schweren Herzens gegen ein kurzes Wiedersehen. Häschen, die den Weg zu Hiltrud von unzähligen Besuchen her kannte, erleichterte ihr die Entscheidung, indem sie weitertrottete und ohne Maries Zutun zum Hof der Freundin abbog.
Der Ziegenhof gehörte zu den größten Höfen im Rheinsoberner Amt. Er bestand aus mehreren Gebäuden, deren Wände aus Fachwerk und mit Lehm beworfenem Weidengeflecht errichtet worden waren und mit Ausnahme der Scheune ein aus Feldsteinen aufgemauertes Fundament aufwiesen. Stall und Scheune waren mit Holzschindeln gedeckt, während das ansehnliche Wohnhaus ein Dach aus hellrot gebrannten Ziegeln hatte. Auf der Wiese neben dem Hof weidete ein gutes Dutzend Kühe, und auf einer anderen hütete eine Jungmagd eine größere Ziegenherde. Thomas, Hiltruds Ehemann, arbeitete zusammen mit einer Schar von Knechten und Mägden auf den Feldern, die zum Hof gehörten, und Hiltrud stand auf einer kleinen überdachten Veranda und rührte das Butterfass. Sie hielt auch nicht inne, als ihre Besucherin mithilfe des Gatterzauns, der den Gemüsegarten des Hofes begrenzte, aus dem Sattel stieg.
Marie band Häschen an einen der beiden Apfelbäume, die zwischen dem Haus und dem Garten standen, und eilte auf Hiltrud zu. »Mmmm! Frische Butter! Ich glaube, ich bin zur rechten Zeit gekommen.«
Hiltrud warf ihrer Freundin einen forschenden Blick zu und stellte wieder einmal fest, dass Marie sich seit dem Konzil in Konstanz kaum verändert hatte. Sie war höchstens noch schöner geworden. Hiltrud selbst war mit den Jahren etwas in die Breite gegangen, und in ihr Gesicht hatten sich die ersten Falten eingegraben. Dennoch galt sie trotz ihrer ungewöhnlichen Größe immer noch als gut aussehende Frau. Ihr Mann, ein ehemaliger leibeigener Ziegenhirt, hatte in den letzten Jahren ebenfalls an Gewicht zugelegt, und sie waren nun ein angesehenes Bauernpaar, das mit sich und der Welt zufrieden war. Das lag nicht zuletzt an dem Kindersegen, den Marie so heiß ersehnte und der sich hier auf dem Ziegenhof in reichem Maße eingestellt hatte. Hiltrud hatte sieben Kinder geboren, von denen fünf am Leben geblieben waren und ihren Eltern Hoffnung gaben, sie würden das Erwachsenenalter erreichen. Michel und Marie, die beiden Ältesten, die zur Unterscheidung von ihren Paten Michi und Mariele genannt wurden, halfen bereits kräftig bei der Arbeit, während die fünfjährige Mechthild auf ihre beiden jüngeren Brüder Dietmar und Giso Acht gab.