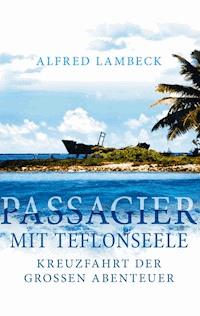Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Bergischen Land, im fiktiven Umland der fiktiven Stadt Eichenbergen, die auch aus früheren Büchern des Autors bekannt ist, in Wirklichkeit aber Remscheid heißt, spielt dieser Kriminalroman. Die Klostermühle, eine uralte Wassermühle, ist naturgemäß der zentrale, romantische Ort der Handlung. Felix Hohenthal, ein junger, leistungsbewusster Unternehmensberater und Viola Montagna, die angehende Kriminalkommissarin, haben hier ihre Heimat gefunden. Viola ahnt nichts von dem Fluch, der angeblich auf dieser Mühle ruht, den Korbinian Kornherr tapfer leugnet, obwohl seine Frau hier Selbstmord begangen hat. Viola Montagna wird von ihrem Polizeipräsidenten, Waldemar Wildgraber, wie schon vorher viele ihrer Kolleginnen, nach einem zauberhaften romantischen Abend am Rhein mit Jazzmusik und dem Blick auf den Kölner Dom, dessen filigrane Kreuzblumen im letzten Abendlicht des Tages liegen, nach unmäßigem Alkohol brutal vergewaltigt. Reilingshagen, ein unseriöser Fotograf, der mit Tatjana Libowski liiert ist, erwischt Wildgraber auf frischer Tat, als der wieder einmal in Köln sein Unwesen treibt, und zwar diesmal mit der sexwilligen Geliebten des Fotografen. Wutentbrannt stellt Reilingshagen Wildgraber in seiner Dienstvilla. Er richtet ihn mit einer Vielzahl von Messerstichen furchtbar zu. Der überfallene Polizeipräsident führt seine Kollegen von der Kriminalpolizei wissentlich und willentlich auf völlig falsche Fährten zu den bekannten Neonazis der Stadt, weit weg von seinen Sex-Affären, die im Polizeipräsidium schon seit langem Tagesgespräch sind, um damit auch von Reilingshagen, dem Messerstecher aus Eifersucht, abzulenken. Wichtigster und gefährlichster Gegenspieler von Wildgraber ist Kriminalkommissar Krötzel, der Wildgraber von Anfang an misstraut und der Reilingshagen wegen seiner Erpressungen auf frischer Tat in einer geheimnisumwitterten Sägemühle festnehmen lassen und schließlich beide, den Erpresser und den Sexwüstling, zu Geständnissen bringen kann. Der Schluss: Wildgraber erschießt Reilingshagen und bricht sich das Genick bei seiner abenteuerlichen Flucht im 80-Seelen-Höhendorf. Der Maler Paulinus Wellersberg wird Zeuge des Endes von Wildgraber und informiert das Präsidium. Der einzige Zeuge des Messerattentats ist Felix Hohenthal, er schweigt, weil er seine Frau Viola schützen muss. Am Ende aber ist er der Mann, der den entscheidenden Hinweis auf die Täterschaft von Reilingshagen liefert. Zwischenzeitlich geschieht viel in diesem spannungsgeladenen Roman, der ein sehr interessantes Bild der modernen Gesellschaft liefert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Messerattacke
Sonderkommission
Bahnübergang
Sensationslust
Melitta Schwaderlapp
Siegfried Märker
Morgenandacht
Druck
Täterbeschreibung
Blaue Stunde
Belanglos
Klostermühle
»Deutsche Eiche«
Mensa
Nuttenwäsche
Sommerfest
Reilingshagen
Vanessa
Lieblingskneipe
Blitzer
Ramona
Schwimmen lernen
Schräge Kiste
Zitternde Hände
Beweisfotos
Dienstvilla
Starker Tobak
Weibergeschichten
Scheiße!
Dunkelkammer
Herzinfarkt
Schweigen
In Handschellen
Landschaften
Einzelhaft
Motiv
Glossar
Personen und Charaktere
Messerattacke
Still lag die Falkenstraße unter dem mondlosen Nachthimmel. Nur in unserem Gebäude brannte schwaches Licht. Durch die zweiflügelige Glastür fiel sein Widerschein auf das nasse Pflaster. Es war ein Gebäude, das sich nicht besonders hervorhob in seiner Umgebung. Ohne die Bronzetafel mit dem in klarer Antiqua geprägten Schriftzug
POLIZEIPRÄSIDIUM
Kreispolizeibehörde Kriminalhauptstelle
hätte hier niemand ein Behördenhaus vermutet. Das voluminöse Gebäude schob sich tief in den abschüssigen Hang hinein. Nur vier oder fünf Fenster im ersten Obergeschoss der rechten Hausflucht waren matt erhellt. Hinter einem dieser Fenster – auf meiner Tür stand in amtlich anmutenden Antiqua-Großbuchstaben Anna Montagna – saß ich und kämpfte mit schwarzem Kaffee gegen die Müdigkeit an, die mich beim Studium öder Akten regelmäßig kurz vor Mitternacht mit bleierner Schwere befiel.
Alarmglocken unterbrachen jäh die schläfrige Stille der Mitternachtsstunde. Eingangshalle und Vorplatz waren zugleich mit dem Alarm in gleißend helles Licht getaucht. Menschen hasteten durch Gänge und Treppenhäuser zur Telefonzentrale neben dem Eingang. Aufgeregte Zurufe: »Messerattacke auf den Chef, Tempo, es geht um sein Leben.«
Der Erste Hauptkommissar Wolfgang Küppers, 44, Diensthabender in dieser Nacht, der altgediente Kriminalkommissar Frank Krötzel und ein halbes Dutzend anderer Beamten der Nachtschicht rannten die steil ansteigende Falkenstraße in Eichenbergen hinauf; zuletzt bog keuchend Oberkommissar Carl August Engels, der in Bälde in Pension gehen sollte, in die Altstädter Gasse ein. Zögerlich folgte ich ihnen zum Tatort.
Zweifel, Unruhe, Angst, Wut, auch auf Wildgraber – die nächtliche Messerattacke hatte das Chaos meiner Gefühle, in dem ich seit Wochen leben musste, ohne dass Felix etwas davon mitbekommen durfte, hatte die ganze Skala der Ängste und Empfindungen in mir sofort und unvermittelt erneut aufgewühlt.
Natürlich war mir völlig klar: Drücken konnte ich mich nicht, ich musste mit den anderen in die Dienstvilla des Präsidenten, musste Wildgraber erneut begegnen. Offen reden konnte ich mit niemandem. Ich wusste nur zu gut: Meine Gefühle durften bei der Aufklärung der schrecklichen Bluttat keine Rolle spielen, Nüchternheit war angesagt, mein analytischer Verstand, meine kombinatorischen Fähigkeiten waren gefragt.
Nach Carl August Engels kam ich als Letzte in den Flur des Hauses. Krötzel musterte mich kritisch. Ob er etwas ahnte, wusste? Der Erste Hauptkommissar schien mich zuerst nicht bemerkt zu haben. Ich war erleichtert. Die Erleichterung währte nur Sekunden. Als er mich wahrnahm, schaute er unverhohlen ungehalten zu mir herüber. Ich sah mich schon in seinem kahlen Büro mit Fragen konfrontiert, auf die ich keine Antworten haben würde. Engels hatte das bemerkt. Er stupste mich an, flüsterte: »Mach dir nichts draus.«
Schreckstarre Nachbarn zeigten auf den weit offen stehenden Eingang der Dienstvilla. Schon als die Beamten die Stufen hochhasteten, sahen sie den Polizeipräsidenten blutüberströmt in einer großen Blutlache auf den im Schachbrettmuster verlegten schwarz-weißen Fliesen liegen. Er atmete schwer, stöhnte. Brust und Oberarme, Unterarme und Hände waren mit Messerstichen übersät, aus denen mit jedem seiner mühsamen Atemstöße das Blut schoss. Ich nahm die Szene des Schreckens ohne innere Anteilnahme wahr. Wie in einem Kinofilm, der mich nicht sonderlich interessierte.
Im Sturz hatte der Überfallene den schön verzierten Langgänger mit sich zu Boden gerissen, der mit seinem sonoren Windsor-Klang Stunde um Stunde das ganze Haus erfüllt hatte. Die Scherben des fein facettierten Glases lagen verstreut, die Ziffern des ziselierten Blattes zeigten, direkt neben Wildgrabers Kopf, bizarr verbogen die stehen gebliebene Zeit: 0.19 Uhr. Die sonderbare Zuordnung prägte sich dem Hauptkommissar ein.
»Das Bild trügt«, konstatierte er. Wildgrabers Lebensuhr war nicht abgelaufen. Zwei junge Beamte, die mit dem Diensthabenden vorausgerannt waren, knieten neben dem Polizeipräsidenten, öffneten hastig sein blutnasses Hemd, schnitten es auf, streiften es vorsichtig ab, fühlten den schwachen Puls. Neue Blutrinnsale zeichneten auf den weißen Kacheln hellere rote Linien und Ornamente. Auf den schwarzen Quadraten waren sie nur schwach zu sehen.
Noch bevor sie mit der Notversorgung beginnen konnten, mussten die jungen Polizisten dem Polizeiarzt Platz machen. Der warf einen Blick auf die Wunden, horchte den Brustkorb ab, begann mit Pflaster und Verbänden die Blutungen zu stillen, gab dem Verletzten eine Spritze, schaute dabei zum Diensthabenden auf: »Hoher Blutverlust, schmerzhafte Stichwunden, zum Glück keine akute Lebensgefahr.« Der Polizeipräsident war bei Besinnung, hielt die Augen geschlossen, sagte leise: »Danke, Doktor.« Er verspürte erste Linderung.
Ich beobachtete, wie Kriminalkommissar Krötzel lässig, vom Geschehen offenbar nicht sonderlich beeindruckt, mit dem Fuß das abgesprungene Schnitzwerk des Langgängers beiseiteschob. Ich hörte ihn leise sagen: »Schade um die schöne alte Uhr.« Niemand außer mir schien das gehört zu haben. Vielleicht ganz gut so.
Im Präsidium nannten mich alle nur die Klostermüllerin, weil ich mit Felix in der romantischen Klostermühle weit außerhalb der Stadt wohnte. Ich hätte viel darum gegeben, jetzt in unserer Mühle zu sein, allein mit den Fröschen im Mühlenteich und den Ratten, die am Holzwerk des Schützes nagten. Anfänglich war mir ihr Geräusch unheimlich gewesen.
Jetzt erschien mir das alles als eine friedliche Idylle, weit weg von diesem schaurigen Hausflur. Ich hielt mich ein wenig abseits, nahe beim Eingang, war betroffen, ängstlich, wusste, dass ich es war, die den völligen Fehlschlag der geplanten braunen Aktion bei der Gedenkfeier für die Toten des Luftangriffs auf Eichenbergen verursacht hatte – mit meiner von Ehrgeiz und Intuition getriebenen Suche nach den Aktionsplänen der Neonazis. War dies ihre blutige Rache? Ich stand schweigend da, vermisste in diesem Augenblick vor allem meine Freundin und Kollegin Julia. Sie musste ausgerechnet jetzt auf Dienstreise sein. Sie nahm an einem Seminar für den höheren Dienst teil. Was würde sie denken, wenn sie jetzt neben mir stünde? Würde sie genau wie ich tiefe Genugtuung und Erleichterung empfinden?
Ich war mir sicher: Krötzel hatte mich während der ganzen Zeit beobachtet. Er glaubte genau zu wissen, was in meinem Kopf vorging. Wahrscheinlich lag er mit seinen Vermutungen richtig.
Hauptkommissar Küppers beugte sich tief zum reglos liegenden Waldemar Wildgraber hinab, den es vor 20 Jahren aus Niederbayern in diese Mittelgebirgslandschaft verschlagen hatte, die nicht mehr Rheinland und noch nicht Westfalen war. Er fragte ihn mit leiser Eindringlichkeit: »Können Sie etwas zum Täter sagen? Haben Sie ihn erkannt?«
Wildgraber antwortete kaum hörbar mit einem vagen »Vielleicht«. Küppers spürte, wie schwer Wildgraber jedes Wort fiel. Befragen musste er ihn trotzdem. Er ahnte den Druck, dem sie alle ausgesetzt sein würden. »Können Sie den Täter beschreiben?« Wildgraber sagte ihm, dass seine Beschreibung nicht sehr genau sein könne. Er habe sein Gesicht schützen, die Angriffe abwehren müssen, so gut er gekonnt habe.
Nach einer Weile, die mir, genau wie Küppers, unendlich lang vorkam – Wildgraber dachte anscheinend mühevoll nach, schien seine Kräfte neu zu sammeln –, hörte ich den Chef mühsam hervorbringen: »Der Kerl war sehr groß, viel größer als ich. Mit kahl geschorenem Schädel, Tätowierungen auf beiden Unterarmen, mit einem grimmigen, breiten Gesicht.« Er sei ganz sicher. Der Täter stamme aus der braunen Szene oder aus der Ecke der gewaltbereiten Autonomen.
»Wieso?«, wollte Küppers wissen.
»Er hat mich mit wutverzerrter Fratze angeschrien: ›Ihr habt uns nur einmal reingelegt und zum Gespött der ganzen Stadt und des Landes gemacht, ihr Schweine, nie wieder! du und deine Kapitalistenknechte werden uns nicht länger in den Dreck treten. Von jetzt an wird zurückgeschlagen. Jetzt machen wir kaputt, was uns kaputt macht, ihr Kettenhunde der korrupten Politik.‹« Der böse Spruch, das war mir klar, galt mehr mir als allen anderen im Präsidium. Meine Skrupel wuchsen.
»Klingt nach doofen 68er-Sprüchen«, sagte Küppers kühl. Krötzel dachte: Sehr mitfühlend klingt das nicht. Wildgraber wollte antworten, hatte Schweißperlen auf der Stirn, brachte kein Wort heraus.
Der Polizeiarzt sah, dass der Polizeipräsident sich immer schwerer tat, Auskünfte zu geben. Die Spritze begann ihre Wirkung zu tun. Er schaute den Hauptkommissar an. »Machen Sie Schluss mit Ihrer Befragung, für heute muss das reichen.«
Er wusste selbst: Reichen würde das nicht. Aber es gab eine grobe Richtung vor, in die Küppers, Engels und seine Leute würden ermitteln müssen.
Der Notarztwagen stand vor dem Eingang. Die Sanitäter warteten auf ein Zeichen des Polizeiarztes. Ich hatte den Eindruck, dass Wildgraber schon nicht mehr spürte, wie sie ihn auf die Bahre legten und in den Krankenwagen schoben, während ich sah, wie blaue Lichtblitze über sein fahles Gesicht, über das regennasse Pflaster und über die schlafenden Fassaden der Häuser huschten. Der Polizeiarzt saß neben der Bahre im Wagenkasten, auf der anderen Seite der Rettungssanitäter, dem man ansah, dass er alles im Griff hatte.
In der Notaufnahme warteten die Klinikärzte. Der Polizeiarzt sagte uns später, dass er sich mit ihnen rasch verständigt und über den vermutlich hohen Blutverlust des Opfers berichtet habe: »Das kann der aber ab, keine Blutkonserven, bitte nicht, sind mir zu riskant.« Eine Blutprobe verschaffte den Ärzten Gewissheit. Sie spritzten einen ACE-Hemmer, entlasteten damit das attackengeschwächte Herz, bekamen den Blutdruck in den Griff.
Vor dem Zimmer am Ende des Ganges bezogen zwei uniformierte Beamte der Schutzpolizei Posten. Die Stationsschwester brachte zwei Stühle. »Bitte nur einen«, sagte der längere der beiden lächelnd, »im Sitzen schläft man leicht ein.«
Gemeinsam mit Carl August Engels ging ich den Weg zum Präsidium zurück. Die Lichter auf dem Vorplatz waren erloschen. Die Septembernacht war ein schwarzer Schwamm, der alles Licht aufgesogen zu haben schien. Engels sagte: »So habe ich mir mein letztes Dienstjahr eigentlich nicht vorgestellt.«
»Ich mir mein erstes auch nicht«, antwortete ich leise. Den Rest des Weges gingen wir schweigend.
Sonderkommission
Fieberhaft versuchte ich Felix zu erreichen, sobald ich die Tür zu meinem kleinen Büro geschlossen hatte. Er arbeitete seit einem halben Jahr in der Frankfurter Niederlassung einer internationalen Unternehmensberatung. Seither konnte er nur noch selten zu Hause in unserer geliebten Mühle sein. Zuerst versuchte ich ihn in seinem Auto zu erreichen. Das Telefon war ausgeschaltet. Auch in seinem Appartement in Frankfurt am Main war er nicht. Ich war enttäuscht. Nur seine ruhige, stets freundliche Stimme auf dem Anrufbeantworter meldete sich. Ich war unruhig. Wie gern hätte ich gerade jetzt seine ruhige, sonore Stimme gehört, die mich immer gleich ruhiger werden ließ. Hastig, in abgerissenen Sätzen, sprach ich auf den Anrufbeantworter, berichtete über die blutige Tat. Rasch legte ich den Hörer auf, war noch tiefer beunruhigt als vorher schon. Ich musste an meinen Vater denken, der vor Jahren sehr ernst und nachdenklich gesagt hatte: Wenn es hart auf hart kommt, dann ist man immer ganz allein.
Zeit zum Nachdenken blieb mir nicht. Über den Hausruf wurden meine Kollegen in den großen Sitzungssaal gerufen. Ich hörte auch meinen Namen: »Frau Viola Montagna, bitte sofort zur Konferenz.« Hauptkommissar Küppers gab uns die Bildung einer Sonderkommission bekannt. Sie wurde stärker besetzt als eine Mordkommission. Die Anordnung, erfuhren wir, kam direkt aus der Landeshauptstadt. Der Innenminister trieb zur Eile. Landtagswahlen standen bevor. Der Regierungspartei war an einer schnellen Aufklärung gelegen. Sehr sogar. Ein politisches Verbrechen in einer völlig neuen Dimension, hieß es in der Presserklärung, die der eilig aus dem Bett getrommelte Ministeriums-Pressesprecher den Agenturen, den Sendern des Landes, zuletzt auch den Zeitungen übermittelt hatte.
Ich saß neben Engels ganz hinten, dicht beim Ausgang. Nur mit Mühe konnte ich mich auf die Worte von Küppers konzentrieren. Mit meinen verwirrten Gedanken war ich immer wieder bei Wildgraber und seinen blutigen Stichverletzungen. Ich hasste ihn, verachtete den Triebtäter in ihm, hoffte zugleich, dass er nicht den schweren Verletzungen erliegen würde, die ihm ein offenkundig wütender Täter beigebracht hatte. Hatte Felix etwas mit der Sache zu tun?, schoss es mir durch den Kopf. Unmöglich, ausgeschlossen, Felix war besonnen. Wütend, außer sich hatte ich ihn nie erlebt.
Von einem feigen, verabscheuenswürdigen Anschlag gegen die Demokratie sprach staatstragend in der Landeshauptstadt der Ministerpräsident. Andere mit Wichtigkeit aufgeladene Worthülsen, wie sie Politiker jeglicher Couleur in solchen Situationen gern abzusondern pflegen, füllten am Morgen danach die Titelseiten der Boulevardblätter; selbst die Schlagzeilen der seriösen Zeitungen waren vier- und fünfspaltig.
Küppers’ Befürchtungen über die hoch aufschäumenden Wogen öffentlicher Empörung in den Medien wurden am nächsten Morgen durch die Realität in den Schatten gestellt. In der Nacht hatte er seinen Kollegen und mir erklärt, dass wir am nächsten Morgen den Ausbruch einer jener allgemeinen Betroffenheitsorgien zu erwarten hätten, bei denen keiner fehlen durfte: die Politik sowieso nicht, die Grünen voran, die Sozialdemokraten, die Schwarzen, die Gelben, am lautesten die Linke. Ausgerechnet die Ex-SED-Leute um den Sohn des früheren DDR-Staatssekretärs für Kirchenfragen, Gysi, sahen die Demokratie in Gefahr. Kirchen, Gewerkschaften, sie durften nicht fehlen. »Wer das Maul am weitesten aufreißt, kriegt die fettesten Schlagzeilen«, sagte Krötzel, »ein gefundenes Fressen für die Boulevardblätter. Ich sehe den Dünnemann schon genüsslich an seiner Schlagzeile für die Titelseite feilen.«
»Feilen, das glaubst du«, sagte der Polizeisprecher. »So was schüttelt der in null Komma nix aus dem Ärmel.« Er musste es wissen, er hatte bei einem Boulevardblatt volontiert.
Die Erwartungen der politischen Spitze in der nahen Landeshauptstadt waren eindeutig: »Ich fordere radikale, brutalstmögliche Aufklärung«, hatte der Innenminister gesagt. Die Szene sei bekannt, sie werde seit Jahren observiert, sei mit V-Leuten durchsetzt. Es müsse doch mit dem Teufel zugehen, wenn der oder die Politgangster nicht binnen weniger Tage dingfest gemacht würden.
Alle, die kurz nach Mittemacht mit Küppers am Tatort waren, wurden in die Sonderkommission berufen, Beamte aus dem gesamten Umkreis noch in der Nacht aktiviert und ins Präsidium beordert. Die Aufgaben wurden verteilt. Die meisten würden, noch in der Tatnacht beginnend, vor Ort die Ermittlungen im neofaschistischen Umfeld vorantreiben. Listen der infrage kommenden führenden Neonazis lagen bereits ausgedruckt vor den Fahndern.
Spezialisten wie C&A (so nannten die Kollegen Carl August Engels) und mir, der angehenden Kommissarin, oblagen die Klärung psychologischer Motive und die Analyse aktueller Fahndungsergebnisse. Mir war sofort klar, dass ich meine Pflicht würde tun müssen. Ohne Wenn und Aber. Mitleid für Wildgraber? Nein! Ich hasste mich selbst, ich hasste Wildgraber, genau wie Julia ihn hasste, an die er sich nur wenige Tage zuvor herangemacht hatte. Julia und mich hatte er danach wie ausgeleerte Konservendosen achtlos fallen lassen, auf die Müllhalde seiner verflossenen Eroberungen geworfen. Nicht nur die beiden Frauen verachteten ihn. Durchschaut hatte ihn vor allem Frank Krötzel. Er recherchierte schon lange, verdeckt, mit der gebotenen Vorsicht.
Auch wenn ich es mir selbst nicht eingestehen wollte, meine Verwundungen saßen tief. Die Tat verabscheute ich, dennoch durfte Privates keine Rolle spielen. Ich war fest davon überzeugt: Dies war ein grausamer Racheakt für die öffentliche Schmach, die wir der braunen Szene zugefügt hatten. Jetzt waren meine Fähigkeiten gefragt, nicht meine Gefühle. Ich konnte mit niemandem darüber reden, schon gar nicht mit Felix. Julia war weit weg. Die Telefone würden überwacht werden. Selbstverständlich doch.
Die Mitglieder der Soko, dessen war sich Küppers sicher, waren wie er selbst hoch motiviert. Sie wussten genau wie ich, welchen Druck Politik und Sensationspresse in den nächsten Stunden und Tagen aufbauen würden – die Politik, um ihre Macht zu demonstrieren, die Boulevardblätter, um unter dem Mantel ihrer umfassenden Sorge um die junge deutsche Demokratie ihre Auflagen zu steigern.
Küppers hatte das allen im Raum deutlich vor Augen geführt, er traf seine Anordnungen in dieser Nacht mit der Präzision eines Roboters. Dienstvilla, Polizeipräsidium, Notfallklinik mussten vor möglichen Folgetätern ebenso wie vor den Medien abgeriegelt werden. Polizeibeamte bezogen Posten vor der Villa Wildgraber, vor allen Eingängen des Präsidiums, rings um die Klinik. Ich bewunderte Küppers ob der Logik seines Vorgehens.
Die ersten Gruppen der Kriminalpolizei begannen ihre Arbeit. Bis erste Ergebnisse ihrer Vernehmungen vorliegen konnten, würde es Vormittag werden. So lange, sagte Hauptkommissar Küppers, sollten C&A und die Klostermüllerin schlafen gehen. Um zehn hatten mein Mentor Engels und ich wieder im Präsidium zu sein.
Bahnübergang
Es wurde grau am Horizont, als ich, tief beunruhigt, unkonzentriert, mit überreizten Sinnen, in meinen schwarzen Mini stieg, hinter der Schranke am Pförtnerhaus am Parkplatz des Präsidiums ungeduldig wartete, bis sich der Schlagbaum hob, mehr Gas als nötig gab und die Falkenstraße hinab bretterte, bis mich das zu dieser Stunde sinnlose Rot der autoleeren Ampelkreuzung am Ende der abschüssigen Straße erneut zum Halten zwang. Ich empfand die Rotphase als endlos lang, gab heftig Gas, als endlich Grün kam, fuhr über die neue kreuzungsfreie Überführung auf die vierspurige Ausfallstraße nach Osten. Lange war das nassschwarze Asphaltband von grauen, gesichtslosen Mietshäusern gesäumt. Im Vorbeifahren sah ich mit einem schnellen Blick nach rechts hinter den Fenstern der Druckerei den Falzapparat der Rotationsmaschine des Generalanzeigers gefaltete Zeitungsexemplare in endloser Folge ausspucken. Die Medienmaschinerie würde in dieser Nacht auf vollen Touren laufen.
Die Bebauung links und rechts der Straße wurde offener, weiträumiger. Eintönige Lagerhallen, kleine Fabriken mit Backsteingiebeln, die mehr versprachen, als dahintersteckte, rußige Schlote, mit quadratischem Grundriss die älteren, rund die neueren, wollten kein Ende nehmen. Als die Straße in der Ortsumgehung des eingemeindeten Vororts schließlich zweispurig wurde, zu beiden Seiten von Wiesen, Äckern und Waldstücken begleitet, begann »meine« Landschaft.
Nichts davon nahm ich wahr, hatte nur einen Wunsch: schnell nach Hause zu kommen, mit Felix zu sprechen. 50 Meter vor dem Ortsendeschild, kurz bevor die Straße unter den schlanken Pfeilern der Autobahn-Talbrücke hindurchführte, wurde ich geblitzt: Mist, dachte ich, macht nun auch nichts mehr. Wenn zu Hause in der alten Mühle nur Felix auf mich warten würde, oder wenn ich mit Julia sprechen könnte. Ich fühlte mich unendlich allein.
Die Landstraße wurde noch ein wenig schmaler, führte auf der Höhe der romantischen Ortschaft mit ihrem charakteristischen Zwiebelkirchturm an einem kleinen Stausee entlang, den der Wasserwirtschaftsverband vor etlichen Jahren als Rückhaltebecken hatte bauen lassen. Die Strecke folgte dem Fluss, der zu dieser Jahreszeit viel Wasser führte. Es gurgelte heftig zwischen den Pfeilern einer alten Steinbrücke, die für den Verkehr schon lange zu schmal geworden war. Bald schon sollte sie in einem großen Stausee verschwinden, 30 Meter unter dem Wasserspiegel, erreichbar dann nur noch für die Sporttaucher. Die Landstraße führte in vielen Windungen durch hügeliges Acker- und Weideland.
Vorsichtig wie immer fuhr ich über den unbeschrankten Bahnübergang gleich nach der Kurve hinter der Brücke. Die Lichtsignale ließ ich keine Sekunde aus dem Auge. Wann immer ich die Strecke passierte, täglich mindestens zweimal, musste ich an den Wurstkonserven-Vertreter denken, der hier in seinem hellblauen VW-Käfer von einem Triebwagen erfasst worden war. Der Bahnübergang war von verbeulten, zerquetschten Dosen übersät gewesen, aus denen Fleisch und Wurst gequollen war. Der Fahrer, etwa 55, vielleicht auch schon an die 60, war im Wagen bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Die Hand vor den Augen, hatte ich mich damals instinktiv abgewandt. »Abwenden gilt nicht«, hatte Engels, der mich mit zum Unfallort genommen hatte, gesagt. »Das musst du abkönnen, auch wenn du noch ganz neu bei uns bist, das muss jeder einfache Polizist auch. Der muss ihn sogar da rausholen. Du musst nur hinschauen, das aber sehr genau. Das ist dein Job.« Es war mein erster Fall. Am nächsten Tag machte ich mir klar, dass sie diese Strecke täglich fuhr.
Engels – damals nannte ich ihn noch nicht C&A, dazu war ich noch zu neu im Job, und mit der üblichen Duzerei hatte ich ohnehin meine Probleme –, Engels hatte sehr genau hingeschaut. Der Triebwagen hatte den VW-Käfer auf der Mitte der Gleise erfasst und ihn gut 50 Meter weit mitgeschleift. Der Kofferraum vorn musste beim Aufprall aufgesprungen sein. Die Musterkollektion des Wurstkonserven-Vertreters war auf den Asphalt geflogen.
»Tückisch, so ein unbeschrankter Bahnübergang. Dem Mann ist er zum Verhängnis geworden. Schrecklicher Unfall«, sagte ich, vom Geschehen und Gesehenen geschockt.
»Wenn es denn einer war.« Engels’ Zweifel waren nicht zu überhören. Er betrachtete noch immer das Innere des Wracks. »Die Sicht war gut, ein hellgrauer Tag, keine Sonne, keine Blendung, keine Bremsspuren. Ich weiß nicht.«
Das Martinshorn des Notarztwagens riss Engels aus seinen Überlegungen. Die Sanitäter liefen über die Schwellen zum Kopf des Triebwagenzuges. Ich beobachtete, wie sie den Lokführer vorsichtig aus dem Zug und zu ihrem Fahrzeug führten. »Schwerer Schock.« Engels hob die Schultern. »Schade, der einzige Zeuge für mindestens drei Tage nicht vernehmungsfähig. Danach kommst du mit in die Klinik. Kann sein, dass der Mann deinen Beistand braucht, wenn ich ihn befrage.«
Schweigend fuhren wir zurück ins Amt. Jeder hing seinen Gedanken nach. Im Präsidium wollte ich gleich in mein Büro gehen. Engels hielt mir die Tür zu seinem Zimmer auf. »Nur frische Spuren sind gute Spuren. Das ist wie auf der Jagd.« Er fragte: »Hast du die Hände des Toten gesehen?« Engels wusste, dass ich nur flüchtig in das verwüstete Innere des Autos geschaut hatte. Die Hände hatten, wie zum Beten zusammengepresst, abgetrennt im Wrack gelegen. Am Lenkrad konnte der Tote sie nicht gehabt haben. »Wir schauen uns das nachher auf den Fotos an. Altmann ist schnell.«
Altmann war der Polizeifotograf. Er arbeitete seit Jahren mit Engels zusammen, wusste, worauf es dem erfahrenen Kriminalisten ankam. Am Unglücksort hatte er mit zwei Kameras gearbeitet. Für den schnellen Überblick belichtete er Polaroids, danach 24x36-mm-Negative für die detailgetreue Dokumentation. Die Polaroid-Aufnahmen legte der Fotograf dem Krimimalbeamten nur Minuten nach dessen Rückkehr vom Bahnübergang auf den kleinen Schreibtisch, Eiche imitiert, hell.
»Psychologie ist gut, Fakten sind besser«, sagte Engels und schob mir eines der bonbonfarbenen Polaroid-Bildchen über den Tisch. Trotz der großen Blutlachen waren die gefalteten, krampfhaft zusammengepressten Hände als Klumpen mit weißen Knöcheln zu erkennen. »Es spricht einiges für Selbstmord.« Ich stimmte resigniert zu. Die Kollegen von der Unfallaufnahme berichteten. Der Wagen war trotz der Wucht des Aufpralls nicht in Brand geraten. Der Tank war nicht ausgelaufen, dennoch leer.
Tage waren damals vergangen, bis Engels mit mir erneut über den Fall am Bahnübergang sprach: Heute Nachmittag würden wir gemeinsam in die Klinik fahren, der Lokführer sei jetzt vernehmungsfähig. Aber bitte behutsam, habe der betreuende Psychologe gesagt. »Der hält uns für Elefanten im Porzellanladen, der Trottel.«
Der Lokführer brauchte keinen seelischen Beistand. Er kam gleich zur Sache: »Der Bahnübergang liegt 200 Meter hinter einer Linkskurve. Ich traute meinen Augen nicht. Mitten auf den Schienen stand der VW-Käfer. Er rührte sich nicht vom Fleck. Ich ließ das Signalhorn ununterbrochen schrillen, leitete sofort eine Notbremsung ein. Sie wissen: Der Bremsweg. Ich war machtlos, mein Triebwagen hat den Käfer voll auf die Hörner genommen. Er wurde zusammengequetscht wie in einer Abwrackpresse. Ich wusste, da war ein Mensch drin. Ich war starr vor Schrecken.«
Ihn treffe nicht die geringste Schuld, sagte Oberkommissar Engels sehr ruhig und bestimmt. Im Gegenteil, der Pkw-Fahrer habe den Schock des Lokführers und die Verletzung der Fahrgäste auf dem Gewissen. Trotzdem habe er im Führerstand seines Triebwagens besonnen und unbedingt richtig gehandelt. »Dessen Gewissen«, sagte der Lokführer, »das war einmal, ist ausgelöscht wie sein Leben.«
Auf dem Rückweg von der Klinik ins Amt hatte Engels beiläufig gesagt, er habe die Berichte der Kollegen vom Besuch in der Wohnung der Witwe des toten Wurstkonservenvertreters gelesen. Traurig sei die Dame nicht gewesen, nur ihre große Bitternis über den Toten sei spürbar gewesen. »Wir können den Fall abschließen. Kein Fremdverschulden, klare Indizien für Freitod, Glück für die Witwe: Die Versicherung muss zahlen. Und ein christliches Begräbnis kriegt er auch.« ›Tod eines Handlungsreisenden‹, ging es mir durch den Kopf.
Engels wählte für die Rückfahrt ins Präsidium einen Umweg. Ich wunderte mich, sagte aber nichts. Bald sah sie den Grund: Engels hielt vor einem Modellbahngeschäft an. »Ich bin in fünf Minuten wieder hier.« Er kam mit einer kleinen Faltschachtel zurück. »Für die Enkel?«, fragte ich neugierig. Engels lachte: »Nein, nein, für mich. Du kannst das noch nicht wissen, ich bin Modelleisenbahner seit meinen frühen Kindertagen. Ein neuer H-Null-Anhänger ist gerade herausgekommen. Der fehlte mir.«
Immer wieder versuchte ich mich von ihren Erinnerungen an ihren ersten Einsatz am Bahnübergang zu lösen, fuhr langsam und nachdenklich den Rest meines Heimweges nach der turbulenten Tatnacht. Die nächste schmale Abzweigung, die zur stillgelegten alten Sägemühle führte, ließ ich heute rechts liegen. An diese schreckliche Sache wollte sie heute nicht auch noch erinnert werden. Ein paar Hundert Meter weiter bog ich nach rechts in den schmalen Weg zur Klostermühle ein. Tau lag auf den Gräsern, perlte von den Halmen des Wiesenschaumkrauts.
Ich war zu Hause. Die Mühle lag still im Wiesental, einladend, friedlich. Die Ruhe, die von der Mühlen-Idylle ausging, diese Stille, die Felix vom ersten Augenblick an in ihren Bann gezogen hatte und die ich wie er liebte, diesmal nahm ich sie nicht wahr.
Ich schloss eilig auf, rannte die knarrenden Dielen der Treppe zum früheren Mahlboden im Obergeschoss hinauf in mein Arbeitszimmer. Mein erster Blick fiel auf das Telefon. Gott sei Dank, Felix hatte zurückgerufen.
Ich hörte seine Stimme, die auch jetzt angenehm und ruhig klang, eine Männerstimme, die mich vom ersten Augenblick unserer Begegnung in der Mensa der Uni so sehr für ihn eingenommen hatte auf meinem Anrufbeantworter. Schrecklich, was da passiert sei in der Nacht. Bei ihm sei alles in Ordnung. Viel wichtiger für ihn: Wie sie sich fühlte nach all dem, was passiert sei in der Nacht. Er sei nach einem langen Arbeitstag in Bonn – sie wisse, dort arbeite er seit Wochen beim derzeit wichtigsten und größten Kunden der strategischen Unternehmensberatung – vom Auftraggeber und von den Kollegen noch nach Köln mitgeschleppt worden. Auf ein Kölsch bei Früh, hatte es geheißen. »Bitte, Viola, ruf sofort an, wenn du zu Hause bist, ganz gleich, wie früh oder spät es dann ist.« Felix hatte aufgelegt.
Ich schaute auf meine Uhr: 5.40 Uhr. Sollte ich Felix wecken? Ich dachte keine Sekunde nach, wählte, ohne mich zu besinnen. Felix war sofort am Telefon, fragte nach meinen Erlebnissen, hörte meinen immer noch atemlos-hastigen Bericht über das Geschehen der Nacht, fragte nach allen Einzelheiten, wollte wissen, wie es mir selbst gehe, ob und wie Polizeipräsident Wildgraber die Attacke überstanden habe, wie schwer er verwundet sei.
Ich erzählte ihm von Wildgrabers schwachen Hinweisen auf den möglichen Täterkreis, sprach über meine Schuldgefühle, war doch ich es gewesen, die den Neonazis die Tour mit der Unterwanderung der Gedenkfeier für die Toten des Luftangriffs auf Eichenbergen durch meinen glücklichen Fund in der Stammkneipe der Braunen vermasselt hatte. Felix widersprach mir vehement: »Wir wissen beide, dass man nur mit einem Spatzengehirn Neonazi sein kann. Aber so unglaublich dumm können selbst die nicht sein. Ich bin sicher: Die waren das nicht.« Felix fragte nach dem Zustand Wildgrabers. »Verdammt zäher Bursche«, war sein Kommentar.
Meine Antwort fiel heftig aus. Ich erschrak über mich selbst. »Du warst mit Kollegen unterwegs – das machst du doch sonst nicht. Diese blöden Sauftouren. Ich hätte dich doch so gerne erreicht.«
Ein wichtiger Mann, hoch angesiedelt in der Hierarchie des Großkunden, habe seine Kollegen und ihn eingeladen, mit ihm nach Köln zu fahren. Da könne man nicht einfach »Nein« sagen. In der Domgarage hätten sie geparkt. Zum Brauhaus Früh seien es von dort aus nur ein paar Schritte. Der Manager lebe in Köln, er kenne sich aus in dem alten Brauhaus. Er habe sie an der langen, lauten Schanktheke vorbei durch die Masse der stehenden, schwadronierenden Biertrinker in das letzte der tiefen Gewölbe gelotst. Bei einem Kölsch sei es nicht geblieben. Kölsch habe zum Glück nicht viel Alkohol. Dann habe der Manager Schlachtplatte für alle bestellt: Blutwurst, Leberwurst, Kassler, Speck, jede Menge Sauerkraut, es habe fantastisch geschmeckt. Danach habe er nur Mineralwasser getrunken. Spät sei es trotzdem geworden. Felix konnte ein herzhaftes Gähnen nicht unterdrücken.
»Und jetzt habe ich dich auch noch in aller Herrgottsfrühe aus dem Schlaf gerissen.«
»Kein Problem, Viola, ich bin glücklich, dass du die ganze unappetitliche Geschichte tapfer hinter dich gebracht hast. Ein schöner Anblick war das bestimmt nicht, als du euren Boss da blutüberströmt am Boden gesehen hast.«
»Mein Kollege Engels hat mir schon ganz früh gesagt, dass man so etwas als Kriminalbeamter abkönnen muss. Ich schaffe das schon ganz gut. Unsere Arbeit hat diese Nacht gerade erst angefangen.«
»Hoffentlich hat euch niemand auf eine falsche Spur gelockt.«
»Wie meinst du das?«
Felix schien verunsichert, antwortete dann ein wenig vage: »Ich habe so ein sonderbares Gefühl, das ich durch nichts begründen kann. Vielleicht hatte der Täter ganz andere Motive. Was immer auch war, mit dir hat das Messerattentat ganz und gar nichts zu tun.«
»Ich weiß nicht.« Ich zweifelte.