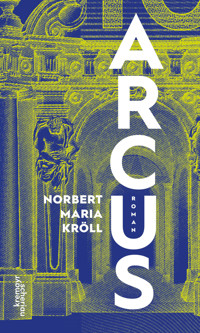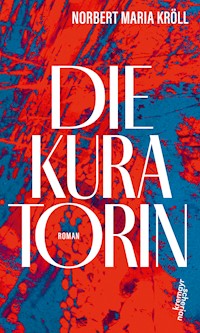
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie hart muss frau sein, um Karriere zu machen? Als Kuratorin eines renommierten Museums sorgt Regina Steinbruch für Aufsehen in der Kunstwelt. Sie ist Karrierefrau durch und durch; um ihre Ziele zu erreichen, geht sie rücksichtslos ihren Weg – flink vorbei an den verachteten männlichen Kollegen. Als Regina bei einem One-Night-Stand schwanger wird, gerät ihre Welt aus den Fugen, und selbst, als sie entscheidet, das Kind ihrer besten Freundin zur Adoption zu übergeben, findet sie nicht zur Ruhe. Baby Toms unwiderstehlicher Geruch bringt die knallharte Fassade der Kuratorin zum Bröckeln und Stück für Stück tritt ein empfindsamer und verletzlicher Mensch in Erscheinung. Norbert Maria Krölls dritter Roman ist eine schwarzhumorige Satire auf den Kunst- und Kulturbetrieb und stellt provokant weibliche und männliche Rollenzuschreibungen infrage. "Die Kuratorin" erzählt vom Mut, stark zu sein, und von der manchmal noch größeren Herausforderung, auch Schwäche zeigen zu können. "Es ist herrlich, als Frau kann man Männer, jedenfalls die gebildeten Exemplare, schlagen, so oft und so fest man möchte, sie werden sich nicht wehren. Als wüssten sie, tief vergraben in ihren Kleinhirnen, dass sie die Schläge im Grunde mehr als verdient haben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Maria Kröll
DIE KURATORIN
Roman
Kremayr & Scheriau
Inhalt
TEIL EINS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
TEIL EINS
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Dank
TEIL EINS
Sometimes making something leads to nothing.
Sometimes making nothing leads to something.
Francis Aÿs
1
Geplatzt. Nicht der Traum, sondern das Kondom. Schon als er es überstreift, fällt mir auf, dass etwas nicht stimmen kann. An einer Stelle wirft es zu viele Falten, an einer anderen sieht es eigenartig gewölbt aus. Aber dann muss es schnell gehen, weil er schon wieder im Begriff ist, schlaff zu werden. Vielleicht ist Marvin schwul. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Künstler seine sexuelle Orientierung über Bord wirft, um sich bessere Chancen auf eine Ausstellung zu verschaffen. Das verstehe und begrüße ich. Da mache ich niemandem einen Vorwurf. Sollen doch die Heuchler, die so tun, als wären sie unbefleckt, laut aufschreien. Dabei wissen alle, die etwas zu sagen haben, dass nur ein einfältiger Mensch den Umweg nimmt, vor allem, wenn das Ziel direkt vor Augen liegt. Schafft man es aber nicht, das Kondom richtig überzustülpen, hört bei mir rasch das Verständnis auf.
Es platzt. Wobei man nicht wirklich von einem Platzen sprechen kann. Es ist ja nicht so, dass ich, wie bei einer Explosion, etwas hören würde;da gibt es kein Plopp oder Peng und auch Detonation gibt es – große Überraschung – keine. Ich spreche vom Platzen, dabei ist es wohl eher ein Zerreißen, ein Aufreißen, ein lautloses Sich-Spalten. Davon spüre ich nichts. Aber auch sonst spüre ich relativ wenig. Dieses unsichere Kneten meiner Brüste. Marvin, sicherlich ist er schwul. Solange der Sex gut ist, kann mich meinetwegen auch ein schwuler Hengst penetrieren. Aber er ist nicht gut, der Sex.
Fertig ist er, als er endlich fertig ist: Marvin stöhnt laut auf und wirft den Kopf zurück, als würde er unversehens mehr spüren als zuvor, als wäre nun die einzigartige Chance auf seinen Höhepunkt in greifbarer Nähe. Und schon gießt er, begleitet von einem leisen Krächzen, seine Erbinformation, freilich ohne es zu wissen, in meinen Körper. Kurz danach sehen wir uns dieses Ding an, das wir normalerweise rasch zubinden und nichts als loswerden möchten; und schau an, was haben wir denn da? Doch nicht etwa ein Loch? Ein Löchlein? Nein, kein Loch: ein Riss, ein Spalt, ein Fetzen. Und der Großteil des Inhalts verschwunden. In mir. Heilig, die Vereinigung, ein heiliger Prozess, nicht wahr? In meinem Fall ein Fluchen, ein Fluch.
»Sorry«, sagt er. Und dann wiederholt er es mit höherer Stimme und einem vorsichtigen Fragezeichen: »Sorry?« Er zeigt mir das lädierte Kondom, diesen Gummischlauch, der an beiden Enden eine Öffnung aufweist. Wie ein niedlicher Spitzbub sieht er aus, als er mir das Ding vors Gesicht hält und zurückhaltend lächelt. Es ist fünf Uhr früh. Mein ursprünglicher Plan war, ihn nach dem Sex vor die Tür zu setzen, um ungestört schlafen zu können.
»Nicht gut«, sage ich. »Gar nicht gut.« Ich spüre, wie sich in meinem Kopf ein Schalter umlegt.
»War doch nicht mit Absicht«, sagt er, fuchtelt mit den Armen und verteilt den letzten Rest seines Samens auf der Couch.
»Das extra dünne Kondom war keine gute Idee«, sinniert Marvin und fügt nach ein paar Sekunden Stille hinzu: »Und wenn du …«, stammelt er, »… schau, Regina, könnte es sein, dass du nicht erregt genug gewesen bist und deshalb unten irgendwie … ähm, wie soll ich sagen, unten zu wenig …«
Den Satz, wenn es denn einer ist, lasse ich ihn nicht beenden. Ich hole aus und verabreiche ihm eine Ohrfeige. Er greift sich an die Wange, dann senkt er die Hand und schaut mich überrascht an. Geläutert wirkt er, als hätte ich ihm durch den Schlag etwas von seiner melancholischen Schwere genommen. Dann öffnet er den Mund, um etwas zu sagen. Ich hole abermals aus, weiter als zuvor, diesmal balle ich die Faust und schlage noch einmal zu, fester.
»Spinnst du!?«, brüllt Marvin, hechtet rückwärts von der Couch und schleicht wie ein verletztes Hündchen in Richtung Küche. Torkelt er wegen des Alkohols im Blut oder wegen des Fausthiebs? Mit beiden Händen kontrolliert er, ob sein Unterkiefer gebrochen ist. Der Schlag hat gesessen. Gut so. Wäre er nicht geflüchtet, der nächste Schlag hätte ihn im Genitalbereich erwischt. Es ist herrlich, als Frau kann man Männer, jedenfalls die gebildeten Exemplare, schlagen, so oft und so fest man möchte, sie werden sich nicht wehren. Als wüssten sie, tief vergraben in ihren Kleinhirnen, dass sie die Schläge im Grunde mehr als verdient haben, dass ihnen eine unbestimmte, nicht verjährte Schuld in den Knochen sitzt und dort noch lange kleben bleiben wird.
»Schade«, sage ich, »als Künstler hast du Potenzial, im Bett dagegen …«
»Das liegt daran …«, schreit Marvin. Doch dann hält er inne und spricht auf einmal sehr leise: »Es liegt blöderweise daran …«, stammelt er, »… das ist mir peinlich. Es ist so, dass ich …«
»Peinlich?«, sage ich und muss laut lachen. »In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich? Halt bitte einfach deinen Mund, zieh dich an und verschwinde.« Ich greife nach der kleinen Schachtel auf dem Tischchen und zünde mir eine Zigarette an.
»Das war Körperverletzung gerade«, sagt er plötzlich ernst, als hätte er jetzt erst begriffen, dass ich ihm eine verpasst habe. Aufrecht steht er da. Sein nackter Körper wird vom Licht aus der Küche von hinten beleuchtet, sodass die Silhouette klar umrissen ist. Er wirkt nicht gerade trainiert, man könnte ihn aber auch nicht als fett bezeichnen. Von der Statur her ein Normalo. Recht schönes Gesicht. Ein lieber Trottel halt. »Nichts anderes als Körperverletzung war das«, wiederholt er. »Du weißt schon, dass ich dich dafür anzeigen könnte?«
»Ja, mach ruhig«, sage ich, »dann zeige ich dich wegen Vergewaltigung an und behaupte, dass es Notwehr war. Schau doch«, sage ich und boxe mir mit der Faust in den Bauch, dann aufs Brustbein. »Siehst du? Körperverletzung kann ich dir auch noch anhängen. Seit #MeToo stellt das kein großes Problem mehr dar. Ich mache Fotos von den roten Flecken, poste sie auf Twitter und verlinke deine Website. Passt das für dich?«
Fassungslos schaut Marvin mich an. Dann öffnet er den Mund.
»Du bist … du bist so eine …«
»Ja, ja«, unterbreche ich ihn, »mach dir nicht die Mühe, nach den passenden Worten zu suchen. Und jetzt ab mit dir! Be gone!«
Er steht regungslos da, als hätte ihn jemand betäubt. Dann, endlich, beginnt er, sich umständlich die Socken anzuziehen.
»Das kannst du draußen machen.«
»Wie bitte?«, fragt Marvin. »Du meinst, im kalten Stiegenhaus?«
»Wenn du willst«, sage ich, »kannst du auch gerne beim Fenster hinausspringen und dich während des Flugs bekleiden. Es wäre, wenn du mich fragst, nicht die intelligenteste Wahl. Andererseits könnte sich dadurch der Wert deiner Kunst steigern. Wenn auch bestimmt weniger stark, als von dir erhofft.«
»Ich gehe zur Polizei«, sagt er.
Unbeeindruckt von seiner Drohung nehme ich einen kräftigen Zug von der Zigarette.
»Geh nur«, sage ich. »Derweil schaue ich, dass der Deal mit der Galerie Grohlinger doch nicht zustande kommt.«
»Jetzt auch noch Erpressung«, sagt er und schüttelt den Kopf.
»Sag mal, bin ich die erste Erwachsene, mit der du in deinem Leben sprichst?«
»Nein«, sagt er mit säuerlichem Lächeln, »nicht die erste Erwachsene, aber das erste richtige Arschloch.«
»Das«, sage ich, »höre ich immer wieder gerne. Wusstest du, dass Gandhi ebenfalls ein Arschloch war? Für die Briten, versteht sich. Und der Dalai Lama ist ein Arschloch für die Chinesen. Die Perspektive ist entscheidend.«
Mittlerweile hat er es geschafft, sich die Socken anzuziehen. Mit den restlichen Kleidungsstücken, als Knäuel in seinen Händen, schlurft er, ohne mich noch einmal anzusehen, in den Vorraum. Seine Arschbacken streift ein matter Lichtstrahl. Süß sind sie. Die Wohnungstür fällt mit einem lauten Knall ins Schloss. Weint er, oder bilde ich mir das leise Wimmern nur ein? Ich nehme noch einen Zug von der Zigarette, suche nach dem Aschenbecher, finde ihn nicht, öffne hinter mir das Fenster und schnipse sie, noch glühend, in die klare Morgendämmerung. Dann steige ich aufs Fensterbrett, halte mich am Rahmen fest, sauge die kalte Luft in meine Lungenflügel … und springe. Während des kurzen Falls zieht mein Leben an mir vorüber.
Die Mutter. Die brave Mutter. Wie sie den Anweisungen meines Vaters hinterhertänzelt, als hätte sie keinen eigenen Kopf, kein eigenes Herz, keine eigenen Augen. Die Mutter. Die brave Mutter. Eine Haushaltsmaschine. Wie sie stets funktioniert. Auf Befehl aktiviert und nach Gebrauch in der Besenkammer abgestellt. Die Mutter, wie sie sich an mich schmiegt oder ich mich an sie, an ihren weichen Körper, der es gewohnt ist, jedem Druck nachzugeben. Diese Wärme, die von ihr ausgeht, die Geborgenheit, in die ich mich lege, wenn sie mich umarmt. Die Mutter, die ihr ganzes Leben lang selbstlos dient, bis nichts mehr von ihr übrig ist, und wenn sie nicht für Vater da sein muss, ist sie vor allem für Gustav da. Habe ich mich je bei ihr bedankt? Muss man sich bei den Eltern bedanken?
Der Vater. Der dumme Vater. Wie er glaubt, dass er mich genauso formen kann, wie er seine Ehefrau geformt hat. Der Vater. Der dumme Vater. Ein Bauarbeiter, dann Vorarbeiter oder Nacharbeiter. Das kann er, schuften, Geld verdienen. Nur denken kann er nicht. Der Vater, der sein ganzes Leben lang täglich Staub schluckt und nicht versteht, dass denken wichtiger sein kann als handeln, dass studieren wichtiger sein kann als kräftig anpacken. Der Vater, der, wenn er nicht mehr weiterweiß, gerne zum Alkohol greift und der, weil es keinen Tag gibt, an dem er weiterweiß, täglich zum Alkohol greift. Anstatt mit der Mutter zu reden, oder mit seinem Sohn, der ihm, ohne zu antworten, geantwortet hätte. Gern habe ich mit ihm geschwiegen, das kann er gut. Der Vater mit seinen kräftigen Armen, die dafür sorgen, dass ich als Kind nie frieren muss, die dafür sorgen, dass ich nie hungern muss, die mir Sicherheit geben. Ja, dafür bin ich dankbar, und doch könnte ich mich nicht bei ihm bedanken.
Mein Bruder. Mein guter Bruder. Er ist, obwohl er nichts versteht, der Einzige, der mich versteht. Der Einzige, der mir zuhören kann, ohne mich zu bewerten. Mein Bruder. Mein guter Bruder. Ein Mensch ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Dazu verdammt, sein Leben im Moment zu verbringen. Andere meditieren jahrzehntelang und erreichen diesen Zustand nicht. Und doch ist Gustav gezwungen, zu bleiben, wer er ist. Sich nicht ändern zu können, es tut weh, das in seinen Augen zu erkennen. Auf Mutters Pflege ist er angewiesen. Sie ist seine Beschützerin, seine Anwältin, sein Anfang und sein Ende. Mein großer Bruder, mein Held, der es schafft, der Ignoranz meiner Eltern Tag für Tag standzuhalten. Er ist stärker, als ich es je sein kann.
Mit dem Kopf voraus schlage ich auf am kalten, rauen Asphalt. Nur ein kurzer, heftiger Schmerz. Der Schädel spaltet sich, das Gehirn quillt heraus, die Wirbelsäule wird gestaucht, Schädelbasisbruch. Oder noch Schlimmeres. Ich sehe das silbrige Licht des frühen Morgens nicht. Es ist aus. Sehr dunkel. Und leise. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Und Vater wird trauern. Spätestens, wenn er von meinem Tod erfährt, wird er Tränen vergießen. Ein Lichtblick in seinem dumpfen Leben, in das er tags darauf wieder versinken kann. Und die Mutter wird, sofern es ihr die Tabletten erlauben, die sie von meinem Bruder zuweilen abzwackt, überhaupt noch Gefühle wahrzunehmen, nach einem Heulkrampf in einen tiefen, traumlosen Schlaf sinken. Und der Bruder wird es nicht verstehen, weil er es nicht verstehen kann. Was das sein soll: sterben, aufhören zu sein. Er kann es nicht verstehen, weil er nicht einmal verstehen kann, was es bedeutet, zu sein, zu existieren. Oder verhält es sich genau umgekehrt? Ist er der Einzige, der versteht, was es bedeutet, zu leben, und ich bin diejenige, die im Dunkeln tappt?
Ich verfolge den Flug des durch die kühle Luft wirbelnden Zigarettenstummels. Ein Auto mit kaputtem Auspuff fährt vorbei, durchbohrt die Stille mit seinem Scheppern. Ein kräftiger Windstoß bläst mir ins Gesicht. Einen Moment lang bekomme ich keine Luft. Ich steige vom Fensterbrett, schließe das Fenster und frage mich, was es mir gibt, mir meinen eigenen Tod auszumalen. Antwort finde ich keine. Ich knipse die Lampe an, lasse mich auf der Couch nieder und betrachte die Fingerknöchel meiner rechten Hand. Sie sind vom Fausthieb stark gerötet. Ich öffne die Hand und schließe sie. Mein Blick fällt auf den Boxsack in der Nische neben der Schlafzimmertür. Mit dem Handschuh gegen ihn zu schlagen fühlt sich definitiv anders an, nicht besser, aber anders. Ich mache mir eine gedankliche Notiz, mich darum zu kümmern, der Direktorin beim nächsten Jour fixe eines von Marvins Werken zum Ankauf vorzuschlagen. Mich langweilt Malerei, aber seine Pinselstriche werden bald viel wert sein.
Der Standort der nächstgelegenen Nachtapotheke ist mir zu weit entfernt. Ich schließe die Öffnungszeiten-App, lege das Handy beiseite und rede mir ein, dass es auf diese paar Stunden nun auch nicht mehr ankommt. Unter der Dusche denke ich an nichts. Mit relativ heißem Wasser fange ich an und senke die Temperatur stetig, bis der Regler bei der kältesten Einstellung angekommen ist. Jeden Strahl spüre ich, als wenn er einzeln in mich hineinfahren würde. Ich kann nur schwer atmen und etwas sticht in meiner Brust. Und doch tut es gut. Nur nicht weich werden, sage ich mir, nur nicht zu einer Warmduscherin werden. So fängt es nämlich an, dass man weich wird, und schon ist die Aufmerksamkeit vermindert, der falsche Fokus justiert. Das Wasser drehe ich ab, steige keuchend aus der Dusche, es kribbelt unangenehm in den Gliedern. Ich stelle mich vor den Spiegel und betrachte meinen Körper, bemerke die Gänsehaut an den Ober- und Unterarmen. Die langen roten Haare legen sich um den Hals, kleben daran. Gut schaue ich aus. Für mein Alter schaue ich immer noch sehr gut aus. Die Wörter immer noch, sage ich mir, sollte ich aus meinem Wortschatz streichen.
Von meiner Mutter habe ich die weiche Haut geerbt, die schmalen Hüften und mit ihnen den kleinen Hintern, auch die brüchigen Nägel und die Zehen, die merkwürdigerweise alle mehr oder weniger die gleiche Länge aufweisen; von ihr habe ich auch die vielen Muttermale auf Bauch und Rücken, die ich irgendwie mag, die grünen Augen, die schmalen Lippen und dann noch die Brüste, die bis jetzt zum Glück nicht hängen. Die Wörter bis jetzt, sage ich mir, sollte ich ebenfalls streichen. Mein Vater hat mir den relativ hohen Wuchs vererbt, die starken Knochen, den durchdringenden Blick, die Zähne, die eine schönere Anordnung verdient hätten, und schließlich das Rot meiner Haare, der Augenbrauen und ja, auch der Schamhaare. Ich sollte sie wieder wachsen lassen, sage ich mir, während ich mich abtrockne und föhne und dabei an die mit geballten Fäusten dastehende und vermeintlich stolz in die Kamera blickende Big Nude-Asiatin denke, die Helmut Newton einst fotografiert hat, die jedoch, wie von Susan Sontag richtig erkannt, mitsamt allen anderen von ihm geschossenen Bildern, frauenfeindlich und erniedrigend abgelichtet wurde. Er hätte nackte Männer fotografieren sollen, dann wären seine Fotos unter Umständen nicht ihrer Zeit verhaftet geblieben. Überhaupt, er hätte durch die Haut hindurch die Menschen einfangen sollen, nicht die Oberflächen von diesen Puppen, präsentiert in bester Riefenstahl-Ästhetik. Vielleicht hätte er auch keine Menschen fotografieren sollen, sondern Tiere, oder auch keine Tiere, sondern meinetwegen Pflanzen, die sind schließlich auch nackt, nicht wahr, aber dann hätte Alice Schwarzer vielleicht keine sexistischen, rassistischen und faschistoiden Züge in seine Werke hineingedichtet, was auch wieder schade gewesen wäre. Ach, er hätte erst gar nie den Auslöser betätigen sollen, dann hätte ich mich vor zehn Jahren, als frisch eingestellte kuratorische Assistentin, nicht ärgern müssen über seine Abzüge. Jedenfalls hat mir der Kurator dieses Provinzmuseums meinen Lebenslauf versaut. Keinen Geschmack, dafür stets die Besucherzahlen im Kopf. Dabei hätte das die Sorge des Direktors sein sollen. Nun, er war ein Mann. Da konnte ich nicht viel erwarten. Sex verkauft sich halt immer noch am besten, hat er mir zugeflüstert, in der Pause damals, und gekichert wie ein Schulbub, der zum allerersten Mal das Wort Vulva in den Mund nimmt. Seine Bemerkung war dermaßen abgelutscht, dass ich mir überlegt habe, die Frühlingsrolle auszuspucken, auf seinen Teller oder, warum nicht, gleich in sein Gesicht. Weil diese Aussage nicht stimmt. Nicht mehr. Ich werde es beweisen. Man hat mich nicht umsonst zur neuen Chefkuratorin des zeitgenössischen Ablegers der Belvertina bestellt, in dem seit seiner Eröffnung vor zwei Jahren nichts als Langweiligkeit zur Schau gestellt wurde. Ich weiß es besser. Nun heißt das nämlich so: money sells. Klar ist es plakativ, es ist aber auch selbstreferenziell, und es geht tiefer, schließt den Wallstreet-Wahnsinn ebenso mit ein wie die spanische Immobilienblase und die Ausbeutung der Schneiderinnen in Bangladesch. Als ich Arcus, dem Künstler der ersten von mir kuratierten Ausstellung in der Belvertina, den Titel vorgeschlagen habe, hat er genickt. »Perfekt«, hat er gesagt. »Das ist es, so machen wir das.«
In der linken Hand halte ich die Kaffeetasse, in der rechten das Handy. Sue ist online. So früh? Ich stelle die Tasse ab und tippe mit beiden Daumen. Im rechten spüre ich ein unangenehmes Ziehen. Vom Scrollen oder vom Boxhieb? Egal. Ich frage Sue, ob sie durchgemacht hat. Diesmal nicht, schreibt sie. Seitdem die Müllabfuhr gekommen sei, bekomme sie kein Auge mehr zu. Ob Jen noch schlafe, frage ich. Ja, wieso? Wie es mit ihr laufe, frage ich. Besser, schreibt Sue. Also hat sie es endlich verdaut?, möchte ich von ihr wissen. Sue fragt, warum ich so früh munter sei, ob ich vielleicht die Kranke sei. Mag sein, antworte ich. Was das zu bedeuten habe, schreibt sie. Dass ich ein kleines Problemchen hätte. Ach ja?, fragt Sue, welches Problem denn? Kein Problem, tippe ich ins Handy, sondern ein Problemchen. Sue schreibt: Aha, und weiter? Ich müsse etwas verhindern, schreibe ich. Den Weltuntergang?, fragt Sue. So etwas Ähnliches, schreibe ich. Ich glaube, Jen wacht auf, schreibt sie. Na und?, tippe ich. I should go down on her, schreibt sie, damit aus ihrem Besser bald ein Prima wird. Ich tippe: Frau muss eben tun, was Frau tun muss. Morgen erzählst du mir dann alles, ja?, schreibt Sue, fügt einen zwinkernden Smiley hinzu und geht offline, bevor ich ihr nein antworten kann.
Instagram, Twitter, Facebook, Mails, ein kurzer Blick aufs Konto. In dieser Reihenfolge. Fotos gepostet, Artikel retweetet, Hashtags hinzugefügt, den Sinn angedeutet, nicht zu viel gezeigt, nicht zu viel erzählt, neugierig gemacht, Herzen gesammelt, geliked, geteilt. Plötzlich ein Stich in der Brust. Diesmal fühlt es sich anders an als unter der Dusche. Ich zucke zusammen, greife hin und frage mich, ob ich mir Sorgen machen muss. Der Schmerz verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Wird nichts sein, rede ich mir ein. Was soll denn groß sein? Seit ein paar Monaten überrascht er mich, der Stich. Er hält sich nicht an Tageszeiten, an keinen Rhythmus. Er kommt und geht. Sollte ich das von einer Ärztin ansehen lassen? Ach, scheiß drauf. Ich bin gesund, bin ich immer gewesen. Das bisschen Rauchen wird mir nicht schaden. Eine Packung verkraftet mein Körper. Wenn es überhaupt eine Packung ist. Ich zünde mir eine Zigarette an, öffne die Wohnungstür und sammle die Zeitung auf. In der Küche blättere ich sie durch, schenke keinem bestimmten Artikel meine Aufmerksamkeit. Ein kurzer Blick auf die Küchenuhr sagt mir, dass die Apotheke um die Ecke bald öffnet. Ich dämpfe die Zigarette aus, stehe auf, betrete den begehbaren Kleiderschrank, lege den Bademantel ab und frage mich, ob es genügt, den Jogginganzug anzuziehen. Da fällt mir der pandemiebedingt verjährte Karl-Lagerfeld-Spruch ein, dass, wer in der Jogginghose rausgehe, die Kontrolle über sein Leben verloren habe. Ich zögere. Und wenn ich nun, wo ich schon munter bin, anschließend doch ins Büro fahre? Arbeit gibt es genug. Also dann: schwarzer Slip, schwarze Hose, weißer BH, weiße Bluse, schwarzer Blazer. Vor dem großen Wandspiegel im Flur fahre ich mir in den Nacken und ziehe die Haare, die noch unter dem Blazer liegen, mit einer Bewegung heraus, die einen geheimen Beobachter an Shampoo-Werbungen aus den neunziger Jahren erinnern würde. Und der Lippenstift? Nachdem ich den Inhalt der Handtasche dreimal umgerührt habe, finde ich ihn in einem kleinen Seitenfach. Brauche ich ihn? Aber klar doch.
Es sind nur ein paar Meter von meiner Haustür bis zum Eingang der Apotheke, und doch muss ich an einem knienden Bettler vorbei. Ich überlege, ob ich die Straßenseite wechseln soll, um diesem deprimierenden Anblick zu entgehen. Bevor ich eine Entscheidung treffen kann, stehe ich vor ihm. Ob ich ihm helfen könne. Seine Familie! Ach, und seine Kinder! Hilfe, bitte um Hilfe! Steht alles auf einem Pappkarton. Ich bleibe stehen, greife nach meinem Portemonnaie und entnehme ihm einen Hundert-Euro-Schein. Das blassgrüne Blatt flattert verheißungsvoll im Wind. Der Bettler lächelt mich mit einem vom Wetter zerfurchten Gesicht an, die meisten Zähne fehlen in seinem Mund; vielleicht ist es gar kein Mund mehr, denke ich, sondern schon ein Maul; immerhin sind ihm die Schneidezähne geblieben, nikotingelb verfärbt. Kurz bevor seine schmutzigen Hände den Geldschein berühren, ziehe ich ihn zurück, stecke ihn ins Portemonnaie und schließe den Zipp.
»Irgendwann in deiner Vergangenheit«, sage ich zu ihm, »bist du falsch abgebogen. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Auch ein Hunderter kann dir nicht helfen. Und deine Familie? Wo ist sie denn? Deine Kinder? Wo sind sie? Wahrscheinlich hat dich deine Frau verlassen, weil du nichts auf die Reihe gebracht hast, weil du gesoffen hast, weil du am Abend nicht mal mehr in der Lage warst, den Dreck unter deinen Fingernägeln zu entfernen. Weil du gestunken hast. Nach kaltem Schweiß und Pisse und süßem Parfum. Weil du ignorant gegenüber den Bitten deiner Frau gewesen bist, ihr schon lange nicht mehr geben konntest, wonach sie sich sehnte. Weil du das wenige Geld, das ihr euch mühsam mit langweiliger Lohnarbeit angespart hattet, mit Sportwetten verspielt hast. Und jetzt kniest du hier, faltest deine Hände und hoffst auf ein Wunder? Erbärmlicher Abschaum!«
»Nix verstehen«, ruft er mir hinterher, als sich die Schiebetür zur Apotheke öffnet. »Bitte! Schöne Frau. Nix verstehen …«
Ein paar Junkies stehen vor mir in der Schlange und warten auf ihre Tabletten. Ein ausgemergelter Typ dreht sich zu mir um und checkt mich kurz ab, und als er sieht, dass ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht zu seinesgleichen gehöre, schaut er beschämt weg. Fühlt er sich bloßgestellt? Ich bin die Letzte, vor der er sich verstecken muss. Der Apotheker öffnet seinen Morphiumordner und verteilt die Medikamente, die von den Substitutionspatienten unverzüglich, und unter genauer Überwachung des Apothekers, eingenommen werden.
»Ich denke nicht schlecht über dich«, flüstere ich dem Junkie oder Ex-Junkie ins Genick. »Habe ich auch mal geschluckt. For the fun of it. Jetzt trinke ich nur noch Wein und rauche unverschämt schwaches Gras. Zum Einschlafen, versteht sich«, füge ich hinzu, nachdem er sich langsam zu mir umdreht und mich beinahe erschrocken anschaut. Nichts kapiert er, der Typ. Ach, ist es nicht herrlich, bei Sinnen zu sein? Will er mir etwas sagen und schafft es sein Gedanke nicht vom Gehirn bis zur Zunge? Arme Sau. Im Vergleich zu ihm kann sich der Obdachlose vor der Apotheke glücklich schätzen. Der Junkie oder Ex-Junkie wird aufgerufen, schluckt sein Morphin retard und verlässt mit gesenktem Haupt die Apotheke.
»Guten Morgen«, begrüßt mich der alte Apotheker mit professionellem Verkäufer-Lächeln.
»Ja«, sage ich. »Die Pille danach.«
»Wie bitte?«
»Ich brauche die Pille danach. Wollen Sie es schriftlich?«
»Also gut«, sagt er und hört auf zu lächeln. »Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?«
Ich antworte nicht. Er steht da, stützt sich mit den Fäusten auf der Glasplatte ab und schaut mich fragend an.
»Ich habe Ihnen gesagt, was ich brauche«, sage ich. »Hätte ich noch etwas anderes von Ihnen haben wollen, so hätte ich meinen Mund geöffnet.«
»Ich wollte nur nett sein«, sagt er sichtlich gekränkt und fragt: »Sie wissen, wie man sie verwendet?«
»Na, man wird sie wohl schlucken müssen, oder soll ich sie mir als Zäpfchen in den Anus schieben?«
»Das empfehle ich Ihnen nicht«, sagt er schmunzelnd. »Sie sollten wissen, dass die Pille danach nur wirkt, wenn der Eisprung noch nicht stattgefunden hat.«
»Sehe ich etwa so aus, als würde ich sie zum ersten Mal nehmen?«, frage ich.
Der Apotheker antwortet nicht, dreht mir den Rücken zu und öffnet ein Regal.
Eisprung, denke ich. Manche Frauen spüren ihn. Wie das möglich sein soll, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich spüre da nichts. Habe ich noch nie. Vielleicht hat es mit dem Ausbleiben meiner Periode zu tun. Ich solle den Stress abbauen, hat mir die Frauenärztin mit strenger Miene empfohlen, da ich laut ihrer Einschätzung unter einer sekundären Amenorrhoe leide. Mein Menstruationszyklus sei also im Arsch, habe ich sie gefragt. So könne man das auch ausdrücken, hat sie gemeint. Aber es sei nichts, was man nicht wieder in Ordnung bringen könne. Wie gesagt, der Stress sei unverzüglich abzubauen. Ha. Haha. Hahaha. Sie hat keine Ahnung. Niemand hat eine Ahnung. Es geht nun schon seit Längerem so. Als ich mit Ende zwanzig die Pille abgesetzt habe, musste ich erst mal zwei Jahre auf die Blutung warten. Irgendwann kam sie so stark, dass die dicksten Binden noch zu dünn waren. Und mit der Zeit ist sie dann wieder verschwunden, völlig verebbt. War mir eh recht. Wofür sollte ich der Blutung nachjammern, wenn es auch ohne geht? Vielleicht habe ich zu viele männliche Hormone, habe ich zur Frauenärztin gesagt. Es hänge jedenfalls mit dem Hormonhaushalt zusammen, der insbesondere vom Hypothalamus und der Hypophyse dirigiert werde. Stress … als wenn ich darunter leiden würde! Ich weiß, dass ich Stress habe, natürlich weiß ich das, da brauche ich keine Ärztin, die es mir attestiert. Was sie nicht weiß, ist, dass ich ihn genieße. Das kann ich. Andere nehmen Koks, das sind die, die es noch nicht herausgefunden haben. Ich reite auf dieser Stress-Welle, und sie bricht und bricht und bricht unaufhörlich; ich surfe in ihrem innersten Tunnel, streife mit der linken Hand über die Wasseroberfläche, und vor mir schwebt das Licht, die Öffnung, der ich hinterhereile. Es gibt mir den ultimativen Kick. Die weißen Spuren auf den Glastischen in den Besprechungsräumen, wie peinlich, dass ich damals mitgemacht habe. Der Stress hingegen ist echt, er ist eine Droge, die ich aus mir selbst heraus erschaffe. Sie macht mich unabhängig. Keine Dealer. Kein Down nach dem High. Und das Allerbeste ist: Sie kostet nichts! Nichts, außer einer unregelmäßigen Menstruation und einem Stechen in der Brust. Diesen Preis bezahle ich gerne.
»Wie viel bekommen Sie von mir?«, frage ich den Apotheker.
»Es kommt darauf an, ob sie die günstigere oder die teurere Pille einnehmen wollen. Die teurere beinhaltet den Wirkstoff Ulipristalacetat, der die Eigenschaft besitzt, …«
»Ich nehme die günstigere.«
»Aber wollen Sie sich die Unterschiede nicht anhören?«, fragt er.
»Sagen Sie, muss ich als Frau immer alles zweimal sagen, damit ein Mann es akzeptiert? Ich habe nein gesagt.«
»Ich wollte Sie bloß informieren. Wissen Sie, das ist mein Job.«
»Das sagen sie dann, die Männer. Dass sie nur helfen wollten. Der armen, hilflosen Frau helfen, weil sie so lieb ist, so bedürftig, so süß.«
Der Apotheker bekommt einen roten Kopf. An seinem starren Blick erkenne ich, dass er nur zu gerne etwas sagen würde, sich aber aus Höflichkeit, oder wohl eher Angst, zurückhält. Braver Tölpel. Schließlich nennt er mir den Preis. Ich bezahle, nehme das Medikament an mich, drehe mich um und remple eine alte Frau an. Natürlich unabsichtlich.
»Also sowas!«, kreischt sie, nachdem sie ihren Körper unter Kontrolle gebracht hat. Durch eine dicke Brille schaut sie mich von unten her an. »Sie sollten besser darauf achten, wo Sie hintreten.«
»Und Sie«, sage ich, »sollten besser darauf achten, wo Sie stehen. Dort drüben befindet sich die Linie. Dahinter hätten Sie warten sollen, Frau Oma.«
»Das ist ja eine bodenlose Frechheit«, schimpft sie. Ob der Apotheker das gehört habe, fragt sie ihn. Er schaut mich an, blinzelt, sagt, dass er leider nichts gehört habe. Ob ich mich wenigstens entschuldigen könne, fragt mich die Alte.
»Ich entschuldige mich nicht mehr«, sage ich.
»Wie bitte?«, fragt sie.
»Passen Sie auf«, rufe ich, öffne meine Handtasche, strecke meine rechte Hand hinein und bitte die Alte, näherzutreten. Sie humpelt heran, beugt sich über die Handtasche und lugt ins dunkle Innere. Dort sieht sie meinen ausgestreckten Mittelfinger, ich lächle derweil den Apotheker an. Er erwidert mein Lächeln nicht. Die alte Frau hebt den Kopf, sieht mich an, als hätte sie eine Außerirdische erblickt.
»Sie sind …«, stottert sie, »… Sie sind eine …«
»Ich weiß«, sage ich und verlasse die Apotheke.
2
Scheiß auf den Feiertag. Ich lasse ihn mir ausbezahlen. Für die Verantwortung, die ich übernehme, verdiene ich ohnehin zu wenig. Soll sie nicht herummeckern, die Auerbach, mit ihrem Sekretärinnen-Blabla, von wegen das sei nicht möglich, man könne das nicht einfach so umschichten, es sei gesetzlich vorgegeben, dass man die Urlaubstage verbrauchen müsse und so weiter und so fort. Ihre Piepsstimme am Telefon, mit ihr zu plaudern ist doch immer wieder ein Fest! Da fühle ich mich gleich wunderbar hineinversetzt in die österreichische Bürokratie oder ins bürokratische Österreich, da kann ich mich für einige Minuten aufgehoben fühlen. Einfach nur die Auerbach reden lassen, das Handy auf Lautsprecher schalten, sich zurücklehnen, und während ihr dünnes Stimmchen durch den Raum tiriliert, sich vorstellen, wie es zugeht in all den Büros dieses Landes, wie die Stempel niedersausen auf die Dokumente, wie die Unterschriften hingefetzt werden, die Daten eingegeben, wie die kleinen hässlichen Bilderrahmen auf den billigen Schreibtischen glänzen, mit den Fotos der Ehemänner und Kinder darauf, und hinter den Fotos der Ehemänner und Kinder, versteckt, die Fotos der Liebhaber.
Dem Taxifahrer, der vom Alter her eigentlich schon im Ruhestand sein oder in einem Sarg zwei Meter unter der Erde liegen müsste, nenne ich den Namen des Museums. Er kennt es nicht, nur das Haupthaus in der Innenstadt. Vom Aussehen her – dunklere Hautfarbe, üppiger grau-weißer Vollbart, bunte Kleidung – dürfte er gebürtiger Inder oder Pakistani sein. Aber daran liegt es nicht. Niemand kennt das Museum, außer jene, die sich ernsthaft für zeitgenössische Kunst interessieren. Ich nenne ihm die Adresse. Er tippt sie in sein antik anmutendes Navigationsgerät.
»Dort draußen gibt es ein Museum?«, fragt er mit leichtem Akzent.
»Ja«, sage ich und stoße einen Lacher aus, »leider.«
»Warum leider?«, sagt er, dreht seinen Kopf etwas nach rechts und sieht mir durch den Rückspiegel in die Augen. »Ein Museum ist doch etwas Gutes.«
»Das schon«, sage ich, »aber es sollte den richtigen Standort haben.« Nach einigen Sekunden nickt er und wiederholt:
»Den richtigen Standort«, murmelt er in seinen gepflegten Bart. »Ja, das schon.«
»Die Kulturstadträtin«, sage ich, als er beschleunigt, »hat sich vom Bürgermeister unter Druck setzen lassen, und dieser von den Wählerinnen und Wählern. Sie wissen ja, die Außenbezirke driften nach rechts ab. Und der einzige Plan, der den Politikerinnen und Politikern einfällt, ist, dass die Kunst das retten muss, was sie nicht auf die Reihe kriegen. Das Absurde ist, dass sich in Simmering kein Mensch für Kunst interessiert. Was denen dort tatsächlich gefallen würde, wäre ein neues Stadion oder zumindest eine große Mehrzweckhalle, damit noch mehr Leute auf einmal Holiday on Ice, Passion for Horses oder Masters of Dirt sehen können. Damit würden sie punkten, damit bekämen sie ihre Wählerstimmen zurück. So aber sind es nichts anderes als Perlen vor die Säue«, erzähle ich dem Taxifahrer.
»Wie bitte? Was haben Sie gesagt?«, fragt der und nimmt zwei kleine weiße Stöpsel aus den Ohren. »Haben Sie mit mir gesprochen?«
Ich überlege, ob ich ihm mein rechtes Knie durch die Lehne in den Rücken rammen soll, atme zweimal tief durch und gebe ihm mit ruhiger Stimme zu verstehen, dass ich überhaupt nichts gesagt hätte. Ich öffne die Handtasche. Die Tablettenpackung sieht aus wie jede andere auch, ihr Anblick eine Zumutung. Die Pille drücke ich aus dem leise knisternden Blister, lege sie, nachdem ich genug Speichel angesammelt habe, auf meine Zunge und ziehe sie in die Mundhöhle hinein. Ich lege den Kopf zurück und schlucke.
Dass ich für eine Schwangerschaft keine Zeit hätte, steht außer Frage. In drei Wochen eröffnet meine erste Ausstellung in der Belvertina mit Arcus’ Performance. Vieles ist nach wie vor unerledigt. Und die nächste Ausstellung wartet schon auf ihre Realisierung. Um jedes Detail muss gestritten werden. Will ich ein spezielles Munken-Papier für den Katalog verwenden, muss darum gestritten werden. Will ich eine mit dem Künstler eng befreundete Südtiroler Punkband, die sich auf sozialpornografische Texte spezialisiert zu haben scheint, für die Eröffnungsparty einfliegen lassen, muss darum gestritten werden. Die Direktorin hat mich noch nicht ins Herz geschlossen, das lässt sie mich spüren. Erst wenn die Besucherzahlen stimmen, wird sie mir mit ausgebreiteten Armen entgegenkommen, dann wird sie aufhören, mich mit Frau Doktor anzusprechen. Sie wird womöglich immer noch per Sie mit mir sein, aber zur Abwechslung immerhin meinen Vornamen verwenden.
Wenn ich aufs Klo muss, dann möchte ich dort bitte nicht kotzen müssen. Wegen übermäßigen Alkoholkonsums? Soll sein. Wegen eines Embryos, eines kleinen Aliens in meiner Gebärmutter? Sicherlich nicht! Gebärmutter, welch kranke Bezeichnung für ein Organ. Schwanger sein, das geht nicht. Das ging nie. Es wird nie gehen. Außerdem habe ich zu schmale Hüften. Sollen schön brav die Simmeringerinnen ihren Nachwuchs werfen, damit sie, wenn ihre Kinder einmal älter sind, diese für einen Bastel- oder Fotoworkshop in die Belvertina schicken können, dann haben die maßlos überforderten Eltern drei Stunden Ruhe für die Zeugung des nächsten Stinkers. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht mit Kindern kann, nichts mit ihnen anfangen kann. Ich bin keine Mutterfrau. Das Wort Mutter passt nicht in mein System. Ein Baby nähme mir mehrere Jahre meiner Lebenszeit. Ich sehe es in den Augen der Mütter. Dass sie längst keine Energie mehr haben. Dass die Kleinen nichts anderes als Energiefresser sind. Es reicht denen nicht, dass sie die Milch aus den Brüsten saugen, das ist nur der Anfang, die wollen mehr und immer mehr, und wenn sie dann in die Pubertät kommen, treten sie einem zum Dank für die täglichen Mühen in den Arsch. Kein Mann riskiert seine Karriere für einen Winzling, auch wenn er noch so lieb dreinschaut. Aber wir Frauen haben selbstlos zu sein. Wir sollen uns, unsere Leben, unsere Ziele, unsere Träume doch diesem scheinbar höheren Zweck hingeben, der kein Geld einbringt, keinen Ruhm. Fehlte es mir an Intelligenz, wer weiß, ob ich mich nicht darauf einlassen würde, so aber spiele ich nicht mit. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht süß wären, die kleinen Scheißer. Wenn ich sie betrachte, so wie ich ein Kunstwerk betrachte, das sich unkontrolliert bewegt und zufällig abstrakte Laute von sich gibt, eine lebende Installation quasi, dann könnte ich sie glatt mögen. Aber im Arm halten? Nein. Franz West hat uns dazu animiert, seine Kunstwerke in die Hand zu nehmen, mit ihnen zu spielen, auf ihnen Platz zu nehmen. Eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mittlerweile (da Franz West jetzt kein Veto mehr einlegen kann) darf niemand mehr auf seinen Plastiken Platz nehmen. Die Restauratorinnen und Restauratoren sowie die Sammler können wieder aufatmen. Die Sammler sind immer männlich. Sammlerinnen gibt es nicht. Die haben kein Geld. Und warum? Na, weil sie Kinder haben!
»Oh«, meint der Taxifahrer mit breitem Grinsen, und als wäre er stolz, es bis hierhin geschafft zu haben. »Ein sehr schönes Museum.«
»Es ist das letzte von Zaha Hadid entworfene Gebäude«, sage ich. »Aus ihrem Grab heraus hat sie es hingestellt.«
»Beachtenswert«, sagt er, lenkt das Auto in eine freie Parklücke und starrt mit offenem Mund durch die Fensterscheibe. »Wie heißt der Architekt?«, fragt er und dreht sich zu mir um. »Zacher Habicht?«
»Die Architektin hieß …« Ich halte kurz inne und sage: »Ja, der Architekt hieß Zacher Habicht. Genau so hat er geheißen.«
Die Chipkarte halte ich zum Lesegerät, das so tief an der Außenmauer angebracht ist, dass ich das Gefühl nicht loswerde, der Eingang ist für Kleinkinder konzipiert. Es macht klack, die Tür öffnet sich mit einem lautlosen Schwenken ins Gebäudeinnere. Mit dem Lift fahre ich in den sechsten Stock des gläsernen, geschwungenen Turms, der seitlich an die zweistöckige Ausstellungshalle geklebt wurde. Beim Eingang ins Büro wird abermals die Chipkarte benötigt. Bald werde ich sie noch zum Einschalten des Computers benötigen, und in dreißig Jahren darf ich wahrscheinlich nicht mehr scheißen gehen, ohne davor mit der Chipkarte über die Klobrille gefahren zu sein, damit die Leute vom Personalmanagement die Kackfrequenz im Auge behalten können, die Konsistenz der hinterlassenen Ware begutachten, meine Gesundheit optimieren, denn eine kranke Mitarbeiterin ist keine gute Mitarbeiterin. Auch eine schwangere Mitarbeiterin ist keine gute Mitarbeiterin. Nur die, die sich selbst ausbeuten, sind gefragtda hat die Führung bei mir den richtigen Riecher gehabt.
Über den Dächern Wiens geht langsam die Sonne auf, ein unnatürliches Fukushima-Orange durchflutet das Büro, das ich mir leider an normalen Arbeitstagen mit Sophia, einer nicht immer übereifrigen Assistentin, die mir zugeteilt wurde und Walter, einem Kurator, der sich ganz der österreichischen und deutschen Nachkriegsmalerei verschrieben hat, teilen muss. Außerdem sitzt im Büro noch Fabian, der sogenannte Junior-Kurator, der einen Monat vor mir eingestellt wurde. Unsere Arbeitsbereiche in der Belvertina überschneiden sich zum Glück nur marginal, da er für einen kleinen Ausstellungsraum, quasi einem Raum im Raum, zuständig ist, wo er Newcomerinnen und Newcomern ein paar Quadratmeter zur Verfügung stellt, um sich dort auszutoben, sich kuratorisch zu profilieren und die ersten Gehversuche in einer größeren Kunstinstitution zu machen. Er hat verdammt gute Kontakte zur Szene, führte zuvor erfolgreich eine Offspace-Galerie in Favoriten, unterrichtet an der Angewandten Ausstellungstheorie und ist überhaupt auf jeder Vernissage zu finden. Zum Glück hat Fabian Gleitzeit, schläft lange und kommt relativ spät ins Büro. Einmal haben wir, freilich nur, um uns besser kennenzulernen, miteinander geschlafen. Nun, seitdem will er mich heiraten. Dass ich keinen Mann in meinem Leben brauche, niemanden an meiner Seite, weil ich mir selbst genug bin, will und kann er offenbar nicht verstehen.
Die Helligkeit sticht in den Augen. Mein Blick wandert über die Fassade der gegenüberliegenden Wohnhausanlage, an der das morgendliche Licht abprallt. Sie wird nicht schöner, je öfter ich hinsehe. Kotzgrün auf Eitergelb. Errichtet von der Stadt Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger. Immerhin zahlen die Bewohnerinnen eine angemessene Miete. Ob das ausreicht für ein glückliches Leben? Mit money sells die Unglücklichen, die Arbeitslosen ins Museum zu holen, das ist mein Plan, die sogenannten Verlierer kommen zu lassen, die Abgehängten, die Streuner. Auf Knopfdruck fährt die Jalousie herunter, begleitet von einem leisen mechanischen Summen, und sperrt das dumpfe Leben des Sozialbaus aus, auch die Wärme der Sonne. Von mir aus könnte es wie in einem dystopischen Science-Fiction-Film den Tag über dunkel bleiben. Vielleicht sollte ich mir eine Yoko-Ono-Sonnenbrille zulegen, dann hätte sich dieser Wunsch auch erfüllt.
Ich blinzle, gebe mein Passwort ein. Der Computer erwacht mit einem verheißungsvollen Klang zum Leben, der wahrscheinlich von Brian Eno komponiert wurde; man kann ja heutzutage nicht einmal mehr am Flughafen in Beirut aufs Klo gehen, ohne von einer seiner Mikro-Kompositionen akustisch umspült zu werden. Der Beginn der Arbeit markiert den eigentlichen Beginn des Tages. Ist natürlich Bullshit. Die Arbeit beginnt nicht im eigentlichen Sinne. Sie ist stets präsent. Den ganzen Tag über. Ich liebe sie. Und sie macht mich fertig. Und deshalb liebe ich sie umso mehr.
Man dürfe im Büro nicht rauchen, zumal sich die Fenster nicht öffnen ließen, hieß es vom Haustechniker, einem großgewachsenen, für seinen Job, meiner Ansicht nach, etwas zu dürr geratenen Mann mit müden Augen. Außerdem sei der Rauchmelder recht streng eingestellt. Ich habe mit ihm in einer ruhigen Minute gesprochen. Er hat mir verraten, dass es ein Fenster gibt, das man sehr wohl öffnen kann, aus reinen Sicherheitszwecken, versteht sich. Ich habe ihm gut zugeredet, habe süß gelächelt, bin mir ein paar Mal mit den Händen durchs Haar gefahren und habe ihn einmal zärtlich an der Schulter berührt, während ich mit ihm gesprochen habe. Was dabei aus meinem Mund herauskam, war völlig irrelevant, das hat er nicht aufgenommen, es ist in seine Ohren hineingeflutscht und in einer einsamen Gehirnwindung versickert. Die Bewegungen meines Körpers hingegen sind erkannt worden. Alle. Da geht generell nichts verloren im auf Reproduktion konditionierten Schädel eines Mannes. Das sinnliche Öffnen meiner Lippen, die leicht heruntergeschlagenen Lider, die ihm signalisieren sollen, dass ich ihn, wenn es denn – ach, wie schade – meine Stellung nur erlauben würde, sofort vernaschen wollte. Es hat nicht lange gedauert, bis er mir den passenden Griff fürs Fenster überreicht hat. Diese Eindimensionalität der Männer! Eigentlich verachtenswert. Das Wort eigentlich, sage ich mir, sollte ich streichen. Gerade in diesem Fall.
Der obersten Lade des Schubladenschranks entnehme ich besagten Henkel. Die Kniebeuge versetzt den Drehstuhl durchs abrupte Aufrichten in Bewegung, er knallt gegen den Schreibtisch des werten Herrn Kollegen und stößt dort mit der Lehne einen am Rand stehengelassenen Orangensaft um. Die Flüssigkeit breitet sich schnell aus und rinnt in Richtung seiner Tastatur. Fluchend greife ich in meine Handtasche und entnehme ihr eine Packung Taschentücher. Ich beuge mich über Walters Schreibtisch. Der Saft ist inzwischen unter seine Tastatur geronnen. Ich hebe sie an einer Seite an und trockne sie, so gut es eben geht. Ob sie noch funktioniert, frage ich mich. Jemand sollte es überprüfen. Nur eine kurze Kontrolle, sage ich mir und schalte – nicht ohne eine gewisse Vorfreude – seinen Computer ein. Und siehe da, sein Passwort hat er sich auf einem kleinen gelben Zettelchen notiert und auf die Unterseite der Tastatur geklebt: KieferBrandlWeilerAtterseeBaselitz12345. Noch etwas länger hätte es sein können. Ist das sein persönliches Künstler-Ranking? Wenn er wenigstens Beuys oder Zobernig, Schlingensief oder Genzken, EXPORT oder Steyerl dazu genommen hätte. Aber das hat nichts mehr mit Malerei zu tun, das geht über Walters Horizont hinaus. Und natürlich fehlt jede Spur einer malenden Frau: JungwirthKrystufekHausnerPakostaLassnig678910, ergänze ich in Gedanken. Als ich die Belvertina übernommen habe, war man der Auffassung, dass Kunst genau das sei: Gemälde, die an den Wänden hängen. Bevorzugt von steinalten, also kurz vor dem Abkratzen stehenden deutschen und – man will ja niemanden ausgrenzen – österreichischen Malern. Deren Werke sind wichtig für die Kunstrezeption. Keine Frage. Und doch müssen wir mit Schwänzen gemalte Gemälde überwinden. Es wird endlich Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Wir müssen den Raum erweitern, ihn in seiner Gesamtheit nutzen. Eine Stocker hat das genau so verstanden wie eine Kowanz, eine Margreiter, eine Bonvicini. Wie armselig ist das denn, mehrere riesige Säle zur Verfügung zu haben, und dann die Kunst nur an den Wänden zu präsentieren? Hauptsache, alles ist Öl auf Leinwand. Wie oft habe ich diese drei Wörter schon gelesen auf den kleinen weißen Schildchen am unteren rechten Rand eines Gemäldes, da krieg ich einen Ausschlag!
Auch die Direktorin ist von der alten bis mittelalten Schule. So wie jede Leiterin und jeder Leiter eines großen Museums. Weil sie konservativ denken müssen. Niemand will junge Punks in den Ausstellungsräumen. Sie sollen alt sein, die Besuchenden, bestenfalls reich, die Männer sollen Columbo-Mäntel tragen, die Frauen Hüte mit aufgestecktem Obst aus Holz, sie sollen sich langsam durch die Gänge bewegen, nicht rennen (was sie eh längst nicht mehr können), sie sollen hohe Spenden ans Museum überweisen, Mitglied werden und den Shop nicht ohne einen überteuerten Klimt-Schal aus Seide und einen dicken Katalog verlassen, den sie zu Hause ungeöffnet ins Bücherregal stellen.
Ich gehe zum Fenster, öffne es mit dem passenden Werkzeug, zünde mir eine Zigarette an. Der Rauch, der meinen Lungen entweicht, wird durch die Schlitze der Jalousien gierig nach draußen gesaugt.
An einer Lamelle dämpfe ich die Zigarette aus und schnipse sie ins Freie. Ich schließe das Fenster, lege den Hebel zurück in meine Lade, gehe zu Walters Computer und tippe, wenn auch ungern, sein Passwort in die Tastatur.
Mit einem Seufzer öffne ich das Mailprogramm. Gleich die neueste Nachricht stammt von Sophia, meiner Assistentin. Sie wurde erst gestern verfasst.