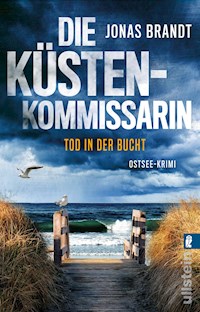9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am Ostseestrand zwischen Dünen und Kiefernwäldern lauert der Tod Im Schatten des Leuchtturms Dahmeshöved wird unter einer Segeljacht die Leiche eines Jugendlichen gefunden. Kommissarin Frida Beck und ihr Partner Deniz Yilmaz von der Kripo Lübeck übernehmen den Fall. Rasch finden sie heraus, dass der Vater des Opfers sich an der Küste durch den Kauf von Immobilien Feinde gemacht hat. Vor allem ein Nachbar, der seit Jahren Leuchtturmführungen für Touristen anbietet, ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Als ein weiterer Toter in Dahmeshöved entdeckt wird, erkennt die Kommissarin, dass die Mordserie noch nicht zu Ende ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Küstenkommissarin – Der Tote am Leuchtturm
Der Autor
Jonas Brandt ist im Norden Deutschlands aufgewachsen. Er arbeitet als Lehrer und reist gern, wobei ihn das Schreiben stets begleitet. Immer wieder zieht es ihn an Deutschlands Küsten, wo er seine klugen Kommissare mit Vorliebe ermitteln lässt.
Das Buch
Der erste Fall für Küstenkommissarin Frida Beck
Im Schatten des Leuchtturms Dahmeshöved wird die Leiche eines Jugendlichen gefunden – zerquetscht unter einer Segelyacht. Kommissarin Frida Beck und ihr Partner Deniz Yilmaz von der Kripo Lübeck übernehmen den Fall. Rasch finden sie heraus, dass der Vater des Opfers sich an der Küste durch den Kauf von Immobilien Feinde gemacht hat. Vor allem ein Nachbar, der seit Jahren Leuchtturmführungen für Touristen anbietet, ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Als ein weiterer Toter in Dahmeshöved entdeckt wird, erkennt die Kommissarin, dass die Mordserie noch nicht zu Ende ist ...
Jonas Brandt
Die Küstenkommissarin – Der Tote am Leuchtturm
Ostsee-Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Titelabbildung: ©FinePic®, München (Wasser); padrady photos/getty images (Dünen); ©Reinhard Schmidt/mato images (Wasser, Möwen, Steg)Gesetzt aus der Quadraat Pro powered by pepyrus.comDruck und Bindearbeiten: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-548-06429
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Mecklenburger Bucht, August 1977
1. Kapitel
Dahmeshöved, März 2019
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Mecklenburger Bucht, August 1977
Der Junge blickte aus dem Fenster. Kleine Dörfer mit reetgedeckten Häusern, Sträucher, die sich in der Meeresbrise bogen. In der Ferne die weißen Schaumkronen der Ostsee. In seiner Brust zog sich etwas zusammen. Er wusste noch nicht, dass es der Abschied war, der sich so anfühlte.
Plötzlich kam das Auto am Straßenrand zum Stehen.
»Alle aussteigen!«, befahl der Volkspolizist und beugte sich herunter, um den Rücksitz besser sehen zu können. »Auch das Kind.«
Lars wartete, bis seine Mutter das Auto verlassen hatte, dann kletterte er aus dem zitronengelben Trabant und griff sofort nach ihrer Hand. Sie fühlte sich anders an als sonst. Nass und kalt.
»Sie haben kein Boot dabei, oder?«, fragte der Polizist.
»Nein«, antwortete sein Vater. Doch das war gelogen. Das schwarz angepinselte Schlauchboot war in den hinteren Autositz eingenäht, auf dem er gerade noch gesessen hatte. Lars wusste, dass sie damit zu dritt über die Ostsee fahren würden. Nächtelang hatte Papa auf Mama eingeredet. Bis sie am Ende nachgegeben hatte. Na gut, wir kommen mit, hatte sie gesagt. Wir, das waren Lars und seine Mutter.
»Die sehen wir hier in Grenznähe nicht so gern«, sagte der Polizist und steckte seinen Kopf ins Auto, um sich darin umzusehen.
»Ach so.« Papas Stimme klang anders als sonst. Weich und nicht so streng.
»Sie sollten schon etwas besser Bescheid wissen. Ist ja schließlich auch Ihre DDR«, erwiderte der Polizist vorwurfsvoll, nachdem er im Kofferraum nachgesehen hatte. »Trotzdem noch eine gute Fahrt!«
»Ihnen auch einen schönen Tag.«
Rasch schob Lars sich wieder auf die harte Rückbank, die ganz warm von der Sonne war. Dann ließ Papa den Motor an.
»Das hast du toll gemacht«, sagte seine Mutter zu ihm und streichelte ihm zur Belohnung das Haar. Er griff nach ihrer Hand. Sie sollte nicht aufhören.
»Nicht schlecht«, lobte ihn sein Vater in das Knattern des Motors hinein, als sie wieder auf der Landstraße waren.
»Was denn?«, erkundigte sich Lars.
»Die Klappe halten und keine Angst zeigen.« Kurz darauf bremste sein Vater scharf und schaute nervös in alle Richtungen. Dann bog er in einen schmalen Waldweg ein, der direkt von der Landstraße abging. »Hat uns jemand gesehen?«
»Nein«, antwortete Lars. Ganz sicher war er sich aber nicht.
Nach einer kurzen Holperfahrt kamen sie an die Düne. Es roch nach Meer und Sommerferien. Lars hörte das Rauschen der Wellen. Eine Möwe schrie eine Begrüßung zu ihnen herunter. Endlich da!
Seine Eltern brauchten eine Weile, um die Nähte der Rückbank aufzutrennen und das Schlauchboot herauszuholen. Es folgten der Blasebalg, drei Taucheranzüge aus dem Stoff mit dem schwierigen Namen, drei kleine Schwimmringe, zwei Schläuche mit Wasser und ein paar Haferkekse, die Mama selbst gebacken hatte. Sie versteckten alles im hohen Gras der Düne und Papa nähte die Sitze wieder halbwegs zusammen. Dann stiegen sie in den Trabi.
»Den müssen wir woanders abstellen«, sagte sein Vater.
Sie fuhren ein Stück in den Wald hinein. Hinter ihnen staubte der Sandweg. Mama nahm seine Hand und streichelte sie. Dann entdeckte Papa offenbar eine Stelle, an der er das Auto verschwinden lassen konnte. Er legte den Rückwärtsgang ein und fuhr ins Gebüsch hinein, bis es nicht mehr weiterging. Als Lars ausstieg, passte er nicht auf, und eine Brennnessel streifte seine nackten Beine. Es brannte ein bisschen. Aber er biss die Zähne zusammen und sagte nichts, während sie sich gemeinsam auf den Rückweg zur Düne machten.
Als sie ankamen, war es spät geworden. Im roten Licht der tief stehenden Sonne sah Lars seinen Eltern dabei zu, wie sie das Schlauchboot abwechselnd aufpumpten. Ihr Schweigen machte ihm Angst, und er fragte sie, ob er mithelfen solle. Sein Vater erlaubte es ihm nicht, aber er sagte, er könne aufpassen, dass niemand kam und sie entdeckte. Lars fand, dass das eine schwierige Aufgabe war. Wenn die Polizei kam und er sie nicht früh genug bemerkte, wäre er allein schuld.
Als es dunkel wurde, trugen sie das Boot einen kleinen Pfad über die Düne entlang zum Wasser. Lars packte auch mit an.
»Die Ostsee ist ruhig hier«, sagte sein Vater. »Erst recht im Sommer.«
Lars tauchte die Hand ins dunkle Meer ein und griff in den weichen Sand am Grund. Vielleicht konnte er ein bisschen davon auf die Reise mitnehmen. Plötzlich verspürte er einen brennenden Schmerz. Ruckartig zog er den Arm aus dem Wasser. Ihm wurde schwindelig und heiß zugleich. Aber er riss sich zusammen und schrie nicht, sondern sagte nur leise: »Aua!«
»Was ist denn, Lars?«, fragte ihn seine Mutter.
»Ich glaube, mich hat was gestochen.«
»Eine Feuerqualle?«
»Was spielt er auch da rum?«, schimpfte sein Vater. »Halt sie ins Wasser, wenn wir fahren. Das kühlt. Wir müssen los.«
»Sei tapfer!«, sagte seine Mutter und küsste ihn auf die Stirn.
Nach dem Kuss tat es noch doller weh. Tränen kullerten ihm über die Wangen. Noch einmal biss er die Zähne zusammen. So fest wie noch nie zuvor in seinem Leben.
Schließlich legten sie ab.
»Die ersten drei Seemeilen vor der Küste sind die gefährlichsten«, flüsterte sein Vater. »Von ihren Beobachtungstürmen aus sehen sie fast alles.«
»Was sind das für große Lichter?«, fragte Lars.
»Flakscheinwerfer«, antwortete sein Vater. »Da dürfen wir nicht reinfahren.«
Nach einer Weile ging ein kleiner Mond auf, der sich aber schnell wieder hinter ein paar Wolken verkroch. Es war fast ganz dunkel. Mehrmals überprüfte der Vater den Kompass mit der kleinen Taschenlampe, die Lars an einer Schnur um den Hals trug. Es war wichtig, dass sie erst einmal stramm nach Norden fuhren. Lars versuchte, nicht an seine Hand zu denken, die immer noch wehtat.
»Was ist das, Papa?«, fragte er in die Stille hinein, die keine mehr war, weil sich ein entferntes Brummen in sie gebohrt hatte. Es kam schnell näher. Ein Schiffsmotor. Lars sah die Bordlichter.
»Leise!«, ermahnte ihn sein Vater und gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Das ist ein Streifenschiff. Sie nennen es Bremse. Aber nicht, weil es so langsam ist, sondern weil es brummt wie eine Pferdebremse.«
»Was ist, wenn die Leute auf der Bremse uns sehen?«
»Pst!«, machte der Vater.
Ich kann ja mal ihre Lichter zählen, dachte Lars bei sich. Doch dazu kam er nicht mehr. Die Bremse hatte plötzlich so laut den Motor aufgedreht, dass er vor Schreck fast ins Wasser gefallen wäre. Dann kam sie direkt auf ihr kleines Schlauchboot zugerast. Immer näher und näher! Mit beiden Händen klammerte Lars sich an seiner Mutter fest. Er konnte spüren, dass sie am ganzen Körper zitterte.
»Was machen die denn?«, rief Papa. Dabei hätte er es wissen müssen, dachte Lars. Das mit der blöden Flucht war schließlich seine Idee gewesen. Er hatte Mama dazu überredet. »Die halten ja volle Kanne auf uns zu!«
»Lars! Halt dich an mir fest!«, schrie seine Mutter in das Dröhnen hinein.
»Eure Schwimmringe!«, hörte er den Vater rufen.
»Hilfe! Mama!«
Das Tosen des Motors wurde immer lauter. Es klang für Lars nicht wie eine Bremse, sondern wie Tausende. Ein großer Schwall Wasser klatschte auf das schmale Schlauchboot. Lars verschluckte sich. Im nächsten Moment wurde er unter Wasser gezogen. Die Bremse war einfach über sie drüber gebrettert, schoss es ihm durch den Kopf. Panisch ruderte er mit den Armen, kam an die Oberfläche und spuckte das Meerwasser aus. Das Salz brannte ihm in der Kehle. Er blickte sich um. Das Schlauchboot war verschwunden. Er begann zu weinen. Eine Welle schlug hart in sein Gesicht, und die Ostsee vermischte sich mit seinen Tränen. Wo war Mama? Um ihn herum war es dunkel, nass und kalt. Die Bremse brummte davon und zog eine weiße Schneise in das schwarze Wasser.
»Lars!«, hörte er die Stimme seines Vaters.
»Ja?«
»Wirf mir die Leine zu, die an deinem Schwimmring dran ist!«, rief er. »Und atme ruhig.«
Er strampelte heftig mit den Beinen, während er die lange weiße Schnur suchte. Er wusste, dass sie an dem Rettungsring festgemacht sein musste, weil seine Finger eben noch mit ihr gespielt hatten.
»Mama?«, kreischte er und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit.
Sein Vater stimmte kurz darauf in seine Rufe mit ein. Sie riefen so lange, bis ihnen die Luft ausging. Aber seine Mutter antwortete nicht. Sie hatte doch einen Schwimmring gehabt! Oder war sie noch im Boot gewesen? Wo war das Boot? Konnte ein Schlauchboot untergehen? Und wo war der Kompass?
»Mama muss hier irgendwo sein«, sagte sein Vater.
»In welche Richtung müssen wir jetzt, Papa?«
»Immer nach Norden.«
»Woher weiß Mama, wo Norden ist?«, fragte Lars japsend. Woher wusste Papa, wo Norden war?
»Rede nicht so viel!«, befahl ihm sein Vater. »Spar dir deine Kräfte auf. Du lässt dich einfach treiben. Ich ziehe dich.«
Papa war ein sehr guter Schwimmer. Früher hatte er sogar Wettkämpfe gewonnen. Lars streckte Arme und Beine von seinem Körper weg. Treiben lassen, dachte er und schloss die Augen.
Er wachte erst wieder auf, als er seinen Vater rufen hörte. »Hilfe! Hier!«
Es war immer noch Nacht, und sie schwammen immer noch im Wasser. Die Kälte war ihm die Beine hochgekrochen. Träumte er? Wo war Mama? Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er konnte sich nicht erinnern, wann er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Hatten sie sich nicht bald wiedertreffen wollen? Hatten sie das nicht so abgemacht?
Seitlich von ihnen erblickte er eine riesige Wand mit vielen Lichtern. Das musste ein Dampfer sein.
Wieder schrie sein Vater: »Hilfe! Hierher!«
Lars wollte auch schreien, aber er brachte keinen Ton heraus. Im Wasser hämmerten die Schiffsschrauben und oben in den hell erleuchteten Fenstern bewegten sich Menschen wie kleine Käfer. Sahen die Leute sie etwa nicht? Hörten sie nichts?
Dann fielen ihm die Augen wieder zu.
Als er das nächste Mal aufwachte, war die Wand mit den Lichtern nicht mehr da. Er bewegte seine Füße und merkte, dass sie taub geworden waren.
»Sieh mal!«, rief Papa. »Da ist der Leuchtturm von Dahmeshöved.«
Lars wusste nicht, was das bedeutete. Aber sein Vater lachte.
»Nun schau doch! Das Licht der Freiheit!«, rief er noch einmal, und Lars drehte den Kopf zur Seite. Er erkannte ein winziges Leuchten, das gleich wieder verschwand. Dann war es wieder da. Dann wieder weg.
»Wie lange noch?«, fragte er.
»Halt durch! Ist nicht mehr weit«, erwiderte der Vater prustend.
Plötzlich bemerkte Lars das Brummen. Es kam schnell näher. Stumm sah er seinen Vater an.
»Eine Motorjacht«, rief der. »Das sind Dänen! Lars, wir haben es geschafft! Sie haben uns gesehen! Hilfe! Hierher! Hier sind wir!«
Lars erkannte an den Lichtern, dass es keine Dänen waren. Es war die Bremse. Sie kam immer näher und blendete ihn. Er schloss die Augen. Die Tränen drückten von innen gegen seine geschlossenen Augenlider. Wo war Mama? Sein Körper fühlte sich kalt und taub an. Die Hand tat immer noch weh. Das Brummen der Bremse war jetzt überall. Unter ihm, über ihm, vor ihm. Sein Vater schrie, aber Lars verstand kein Wort.
Dann wurde alles schwarz.
1. Kapitel
Dahmeshöved, März 2019
Als der Professor die Plane beiseiteschob, schleuderte ihm ein Windstoß zur Begrüßung eine Handvoll Nieselregen in den zerzausten Bart. Mit schläfrigen Augen blinzelte er zum Leuchtturm hoch. Wie eine riesige Schachfigur erhob sich das Licht der Freiheit in ein graues Wolkengebirge hinein. Warum hatten sie dem Turm nur sein rot-weißes Kleid ausgezogen? Diese nackten Klinkersteine sahen auch nach so vielen Jahren immer noch beschämend aus. Das konnte selbst die putzige rote Pudelmütze nicht wettmachen.
Als der Blick des alten Mannes vom Leuchtfeuer zur Straße wanderte, schnalzte er mit der Zunge. Die Verheerungen des nächtlichen Sturms konnten sich sehen lassen. Die Äste, die der Wind den Bäumen ausgerissen hatte, lagen wie Leichenteile nach einem Attentat kreuz und quer auf der schmalen Leuchtturmstraße verstreut. Ansonsten ließ sich kein größerer Schaden erkennen. Hauptsache, die Planen seines mietfreien Souterrains hatten gehalten! Der Professor hatte sie neben dem halbfertigen Rohbau zwischen zwei Sanddornsträuchern aufgespannt. Die Baustelle, in der er sich eingenistet hatte, gehörte Knut Petersen, der hier ein Spa hinpflanzen wollte. Gegenüber vom Leuchtturm und direkt neben der Eltern-Kind-Klinik.
Bis auf das Leuchtfeuer selbst hatte der Petersen hier fast alles aufgekauft: beide Nebengebäude, den kleineren Beobachtungsturm, das dazugehörige Land und die großen Grundstücke südlich und östlich des Turms. Vor einem Jahr hatte eine Hamburger Baufirma damit begonnen, das Fundament für das Hotel zu setzen und die Grundmauern hochzuziehen. Kurz darauf war die ganze Sache dann ins Stocken geraten, und niemand wusste, warum. Auch nicht die rumänischen Bauarbeiter, die ab und an vorbeikamen und dem Professor ein Mittagessen hinstellten. Gute Leute, die ihm wohlgesonnen waren und nicht gleich die Nasen rümpften, wenn er sich ihnen näherte.
Die Petersen-Brüder, die in der umgebauten Scheune direkt hinter dem Leuchtturm von Dahmeshöved verkehrten, sprangen da schon unsanfter mit ihm um. Ihnen gefiel es nicht, dass ihr Vater einen Penner auf seinem Grund und Boden campieren ließ. Der jüngste Sohn Bjarne kam fast täglich nach Dahmeshöved, um an seiner Jacht zu basteln. Eine alte Uecker Fahrensmann, die mittlerweile ganz passabel aussah, davon hatte der Professor sich bereits überzeugen können. Angeblich wollten Vater und Sohn den Umbau noch in diesem Frühjahr abschließen. Es stand ein großer Segeltörn an.
»Guck mal, wer da kommt!«, ertönte plötzlich eine schrille Stimme von der schmalen Straße her. Sie gehörte Ansgar Petersen, der gelegentlich nach Dahmeshöved kam, um sich bei seinem kleinen Bruder Bjarne mit Barem zu versorgen.
»Moin!«, grüßte ein sinistrer Bariton zurück. Wenn das mal nicht der alte Hansen war, dachte der Professor und streckte seinen Kopf unter der Plane hervor. Vorn, an der Straße, erspähte er das lange Elend Ansgar und Opa Hansen mit seinem Enkel Hendrik. Wurde ja ein richtiger Menschenauflauf. Und das bei dem Schietwetter!
»Wie geht es Hendrik?«, erkundigte sich Ansgar mit von Spott triefender Stimme. »Trägt er immer noch Windeln?«
Von seinem Unterschlupf aus sah der Professor, dass der Alte grußlos in einiger Entfernung stehen geblieben war und auf den Jungen starrte, der am Wegrand saß und unverständliche Laute von sich gab. Der Professor wusste, dass der Hendrik schon zwölf Lenze zählte, aber im Kopf gut zehn hinterherhinkte.
»Kümmere dich um deinen eigenen Kram!«, fuhr Hansen Ansgar an. Passend dazu brachte eine Böe sein weißes Haar in Abwehrstellung, während Hansens Gesicht so aussah, als wollte es der Steilküste von Heiligenhafen Konkurrenz machen.
»Guck ihn dir doch mal an!«, spottete Ansgar weiter und verschränkte die dünnen Arme vor der Brust. »Er frisst Gras.«
Hendrik hatte plötzlich damit begonnen, büschelweise Gras auszureißen und es sich in den Mund zu stopfen. Nur mit Mühe konnte Opa Hansen die Hände des Jungen aufbiegen und sie von dem Grünzeug befreien. »Lass das, Hendrik!«
»Wir haben hinter dem Haus noch eine Wiese«, rief Ansgar zu ihm hinüber und grinste.
Doch Hansen achtete nicht auf ihn, sondern zog seinen widerspenstigen Enkel vom Boden hoch und machte, dass er weiterkam.
Während sie in der Kurve verschwanden, trottete Ansgar gemächlich in Richtung Scheune. »Bjarne, du alter Sack! Komm gefälligst raus!«, rief er nach seinem Bruder. Dann schlüpfte er durch die Hecke am Ende des Grundstücks, überquerte den schmalen Weg und verschwand in der grün verkleideten Werkstatt.
Kurz darauf ertönte ein markerschütternder Schrei.
»Was ist denn nun los?«, flüsterte der Professor, der seine Behausung mittlerweile verlassen hatte und erstaunt dabei zusah, wie Ansgar mit blassem Gesicht aus der Werkstatt gestürmt kam und wie ein leckgeschlagener Einmaster bei heftigem Seegang über die Leuchtturmstraße schaukelte. Ansgars Blick wanderte nervös umher und landete schließlich auf seinen eigenen Händen, die mit roter Farbe beschmiert waren. Fahrig wischte er sich die Finger an seiner Hose ab, klaubte sein Telefon aus der Tasche und wählte eine Nummer.
»Ole! Hier ist was passiert! Du musst unbedingt kommen!«, brüllte er in sein Handy und begann plötzlich, in Richtung Dahme zu laufen.
Jetzt erkannte der Professor auch, dass das Rote an seinen Händen keine Farbe war. Sondern Blut.
2. Kapitel
Oberkommissarin Frida Beck saß im Büro der Mordkommission Lübeck und starrte auf ein ballistisches Gutachten, das mehrere Monate in der untersten Schublade ihres Schreibtischs gelegen hatte. Der Text verschwamm vor ihren Augen, und nur vereinzelt drangen die Wörter wie Projektile über die Netzhaut in ihr Gehirn: Makarow, Schussbahn, Schädelknochen. Sie schaffte es nicht, auch nur einen vollständigen Satz aus dem Bericht zu behalten. Es tat zu weh.
Jemand im Büro rief ihren Namen. Frida schob das Papier unter einen Stapel Akten und hob den Kopf. »Hi, Deniz!«
»Lasse und ich gehen was essen. Kommst du mit?«, fragte der mittelgroße, dunkelhaarige Mann und fuhr sich mit der Hand über den locker sitzenden Bauch. Deniz war einer ihrer Lieblingskollegen in der KI und Lasse war ein Studienfreund von ihm, der erst vor Kurzem nach Lübeck gekommen war. Warum glänzten Deniz’ braune Augen bloß schon wieder so verdächtig? Seit einiger Zeit hatte Frida den Eindruck, dass er sie mit seinem Studienfreund Lasse verbandeln wollte. »Nein, danke. Habe keinen Appetit.«
»Na gut. Dann bis später!«
Sie schätzte Kommissar Deniz Yilmaz aus vielen Gründen. Er besaß eine gute kriminalistische Intuition, glänzte regelmäßig mit ausgefallenen Ermittlungsideen und war humorvoll, wenn er auch mit seinen Witzchen manchmal danebenlag. Dass er den Cupido für sie spielen wollte, nahm sie ihm nicht weiter übel. War sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen.
»Frau Beck?«, ertönte die tiefe Stimme eines Mannes.
Diesmal war es der Erste Hauptkommissar Björnsen, ihr direkter Vorgesetzter in der Mordkommission. Ein bulliger Typ mit rasiertem Schädel, der perfekt in jede US-amerikanische Detektivserie gepasst hätte und dessen Aussehen die bösen Jungs zuverlässig einschüchterte. Bei den Kollegen war er allseits beliebt, und auch Frida fand, dass sie es gut mit ihm getroffen hatte. Er war der einzige Kollege, der sich gelegentliche Machosprüche bei ihr erlauben durfte. Und das hatte was zu heißen.
»Was gibt es?«
»Staatsanwalt Thies hat mich eben angerufen«, erwiderte Björnsen, dessen Mundwinkel sich verdächtig weit nach unten neigten und Frida das Schlimmste befürchten ließen. »Mordermittlungen in Dahme.«
»Und wieso dann so ein Gesicht?«
»Der Fall wird Sie nicht vom Hocker reißen«, entgegnete Björnsen zögerlich. »Sieht mehr nach Unfall aus.«
»Aber das ist nicht alles, oder?«, bohrte Frida nach. Der Vorteil eines glatt rasierten Gesichts war, dass man es gut lesen konnte. Und das zuckende Kinn ihres Vorgesetzten ließ sie misstrauisch werden.
Der Hauptkommissar seufzte. »Das Opfer ist ein Junge, der von seinem Boot zu Tode gedrückt wurde.«
Frida sah sich um. Sämtliche Kollegen waren ausgeflogen. Eine kopflose Leiche aus dem Kanal hielt derzeit große Teile der Mordkommission auf Trab. Blieben nur Deniz, der mit Lasse beim Italiener um die Ecke saß, und sie. Björnsen hatte eigentlich keine Wahl. »Und nun?«
»Das Kind soll wirklich entsetzlich aussehen«, erklärte ihr Vorgesetzter weiter.
»Verstehe«, antwortete Frida. Obwohl Björnsen es nicht ausgesprochen hatte, war ihr klar, dass er sie schonen wollte. In der Mordkommission wurde niemand gezwungen, einen Fall zu übernehmen. »Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie so rücksichtsvoll sind, aber ich würde gern einfach meinen Job machen. Wie alt war der Junge denn?«
»Siebzehn.«
»Also eher ein junger Mann. Kommen Sie! Ich packe das. Erklären Sie mir lieber, warum es Mord sein soll. Ein schrecklicher Anblick allein macht ja noch kein Verbrechen.«
»Stimmt schon«, antwortete Björnsen nachdenklich. »Aber die Kollegen vor Ort sehen das etwas anders.«
Frida wurde erneut stutzig. »In Dahme, sagten Sie? Fällt also in die Zuständigkeit von Oldenburg. Und wenn die Verschwendung personeller Ressourcen nicht so traurig wäre, müsste ich jetzt lachen.«
Allein im letzten Monat hatte der Leiter der Außendienststelle Oldenburg in Holstein die Staatsanwaltschaft Lübeck zweimal dazu gebracht, Mordermittlungen einzuleiten. Im ersten Fall war eine Neunzigjährige in Neukirchen ohne äußere Einwirkung gestürzt und eine Woche darauf im Krankenhaus verstorben. Beim zweiten Fall war ein Fleischerlehrling mit zweieinhalb Promille vom Boot gefallen. Beide Male hatte die rechtsmedizinische Untersuchung die Ermittlungen abrupt beendet.
»Was wissen wir noch?«, erkundigte sich Frida.
»Der Staatsanwalt hat von einem manipulierten Bootslift gesprochen. Klang ziemlich technisch, wenn Sie mich fragen. Ich habe das LKA in Kenntnis gesetzt. Die schicken uns jemanden, der sich damit auskennt.«
»Bootslift?«, fragte Frida. »Wo gibt es denn in Dahme eine Marina?«
»Die Leiche wurde in einer Hobbywerkstatt in Dahmeshöved gefunden«, erklärte Björnsen. »Vater und Sohn sollen dort an der mörderischen Jacht gebastelt haben.«
»Vater und Sohn«, wiederholte Frida. »Hat der Herr Erzeuger da vielleicht ein paar Sicherheitsvorschriften verletzt? Könnte auch was für einen Versicherungsermittler sein, oder?«
»Gut möglich. Im Moment stützen wir uns jedoch auf die Einschätzung der Oldenburger Kollegen, die der Ansicht sind, dass jemand an der Anlage herumgeschraubt hat«, entgegnete Björnsen.
»Was ist mit Zeugen?«
»Sie lassen sich wirklich nicht abhalten, oder?«, erwiderte Björnsen, der langsam seine Meinung zu ändern schien.
»Sie kennen mich doch.«
Mit Mitte dreißig war Frida zwar eine der jüngsten Kommissarinnen hier, aber sie war dafür bekannt, ihre Fälle mit Scharfsinn und einem ausgesprochen harten Schädel zu lösen. Bei den Kollegen war sie mittlerweile respektiert, wenn nicht sogar gefürchtet. Das hatte vor einem Jahr, als sie bei der K1 angefangen hatte, noch ganz anders ausgesehen. Missgünstige Kollegen hatten behauptet, sie sei nur zur Mordkommission gegangen, um ihr persönliches Schicksal zu verarbeiten.
Entsprach das der Wahrheit? Frida hatte keine Ahnung. Sie wusste nur, dass sie ihre Entscheidung noch nicht einen Augenblick bereut hatte.
Eine knappe halbe Stunde später befanden sich Frida und Deniz auf der Bundesstraße Richtung Dahme. Während die triste Märzlandschaft an ihnen vorbeiflog, musste Frida an Elias denken. Er war gern Auto gefahren. Dabei hatte er stundenlang staunend aus dem Fenster sehen können. Die Welt da draußen war ein einziges großes Rätsel für ihn gewesen. Oft hatte er Dinge entdeckt, die Manuel und ihr verborgen geblieben waren. Wenn er jetzt bei ihr gewesen wäre, hätte er sie auf jeden Elefanten und jedes Krokodil aus Wolken aufmerksam gemacht. Jeden Vogel im Wind, jedes Schiff in der Ferne und jede Buhne in der Gischt hätte er sich ganz genau angesehen. Er hätte nach ihren Namen gefragt und sich gewundert, wo sie herkamen und wo sie hinwollten. Er war ein guter Beobachter gewesen. Frida dachte oft an seine Wortschöpfungen, seine Blicke, sein Lachen, wie er etwas in der Hand gehalten und wie er sie umarmt hatte. Sie hatte damit begonnen, ihre Erinnerungen in ein kleines Heft zu schreiben, auf dem »Elias« stand. Manchmal wünschte sie sich, sie wäre eine gute Zeichnerin. Dann hätte sie auch die Gedanken festhalten können, für die sie keine Worte mehr fand.
Bei einem Blick in den Rückspiegel begegneten ihr ihre eigenen rot geränderten grauen Augen, aschblondes Haar, das schlaff um blasse Wangen fiel, Furchen auf der Stirn. Elias hätte sie bestimmt gefragt, ob sie schlecht geschlafen hatte. Sie hätte ihm antworten können, dass die Polizeiarbeit nun mal keine Schönheitskur war. Bösewichte, Nachtschichten und ständige Bereitschaft hinterließen eben ihre Spuren. Was sie ihm nicht hätte sagen können, war, dass sie seinetwegen so abgeschlagen aussah, egal, wie ausgeruht sie war. Weil er nicht mehr da war.
Ein Telefon klingelte. Deniz schaltete die Freisprechanlage ein. Es war Björnsen.
»Wir haben noch ein paar Infos über das Opfer und seine Familie erhalten«, sagte ihr Vorgesetzter.
»Schießen Sie los!«, antwortete Deniz.
»Ich fange mit dem Vater des Toten an«, begann Björnsen seine Ausführungen zu erläutern. »Er heißt Knut Petersen, ist ein großer Investor in der Region, und je länger man sucht, desto mehr findet man über ihn.«
»In was investiert er denn?«, fragte Frida.
»Wohnkomplexe, Hotels, Restaurants und Privatkliniken. Vom Timmendorfer Strand bis Fehmarn«, antwortete Björnsen.
»Warum liegt diese Jacht eigentlich nicht in der Marina Grömitz?«, fragte Deniz dazwischen. »Sondern in einem Schuppen in Dahmeshöved?«
»Weil sie noch an dem Boot gebastelt haben«, entgegnete Björnsen.
»Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich ein Unternehmer dieses Kalibers die Hände mit Antifouling beschmiert«, wandte Frida ein. »Muss wohl so ein Vater-Sohn-Ding sein.«
»Das ist es«, pflichtete Björnsen ihr bei, der selbst zwei Söhne hatte.
»Apropos Schmutz!«, sagte Frida. »Sind irgendwelche Konflikte mit der Obrigkeit bekannt? Ein bisschen Bilanzfälschung oder Steuerhinterziehung vielleicht?«
»Sie sind aber misstrauisch, Frau Beck«, meinte Björnsen. »Trotzdem eine gute Frage. Gegen Petersen wurde vor ein paar Jahren mal wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Verfahren eingestellt. Seitdem gab es nur noch zivilrechtliche Streitigkeiten.«
»Ach ja?«, entgegnete Frida.
»So wie es aussieht, ging es um Grundstücksgrenzen in Dahme und Heiligenhafen. Mehr habe ich noch nicht herausbekommen.«
»Weitere Kinder?«, fragte sie, während sie mit quietschenden Reifen die Abzweigung nach Dahme-Süd nahm.
»Er hat noch einen Sohn. Hört auf den Namen Ansgar. Außerdem gibt es eine Ehefrau namens Lilo Petersen«, antwortete Björnsen.
Dann knackte es in der Leitung. Im Hintergrund war das Meeresrauschen des Polizeifunks zu hören. Jemand gab in stakkatoartigen Sätzen eine Lagebeschreibung durch. Frida nahm vorsichtshalber den Fuß vom Gas. Ein paar Radfahrer kamen zum Stehen und starrten ungläubig auf das lütte Blaulicht auf ihrem Dach.
»Hier kommt gerade ein Funkspruch vom Kollegen Kramer rein, Kripo Oldenburg«, rief Björnsen. »Es gibt einen Verdächtigen, der offenbar vom Tatort geflüchtet ist. Sind Sie schon in Dahme?«
»Jawohl. Wir biegen gerade in die Leuchtturmstraße ein«, erwiderte Frida.
»Stimmen Sie sich über Funk mit dem Kollegen ab«, wies Björnsen sie an.
Frida und Deniz warfen sich einen Blick zu. Man verstand sich. Die Sache war plötzlich in Bewegung geraten. Frida nahm das Funkgerät aus der Halterung.
»Hallo? Ronny Kramer hier!«, meldete sich der Kollege am anderen Ende der Leitung.
»Beck und Yilmaz, Mordkommission Lübeck. Wir hören Sie und fahren gerade in Richtung Leuchtturm.«
»Halten Sie an, sobald Sie linker Hand den Stellplatz für die Wohnmobile sehen«, kommandierte Kramer.
»Schon da!«, rief Frida und stoppte auf der Höhe eines Wohnwagens, vor dem eine Mutter ihre zwei irritiert dreinschauenden Kinder umklammerte.
»Rechts das Feld! Da müssten Sie ihn sehen. Er ist uns gerade über den Zaun entwischt«, ertönte die kratzige Stimme aus dem Gerät. »Ein großer Mann um die zwanzig mit dunkelblondem Haar und grüner Jacke. Wir vermuten, dass es Ansgar Petersen ist, der Bruder des Opfers.«
»Ist er bewaffnet?«, fragte Deniz.
»Nicht bekannt!«
»Da läuft er!«, rief Frida. In ungefähr dreißig Metern Entfernung sprang jemand ungelenk über das Brachfeld. Diese außer Kontrolle geratene Gliederpuppe sollten sie doch einholen können, schoss es ihr durch den Kopf. Dann sah sie den glänzenden Gegenstand in seiner Hand. Was war das?
»Haben jetzt wieder Sichtkontakt«, hörte sie die Stimme aus dem Funkgerät sagen. »Verdächtiger hat eine Stichwaffe.«
»Sieht eher wie eine Verpackung aus«, rief Frida und sprang aus dem Auto. Sie erkannte einen Mann in Zivil auf der anderen Seite des Feldes. Wahrscheinlich einer der Oldenburger Kollegen. Auch der Flüchtige hatte seinen Verfolger erblickt und kam jetzt geradewegs auf Deniz und Frida zugelaufen. Wahrscheinlich ahnte er nicht, dass sie vom gleichen Verein waren und in weniger als zwei Sekunden ihre entsicherten Dienstwaffen auf ihn gerichtet hätten.
»Was hat er vor?«, fragte sie ihren Partner.
»Er geht auf uns los!«, rief Deniz.
»Stehen bleiben! Polizei!«, schrie Frida dem Mann entgegen, doch der ignorierte sie und stürmte weiter.
Am rechten Rand des Feldes tauchte ein Rothaariger auf. Das musste der zweite Oldenburger sein.
»Polizei! Bleiben Sie stehen!«, rief der Rothaarige, während er sich bemühte, über einen Holzzaun zu bouldern. Es war offensichtlich, dass sein letzter Fitnesstest eine Weile her war.
»Jetzt ist er eingekesselt«, stellte Deniz fest.
»Das hat er auch gemerkt«, erwiderte Frida, als sie sah, dass der Fliehende plötzlich die Richtung wechselte. Er stürmte auf das Wäldchen zu, das am südlichen Ende des Feldes lag. Dabei kam der holprige Acker seiner scheinbar beeinträchtigten Grobmotorik nicht gerade entgegen. Der Verdächtige stolperte mehr, als dass er lief.
»So wie der rennt, muss man ja Angst haben, dass er sich selbst verletzt«, sagte Deniz. »Was immer er da bei sich trägt.«
Derweil kämpfte der rothaarige Kollege immer noch mit dem Zaun. Offenbar war er hängen geblieben und zappelte wie ein gigantischer Fuchs auf seiner Lebendfalle.
Was für ein Tollpatsch, dachte Frida. Plötzlich erinnerte sie sich! Diesen Trampel kannte sie doch. Das war Emil Röder aus Kiel! Was trieb der denn hier? Er war ein sehr guter Freund ihres Mannes gewesen. Sie hatten oft gemeinsame Familienausflüge unternommen. Der Kontakt war nach Manuels Tod irgendwann abgebrochen. »Das ist ja der Röder!«
»Ahh!« Die Antwort kam in Form eines verzweifelten Schreis. Frida sah, wie Röder mit weit aufgerissenem Mund eine Art Kopfsprung vom Zaun machte. Dann fiel der Schuss.
»Hilfe!«, brüllte der Verdächtige von der anderen Seite, schleuderte den glänzenden Gegenstand von sich und warf sich flach auf den Boden.
»Das war nur Aluminiumpapier«, sagte Deniz.
»Stimmt«, pflichtete Frida ihm bei und zeigte auf Röder, der reglos vom Zaun hing. »Aber ich befürchte, wir haben gerade ein ganz anderes Problem.«
3. Kapitel
Die ersten Einsatzwagen waren direkt vom Leichenfundort in Dahmeshöved über die Leuchtturmstraße zurückgekommen. Danach waren weitere Fahrzeuge aus Oldenburg, Neustadt und schließlich auch aus Lübeck eingetroffen. Uniformierte aller Couleur steckten ihre Köpfe in den steifen Wind, der von der nahegelegenen Küste herüberwehte. Schutzpolizei, Rettungssanitäter, Spurensicherung, Rechtsmedizin und eine Kompanie Silbermöwen, alle waren da. Die schmale Straße war komplett gesperrt worden. Und mit ihr gleich der Zugang zum Strand, der direkt neben dem kleinen Stellplatz für Wohnmobile lag.
Das Geräusch der Rotorblätter des Rettungshubschraubers mischte sich in das Rauschen der Ostsee. Die Möwen machten eifrig Platz, und Frida blickte dem dicken, weiß-roten Vogel besorgt hinterher. Bei der Zaunakrobatik Röders hatte sich eine Kugel aus seiner Dienstwaffe gelöst und ihn am Oberschenkel getroffen. Niemand hatte sagen können, ob er durchkommen würde. Einen noch schlechteren Start in die Mordermittlungen hätte es nicht geben können.
»Wissen wir schon, was genau dieser Ansgar Petersen bei sich hatte?«, erkundigte sich Deniz.
»So um die zwanzig Gramm Marihuana«, schätzte Frida, die das Päckchen bei der Verhaftung kurz in Augenschein genommen hatte.
»Und deswegen liegt jetzt ein Kollege auf der Intensivstation?« Deniz schüttelte ungläubig den Kopf.
»Die entscheidenden Drogen hat er wohl nicht in seinen Taschen gehabt, sondern in der Blutbahn«, sagte Frida. Die Jahre bei der Drogenfahndung in Kiel hatten ihren Blick für Intoxikationen aller Art geschärft. Und Petersen Junior hatte eindeutig härtere Sachen als ein bisschen Gras intus. »Den können wir erst mal vergessen.«
»Glaubst du, er hat etwas mit dem Tod seines Bruders zu tun?«, fragte Deniz und zeigte auf den Mannschaftswagen, in dem der gefesselte Ansgar saß.
»Du bist gut«, entgegnete Frida. »Wir sind ja noch nicht mal an unserem Tatort angelangt. Allerdings sehe ich eher einen unzurechnungsfähigen Jugendlichen als einen Mörder. Zumindest bis jetzt. Sobald die Kriminaltechnik mit ihm fertig ist, sollen sie ihn nach Lübeck bringen. Dort kann er dann ausnüchtern, bis wir ihm in ein paar Stunden noch mal die Ehre erweisen.«
»Apropos«, bemerkte Deniz und wies auf den Kollegen der Spurensicherung, der geschäftig auf sie zukam.
»Moin«, begrüßte sie der Kommissar. »Bevor Sie zum Leuchtturm aufbrechen, wollte ich Ihnen kurz mitteilen, was wir bei Ansgar Petersen gefunden haben.«
»Tun Sie sich keinen Zwang an«, sagte Frida. Sie hatte gesehen, wie die Kollegen den Verdächtigen mit Luminol besprüht hatten, um unter Schwarzlicht feststellen zu können, ob es sich bei den Flecken auf seiner Kleidung um Blut handelte. Offenbar waren sie fündig geworden.
»Wir haben recht großflächige Blutspuren an Hose, Jacke und Händen festgestellt«, erklärte der Kriminaltechniker.
»Bis wann können Sie sagen, ob es das Blut seines Bruders ist?«, erkundigte sich Frida.
»Spätestens bis morgen früh«, erwiderte der Kollege. »Und jetzt wünsche ich Ihnen beiden starke Nerven. Der Tote vom Leuchtturm soll kein schöner Anblick sein.«
Kein schöner Anblick, wiederholte Frida in Gedanken. Der Mann konnte ja nicht wissen, dass sie die schrecklichsten Bilder ihres Lebens bereits hinter sich hatte. Das blutüberströmte Gesicht Manuels und den zerfetzten Schädel ihres zehnjährigen Jungen würde sie nie wieder aus dem Gedächtnis bekommen. Was sollte da schon noch kommen?
Links der Werkstatt führte ein Weg hinunter zur Küste, rechts davon lag ein Rasen, der erstaunlich gut durch den Winter gekommen war. Davor rankten sich einige Sanddornsträucher, an deren eingetrockneten Früchten sich ein paar Amseln gütlich taten. Der Wind pfiff durch das offene Werkstatttor und mischte dem Ölgeruch noch ein wenig Küstenaroma unter.
Die sieben Meter lange Segeljacht mit dem weinroten Rumpf trug den Namen Fernanda undlag auf einem Haufen zerknickter Stahlstreben, die offensichtlich mal ein Gestell gebildet hatten. Der Mast des Bootes hatte ein Loch in die Gebäudewand geschlagen, und die Bootshebeanlage war auf einer Seite eingestürzt. Am Tor standen ein paar Feuerwehrleute und sahen den Kriminaltechnikern besorgt bei der Arbeit zu.
Langsam wanderte Fridas Blick durch die kleine Halle und stieß auf eine Blutlache, in der eindeutig jemand herumgetrampelt war. Ansgar Petersen? Am Rand des Flecks erblickte sie etwas, das entfernt an einen menschlichen Schädel erinnerte. Sie sah eine Gelfrisur, Gehirnmasse, Gesichtsknochen und Gebissteile. Frida musste an den Wandkalender von Francis Bacon denken, den ihr ihre Schwester Thea zum Geburtstag geschenkt und den sie gleich darauf in einer Schublade vergraben hatte. Die abgedruckten Gemälde hatten sie zu sehr an Tatorte wie diesen erinnert. Francis Bacon war definitiv kein Künstler für mental gesund gebliebene Kriminalbeamte. Und zu denen zählte Frida sich trotz allem immer noch.
Der Körper des jungen Mannes war vom Hals abwärts seltsam verdreht. Er lag mit den Beinen nach oben über einer Querstrebe des Stahlgerüsts. Die weiße Jogginghose, die der Jugendliche trug, war über und über mit Blut befleckt und wies gesäßseitig einen glatten Schnitt auf. Ein Hinweis darauf, dass die Forensikerin bereits eine Temperaturmessung im Rektum vorgenommen hatte, um den Todeszeitpunkt ermitteln zu können. Den höchsten Punkt bildete die Hüfte, bei deren Betrachtung Frida etwas Merkwürdiges auffiel.
»Postmortale Erektion.« Eine weibliche Stimme drang zu ihr.
Frida drehte sich zu der Rechtsmedizinerin um, die auf einmal neben ihr auftauchte. »Guten Tag, Frau Doktor Andreani!«
»Das ist kein Anzeichen von verschwendeter Potenz, sondern schlicht der Position des Körpers geschuldet. Sobald die Leiche bewegt wird, verschwindet die Blutstauung und damit auch diese Beule«, erklärte Andreani. »Moin, Frau Beck.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.