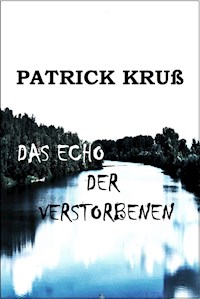Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor zwei Jahren verschwand Penelope Ahrendt spurlos. Nur ihr Bruder Gregor hat sie noch nicht aufgegeben. Während einer Gedenkfeier für Penelope überschlagen sich die Ereignisse und Gregor scheint tatsächlich auf ein erstes Lebenszeichen seiner Schwester zu stoßen. Dabei erinnert er sich an ein Spiel, das sie als Kinder spielten: Gelingt es ihm die hinterlassenen Hinweise richtig zu deuten, wird er Penelope finden. Schon bald gerät Gregor in einen Strudel düsterer und schockierender Geheimnisse. Wem kann er noch vertrauen? Ist Penelope wirklich am Leben oder droht er den Verstand zu verlieren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Kruß
Die lebenden Schatten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die lebenden Schatten
Widmung
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel 1: Gregor
Kapitel 2: Maiah
Kapitel 3: Gregor
Kapitel 4: Maiah
Kapitel 5: Gregor
Kapitel 6: Maiah
Kapitel 7: Gregor
Kapitel 8: Maiah
Kapitel 9: Gregor
Kapitel 10: Maiah
Kapitel 11: Gregor
Kapitel 12: Maiah
Kapitel 13: Gregor
Kapitel 14: Maiah
Kapitel 15: Gregor
Kapitel 16: Maiah
Kapitel 17: Gregor
Kapitel 18: Maiah
Kapitel 19: Gregor
Kapitel 20: Maiah
Kapitel 21: Gregor
Constantins Warnung
ZWEITER TEIL
Penelopes Entscheidung
Kapitel 22: Gregor
Kapitel 23: Maiah
Kapitel 24: Gregor
Kapitel 25: Maiah
Kapitel 26: Gregor
Kapitel 27: Maiah
Kapitel 28: Gregor
Kapitel 29: Maiah
Kapitel 30: Gregor
Theodors Hoffnung
Kapitel 31: Maiah
Fleurs Rettung
DRITTER TEIL
Kapitel 32: Gregor
Kapitel 33: Maiah
Kapitel 34: Gregor
Kapitel 35: Maiah
Philippes Bestimmung
Kapitel 36: Gregor
Kapitel 37: Maiah
Kapitel 38: Gregor
Epilog
Impressum neobooks
Die lebenden Schatten
Impressum
Texte: © Copyright by Patrick KrußUmschlag: © Copyright by Patrick KrußVerlag: Patrick Kruß
Vorarlberger Weg 1879111 Freiburgpatrick [email protected]
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Widmung
Für mein Zuhause. Alle, die meine Wurzeln sind. Und meine Flügel.
Prolog
Als Kinder spielten wir ein Spiel. Vielleicht hat damit alles begonnen. Vielleicht verfolgt es mich deshalb.
Mein Vater ist Wissenschaftler und war über 15 Jahre in ständig wechselnden Projekten und Anstellungen tätig. Sein Fachgebiet ist die biologische Anthropologie und wenn er danach gefragt wird, entbrennt er in einem leidenschaftlichen Vortrag über die Bedeutung seiner zahlreichen Forschungsarbeiten.
Zu jener Zeit zogen wir regelmäßig um. Kaum hatten meine Schwester und ich uns an einem Ort eingelebt, mussten wir uns wieder auf ein neues Zuhause einstellen.
Zuhause. Die Bedeutung dieses Worts war mir, denke ich darüber nach, lange fremd.
Ich lebte in der ständigen Erwartung des Abschieds. Weshalb also sollte ich mich jedes Mal von Neuem darum bemühen, Freunde zu finden? Hatten andere Kinder in meinem Alter ihren festen Freundeskreis, ihren Verein, ihre Clique aus der Nachbarschaft oder einfach gesagt ihre Gefährten, so blieb mir letztlich nur eine Person neben meinen Eltern, auf die ich mich verlassen wollte. Meine Schwester Penelope. Sie ist - oder sollte ich sagen war? - drei Jahre älter als ich.
Ich weiß nicht, ob unsere Eltern es bemerkten, doch entwickelte ich eine Abneigung davor, mich Fremden gegenüber zu öffnen und Bindungen einzugehen. Bindungen, die ohnehin nicht lange hielten und so schnell zerbrachen, wie sie mühevoll geknüpft wurden. Erst als unser ständiges Umziehen endete und wir nicht länger wie Vagabunden lebten, fand ich langsam wieder Sicherheit in Beziehungen zu anderen Personen. In jenen Jahren war meine Schwester alles für mich. Sie stellte meine beste Freundin dar. Meine Seelenverwandte. Musste ich mich gegenüber meinen Eltern erklären, so brauchte ich bei Penelope nicht viele Worte, damit sie mich verstand. Sie sah mir an der Nasenspitze an, wenn es mir nicht gut ging und durchschaute mich sofort, falls ich schwindelte. Sie kümmerte sich um mich, munterte mich auf, stellte mich zur Rede und überzeugte mich von dem Wert der Wahrheit. Und sie spendete mir Zuversicht an den Tagen unserer unzähligen Abschiede.
Kamen wir an einem neuen Ort an, erkundeten wir zu zweit die Umgebung. Wir fühlten uns wie Pioniere auf einer Expedition in unerforschtem Land. Und in unserer Vorstellung fanden sich auf den fremden Straßen der Nachbarschaft zahlreiche Abenteuer, die wir nur gemeinsam bestreiten konnten.
Unser Spiel war - wenn ich es gleich beim Namen nenne - nicht außergewöhnlich. Es war Verstecken. Doch mit den Regeln, die wir uns setzten, war es dennoch etwas Besonderes.
Nelo, so der Spitzname meiner Schwester, war eine Meisterin des Verschwindens. Sie hatte ein Auge dafür, ein Versteck zu wählen, in dem ich sie - und vermutlich auch jeder sonst - nur schwer finden konnte. Ob es im Gestrüpp des Gartens, zwischen den Kleidern eines Wandschranks oder hinter einem Stapel von Kisten auf dem Dachboden war - Nelo entdeckte stets einen Ort, um buchstäblich unsichtbar zu werden.
Es war ziemlich frustrierend, mich ständig geschlagen zu geben. Kam sie aus ihrem Versteck heraus, glaubte ich nur zu oft, mir fielen regelrecht Schuppen von den Augen. Wütend auf mich selbst, stimmte sie mich mit ihrem gütigen Lachen wieder milde und motivierte mich dazu, nicht aufzugeben.
Wie viele Male hatte ich versucht, Nelo zu finden? Manchmal mischte sich meine Mutter ein, aber auch sie musste erst unser Spiel offiziell für beendet erklären, damit Penelope ihr Versteck verließ. Genau vier Wochen nach meinem neunten Geburtstag verriet meine Schwester mir plötzlich ihre spannende Idee. Um mir eine höhere Chance für einen Sieg zu ermöglichen, werde sie mir Hinweise hinterlassen. Kleine Anhaltspunkte, die ich deuten müsse und die - falls ich sie entschlüssele - mich letztlich zu ihrem Versteck führen werden.
„Was meinst du, wollen wir es versuchen?", fragte sie mich erwartungsvoll.
Ich ließ mich überzeugen und so entstand unser Spiel.
„Schließ deine Augen und zähle langsam bis zwanzig."
Ich folgte ihrer Anweisung, doch kaum hatte ich die erste Zahl ausgesprochen, spürte ich ihren warmen Atem an meinem Ohr. Ich lauschte ihrem Flüstern erwartungsvoll.
Der Klang ihrer Stimme hat sich für immer in meiner Erinnerung eingeprägt. Die Worte, die sie in diesem Moment wählte, hallen noch heute in mir nach.
„Finde mich, Gregor. Finde mich."
ERSTER TEIL
Kapitel 1: Gregor
Ich reibe die Daumen aneinander und während ich erzähle, fixiere ich sie mit meinem Blick, so als könnte ich beim Betrachten der Geste Antworten finden.
Die Erinnerung an meine Schwester und an unsere Kindheit - an all die Jahre, in denen es für mich nur uns beide gab - erfüllen mein gesamtes Denken.
Heute ist es schlimmer als sonst. Schlimmer als die Tage, an denen ich mich dazu zwingen muss, nach vorne zu schauen und zurück zu dem zu finden, der ich einst war.
Ich höre, wie mein Gegenüber etwas notiert und sich räuspert.
„Haben Sie eine Vermutung, Gregor, warum Penelopes Worte eine derartige Bedeutung für Sie haben?"
Ich sehe auf und mustere meine Therapeutin Dr. Clara Brunner. Sie trägt eine weiße Bluse, eine sandfarbene, breit geschnittene Hose aus Leinen und mit bunten Edelsteinen verzierte Sandalen. Ihre braunen Haare fallen ihr gestuft über die Schultern. Obwohl zwischen uns fast zwanzig Jahre liegen, finde ich sie attraktiv. Aber daran sollte ich nicht denken und tue es doch gerade deshalb, weil es absolut unpassend ist. Mit ihren dunkelbraunen Augen, die von einer Brille mit dünnem, schwarzen Gestell umrahmt werden, schaut sie mich neugierig an; bereit mit dem Stift in ihrer rechten Hand auf dem Notizblock vor sich meine Aussagen und ihre eigenen Eindrücke hierzu stichwortartig festzuhalten. Bei unserer ersten Sitzung hatte ich mich über ihre Notizen beschwert und erklärt, mich wie bei einem Verhör zu fühlen; besonders, weil Dr. Brunner mir ihre Mitschrift nicht zeigen wird. Nach fast drei Monaten habe ich jedoch ihre Arbeitsweise akzeptiert.
„Bei unserem Spiel", beginne ich nach einem Moment des Überlegens „habe ich stets die Rolle des Suchenden übernommen. Ich war der Geforderte. Penelope verschwand und ich musste sie finden."
„Glauben Sie diese Rolle noch immer inne zu haben?", hängt sich Dr. Brunner an meiner Wortwahl auf.
„Vermutlich ja", stimme ich ihr zu und merke dabei, wie sich mein Körper verkrampft. Eine schmerzliche Erkenntnis gewinnt die Oberhand und ich verschaffe ihr Gehör. „Nach zwei Jahren haben alle aufgegeben. Niemand sucht mehr nach ihr. Die Polizei behauptet zwar das Gegenteil, aber ich bin mir sicher, dass sie kein Interesse mehr daran hat, Penelopes Verschwinden aufzuklären. Und meine Eltern… sie scheinen keine Kraft mehr zu verfügen, um die Suche noch weiter voranzutreiben. Also bleibe nur ich übrig." Ich schlucke und kämpfe durch rapides Blinzeln gegen das Brennen in meinen Augen an.
„In unserem letzen Gespräch haben Sie den Wunsch geäußert, Ihr Studium fortzusetzen. Sie sagten sehr bildhaft, sich von den Fesseln lösen zu wollen, die Sie seit zwei Jahren umspannen. Halten Sie es für möglich, Gregor, dass auch Ihre Eltern ähnlich empfinden und sie deshalb aufgehört haben, Penelope zu suchen?"
Ich hole tief Luft. Dr. Brunner kennt weder meinen Vater noch meine Mutter. Ich könnte ihr natürlich erzählen, in welcher Weise beide mit dem rätselhaften Verschwinden meiner Schwester umgehen, aber genau diesem Verhalten werde ich mich heute Abend stellen müssen und deshalb ziehe ich es vor, so lange wie möglich keinen Gedanken daran zu verschwenden.
„Vielleicht", stimme ich ihr halbherzig zu. Die Wanduhr zu meiner rechten erklingt und kündigt das Ende unserer Sitzung an.
„Wir werden hier das nächste Mal anknüpfen." Dr. Brunner legt Stift und Notizbuch beiseite, steht auf und reicht mir ihre Hand. „Ich weiß, welcher Tag heute ist. Falls Sie spüren, dass Ihre Emotionen und Erinnerungen besonders hohe Wellen schlagen, versuchen Sie sich auf das zu besinnen, was wir in den letzten Wochen zusammen erarbeitet haben. Lassen Sie es eine Art Anker sein."
Ich erwidere Dr. Brunners Geste und bedanke mich. Von der Garderobe nehme ich meine dunkle Lederjacke, die - so wird mir bewusst, als ich nach draußen auf die Straße trete - für die warmen Temperaturen dieses Abends viel zu klobig ist.
Noch zwei Stunden, schießt es mir durch den Kopf, bevor ich zu meinen Eltern muss. Je weniger Zeit mir bleibt, desto stärker wird in mir der Wunsch davonzurennen und mich in die Lüge zu flüchten, dass Penelope noch immer bei uns ist. Dass sie nicht ohne ersichtlichen Grund verschwand und bis heute jede Spur von ihr fehlt.
Wo bist du, Nelo? Geht es dir gut? Was ist damals passiert? Bist du überhaupt noch am Leben?
Die quälenden Fragen in meinem Kopf treiben mich zur Standpauke, dem beliebten Lokal meines Kumpels Leo, in dem ich zwischenzeitlich an den meisten Tagen der Woche Bier zapfe, Kaffee zubereite, Softdrinks ausschenke und Cocktails mixe. Nachdem ich mein kombiniertes Studium des Journalismus und der Medienwirtschaft unterbrochen habe - oder aufgrund meiner damals schlechten Verfassung abbrechen musste - bat mir Leo einen Job an. „Bis du wieder völlig auf den Beinen bist", schlug er mir vor. Ich bin froh, ihn meinen Freund nennen zu dürfen. Er machte sich Sorgen und sah, dass mir jegliche Tagesstruktur fehlte. Nachdem all meine Bemühungen Penelope zu finden gescheitert waren, verkroch ich mich in meiner kleinen Wohnung und ging nur noch hinaus, wenn es unausweichlich war.
Das regelmäßige Arbeiten und die Therapie bei Dr. Brunner haben mir tatsächlich geholfen, mich zu stabilisieren. Aus Sorge, der Zugang zum Alkohol könnte mich noch tiefer ins Verderben stürzen, teilte mich Leo anfangs nur für Schichten am Nachmittag ein, an denen er selbst meistens im Lokal anwesend war und die Gäste Kaffee, Wasser und Limonade bevorzugten. Leo erkannte schnell, dass ich nicht der Typ bin, der seinen Kummer in Hochprozentigem ertränkt - zumindest nicht im beängstigenden Maß - und so wechselten meine Schichten nach und nach auch in den Abend.
Nur heute, an diesem besonderen Tag, sitze ich am Tresen der Standpauke und trinke, während mir Leo von den Hochzeitsvorbereitungen mit seiner Verlobten Ayleen berichtet, einen Whiskey Sour.
„Auf unserer Gästeliste haben wir inzwischen 127 Namen und Ayleen würde gerne noch mehr einladen. Wenn das so weitergeht, muss ich mein Lokal verkaufen, um die Hochzeit bezahlen zu können", scherzt Leo und nippt an seinem Wasser.
„Bei Ayleens sechs Geschwistern nimmt die Verwandtschaft bereits einen großen Teil ein", erinnere ich ihn und schaue kurz auf meine Armbanduhr.
„Entschuldige", kommentiert Leo meine Geste. „Ich weiß eigentlich, dass du gerade keinen Nerv für solche…Lappalien hast."
„Nein, schon in Ordnung", versichere ich. „Jede Ablenkung hilft mir, nicht an die Erinnerungsfeier zu denken."
„Ziemlich bizarr das Ganze", antwortet Leo vorsichtig; den Blick auf das dunkelbraune Holz der Theke gerichtet.
„Sie wollen damit Nelo ehren und die Erinnerung an sie mit allen teilen, für die sie wichtig war." Ich nehme einen großzügigen Schluck meines Longdrinks und verziehe das Gesicht. „Als ob sie jeden ihrer Freunde und Vertrauten kannten. Heute Abend werden hauptsächlich Personen anwesend sein, die meinen Eltern wichtig sind."
„Halten sie es denn inzwischen für die einzige Möglichkeit, dass Penelope…", beginnt Leo eine Frage, deren Ende er eigentlich nicht aussprechen möchte.
„Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht", schneide ich ihm das Wort ab. „Sie haben die Suche nach ihr aufgegeben und wiegen sich - wenn sie eine Emotion zulassen - in dem Selbstmitleid, nach all den Aufrufen, den Vermisstenanzeigen, dem Vertrauen auf die Polizei und dem Einschalten der Presse, nichts mehr unternehmen zu können. Ich bin der Einzige aus unserer kleinen und einst so perfekten Familie, der Nelo weiterhin zu finden versucht. Oder der vielleicht glaubt, dass sie am Leben ist."
Leo weiß, dass auch all meine Bemühungen umsonst geblieben sind. Meine eigenen Recherchen verliefen genauso im Sand wie die Untersuchungen der Polizei. Niemand von uns konnte auch nur annähernd einen Grund erkennen, der Penelope dazu gebracht hätte, aus freien Stücken zu verschwinden.
Meine Schwester war glücklich, da bin ich mir sicher. Sie studierte Medizin, war beliebt, pflegte zu meinen Eltern und zu mir ein inniges Verhältnis und hatte einen Freund, den ich zwar nicht leiden kann, was jedoch unerheblich ist. Sie war eine hilfsbereite, fröhliche, optimistische und ausgeglichene 27jährige Frau.
Welches Motiv hätte sie also dazu gebracht, zu verschwinden?
Die Ermittler nahmen das Leben meiner Schwester unter ihr Sezierbesteck und setzten ihr Skalpell an jedem Detail an, das sie in Erfahrung brachten. Sie überprüften ihre Kreditkartenabrechnungen und Telefonate, durchstöberten ihre Emails und ihre Konten bei den gängigen sozialen Netzwerken. Befragten Familie, Freunde, Angehörige, Studienkollegen, Mitbewohner, Nachbarn. Aber sie entdeckten nichts. Wurde sie demnach das Opfer eines Gewaltverbrechens? Liegen ihre Knochen, die Überreste ihres geschändeten Körpers, irgendwo vergraben?
Penelope befand sich auf dem Nachhauseweg von ihrer Uni zu der Wohngemeinschaft, in der sie ein Zimmer bezog. Die Polizei fand, selbst als sie die letzten Stunden, an denen meine Schwester nach Zeugenaussagen gesehen wurde, rekonstruierten, keine Anhaltspunkte für eine gewaltsame Entführung.
Bei dem Gedanken, dass Nelo wie ausgelöscht wirkt, beginnt sich in mir eine eisige Kälte auszubreiten und gleichzeitig kämpfe ich gegen den Brechreiz an, der sich durch die Luftröhre hinauf in meinen Mund zieht.
Dr. Brunner hat mich darum gebeten, an unsere Gespräche zu denken. An die Möglichkeiten, die wir gemeinsam erarbeiten, damit ich nach vorne sehen und Penelopes Verschwinden als ein geschehenes Ereignis akzeptieren kann. Möglichkeiten, wie etwa das Wissen, dass sich meine Schwester für mich eine glückliche Zukunft wünschte. Penelope wollte für mich immer das Beste und nahm Anteil an den Höhen und Tiefen, die ich während meiner Schulzeit und zuletzt meines Studiums zu meistern hatte. Sie war für mich da, als mich vier Jungs die gesamte neunte Klasse über auf dem Kieker hatten und mich bei jeder erdenklichen Gelegenheit wegen meiner damals kinnlangen, schwarz gefärbten Haare als Tunte, Transe oder Emo-Schwuchtel beschimpften. Sie unterstützte mich bei der Frage, was ich mir für meine berufliche Zukunft wünsche und ermutigte mich dazu, mein Interesse an Journalismus zu verfolgen. Und sie gab mir Halt, als die langjährige Beziehung mit meiner Freundin Julia zerbrach, nachdem diese sich dazu entschieden hatte, in Valencia zu leben und ich es mir - nach all den Umzügen meiner Kindheit - nicht vorstellen konnte, abermals alles hinter mir zu lassen. Ich fokussiere mich auf die Annahme, dass ich keinen Einfluss auf die Geschichte meiner Schwester nehmen konnte - egal, ob ihr Verschwinden aus freien Stücken geschah oder sie Opfer eines Verbrechens wurde.
Ich weiß zwar, dass ich damit nur ein Kartenhaus errichte und ein kleiner Windhauch genügen wird, um das fragile Konstrukt wieder zum Einsturz zu bringen. Doch für diesen Moment finde ich dadurch zur Ruhe zurück. Während sich meine Körperhaltung entspannt und ich leise im langsamen Rhythmus tief ein- und ausatme, bemerke ich, wie Leo mich sorgenvoll ansieht.
„Schaffst du das nachher?", fragt er. „Wenn es dir schlecht gehen sollte, melde dich bei mir. Du brauchst heute auch nicht alleine bleiben und kannst gerne bei Ayleen und mir übernachten."
„Danke", beteuere ich einsilbig und versuche dennoch damit zum Ausdruck zu bringen, wie sehr ich sein Angebot schätze. „Ich denke, ich komme klar. Meine Eltern erwarten ziemlich viele Gäste. Sicherlich fällt es ihnen nicht auf, wenn ich nach zwei oder drei Stunden wieder verschwinde." Ich trinke den letzten Rest Whiskey Sour, stelle das Glas mit Nachdruck auf die Theke und zeige mich entschlossen. „Schätze, es wird Zeit."
Das Haus meiner Eltern Theodor und Marietta Ahrendt steht in einer der noblen Gegenden der Stadt. Umrahmt von Rasen, hellgrauem Kies und hoch gewachsenen Bäumen, liegt es hinter einem kunstvoll aus dunkelgrauem Eisen gefertigten Zaun. Wahrlich verdient es den Titel Stadtvilla. Bevor meine Eltern das Anwesen kauften, gehörte es einer Gräfin, die es hauptsächlich für Aufenthalte während des Sommers nutzte und die Wintermonate auf Teneriffa verbrachte. Nach ihrem Tod stand es lange leer und durch seine Beziehungen erhielt mein Vater schließlich den Zuschlag. Ich war damals fünfzehn Jahre alt, als wir hier ankamen und erfuhr, dass es unser letzter Umzug sein wird. Zunächst wollte ich das Wort meiner Eltern nicht für bare Münze nehmen und erst als mein Vater die Festanstellung an einem großen pharmazeutischen Institut annahm, fasste ich Vertrauen darin, dass wir hier wirklich Wurzeln schlagen würden.
Ich laufe über den knirschenden Kies und bleibe, bevor ich die wenigen Stufen zur Haustür hinaufnehme, kurz stehen. Durch die geöffneten Fenster dringt ein Meer aus Stimmen hinaus ins Freie und ich vermute, dass ich sicherlich einer der letzten Gäste bin, die meine Eltern zu Erinnerungsfeier für Penelope eingeladen haben. Mein Gefühl drängt mich dazu, umzudrehen und mich nicht dem hinzugeben, was meine Eltern aus dem Verschwinden meiner Schwester zu konstruieren versuchen. Sie möchten der Welt und sich vermitteln, dass trotz des gravierenden Verlusts, den wir zu erleiden hatten, all die schönen Erinnerungen an Penelope überlebt haben und in unseren Herzen für immer verweilen. Und dass wir - wenn wir Penelope auch nie aufgeben werden - unser Leben fortführen. Es ist eine einzige Lüge. Beide verdrängen ihre wahren Empfindungen und sind nicht dazu fähig, sich dem unerklärlichen Schicksal meiner Schwester zu stellen. Der Einzige aus meiner Familie, der sich zu einer Therapie entschlossen hat, bin ich. Dr. Brunner hat mir bereits mehrmals angeboten, meine Eltern zu einem Termin einzuladen, doch lehnen beide es vehement ab, mich zu begleiten. Stattdessen flüchtet sich mein inzwischen pensionierter Vater in Vorträge an Universitäten und Krankenhäusern und meine Mutter in dem Organisieren von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Und während mein Vater aufgrund seiner Vorträge regelmäßig verreist und dadurch jeden Gedanken an Penelope ignorieren kann, bedient sich meine Mutter gerne an dem gewaltigen Vorrat erlesenem Rotwein im Keller.
„Zieh das jetzt durch", ermahne ich mich selbst und gehe den Rest zur Hautür. Schon möchte ich klingeln, da öffnet sich die Tür und ich schaue in die prüfenden, blaugrauen Augen meines Vaters.
„Gregor, da bist du ja. Ich habe dich gerade eben entdeckt", deutet mein Vater mit dem Kinn in Richtung des Esszimmers, von dem er mich aus in der Einfahrt stehend bemerkt hat. Unter einem dunkelblauen Jackett trägt er ein schlichtes weißes Hemd und dazu eine passende dunkelblaue Stoffhose. Seinem modischen Kleidungsstil und noch vollem, rotbraunen Haar verdankt er, dass viele ihn weitaus jünger schätzen als Mitte sechzig.
„Hallo Papa", begrüße ich ihn, lasse die Berührung seiner Hand auf meiner Schulter - eine schwache Geste des Willkommens - zu und hänge meine Jacke an die Garderobe.
„Es sind fast alle hier. Komm, begrüß deine Mutter. Sie steht bei ihren Freundinnen im Wohnzimmer."
Vater schiebt mich vor sich her, bis ich an der Schwelle zum Wohnzimmer stehe und er im Kreis seiner Kommilitonen, ebenfalls langjährige Freunde, in eine rege Diskussion aus Fachjargon einsteigt.
Meine Mutter hat ihre dunkelblonden Haare zu einem Dutt nach oben gesteckt. Sie trägt ein zur Garderobe meines Vaters passendes Cocktailkleid und ihre geliebte Perlenkette; ein Erbstück meiner Großmutter. Bereits meine Ankunft auf der Erinnerungsfeier verläuft genauso, wie ich es mir ausgemalt habe. Mein Vater begrüßt mich ohne zu fragen, wie es mir geht. Denn mein Empfinden, so ist er sich bewusst, ist mit dem verbunden, was er so meisterhaft aus seinem Leben drängt. Stattdessen pflegt er lieber belanglose Konversation über belanglose Themen. Meine Mutter lenkt ebenso geschickt die Gespräche zu ihren Gunsten. Aus Höflichkeit wird jede ihrer Freundinnen nur dann über Penelope sprechen, sofern Marietta Ahrendt die Bereitschaft hierfür zeigt. Wenn dies eine Erinnerungsfeier für meine Schwester ist - eine Feier genau an dem Tag platziert, an dem sie vor zwei Jahren verschwand - so obliegt es einzig meinen Eltern, die Erinnerungen heraufzubeschwören, nicht aber den Gästen. Als mich meine Mutter entdeckt, schenkt sie mir ihr bestes Lächeln, entschuldigt sich bei ihren Freundinnen und läuft zu mir herüber. Bevor sie bei mir ist, nippt sie an dem Rotwein ihres fast leeren Glases. Wie viel sie bereits getrunken hat, kann ich nur vermuten.
Meine Mutter umarmt mich kurz und ich rieche den Alkohol in ihrem Atem. Je mehr sie trinkt, desto intensiver versucht sie, höflich zu sein, sich gewählt auszudrücken und ihre Haltung zu wahren. Viele mag sie damit täuschen, aber ich durchschaue ihr Verhalten, weil ich es in den letzten beiden Jahren regelmäßig erlebt habe. Und so, wie mein Vater immer wieder kurz zu uns herüberschaut, hat auch er bereits bemerkt, dass sie nicht mehr ganz nüchtern ist. „Wie schön, dass du hier bist, Gregor", haucht sie in mein Ohr. „Hast du schon etwas gegessen? Im Esszimmer ist eine große Auswahl an Finger Food und Antipasti."
„Gute Idee", stimme ich ihr zu und deute symbolisch auf meinen Bauch. Zumindest kann ich damit meine Zeit totschlagen, denke ich mir und steuere das Buffet an, was meine Mutter bestellt hat. Das Angebot ist riesig und übertrieben. Anstatt unsere Gedanken über Penelope auszutauschen, mache ich mich daran - wie alle anderen Gäste - einen Teller mit Hackbällchen, kleinen Quichetörtchen, Schinkencroissants, Oliven, Käse, Baguette und Spießen aus gegrilltem Fleisch und Gemüse zu beladen. Ich stelle mich damit in die Nische neben dem Klavier meines Vaters, an dem er einst Penelope das Spielen beibrachte, und hoffe unsichtbar zu werden. Ohne Hunger esse ich und sehe dabei zu, wie sich die Anwesenden in ausgelassener Stimmung unterhalten.
Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der bemerkt, wie grotesk diese Feier ist. Theodor und Marietta Ahrendt wollen der Welt deutlich vermitteln, wie stark und optimistisch sie sind. Dass das Leben weitergeht, egal welche Schläge das Schicksal für einen bereithält.
„Gregor!", höre ich jemanden meinen Namen rufen und beuge mich leicht nach vorne, um in Richtung Flur schauen zu können. Meine Stimmung hebt sich etwas, denn tatsächlich finden sich unter den Gästen auch zwei Personen, die Penelope nicht nur flüchtig kannten. Ihre langjährige Freundin Emma und ihre ehemalige Mitbewohnerin Sophie.
Emma läuft eilig auf mich zu, während Sophie sich gleichzeitig neugierig und etwas verlegen im Haus meiner Eltern umsieht.
„Wie geht es dir?", fragt mich Emma, während sie mich umarmt. Ihre langen, kastanienbraunen Haare, fallen glatt über ihre von einem schwarzen Spitzenkleid bedeckten Schultern. Sie verströmen den angenehmen Duft von Kamille und für einen kurzen Moment schließe ich die Augen und inhaliere ihn regelrecht.
„Schau dich um", deute ich mit einer Hand in Richtung des Buffets und der zahlreichen Personen, die darum verteilt stehen „wenn meine Eltern den Preis für Souveränität in Krisen gewinnen wollen, haben sie durch diese Veranstaltung ihren Ehrgeiz bewiesen." Ich lächle bitter und beiße in ein Stück gegrilltes Fleisch.
„Es ist furchtbar", gibt Emma zu und streicht mir über den Arm. „Als Sophie und ich hergekommen sind, dachte ich, wir sind auf einer Cocktailparty der städtischen Schickeria gelandet." Ihre braunen Augen sehen zu mir auf. „Ich hoffe du weißt, dass wir Nelo nicht vergessen… wir brauchen keine Feier, um sie…"
„Schon okay", versichere ich Emma. „Mir ist bewusst, dass für euch diese Veranstaltung nicht notwendig ist." Meine Augen beginnen zu brennen und ich kämpfe gegen den Wunsch an, aufzuschreien.
„Hey", gesellt sich Sophie zu uns. Auch sie umarmt mich kurz. „Ist es falsch zu sagen, dass ich von dem Haus deiner Eltern wirklich begeistert bin? Ich fühle mich wie Aschenputtel, die zu einem Ball darf", gesteht Sophie und Emma und ich lachen kurz.
„Die Feier allein schon ist der reinste Hohn", gebe ich zu. „Du kannst also völlig unbekümmert unpassende Gedanken äußern."
„Penelope hatte nicht erzählt, wie ihr beide aufgewachsen seid… ich meine, in was für einer Villa", verrät Sophie.
„Vermutlich war es für sie nicht wichtig, zumal sie bereits Ende siebzehn war, als wir hierherzogen. Nelo war niemals darauf aus, ein Leben mit erlesenem Komfort und überzogenem Wohlstand zu führen. Sie hatte andere Ziele, die nichts mit Reichtum zu tun hatten. Ich bin mir sicher, ihr gefiel das Leben in eurer WG weitaus besser als in den Zimmern dieses Hauses."
„Aus diesem Grund wollte sie auch Ärztin werden", stimmt Emma mir zu. „Um anderen zu helfen. Darin sah sie ihre Aufgabe; ihre Bestimmung."
Wir sprechen in der Vergangenheit über sie, schießt es mir durch den Kopf. Jedes Wort klingt so, als liege Penelope in einem Grab. Ich mustere Emma und Sophie und auf einmal wirken ihre dunklen Kleider wie die Garderobe für eine Beerdigung. Sie erscheinen damit auf mich genauso fehl am Platz wie die elegant gekleideten Freunde meiner Eltern. Mir wird seltsam heiß unter meiner Haut und ich zupfe am Kragen meines T-Shirts herum, weil ich glaube, der Stoff schnürt mir die Luft ab.
„Wenn ihr beide mich kurz entschuldigt", bahne ich mir den Weg an Emma und Sophie vorbei. Zielstrebig laufe ich auf den Flur zu, um von dort aus hinaus ins Freie zu gelangen. Diese Feier ist schrecklich und ich spüre deutlich, wie jede weitere Minute mir zusetzt.
Mein Blick fokussiert die Klinke der Haustür und als ich nach ihr die Hand ausstrecke, halte ich inne.
Ich schaue zurück und sehe, wie sich mein Vater mit einem Gast unterhält, der offenbar noch nach mir eingetroffen ist. Sofort beginnt Wut in mir aufzukeimen und obwohl ich hätte damit rechnen müssen, bin ich doch fassungslos ihn hier zu sehen. Sebastian Schönbrecht, Penelopes Exfreund und eines der größten Arschlöcher, die ich - so bin ich mir sicher - in meinem Leben kennen lernen durfte, steht in seiner Businessmontur mit gepflegtem Drei-Tage-Bart und modischem Kurzhaarschnitt im Flur und nippt an einem Glas Mineralwasser. Er unterstreicht damit sein Saubermannimage. Meine Eltern sehen in ihm den perfekten Schwiegersohn, doch ist dieser Traum inzwischen geplatzt. Etwa fünf Monate nachdem Penelope verschwand, erschien Sebastian mit einer neuen Frau an seiner Seite in der Standpauke. Ich saß an der Theke und sah schockiert dabei zu, wie er für sich entschieden hatte, nicht länger darauf zu hoffen, Penelope könnte zurückkehren. Sebastian hatte immer wieder betont, wie tief seine Liebe zu meiner Schwester sei. Der Beweis, was Tiefe für ihn bedeutet, hatte er mir an jenem Abend geliefert. Als mich Sebastian bemerkte, schien es ihm unangenehm zu sein, so als hätte ich ein Kind beim Naschen erwischt. Er bezahlte die beiden Longdrinks, winkte mir kurz zu und verließ mit seiner neuen Flamme die Kneipe. Sicherlich fragte sie sich, warum er es plötzlich so eilig hatte, wieder zu gehen.
Noch hat er mich nicht bemerkt. Würde er mich jetzt ansprechen, so bin ich mir sicher für nichts garantieren zu können. Ich schaue hinab und bin selbst erstaunt, wie sehr meine Hände zittern. Ich schätze Sebastian stärker als mich ein, doch zumindest hätte ich das Überraschungsmoment auf meiner Seite, wenn meine Faust aus seiner Nase eine Blutfontäne schießen lässt. Wie würden Theodor und Marietta Ahrendt reagieren, wenn ihr Sohn völlig ausrastet, während sie beide doch so besonnen und vernünftig mit ihrem furchtbaren Schicksal umgehen? Meine Wut auf Sebastian richtet sich ruckartig gegen meine Eltern und dass sie es tatsächlich für notwendig halten, ihn einzuladen. Eilig wende ich mich der Haustür zu, trete hinaus in die milde Nachtluft und erweise uns damit allen einen großen Gefallen. Auf keinen Fall möchte ich mit Sebastian auch nur ein Wort wechseln.
Ich umrunde das Haus und lasse mich im Garten auf einer Bank aus weiß gestrichenem Holz nieder, die vor dem Stamm eines Kirschbaums thront. Hier verstummt das Stimmengewirr völlig und beim Betrachten des Vollmondes und der Milliarden Sterne am Firmament finde ich seit der Ankunft auf der Feier erstmals etwas Ruhe. Lange werde ich mir diese Auszeit nicht gönnen dürfen, denn obwohl sich so viele Gäste im Haus befinden, kreist in mir die Vermutung, dass meine Eltern meine Abwesenheit bemerken und problematisieren werden.
Ich lehne meinen Hinterkopf gegen den Baumstamm und atme mehrmals tief und gleichmäßig ein und aus. Nur einen Moment möchte ich meine Augen schließen, doch als ich sie wieder öffne, hat sich etwas verändert. Der Mond ist weitergewandert. Ich muss eingeschlafen sein und schaue mich irritiert um. Wie lange war ich weggetreten?
Ich strecke meine Arme nach oben und gähne, um damit die restliche Müdigkeit aus meinem Körper zu vertreiben. Als ich aufstehe und zurück zur Erinnerungsfeier möchte, halte ich ruckartig inne. Meine Augen weiten sich und ein Gefühl zwischen Irritation und Zorn beginnt in mir seinen Weg an die Oberfläche zu bahnen.
Aus Penelopes einstigem Zimmer im Obergeschoss dringt durch das geschlossene Fenster ein Lichtschein nach draußen und ich kann die Umrisse einer Gestalt ausmachen, die sich in dem Raum hin- und herbewegt. Wer von den Gästen ist dort oben? Meine Mutter hütet dieses Zimmer wie einen Schrein und eigentlich war ich bisher der Überzeugung, sie würde niemanden außerhalb der Familie den Zugang gewähren. Vielleicht hat der Rotwein ihre Haltung erweichen lassen? Doch weshalb sollte sie plötzlich die unzähligen Erinnerungen, die überall dort oben schlummern, teilen wollen?
Noch immer stehe ich wie angewurzelt im Garten und sehe hinauf zu dem Fenster. Der Schemen läuft in dem Zimmer hastig auf und ab. Sucht die Person etwas? Wer ist dort oben? Ich kann zwar ihre Konturen erkennen, doch bleiben das Gesicht und Details im matten Licht verborgen. Ich bin mir jedoch ganz sicher, dort oben eine Frau zu erkennen.
Plötzlich hält der Schatten inne und sieht - so scheint es - hinaus zu mir in den Garten. Die Person hat mich entdeckt, hat registriert, wie ich sie beobachte. Einem aufgescheuchten Reh gleich verschwindet sie ruckartig aus dem Licht.
Adrenalin beginnt elektrisierend durch meinen Körper zu jagen. Ich muss unbedingt herausfinden, wer dort oben war. So schnell mich meine Füße tragen, stürme ich zur Haustür. Sie ist zu und natürlich habe ich weder einen Schlüssel dabei, noch kann ich mich im Moment daran erinnern, wo meine Eltern einen Zweitschlüssel versteckt haben. In wildem Stakkato hämmere ich auf die Klingel ein, bis mir ein Mann - er muss ein Kommilitone meines Vaters sein - öffnet. Ich schieße an ihm vorbei und die Treppe hinauf ins Obergeschoss, greife nach der Klinke und stelle zu meiner Überraschung fest, dass die aus dunkelbraunem Holz gefertigte Tür verschlossen ist.
„Wie ist das möglich?", frage ich laut. Die Tür ist der einzige Zugang zu den Zimmern im oberen Stock. Haben meine Eltern also doch jemanden eintreten lassen?
Ich renne zurück und halte nach meiner Mutter Ausschau. Die zahlreichen Gäste scheinen plötzlich zu einem regelrechten Dickicht zu verschmelzen und mir die Orientierung zu rauben. Fällt ihnen auf, wie panisch ich wirke? Schweißperlen wandern an meinen Schläfen hinab und die Kleidung klebt regelrecht an meinem Körper.
Ich bin kurz davor, laut nach Marietta Ahrendt zu rufen, als ich sie in der Küche dabei finde, wie sie eine neue Flasche Rotwein entkorkt.
„Gregor, ist alles in Ordnung?" Sie sieht mich irritiert an, während sie an dem Korkenzieher dreht.
„Hast du jemanden in Penelopes Zimmer gelassen?", schießt es unverblümt aus mir heraus.
Mariettas Gesicht wirkt einen Moment wie erstarrt. Mit dieser Frage hat sie auf keinen Fall gerechnet.
„Um Himmelswillen, nein. Weshalb sollte ich unsere Gäste nach oben führen?" Marietta wendet ihren Blick ab und fixiert ihn auf der Weinflasche vor sich.
„Jemand muss dort gewesen sein", halte ich ihr entgegen. „Ich war kurz an der frischen Luft und habe vom Garten gesehen, wie sich jemand in Nelos Zimmer umgesehen hat."
Die Unterlippe meiner Mutter beginnt zu beben. Es ist das deutliche Zeichen, wie sehr sie meine Worte aufwühlen. Doch darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen.
„Die Tür ist verschlossen", antwortet mir Marietta mit gefasster Stimme. Sie hat die Zügel an ihren Emotionen wieder fest im Griff. „Die Einzigen, die neben deinem Vater und mir einen Schlüssel dafür haben, sind du und…"
„Penelope", schneide ich ihr das Wort ab. Mir läuft ein eisiger Schauer über den schweißbedeckten Rücken. Meine Hände suchen Halt an der Arbeitsfläche der Kochinsel. Mit weit aufgerissenen Augen starre ich meine Mutter an, wohl wissend um die Frage, die zwischen uns liegt.
„Das kann nicht sein", wehrt sich meine Mutter und schiebt die Weinflasche von sich.
„Es sind so viele Personen im Haus", deute ich hinter mich. „Und heute ist der Jahrestag ihres Verschwindens. Was, wenn sie unbemerkt…"
„Gregor, es ist GENUG!", fordert Marietta mich mit lauter Stimme dazu auf, meine Gedanken nicht weiter zu formulieren. Ihre Augen funkeln mich zornig an. Aber selbst, wenn sie sich auf mich stürzen würde, wäre es mir im Moment egal.
„Gib mir deinen Schlüssel." Ich strecke ihr demonstrativ meine Hand entgegen. Marietta schüttelt ihren Kopf und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie wirkt wie ein störrisches Kind, das sich absichtlich den Anweisungen seiner Eltern widersetzt.
„GIB MIR DEINEN SCHLÜSSEL!" Meine Worte beben vor Zorn und Marietta zuckt unweigerlich zusammen. Ihre Augen schimmern glasig und auf einmal wird mir bewusst, wie sehr ich sie mit meinem Drängen verletze. Eine Stimme in mir rät, mich zu entschuldigen und Mama in den Arm zu nehmen. Ich mache einen Schritt auf sie zu, da öffnet Marietta eine Schublade und zieht einen Schlüsselbund hervor. Sie fährt sich mit der freien Hand über die Augen und legt den Schlüssel auf die Arbeitsfläche.
„Schließ ab, sobald du mit deiner Geisterjagd fertig bist", entgegnet sie mir mit kühlem Tonfall und verlässt, die offene Weinflasche in der Hand, die Küche.
Für wenige Sekunden sehe ich ihr nach, dann greife ich nach dem Schlüsselbund und stürze durch den Flur hindurch zurück zur Tür am oberen Ende der Treppe.
Meine Hände zittern und nur mit Mühe kann ich den passenden Schlüssel am Bund ausmachen und ins Schloss schieben. Ich drehe ihn zwei Mal nach links, dann öffnet sich die Tür mit einem leisen Knacken und ich kann eintreten.
Völlige Dunkelheit empfängt mich. An der Wand taste ich nach dem Lichtschalter und wenige Sekunden später erhellen mehrere in der Decke eingelassene Spots den Flur, an dessen Ende die früheren Zimmer meiner Schwester und mir liegen. Ich schaue hinter mich, nur um festzustellen, dass die Tür zu dem kleinen Badezimmer auf dieser Etage ebenso geschlossen ist, wie die Luke in der Decke, die hinauf zum Speicher des Hauses führt. Ich lausche in beide Richtungen, kann jedoch kein Geräusch vernehmen. Das Obergeschoss ruht in gespenstischer Stille. Langsam, so als stellt jeder weitere Schritt ein großes Risiko dar, bewege ich mich zu Penelopes Zimmer.
Was, wenn die unbekannte Person noch immer hier oben ist und sich im Zimmer meiner Schwester versteckt hält? Was, wenn sie eine Waffe bei sich hat?
Andere Gedanken mischen sich unter die vermutete Gefahr, auf die ich möglicherweise zusteuere.
Was, wenn ich gleich Penelope treffe?
Was, wenn ich hier plötzlich nach zwei Jahren gegenüberstehe?
Was werde ich tun, was werde ich sie fragen?
Ich spüre, wie mir speiübel wird und ich dagegen ankämpfe, mich zu übergeben.
Vor der Zimmertür halte ich inne. Vorsichtig umschließe ich den Türgriff und in meinem Kopf jagen Bilder der vergangenen Jahre im Zeitraffer umher. Ich, 15 Jahre alt und Penelope, kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag. Wir sitzen in ihrem Zimmer und reden. Wir albern miteinander herum. Wir streiten uns. Wir schenken dem anderen Mut, wenn er am Boden ist. Wir halten zusammen. Wir verbünden uns gegen unsere Eltern. Wir beide.
„Na los", treibe ich mich selbst an und öffne die Tür. Sie schwingt zur Seite und gibt den Blick auf das im Halbdunkel liegende Zimmer frei. Nichts ist zu hören. Ich knipse das Licht an und gehe hinein.
Meine Eltern haben hier nichts verändert. Deshalb wirkt das Zimmer wie der Ausstellungsraum eines Museums. Kurz bevor Penelope verschwand, war sie hier zu Besuch und hatte übernachtet. Wir hatten miteinander über unsere Smartphones Nachrichten ausgetauscht und sie sendete mir ein Photo, wie sie auf ihrem Bett saß und in die Kamera lächelte. Es ist die letzte Aufnahme, die ich von meiner Schwester habe. Sie ist für mich so kostbar.
Nun, da ich niemanden finde, beginnen Zweifel in mir zu wachsen. Habe ich wirklich jemanden gesehen oder hat mir meine Müdigkeit einen Streich gespielt? Hat mich die Hoffnung, Penelope könnte aus dem Nichts auftauchen - genau zwei Jahre nach ihrem Verschwinden -, fehlgeleitet?
Ich schaue aus dem Fenster hinab in den Garten und bin kurz davor, mir meinen Trugschluss einzugestehen. Erschöpft setze ich mich auf das Bett und vergrabe das Gesicht in meinen Händen.
„Was bin ich nur für ein Idiot", äußere ich laut und mir wird bewusst, welch langer Weg noch vor mir liegt, bis ich meine Therapie bei Dr. Brunner beenden kann.
Ich richte mich auf und entscheide mich zurück ins Erdgeschoss zu gehen. Vielleicht bietet sich mir eine Chance, die Feier zu verlassen. Meiner Mutter kann ich jetzt unmöglich erneut unter die Augen treten.
An der Türschwelle halte ich abrupt inne. Ich atme tief ein und auf einmal kehrt die Gewissheit zurück, dass ich mich nicht getäuscht habe. Jemand war hier oben. Wie erstarrt, heftet sich mein Blick in Richtung des Fensters.
Warum habe ich es nicht gleich bemerkt?
Dabei ist er unverkennbar. Der Duft von Penelopes Parfüm erfüllt das gesamte Zimmer.
Kapitel 2: Maiah
Ich sehe mein Spiegelbild. Sehe die Frau, mit den kinnlangen, braunen Haaren und den hellblauen Augen. Sehe das Netz aus kleinen Sommersprossen, das über meinen Nasenflügeln liegt. Sehe die helle, leicht rosige Haut und die Narbe an meiner rechten Wange, die ich dem Schnitt einer Glasscherbe schulde. Sehe meine vollen Lippen, die schon manchen Mann zu einem Kuss verführen wollten. Und ich sehe meinen drahtigen Körper, der in den letzen Monaten an Gewicht verlor, bevor er sich in diesem mageren Bereich wieder stabilisiert hat. Ich mag schwach wirken, doch habe ich trainiert und bin keine wehrlose junge Frau. Mein Erscheinen täuscht und stellt der einzige Trumpf dar, über den ich verfüge.
„Mein Name ist Maiah Winter", spreche ich laut der Person im Spiegel entgegen. Es ist wichtig, dass ich meinen Namen mindestens zwei Mal am Tag bewusst höre. Er macht meine Existenz, meine Persönlichkeit aus. An ihn ist geknüpft, wer ich und warum ich hier bin. Auf keinen Fall darf ich ihn vergessen. Denn der Ort, an dem ich mich befinde, hat - so wurde mir seit meiner Ankunft ersichtlich - das Potential, die eigene Identität zu rauben. Es ist ein Drahtseilakt, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber ich habe keine andere Wahl, wie mich der Gefahr zu stellen. Ich kann und werde nicht umkehren, bis ich mein Ziel erreicht habe.
Für gewöhnlich verinnerliche ich meinen Namen am Morgen nach dem Aufstehen und - so wie jetzt - in der kurzen Ruhephase vor dem Abendessen. Ich ziehe mir ein weißes T-Shirt und eine graue Strickjacke über und wähle eine dunkle, blickdichte Strumpfhose und einen ebenfalls grauen, knielangen Rock. So trist wie meine Kleidung ist, so farblos fühle ich mich. Jeder, der hier lebt, hält sich an diese reizarme Kleiderordnung, doch im Gegensatz zu mir sehen die anderen in ihr einen Schutz.
Ich öffne die Tür meines mit Tisch, Stuhl, Bett und Bücherregal spartanisch eingerichteten Zimmers und folge dem mild erleuchteten Korridor zur Treppe hinab in die große Empfangshalle im Erdgeschoss. Gemeinsam mit all den anderen Bewohnern nehme ich im Speisesaal Platz. Der Stuhl am Tischende ist noch leer und wir warten in vollkommener Stille.
Die große Flügeltür dahinter öffnet sich und Constantin tritt ein. Er ist, wie so häufig, völlig in weiß gekleidet und seine grauschwarzen Haare sind glatt nach hinten gekämmt. Die oberen beiden Knöpfe seines Hemdes sind offen und geben den Blick auf eine Kette frei, an der ein Medaillon ruht. Constantin trägt sie immer und befindet er sich in Gedanken, streifen seine Finger über die glatte Oberfläche des ovalen Anhängers, in dessen Innerstes er - so bin ich überzeugt - etwas für sich sehr Wertvolles verborgen hält. Es ist eines der zahlreichen Geheimnisse, die diesen Ort umgeben.
Hier lebt die Gemeinschaft; ein Zuhause für gequälte Seelen, die ihrer Vergangenheit entrinnen und ein neue Existenz beginnen möchten. Unter den Bewohnern finden sich Süchtige, Verwahrloste, Opfer von Gewaltverbrechen und Personen, die lange vor sich selbst auf der Flucht waren. Sie alle haben in ihrem Leben Schmerz erfahren und das zumeist auf eine unerträgliche Weise. Kommen sie hier an, so suchen sie einen letzten Ausweg aus der Hölle, in die sie geraten sind. Constantin bietet ihnen eine Zuflucht. Gelingt es ihnen, sich an die Regeln der Gemeinschaft zu halten, dürfen sie bleiben und im Schutz des Refugiums auf eine bessere Zukunft hoffen. Sie alle lieben und ehren ihren Retter Constantin Saarfeld. Er ist alleiniger Erbe des Saarfeld-Imperiums; eines weltweit agierenden Unternehmens, das sich in zahlreichen Branchen einen mächtigen Einfluss erschlossen hat. Die Saarfeld-Gruppe investiert in die Forschung der unterschiedlichsten Bereiche und immer wieder munkeln die bösen Zungen der Presse, dass Constantin selbst bereits den Überblick verloren hat, für was sein Unternehmen eigentlich steht.
Der Gemeinschaft zollt die Öffentlichkeit dagegen kaum Interesse und Constantin nutzt seine gegründete Einrichtung weder, um sich als Wohltäter zu vermarkten, noch um damit Bewunderung für seine Person zu provozieren. Er scheint keinerlei Interesse an Lorbeeren zu haben. Nur einen einzigen Bericht über die Gemeinschaft konnte ich entdecken und in ihm fanden sich kaum Informationen über die Ziele dieser Einrichtung. Vielmehr wurde auf recht plumpe Weise spekuliert, ob Constantin Saarfelds eigene Vergangenheit das Fundament der Gemeinschaft begründet.
Constantin schenkt uns sein Lächeln, während seine moosgrünen Augen jeden am Tisch mit einem freundlichen Blick bedenken. Er tritt an seinen Stuhl, wünscht uns allen einen glücklichen Abend und bittet uns, mit dem Essen zu beginnen. Trotz der Geräusche von Besteck und Tellern und den zahlreichen, leisen Gesprächen ist der Raum weiterhin erfüllt von einer unglaublichen Ruhe.
„Möchtest du auch eine Scheibe Brot?", reißt mich Nicoletta aus meinen Gedanken, die ihren Platz mir gegenüber hat. Ich danke ihr und bediene mich aus dem Brotkorb, den sie mir einladend entgegenstreckt.
Nicoletta wurde von ihrem Vater, einem Alkoholiker, etliche Male verprügelt und fast ihr gesamtes bisheriges Leben gedemütigt. Als sie in der Gemeinschaft aufgenommen wurde, so berichteten mir die anderen, sah sie schrecklich zugerichtet aus und war, durch die jahrelange Strenge und die unzähligen Schläge ihres Vaters, völlig gebrochen. Nun hat sie sich wieder erholt und gewinnt zusehends das Selbstvertrauen zurück, ein wertvoller Mensch zu sein, der es verdient hat, glücklich zu werden.
Jeder am Tisch wäre an seinem eigenen Schicksal zu Grunde gegangen. Und nun sitzen wir alle beisammen, essen unser Abendbrot und genießen die Geborgenheit des Miteinanders.
Ich schmiere mir ein Butterbrot und nehme einen Bissen davon. Als ich kurz zur Seite schaue, bemerke ich, wie Constantin mich beobachtet. Ab und an sucht mich die Überlegung heim, ob er die Gedanken anderer lesen kann. Ich versuche ein kurzes Lächeln und wende mich instinktiv Nicoletta zu. Sie berichtet mir, wie ihre Kräuter, die sie in den Gewächshäusern der Einrichtung anpflanzt, gedeihen. Dabei versuche ich, Interesse zu bekunden und nicht noch einmal in Constantins stechende Augen zu blicken.
In meinem Leben ist mir noch nie ein Mensch begegnet, der über eine vergleichbare Ausstrahlung verfügt. Constantins Erscheinung und nur wenige Worte aus seinem Mund genügen, um einen regelrecht gefangen zu nehmen. Er fasziniert seine Mitmenschen und entfacht in ihnen die Bereitschaft, für ihn durchs Feuer zu gehen.
Auch mir fällt es schwer, sich seinem Bann zu entziehen.
Nach dem Abendessen räumen wir gemeinsam den Tisch ab, waschen das Geschirr und decken bereits für das Frühstück am nächsten Morgen ein. Jeder kennt seine Aufgabe und erfüllt diese mit leidenschaftlichem Pflichtgefühl.
Als ich damit fertig bin, die Stühle am Tisch zurecht zu rücken, läuft Constantin an mir vorbei. Er berührt mich kurz an meiner Schulter und ich drehe mich ihm zu.
„Du wirkst in letzter Zeit sehr nachdenklich, Maiah", richtet er das Wort an mich. „Geht es dir gut? Oder quälen dich deine Erinnerungen wieder?", fragt er mit samtweichem, einfühlsamem Tonfall, während er sich über seine Wange streicht - und zwar genau an der Stelle, an der meine Narbe verläuft.
„Ich habe gute und schlechte Tage", erwidere ich. „Es ist nicht so leicht, sich den Schatten der Vergangenheit zu entledigen."
„Natürlich", stimmt Constantin mir voller Verständnis zu. „Durch unsere gemeinsamen Gespräche konnten wir zusammen schon viel erreichen. Lass uns hieran anknüpfen", schlägt er mir plötzlich vor. Mein Herz beginnt wild gegen meine Brust zu hämmern und ich spüre deutlich, wie sich mein Bauch verkrampft. Dennoch darf ich mir nichts anmerken lassen.
„Das würde mir sicherlich sehr weiterhelfen."
Constantin lächelt mich zuversichtlich an. „Dann sehen wir uns morgen am Spätnachmittag. Ich komme auf dich zu." Bevor er sich verabschiedet, berührt er mich noch einmal an meiner rechten Schulter und massiert mit seinem Daumen sanft den Stoff meiner Strickjacke. „Du wirst deine Erlösung finden."
Ich sehe ihm nach, wie er durch die große Flügeltür verschwindet.
„In der Tat", flüstere ich.
Endlich können sich meine Finger zu zwei Fäusten zusammenziehen.
Ich hasse Constantin Saarfeld aus tiefstem Herzen. Und ich lebe nur noch aus einem einzigen Grund.
Um ihn zu töten.
Kapitel 3: Gregor
Ich zählte bis zwanzig und öffnete meine Augen. Penelope war fort und es war meine Aufgaben, sie zu finden.
Unser Spiel hatte begonnen.
Eine Gänsehaut schlich sich an meinen Armen hinab und ließ die feinen Härchen an ihnen zu Berge stehen. Unter meiner Haut begann es zu kribbeln, so als befänden sich tausende von Ameisen auf Wanderschaft.
Werde ich die Hinweise erkennen, die Penelope mir hinterlassen hat? Werde ich sie deuten können, damit sie mich zu ihr führen?
Aufgeregt sah ich mich um. Ich stand in dem langen Flur im Erdgeschoss und schaute hinüber zu dem Empfangsbereich, in dem unsere Schuhe auf einem breiten Regal aneinandergereiht waren. Tatsächlich waren sie noch nicht in Umzugskartons verpackt. Dabei würden wir morgen bereits zu unserem neuen Zuhause aufbrechen. Ich schob meine wehmütigen Gedanken über unseren Abschied beiseite und wollte ich mich fürs erste nur auf die Suche nach Penelope konzentrieren.
Hatte sich meine Schwester im Haus versteckt oder war sie hinausgerannt? Ich überlegte, ob ich das Geräusch einer sich öffnenden und wieder schließenden Tür vernommen hatte, doch wollte mir meine Erinnerung - war sie auch erst wenige Sekunden alt - nicht weiterhelfen. Ich musterte die Schuhe und auf einmal fiel mir auf, dass Penelopes gelbe Gummistiefel fehlten. Sie hatte das Haus also verlassen. Ich schlüpfte in meine Windjacke, zog mir selbst mein Paar Gummistiefel an und ging ins Freie. Doch wie sollte ich sie nun finden? Wo befand sich der nächste Hinweis, der mir dabei helfen würde?
Ich war erst am Anfang meiner Suche.
Mit geschlossenen Augen inhaliere ich regelrecht den Duft, der mich in seinen Bann zieht und mir das Versprechen gibt, Penelope sei hier gewesen. Unfähig, mich auch nur einen Schritt zu bewegen, knabbere ich an der Frage, was meine Schwester zurück in das Haus unserer Eltern geführt haben könnte. Steckst du in Schwierigkeiten, Nelo? Warum hast du uns verlassen? Was ist mit dir passiert?
Ich öffne die Augen und bemerke, dass sie voller Tränen sind, die in zwei Rinnsalen an meinen Wangen hinabfließen. Der Moment ist so unwirklich und doch so intensiv, dass ich jede Selbstbeherrschung verloren habe und bitterlich weine. Mit den Ärmeln meiner Jacke streife ich mir mehrmals über mein Gesicht und versuche damit, die Fassung wieder zu gewinnen.
Wer wird mir schon glauben, wenn ich von meiner Beobachtung im Garten erzähle und wie ich das Parfüm meiner Schwester erkannt habe? Egal, wem ich davon berichte, wird vermuten, dass ich halluziniere. Und doch pocht mein Verstand darauf, dass ich der Wahrheit auf der Spur bin.
Das Knirschen der Tür im Flur schreckt mich auf. Obwohl es leise war, reicht es aus, um mir zu verraten, dass sich jemand da draußen befindet. Ich halte den Atem an und höre, wie hastige Schritte die Treppe hinabjagen.
Sofort eile ich aus dem Zimmer und sehe, wie die Tür, zuvor durch einen kräftigen Ruck geöffnet, langsam zurückschwingt. Im selben Moment wird mir bewusst, dass sich jemand im Badezimmer versteckt haben muss, denn auch dessen Tür steht nun offen und mein Blick fängt sich in den weißen Fliesen, die das Licht aus dem Flur in milchigem Schimmer reflektieren.
Von dem Instinkt gelenkt, den Eindringling zu fassen, schieße ich regelrecht die Treppe hinab und habe alle Mühe, nicht über meine eigenen Füße zu stürzen und damit das Gleichgewicht zu verlieren.
Im Erdgeschoss angelangt, sehe ich mich irritiert um. Irgendjemand muss die Person identifizieren können, die hier gerade herab gerannt kam - so bin ich zumindest der festen Überzeugung. Doch haben sich alle Gäste im Wohnzimmer versammelt und lauschen den Worten meines Vaters. Niemand hat also bemerkt, wer der Eindringling ist, der sich oben im Zimmer meiner Schwester umgesehen hat. Der Fremde ist verschwunden; er hat das Haus verlassen und ist in den Schutz der Nacht eingetaucht. Ich werde ihn - oder sie - unmöglich verfolgen können.
„…jede Familie hat ihre Bürde und jede davon ist so unterschiedlich wie besonders. Unsere ist es, Penelopes Geschichte anzunehmen und mit ihr zu leben", höre ich Vater sprechen.
Ich verschränke die Hände hinter dem Kopf und versuche mich, die Fingerspitzen tief in meinen Haaren vergraben, selbst zu beruhigen. Mein Blick wandert die Treppe zurück nach oben und ich sehe, wie Licht durch den schmalen Türspalt durchsickert. Mit schweren Schritten kehre ich zurück ins Obergeschoss und wende mich dem Badezimmer - dem Versteck des Eindringlings - zu.
Ich schalte auch hier die Deckenbeleuchtung ein und mustere die wenigen Quadratmeter. War sich die Person dem Risiko bewusst, das sie mit der Wahl ihres Verstecks eingegangen ist? Ich habe zuerst in Penelopes Zimmer nach Spuren des Fremden gesucht, doch genauso hätte ich jeden anderen Raum danach überprüfen können, ob sich der Eindringling irgendwo verborgen hält. Ich ärgere mich über meine Dummheit, dem Impuls, gleich dem Zimmer meiner Schwester die volle Aufmerksamkeit zu schenken, nachgegeben zu haben.
Das Badezimmer liefert mir keine Anhaltspunkte, wer der Fremde ist oder was er gesucht haben könnte. Schon möchte ich umkehren, da sehe ich, wie kleine Wassertropfen den Rand des Waschbeckens säumen. Ich fahre mit den Fingern über das Keramik und mir wird schlagartig bewusst, dass sich der Eindringling hier - wenn auch nur kurz und eilig - gewaschen haben muss. Das Handtuch neben den Armaturen ist feucht und unterhalb des Seifenspenders hat sich eine kleine schmierige Pfütze aus Seifenresten gebildet.
„Was hast du hier oben gewollt?", frage ich mich leise. Und ein anderer Gedanke schließt sich an:
Hast du es gefunden oder wirst du erneut herkommen?
Aus dem Erdgeschoss dringt der Beifall der Gäste nach oben. Offensichtlich hat mein Vater seine Rede über die unermüdliche Zuversicht und Stärke der Familie Ahrendt beendet. Zumindest ist mir dieser miserable, erzwungen emotionale Moment erspart geblieben. Die Gäste verstreuen sich erneut und möglichst unauffällig bahne ich mir meinen Weg zurück in die Küche, wo ich den Schlüsselbund in der Schublade verstaue, aus der meine Mutter ihn zuvor herausgezogen hatte.
„Theodors Worte waren sehr berührend", gibt sich Sebastian hinter mir zu erkennen. Er hat sich ein Glas Sekt geholt und nippt daran.
Ich verschränke die Arme vor der Brust und sehe ihn missbilligend an.
„Ohne Begleitung hier?", ist das Einzige, was ich mit halbwegs beherrschter Stimme herausbringe.
Sebastians Stirn legt sich in Falten und sein Mund formt ein angespanntes Lächeln.
„Das steht also immer noch zwischen uns. Eigentlich sollte es mich nicht überraschen", erwidert er.
„Und das wird auch so bleiben", versichere ich ihm. „Du bist Gast meiner Eltern, es steht mir also nicht zu, dich hinauszuschmeißen. Aber wenn es nach mir gehen würde, hättest du jetzt eine blutige Nase und müsstest deine Überreste vom Kies in der Einfahrt kratzen."
„Seit ich dich kenne, Gregor", scheint Sebastian meine deutliche Drohung zu ignorieren „begleitet mich ein Gedanke. Zuerst hielt ich ihn für eine Einbildung, aber inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, mich nicht zu täuschen." Er stellt sein Sektglas ab, schiebt seine Hände in die Hosentaschen und macht zwei entspannte Schritte auf mich zu. Die Welle an Provokation baut sich meterhoch über mir auf und es bedarf nur noch weniger Worte, um sie zum Brechen zu bringen.
„Du kommst nicht damit klar, dass Männer wie ich es Penelope besorgen durften." Sebastian grinst mich hämisch an. Er glaubt, mich Schach mattgesetzt und unser verbales Gefecht für sich entschieden zu haben. Und tatsächlich, das hat er - denn nun stürze ich mich auf ihn. Meine Faust zielt mitten auf sein Gesicht, doch gelingt es ihm, meinen Schlag abzufangen und mich zur Seite zu stoßen. Ungeschickt gehe ich zu Boden. „Grundgütiger", mischt sich meine Mutter plötzlich ein. Eilig schließt sie die Tür zur Küche; darauf bedacht, dass niemand die begonnene Prügelei bemerkt.
„Sebastian, ist alles in Ordnung?", ist das Erste was Marietta wissen möchte, während ich Halt auf meinen Beinen suche.
„Es tut mir leid", beteuert Sebastian, sein Saubermann-Image pflegend. „Gregor, lass uns die Sache wie vernünftige Männer…"
„Fahr zur Hölle", unterbreche ich Sebastians verlogenes Angebot.
„Es hat keinen Sinn", gesteht Sebastian sich tief durchatmend ein. „Vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt…"
„Auf keinen Fall", stellt sich Marietta wie ein Schutzschild vor ihn. „Gregor, du hast für heute Abend genug Chaos angerichtet."
Fassungslos schaue ich meine Mutter an. Sie hält mich für den Schuldigen. Jenen, der die Konsequenzen für die Eskalation zwischen Sebastian und mir zu tragen hat.
„Verstehe", antworte ich kurz und lasse durch meinen Blick erkennen, wie maßlos enttäuscht ich bin. Marietta sieht mich nicht an, als ich in den Flur trete und in dem Gewirr aus Personen, Stimmen und geheuchelten Empfindungen das Haus verlasse.
Der pulsierende Schmerz in meinem linken Bein, welchen ich meinem misslungenen Angriff auf Sebastian verdanke, begleitet mich über die gekieste Einfahrt zur Straße. An einer Mauer lehne ich mich an und massiere die Stelle, aus der ein heftiges Brennen durch meinen Körper strömt.
Die Erinnerungsfeier für Penelope war sogar noch fürchterlicher als ich vermutet hatte, fasst ein Gedanke in mir die Ereignisse des Abends zusammen. Ich schaue zurück auf das Obergeschoss und Dach meines Elternhauses.
Wer war dort oben? Warst du es, Penelope? Woher wusstest du von der Feier? Wieso gerade heute? Dachtest du, die Vielzahl an Gästen bietet dir die ideale Gelegenheit, dich unerkannt ins Haus zu schleichen? Du bist schließlich begnadet darin, unbemerkt zu bleiben. Wie bei unserem Spiel. Wenn du nicht gefunden werden möchtest, findet dich niemand.
Eine mahnende Stimme durchdringt meine Überlegungen. Ich laufe große Gefahr, meinen Wunsch, Penelope wieder bei mir zu wissen, in die unheimlichen Rätsel dieses Abends zu projizieren. Es kann etliche andere Erklärungen geben und eine davon ist, dass ich mir alles - den Eindringling, Penelopes Parfüm, ja selbst die hastige Flucht des Fremden - nur einbilde und langsam verrückt werde. Selbst die Spuren im Badezimmer können von Mutter oder Vater stammen. Vielleicht hat Marietta, kurz bevor die Gäste kamen, oben nach dem Rechten gesehen und sich die Hände gewaschen?
Wie oft ziehst du dich dorthin zurück, Mutter? Erliegst du, während Vater seine Vorträge als Dozent hält, der Einsamkeit des großen Hauses und sucht in den einstigen Zimmern deiner Kinder Trost? Falls ja, würdest du es zugeben?
„Dir reicht es wohl auch", spricht mich jemand von der Seite an und ich entdecke Sophie. Über ihrem dunklen Kleid trägt sie eine dünne, cremefarbene Jacke, die dem Ton ihrer rosigen Haut und ihren schulterlangen, dunkelblonden Haaren sehr schmeichelt.
„Oh ja", gebe ich zu, ohne Sophie nähere Details für meinen Aufbruch zu geben.
„Ich habe die Rede deiner Eltern durchgehalten. Emma wollte dich suchen, aber ich glaube, sie ist bereits gegangen."
„Wir haben uns wohl verpasst", weiche ich aus, um nicht erklären zu müssen, dass ich auf der Jagd nach einem Schatten war. „Und da ich gerade in eine Prügelei mit Nelos Exfreund geraten bin, hat es meine Mutter für die beste Entscheidung gehalten, mich nach Hause zu schicken."
„Lass mich raten: Sebastian hat dich provoziert? Er ist so unglaublich arrogant und von sich überzeugt. Keiner aus unserer WG hat verstanden, was Nelo in ihm gesehen oder vielmehr wie sie es mit ihm ausgehalten hat. Wenn er etwas kann, dann den Ton angeben, an der richtige Stelle eine Schleimspur hinterlassen und sich gleichermaßen unbeliebt machen. Und insgeheim hat Nelo das gespürt, schließlich wollte sie auch nicht mit ihm zusammenziehen. Obwohl er ihr immer wieder das Angebot machte und sie dazu drängte. Einmal hatte…"
Sophie hält plötzlich inne. Für einen Moment schien sie etwas Wichtiges ergänzen zu wollen.
„Du kannst es mir erzählen", versichere ich ihr und spüre, wie eine angespannte Nervosität in meinen Körper zurückkehrt.
Sophie versucht ein beschwichtigendes Lächeln. „Es ist nichts", behauptet sie. „Um ehrlich zu sein, bin ich gerade voller trüber Gedanken." Sie sieht mich herausfordernd an. „Ich wette, dir geht es ähnlich. Weißt du, was dagegen hilft? Alkohol und Tanzen!"
Ich wirke sichtlich verwundert über ihre Idee. Das Letzte, was mir gerade in den Sinn kommt, ist zu feiern. Und doch scheint es plötzlich wie die einzige Lösung, um dem Sog dieses Abends aus unerklärlichen Geschehnissen und schmerzhaften Erinnerungen zu entkommen.
Sophie und ich teilen uns die Kosten eines Taxis und landen mitten in der Innenstadt. Das Brennen in meinem Bein hat nachgelassen, so als wolle mir mein Körper bestätigen, dass ich der richtigen Entscheidung gefolgt bin. Wir steuern eine Studentenkneipe an, die ab Mitternacht Shots für fünfzig Cent anbietet. Immer wieder bestellen wir uns eine neue Runde Tequila, Schnaps oder Likör und mit jedem Glas verstummen die quälenden Gedanken an Penelopes Verschwinden, an die unheilvollen Befürchtungen und Rätsel mehr und mehr. Es fühlt sich an, als wäre ich betäubt. Ich weiß, dass der Schmerz noch da ist, aber ich kann ihn vorübergehend nicht mehr spüren. Und fürs Erste setze ich alles daran, dass dies zumindest für die weiteren Stunden der Nacht so bleibt.
Sophie und ich beginnen uns zu amüsieren. Sie erzählt mir zahlreich Geschichten aus ihrem Studenten- und WG-Leben. Von Kommilitonen, deren Name ich noch nie gehört habe, aber die von Penelope allesamt begeistert waren. Von Partys mit verrücktem Motto. Von dem kleinen Ort, aus dem sie stammt und wie sie durch ihre Entscheidung zu studieren die Tradition ihrer Familie - allesamt Winzer - durchbrochen hatte. Ich höre zu, frage nach und widme mein gesamtes Interesse Sophies Erzählungen.
Als sich die Kneipe zusehends leert und die Frage Raum einnimmt, nach Hause zu gehen, entscheiden wir uns sofort dagegen und folgen einer Gasse zu einem im Kellergewölbe liegenden Club. Er ist trotz der späten Uhrzeit noch immer bis zum Anschlag mit Tanzenden gefüllt und im Licht wandernder Scheinwerfer und einer langsam rotierenden Discokugel fügen Sophie und ich uns in die Masse aus feiernden und schwitzenden Leibern ein. Aus unsichtbaren Boxen hämmert der wilde Beat zahlreicher Songs unserer Jugend durch den Raum. Beginnt ein neues Lied, so durchfährt immer wieder ein Aufschrei die Menge. Die Euphorie über die Musik ist mitreißend und ich kann mich nicht länger dagegen wehren, es Sophie gleich zu tun und ebenfalls lauthals mitzusingen. Zwischen uns ist nur wenig Raum und während wir uns zur Musik hin- und herbewegen, fangen sich immer wieder unsere Blicke und Sophie lächelt mich selbstbewusst an.
Ein Typ hinter mir stößt mir durch sein wildes Tanzen in den Rücken und mit Mühe kann ich eine Bruchlandung auf Sophie verhindern. Sie lacht, als mein Gesicht auf ihrer rechten Schulter landet und streicht mir über die Wange. Verlegen schaue ich auf und möchte mich entschuldigen, da beginnt sie mich zu küssen.
Ohne weiter zu überlegen, was gerade passiert und ob wir diesen Moment nur dem Alkohol schulden, lasse ich mich darauf ein. Aus den zaghaften Berührungen unserer Lippen wird schnell ein wildes Spiel aus Zungen und wir suchen uns eine freie Stelle jenseits der Tanzfläche. Ich drücke Sophie an die Wand und küsse sie immer wieder. Ihre Hände liegen an dem Bund meiner Jeans und mit den Fingerspitzen fährt sie über die von Schweißperlen bedeckte Haut unter meinem T-Shirt. Ich liebkose ihren Hals und meine rechte Hand streift forsch über ihren Po. Ich spüre, wie Sophie meine Berührungen genießt und ihr warmer, nach Schnaps duftender Atem meine Wange kitzelt.