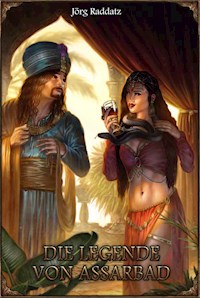
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Spiele
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
"Seid gewarnt vor Assarbad!" So klingt es in den Träumen des aranischen Prinzen Arkos. Doch wer ist die verschleierte Frau, jene Traumgestalt, die diese rätselhafte Warnung überbringt? Und was verbindet den vor Jahrtausenden verschollenen Magiermogul Assarbad mit dem gefürchteten Borbarad, einem anderen Schrecken der Vergangenheit, der bis in unsere Tage wirkt? Prinz Arkos begibt sich auf eine gefahrvolle Queste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ulisses Spiele
Band US25747EPUB
Titelbild: Sebastian Watzlawek
Aventurien-Karte: Daniel Jödemann
Redaktion: Nikolai Hoch
Bearbeitung der Neuauflage: Claudia Waller
Umschlaggestaltung und Illustrationen:Steffen Brand, Matthias Rothenaicher, Nadine Schäkel, Patrick Soeder
Layout und Satz: Matthias Lück, Michael Mingers
Zoe Adamietz, Jörn Aust, Philipp Baas, Mirko Bader, Steffen Brand, Bill Bridges, Simon Burandt, Alina Conard, J-M DeFoggi, Trisha DeFoggi, Carlos Diaz, Nico Dreßen, Christiane Ebrecht, Christian Elsässer, Cora Elsässer, Thomas Engelbert, Simon Flöther, Frauke Forster, Christof Grobelski, Kai Großkordt, Markus Heinen, Nils Herzmann, Nikolai Hoch, Nadine Hoffmann, David Hofmann, Curtis Howard, Jan Hulverscheidt, Nadine Indlekofer, Philipp Jerulank, Kirk Kading, Johannes Kaub, Nele Klumpe, Anke Kühn, Christian Lonsing, Matthias Lück, Julia Metzger, Thomas Michalski, Carolina Möbis, Carsten Moos, Johanna Moos, Phillip Nuss, Dominik Obermaier, Sven Paff, Stefanie Peuser, Felix Pietsch, Marlies Plötz, Markus Plötz, Stephan Pongratz, Elisabeth Raasch, Nadine Schäkel, Maik Schmidt, Ulrich-Alexander Schmidt, Thomas Schwertfeger, Alex Spohr, Anke Steinbacher, Stefan Tannert, Maximilian Thiele, Katharina Wagner, Jan Wagner, Michelle Weniger, W. Gwynn Wettach, Carina Wittrin, Kai Woitczyk
Originalausgabe: Copyright © 1996 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München und Schmidt Spiele + Freizeit GmbH, Eching
Copyright © 2022 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN, UTHURIA und THE DARK EYE sind eingetragene Marken der Ulisses Spiele GmbH, Waldems. Alle Rechte vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Jörg Raddatz
Die Legendevon Assarbad
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Überarbeitete Neuauflage
Prolog
»Da vorn!«
»Er ist bei der Eiche!«
»Dort läuft er!«
Die Jagdgesellschaft hatte ihre Beute erspäht, und so spontan, wie die Hatz begonnen hatte, verteilten sich die Jägerinnen – denn auch ihre Beute zog es fort von der feuerhellen Lichtung, hinein in den nachtdunklen Wald mit seinem Gestrüpp und seinem dichten Unterholz. Das Gelände bot viele Versteckmöglichkeiten, aber es war mit niedrigem Gestrüpp durchwachsen und hinderte am eiligen Vorankommen.
Doch allein eine schnelle Flucht konnte die Jägerinnen um den Erfolg bringen, denn sie waren zu viele und kannten den Wald zu gut, als daß sich irgendjemand oder irgendetwas längere Zeit vor ihnen zu verstecken vermochte. Schon von weitem hörte man das Brechen dürrer Zweige; es war Hochsommer, das Gestrüpp trocken, und die warme Luft trug Geräusche gut durch die Nacht. So nahmen viele die Jagd auch eher als willkommene Abwechslung – eine sanfte Brise hatte die Schwüle des Tages vertrieben, der Duft von Methumian und Lavendel umschmeichelte die Sinne, und bald machten viele Jagdtrupps mit Scherzen und Gelächter mehr Lärm als die Beute.
Unter den vordersten Jägerinnen befand sich eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, deren angespannter Blick das Jagdfieber verriet. Die langen roten Locken nachlässig im Nacken verknotet, streifte sie fast lautlos durch das Gestrüpp und achtete mit keinem Blick auf das seidene Ballkleid, das bei jedem Schritt von den Zweigen und Dornen weiter zerrissen wurde. Niemals weiter als einen Schritt von ihrer Seite weichend, glitt mit geschmeidigen Bewegungen ein ausgewachsener Gepard durch das Unterholz.
Doch inzwischen waren das Knacken und Prasseln verstummt. Anscheinend hatte sich die Beute gut verborgen, und alles schien auf ein langwieriges Abklopfen der Büsche hinauszulaufen. Allmählich ließ der Eifer der Suchenden nach. Einige hatten lauschige Stellen voller betörend duftendem Lavendelkraut entdeckt und stimmten sich lieber unter dem Mondlicht auf die kommende Festlichkeit ein, andere erinnerten sich, daß am Feuer wichtigere Dinge für die Hexenschaft Araniens behandelt wurden als ein unverschämter – und zudem ungeschickter – Späher am Waldrand. Wieder anderen wurde es bald langweilig, und sie kehrten zu ihren Schwestern ans Feuer zurück.
So blieben bald nur noch wenige Jägerinnen im dunklen Wald zurück.
Die junge Rothaarige erblickte die Beute als erste. Der Eindringling hatte sich hinter einem Dornenstrauch zusammengekauert und beobachtete einen Trampelpfad, der unweit seines Verstecks durch den Wald führte. Die Hexe betrachtete ihn mit gekrauster Stirn. Er war noch ein Jüngling, gewiß keinen Tag älter als siebzehn Sommer, und voll ungerechtfertigten Vertrauens in seine Waldläuferkunst.
An nur einer Seite verdeckt, unweit vom vielbenutzten Pfad, sich trotz Dunkelheit mehr auf sein Augenlicht als das Gehör verlassend, würde er selbst der unerfahrensten Jägerin zum Opfer fallen, die des Weges käme. Ohne besondere Mühe glitt die Rothaarige hinter ihn, bis sie seinen Rücken hätte berühren können, und schaute ihm mit angehaltenem Atem über die Schulter.
Tatsächlich näherte sich gerade, eher schlendernd als schleichend, eine weitere Frau der kleinen Lichtung; doch der Späher schien nicht an Rückzug zu denken. Eine lautlose Beschimpfung murmelnd, trat die Jägerin zurück und schleuderte einen Pinienzapfen auf den Weg.
In der Stille klang das Platzen des trockenen Samenkorbs wie berstendes Holz. Schnell und recht gewandt richtete sich der junge Mann auf und floh auf dem Pfad weiter. Diesmal knackte kaum ein dürrer Zweig unter seinen Füßen.
Vom Splittern des Zapfens aufgeschreckt, blickte die Frau hoch: »Ach, du bist es, Mara. Ich dachte schon, ich hätte den Späher erwischt.«
Mara lachte und warf eine rote Strähne in den Nacken. »Wer wollte das nicht, Yashendi? Ein Frevler bei unseren Feiern muß gefunden werden … Aber ich fürchte, da müssen wir noch länger suchen. Hier fallen nur die Äste von den Bäumen.«
»Ach was, das Jagen nach den Männern will ich euch Jüngeren überlassen. Ich selbst habe ihn ja gar nicht gesehen, vermutlich ist er ein häßlicher, dummer Bauernbursche mit einem Gesicht wie eines seiner Schweine.« Lachend wandte die Ältere sich um und kehrte zur Lichtung zurück.
Nun konnte die Jagd ernsthaft beginnen. Der Jüngling war gut und sauber gekleidet gewesen, weit besser als ein Bauer aus dem Umland diesseits des Flusses. Eigentlich gab es nur ein einziges Ziel für ihn, und er würde nicht lange zögern, es anzusteuern. Daß er einen nicht geringen Vorsprung hatte, machte die Jagd nur verlockender.
Es kam wie erwartet: Schon ehe die Oberfläche des Barun-Ulah zwischen den Bäumen zu sehen war, drang das regelmäßige Tappen zweier eiliger Füße herüber. Die Beute hielt geradewegs auf das Ufer des größten aranischen Stroms zu und merkte nicht einmal, daß eine junge Frau mitsamt Gepard ein gutes Dutzend Schritt neben ihm durch den Wald eilte.
Jenseits des Flusses glänzten die Lichter Zorgans in einem weiten Bogen vom Spiegelpalast am nahen Meer bis zu der Zitadelle und spiegelten sich auf den Wellen. Zusammen mit dem Schein des Vollmonds reichte das Licht aus, den Weg des Fliehenden zu erhellen – vom Waldrand hinunter zum Strand, wo die Boote der satuarischen Festgesellschaft lagen und wohl auch sein eigenes Boot vertäut war.
Ein boshaftes Lächeln lag auf Maras Gesicht, als sie den jungen Mann zwischen zwei knorrigen Korkeichen hervortreten sah. Hier am breiten Uferstrand, wo weder Dorngestrüpp noch Bäume im Weg waren, konnte sie ihrem Jagdpardel ein Spiel gönnen – doch fürs erste sollte sich die Beute in Sicherheit wiegen.
Der Späher war noch einige Dutzend Schritt vom Wasser entfernt, als Mara dem Gepard das Zeichen gab.
Einen Atemzug brauchte der junge Mann, um das Geräusch von Pfoten auf Sand zu bemerken, einen weiteren, sich umzudrehen und zu schauen, den dritten, um in hastiges Rennen zu verfallen. Er hatte gerade den Flutstreifen erreicht, als die Raubkatze auf seiner Höhe war.
Geparden schlagen ihre Beute, indem sie sie mit einem raschen Prankenhieb von den Beinen reißen – und so lag der Mann wenig später im Schlick, Kopf und Kehle mit den Armen beschützend.
Erst als der Biß ausblieb, öffnete er vorsichtig die Augen und blickte in das spöttische Gesicht der jungen Hexe. In ihrem zerrissenen Kleid, die kupfernen Haare wirr und zerzaust, die leicht schräggestellten grünen Augen katzenhaft leuchtend, wirkte sie wie ein ungezähmtes und gefährliches Raubtier aus der Wildnis – hier, keine halbe Ruderstunde von der aranischen Fürstenstadt entfernt.
Ihre Stimme aber war die eines jungen Mädchens, hell und rauh zugleich. »Du hast mir eine gute Jagd geboten, Bursche, auch wenn ich dir erst auf die Sprünge helfen mußte …«
»Was habt Ihr mit mir vor? Ich habe nichts getan …!«
Maras Lachen klang spöttisch: »Natürlich wollen wir dich braten und auffressen, Schatz. Für das Einsperren und Mästen fehlt uns leider die Zeit.«
Das Gesicht des jungen Mannes drückte solches Entsetzen aus, daß Mara nur umso mehr lachen mußte. »Unsinn – was hast du für Geschichten gehört? Du wolltest uns besuchen und bist sofort wieder davongestürzt, als wir dich entdeckten. Also wollen wir dich einfach noch einmal näher anschauen.«
Mit einem überraschend kraftvollen Griff half die Hexe dem Jüngling auf die Beine – nicht ohne weiterzuspotten. »Da wir jetzt doch zum Feuer zurückgehen, hättest du dir den Weg besser gar nicht gemacht. Ich habe ja gesehen, daß du nicht gut zu Fuß bist – stolperst über einen faulen alten Kater, der im Weg liegt!« Das wütende Knurren des Geparden entlockte ihr nur ein fröhliches Kichern.
Die schmale Hand auf seine breite Rechte gelegt, führte sie ihn wieder zwischen den Eichen und Zypressen des Waldes hindurch. »Wenn du magst, kannst du ein weiteres Mal ausreißen: Shiko und ich sind noch nicht allzu erschöpft.«
Ohne ein Wort und ohne Fluchtversuch war er ihr gefolgt, und in überraschend kurzer Zeit hatten sie auf dem Pfad wieder die Lichtung erreicht. Das lodernde Feuer war ein wenig heruntergebrannt, und die Debatten über die Zukunft der Schwesternschaften neigten sich dem Ende zu. Jedenfalls hatte eine hochgewachsene Frau mit tiefschwarzem Haar sich bereits erhoben und schlenderte umher, gefolgt von einem halben Dutzend Hexen, die eifrig ihren Worten lauschten.
Jede Hexe des aranischen Zirkels kannte diese Mitschwester von hochadligem Blute, großer magischer Macht, und niemand sann darauf, es sich mit ihr zu verderben – zumal selbst die wildeste Junghexe und das versponnenste Kräutermütterlein wußten, daß die Schwarzhaarige nur noch auf den Tag wartete, da ihr das Amt der Oberen zufallen würde …
Neben der gertenschlanken hohen Gestalt mit dem schönen Tulamidengesicht und den tiefschwarzen Augen, die ohne Zwinkern jede kleine Bewegung zu erfassen schienen, wirkte die zierliche Mara eher wie eine zerzauste Scheunenkatze denn wie ein Raubtier aus dem Wald.
Mit einem huldvollen Lächeln empfing die Adlige sie wie eine Untertanin. »Wen hast du uns denn da mitgebracht, Mara? Den Knaben, der solchen Aufruhr unter den Schwestern erregt hat?«
Die Angesprochene nickte: »Ich habe ihn kurz vor dem Fluß eingefangen, Schwester.« Die fröhliche Ausgelassenheit der anderen Gruppen war hier fehl am Platze – und trotz aller herrschenden Freundschaftlichkeit nannte keine junge Hexe diese Frau beim Vornamen.
Ohne der Jägerin viel Aufmerksamkeit zu schenken, betrachtete die Edeldame den Gefangenen näher – seinen widerspenstigen rotblonden Schopf, das dreckverschmierte sommersprossige Gesicht, die schmutzige, einstmals vornehme Jagdkleidung. Mit knappen, gemessenen Bewegungen streifte die schlanke Gestalt in dem knöchellangen engen Kleid den perlenbesetzten Handschuh ab und begann nachlässig, Fragen zu stellen.
»Du weißt, daß du in ein fürstliches Jagdrevier eingedrungen bist, Junge?«
Der Bursche errötete wie ein ertapptes Kind und schwieg, den Blick auf den Boden gerichtet.
»Wie ist dein Name, Junge?«
Zum ersten Mal schaute er auf. Die Frage schien ihm unverfänglich. »Bernfried.«
»Garethier also?«
»Nein, Aranier.« Seine Miene glättete sich sichtlich.
»Aber garethischer Herkunft«, konstatierte sie. »Die wissen nicht, wo ihr Platz ist.«
Sein empörter Blick sprach Bände, aber auch die umstehenden Hexen warfen sich verwunderte Blicke zu.
Die meisten waren als Frauen, Hexen, Aranierinnen hier und gaben wenig auf die Herkunft oder den Unterschied zwischen den Tulamidya und Garethi Sprechenden.
Doch schon fragte die Schwarzhaarige weiter. »Und was führt dich hierher … Bernfried?«
Nach kurzem Abwägen verzog sich Bernfrieds Mund zu einem trotzigen Grinsen. »Ich wollte schöne Frauen sehen!«
Die strenge Miene der Frau wich einem Lächeln. »Du hattest Grund, hier solche zu erwarten?«
Fast mitleidig schaute der Junge sie an. »Das weiß doch nun wirklich jeder, daß hier in Sommernächten die Hexen nackt ums Feuer tanzen!«
Ehe die vornehme Frau antworten konnte, reagierte Mara voller Spott. »Das ist aber sehr unhöflich, Bursche. Erst kommst du bekleidet zu den erhofften Nackten, und dann versaust du dir deine Kleidung wie ein Selemferkel.«
Zornig über die Unterbrechung, warf die Adlige der jungen Rothaarigen einen frostigen Blick zu. Doch dann erwärmte sich ihre Miene wieder, wie dunkle Glut glomm es in ihren Augen, und erneut lächelte sie. Als sie sprach, lag allerdings Eis in ihrer Stimme. »Hast du nicht gehört, Junge? Zieh dich aus!«
Auf Bernfrieds überraschten Blick hin klopfte sie sich ungeduldig mit dem Handschuh auf die Handfläche. »Worauf wartest du noch? Wir wollen dich nackt sehen.«
Es war nicht nur Angst, daß sein Kehlkopf rasch auf und ab glitt, während er die verschmutze Kleidung abstreifte, und als er nackt vor den Frauen stand, zitterte er nicht nur vor Kälte.
Natürlich hatte die Adlige es bemerkt. »In einer solch schönen Sommernacht ist dir kalt? Dann hast du wohl kaum Erfahrung darin, dich nackt zu zeigen.« Ihr Blick wurde verächtlich. »Hast du überhaupt eine Liebste, Bernfried?«
Der junge Aranier genoß das unverhohlene Starren der Frauen sichtlich. »Eine …? Mit einem halben Dutzend kann ich es schon aufnehmen!«
»Es sieht ganz danach aus. Dann bist du der Hahn im Korb bei euch im Dorf?«
Bernfried schnaubte durch die Nase. »Meine Mutter ist Ritterin auf Gut Dreiweizen bei Zorgan!«
In gespielten Erstaunen riß die vornehme Dame die schwarzen Augen auf und trat einen Schritt näher, so daß nur noch Armeslänge sie von dem nackten Burschen trennte und sein weinschwerer Atem zu ihr herüberwehte. »Ein echter Adelssohn bist du? Der sich mit Ritterlichkeit und Etikette auskennt?«
Mit hochmütigem Gesichtsausdruck, als wolle er auf die größere Frau hinabschauen, lächelte er zustimmend.
Es wirkte locker und verspielt, als sie ihm ihren Handschuh ins Gesicht schlug, doch seine Wange zeigte rotgeränderte helle Striemen im Feuerschein, und in seinen Augen schimmerte es feucht. Hart fuhr sie ihn an: »Und dann weißt du nicht einmal, wie man mit einer aranischen Dame spricht, Garethier?«
Bernfrieds Kehlkopf tanzte, als er antwortete. »Doch.«
Dem zweiten Schlag war anzusehen, welche Härte dahinter lag. »Wie sagt man?«
»Verzeiht …, Herrin.«
Ein kurzes Lächeln erhellte das Gesicht der vornehmen Dame. »Nun also, es ist doch möglich. Wenn du solch ein Rittersöhnchen bist, weißt du ja, daß man als Rondrianer Gehorsam zu lernen hat und Bestrafungen gleichmütig und tapfer erträgt. Ich bin so nett, mit dir für deine Zukunft zu üben. Was sagst du dazu?« Ihr Ton war versöhnlich, fast freundschaftlich, doch das Feuer ihrer schwarzen Augen brannte wieder heiß und ließ nur eine einzige Antwort zu.
»Danke, Herrin.«
Ohne ihn eines weiteren Wortes zu würdigen, schlug sie zu. Die Schläge fielen rasch, aber gezielt, ruhig, aber hart. Als sie schließlich innehielt, ging ihr Atem weiterhin stetig und gemessen, kein Tropfen glänzte auf ihrer Stirn; doch auf des Jungen Gesicht schimmerte Blut und einige Perlen waren vom Handschuh abgerissen. »Was unterstehst du dich? Du hast mit deinem Kopf meinen Handschuh beschädigt. Du wirst jetzt sofort alle Perlen aufsammeln, oder ich verliere die Geduld.«
Stumm schluchzend kniete der nackte Jüngling vor seiner Peinigerin nieder und tastete ziellos durch das Gras. Die Zuschauerinnen warfen sich teils unsichere, teils belustigte Blicke zu. Lächelnd hatte gerade die vornehme Herrin eine Mitschwester Satuarias zu den am Feuer Versammelten geschickt, die alte Amalthea zu suchen, als dort ein vielstimmiger Gesang anhob. Eine Frau mit vollem Blondhaar erhob sich und versuchte sich unauffällig zu entfernen, doch dem scharfen Blick der Adligen war ihr Rückzug nicht entgangen. »Du willst gehen, Aldegund? Gefällt es dir hier nicht?«
Die Angesprochene hielt inne und wandte sich widerstrebend der Sprecherin zu. Zögernd antwortete sie: »Das schon, Schwester, aber das Ritual beginnt, und ich brauche doch Flugsalbe …«
»Ach, Mädchen, traust du unseren Schwestern denn gar nichts zu? Sie werden es schon schaffen, auch für dich ein Tiegelchen mitzubrauen. Und du willst doch nicht etwa unseren Gast verlassen? Nur weil du auch eine hübsche kleine Garethierin bist …?« Der Nachsatz kam wie ein Peitschenhieb.
Sichtbar zuckte die Blonde zusammen und reihte sich still wieder unter die Zuschauerinnen ein.
Wortlos lauschten die Töchter Satuarias dem herüberdringenden Ritualgesang, als die Abgesandte mit der Gesuchten zurückkehrte. Mühsam auf einen knorrigen Stab gestützt, kam diese näher und hatte den Kreis gerade erreicht, als der zitternde Jüngling mit einem Blick voller Angst und Erwartung hochschaute und ein Dutzend Perlen in der schmutzigen Hand vorzeigte. Nachlässig nickte die Dame ihm zu und widmete ihre Aufmerksamkeit dann ganz der alten Frau.
Amalthea war eine Hexe unbekannten, aber weit fortgeschrittenen Alters – und irgendwann hatte sie nach ihrer Jugend, ihrer Schönheit und ihren Zähnen auch ihren klaren Verstand verloren. Doch offenkundig reichte ihre reine Intuition aus, um sie immer wieder zu Hexennächten zu führen, wo sie am Feuer hockte, in unverständlicher Greisensprache mit ihrer Vertrauten murmelte und ein wenig am Essen mummelte, das ihr zugesteckt wurde. Denn jede Tochter Satuarias hatte von ihr gehört und respektierte sie nicht nur wegen ihres hohen Alters, sondern auch aus Angst vor der den Flüchen, die sie in ihrem langen Leben gelernt haben mochte. Doch hinter ihrem Rücken machten sich die jüngeren Hexen so manchen Spaß mit der Greisin, und nun schien es, als solle die gutmütige Alte ein weiteres Mal Werkzeug eines grausamen Spiels werden. Zuerst allerdings wies die Adlige eine Begleiterin an, Amalthea zu einem gemütlichen Sitzplatz zu verhelfen, und wandte sich dann den Zuschauerinnen zu.
»Wir wissen ja alle, daß die Garethier von den Schweinen abstammen. Gib ihnen einen Grund, im Dreck zu wühlen, und sie sind glücklich. Und wenn man ihnen dann noch Perlen vorwirft …«
Mit echtem oder gezwungenem Gelächter antworteten die umstehenden Frauen – nur die fast taube Amalthea gluckste zufrieden vor sich hin und kraulte mit gichtigen Fingern die Warzen ihrer Kröte; die junge Mara aber schaute mit weitaufgerissenen Augen zwischen dem Ritterssohn und seiner Peinigerin hin und her.
Diese fuhr mitleidlos fort: »Wißt ihr, Schwestern, wann sich ein Garethier so richtig freut?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Wenn er ein so viel höheres Geschöpf wie etwa die Kröte unserer ehrenwerten Amalthea küssen darf.«
Während sich Bernfrieds Gesicht vor Ekel verzerrte, ließ sich die verständnislos lächelnde Greisin von der weit jüngeren Edeldame ihre Vertraute aus der Hand nehmen. Auf der behandschuhten Linken hielt die Schwarzhaarige dem zitternden Jüngling das schleim- und warzenbedeckte Tier vors Gesicht, mit dem Zeigefinger der Rechten tippte sie ihm sanft auf die Stirn. »Ich kenne doch deine Art, Garethier. Dein inniger Wunsch ist es doch, deine dreckigen Lippen auf diese schöne Kröte zu drücken.« Ihr Lächeln war süß, und ihre Augen erzählten von unaussprechlichen Strafen, sollte er sich zu widersetzen wagen.
Gehorsam, fast eifrig beugte sich der Knabe vor und küßte das aufgeblähte Hexentier – im nächsten Augenblick schon fuhr er wieder zurück und starrte die Kreatur, deren Gift noch auf seinem Mund glänzte, voller Unglauben und Verzweiflung an, unfähig, den Grund seiner Gefügigkeit ganz zu erfassen.
Mit einer schlangenhaften, glatten Bewegung hatte die Adlige der alten Frau ihre Vertraute zurückgegeben. »Was zu beweisen war, Schwestern. Einer solchen Gelegenheit kann einer wie er nicht widerstehen.« Ein leises Murren klang von den Zuschauerinnen herüber, doch keine Hexe konnte den Blick von dem Schauspiel lösen. Selbst Mara wandte keinen Augenblick lang die funkelnden grünen Augen vom Gesicht der vornehmen Hexe, die ihr Opfer in beißendem Spott lobte. »Brav, brav. Du kannst also, wenn du nur willst.« In seinen Schopf greifend, zog sie Bernfrieds Kopf zu sich und zischte: »Zur Belohnung will ich dir den Wunsch erfüllen, der dich hierhergeführt hat. Du sollst dich einmal mit einer Hexe vergnügen – schau dir dein Liebchen gut an, das dich voller Feuer erwartet …«
Nur die greise Amalthea begriff nicht, daß sie gemeint war, verstand überhaupt nichts von dem Geschehen. Mit leisem Schluchzen und gebrochenem Willen rutschte der nackte Jüngling auf die uralte Hexe zu, als ihn ein scharfer Tadel der Adligen zum Innehalten zwang.
»So – unser garethischer Wilddieb will in fremdem Revier jagen. Eigentlich müßte ihn das die Hand kosten, aber in diesem Fall denke ich, daß sich die Strafe passenderweise auf ein anderes Glied richten sollte.« Mit einer leichten Bewegung der Rechten zog sie das im Flammenschein blitzende Jagdmesser aus der Gürtelscheide und fuhr dann scheinbar in Gedanken fort: »Aber da er so anstellig war, strafen wir ihn nur ein bißchen, so daß er wie ein guter Tulamide aussieht …«
»Ich denke, das reicht jetzt, Schwester!« Eine Jungmädchenstimme hatte gesprochen.
Ein Schlag hätte keine stärkere Wirkung auf dem Antlitz der vornehmen Edeldame hervorrufen können: Das Blut wich ihr aus den braunen Wangen, und die schmalen Lippen verengten sich zu Strichen.
»Es gefällt dir nicht, Mara? Du willst uns auch verlassen wie die kleine Aldegund?« Sie sprach in süßesten Tönen von Wut und Haß, und ihr Gefolge hielt den Atem an.
»Ich komme und gehe, wie es mir beliebt, Schwester«, erwiderte die junge Hexe. »Aber der Junge ist meine Beute, und dein Spaß mit ihm hat länger gedauert, als lustig ist.« Versöhnlich fügte sie hinzu: »Er ist gestraft und eingeschüchtert genug und wird uns so bald nicht mehr beobachten wollen.«
Süß und nachsichtig klang die Stimme der Edeldame, doch das kaltlodernde Feuer in ihren Augen verriet, daß sie kein Mitleid kannte: »Ach, kleine Mara – siehst du nicht, daß der Spaß noch lange weitergehen kann …? Er ist ja noch in der Lage, allein zu knien …«
Das Temperament der wilden Katzenhexe hielt sie nicht mehr an ihrem Platz: Sprungbereit, mit gesträubten Haaren, ein kaum hörbares Grollen in der Kehle, das zerrissene Kleid hochgerafft und die Finger mit den langen Nägeln halb abwehrend, halb drohend erhoben, stand sie zwischen der Peinigerin und ihrem Opfer – ungezügelte Wildheit gegen aristokratische Autorität.
Ohne ein weiteres Wort zu sagen, zwang sie die Edeldame, einen Schritt zurücktreten, doch der Rückzug diente dieser nur dazu, ihre Kräfte neu zu sammeln. »In den alten Zeiten haben sich die Herrscherinnen auch mit ihren Sklaven vergnügt.« Der Triumph der gebildeten Adelsdame sprach aus jedem Wort, jeder Geste.
Den Blick nicht von den schwarzen Augen wendend, schleuderte ihr die kleine Katzenhexe die Worte wie Pfeile entgegen. »In den alten Zeiten haben die Herrscherinnen Sklaven zu ihrem Vergnügen umgebracht, Schwester. Hast du das auch vor?«
Wirkungslos prallte die Frage am eisigen Lächeln der Aristokratin ab. Jeder Spann eine Herrscherin, stand sie da und erwiderte knapp: »Warum nicht, wenn es sich so ergibt? Ist das wichtig?«
Etliche Herzschläge lang maßen sich das grüne und das schwarze Augenpaar – man konnte es nicht in Augenblicken messen, denn keine der beiden zwinkerte –, bis Mara das Duell aufgab und tonlos, fast beiläufig feststellte: »Du bist wahnsinnig, Schwester!« Sie schluckte heftig, und ihre helle Haut wurde weiß wie Schnee, als sie erst einen, dann zwei Schritte zurückwich und gegen den zusammengesunkenen nackten Jungen stieß.
Doch der Bann, der über der Gruppe gelegen hatte, war gebrochen. Wie aus einem fesselnden Traum erwachend, schauten die Schwestern sich um, sannen über das Geschehene, über ihre Anführerin nach, und selbst diese wirkte unsicher, als begreife sie nicht ganz, was sie getan hatte. Um sich die gefährdete Macht über ihr Gefolge zu sichern, führte sie Gründe ins Feld, die in der Schwesternschaft noch nie etwas gezählt hatten. »Und überhaupt steht mir als Hochadliger das verbriefte Recht zu, Übeltäter in Haft zu nehmen und zu verurteilen, wenn keine passende Richterin da ist.« Als ihre kleine Gegnerin nichts antwortete, fügte sie hinzu: »Und das aranische Recht kennt ja nun einmal die Strafsklaverei für Verbrecher!« Noch immer schwieg die junge Katzenhexe, doch ließ sich schwer entscheiden, ob es aus Unsicherheit geschah oder weil sie spürte, daß die Mehrzahl der Schwestern nun auf ihrer Seite war. »Aber davon verstehst du nichts, Mara«, fuhr die Adlige fort, »bist ja nicht einmal in Aranien geboren!«
»Haben wir jetzt eine Regel, die solchem Umstand Bedeutung zumißt? Mir scheint, meine Töchter, ich habe hier etwas versäumt.« Erschrocken vom Ausbruch des heftigen Streits, hatte die greise Amalthea sich wohl schon vor einer Weile unbemerkt abgewandt und das getan, was ein letzter Funken Verstand ihr riet: die Obere geholt, auf daß diese den ersten offenen Streit seit langem in einer aranischen Hexennacht schlichte.
Hastig und aufgewühlt, in ihrer Erregung, die Reihenfolge der Ereignisse durcheinanderbringend, berichtete Mara von der Jagd, erzählte von den Demütigungen, klagte ihre adlige Widersacherin an. Erst als alles erzählt schien, ließ der Wortschwall nach und kam schließlich zum Versiegen.
Die Edeldame hatte schweigend gelauscht, nun wandte die Obere sich an sie: »Und du, meine Tochter, was hast du dazu zu sagen?«
Aristokratisch knapp, sorgfältig ihre Worte setzend, erwiderte die Aranierin: »Die junge Landesfremde besitzt viel Gefühl, hat aber von Ironie bislang wohl nichts gehört. Ich wollte den Eindringling nur einschüchtern.«
»Das ist dir zweifellos gelungen, meine Tochter.« Die Obere wies auf den schluchzenden Bernfried. »Ich denke, wir sollten dafür sorgen, daß seine Anwesenheit keinen weiteren Streit entflammt. Gebt ihm saubere Kleider und etwas Wirksames gegen seine Wunden, dann soll er zu seiner Mutter zurückkehren.«
Der junge Garethier war, frisch eingekleidet, geheilt und von einigen mitleidigen Töchtern Satuarias getröstet, zu seinem Boot verschwunden – doch auch ohne die Anwesenheit des Zankapfels vermochte bei so mancher Beteiligten in dieser Hexennacht keine Feststimmung aufkommen. Während die große Mehrheit der Kräuterfrauen und Heilerinnen sich vergnügt und sinnlich dem Feiern hingab, nun da alle Fragen geklärt, alle Streitigkeiten beigelegt schienen, hockten an mehreren Orten Frauen fast reglos im duftenden Gras, als hätte sie nach heftigem Rausch der Schmerz des Zeitalters ergriffen.
Selbst über die junge Gepardenhexe tuschelten manche, sie habe in vergangenen Jahren weit fröhlicher, weit ausgelassener zu feiern verstanden, und sobald das rote Licht im Osten den Morgen ankündigte, bestieg Mara mit ihrem Vertrauten ein Flußboot, um nach Zorgan zurückzukehren, während viele ihrer Schwestern erschöpft und erregt zugleich noch einige Stunden auf der bei Tageslicht zur prächtigen Blumenwiese erblühenden Lichtung entspannten.
Aus den noch nicht gewichenen Schatten am Waldrand heraus aber starrte eine gertenschlanke große Frau mit langem schwarzem Haar der jungen Hexe nach, die mit ihrem gefleckten Begleiter sprach.
»Es ist nichts vergessen, Schwester Mara. Nichts!«
1. Kapitel
Viele Sommer wurde nun schon gekämpft an der Grenze des Königreichs, und in jedem Jahr hatten die Barbaren aus dem Gebirge ihre Angriffe auf das fruchtbare und reiche Aranien wiederholt. Diesmal mußte die Entscheidung fallen zwischen wilder Grausamkeit und ritterlicher Ehrenhaftigkeit. Die Hügel von Hilarwend zählten zu den wichtigsten Stellungen des gesamten Gebiets, und in den letzten Jahren hatte sich eine unbenannte Erhebung als Schlüsselpunkt entpuppt: Hier, oberhalb der Straße ins üppige Kernland des Reiches, hatte darum König Arkos die Kämpfer seines Landes zusammengerufen. Nun würde sich erweisen, ob die Recken Araniens in der Gunst Rondras standen und der Göttin der Schlachten einen glänzenden Sieg zu Füßen zu legen vermochten. Vom Rücken seines mächtigen Schlachtrosses aus, ließ der Monarch den Blick seiner stahlgrauen Augen über das versammelte Heer streifen. Zu seiner Rechten hatten sich die Baburiner Ritter in ihren blitzenden Vollrüstungen aufgestellt – heldenhafte Recken mit wehenden Helmbüschen und sanft im Wind wehenden Wappenröcken. In gepanzerten Fäusten hielten sie tödliche Lanzen, ihre Langschwerter steckten noch in den geschmückten Scheiden, bereit, im Nahkampf in Windeseile herauszufahren und das Herz des Feindes zu suchen. Unter den polierten Helmen waren die Gesichter nicht zu erkennen, doch daß niemand von ihnen Schweißtropfen auf der Stirn trug oder auch nur in Erwartung der Feinde blinzelte, stand außer Zweifel.
Die Verteidiger des Landes Oron hatten mehrere Schritt vor ihnen Stellung bezogen. Sie trugen schlichte Tuchrüstungen, die Arme und Schenkel freiließen, denn sie verließen sich im Gefecht auf ihre Schnelligkeit und Gewandtheit, um den Hieben der Feinde zu entgehen. Wer sie so dastehen sah, entspannt und gelassen, das braune Kraushaar unter den Helmen hervorlugend, lässig auf ihre leichten Schilde gestützt, mochte sie für lachende und scherzende Ausflügler halten, doch sie hatten ihre Kampfkraft schon vielfach unter Beweis gestellt. Ihr Lied klang froh und heiter, doch erzählte es von Tod und Blut in Schlachten voller Ehre und Triumph.
Am Fuße des Hügels waren die Gorischen Reiter zu sehen. Ihre weiten Gewänder so makellos weiß wie ihre Pferde, die Stoßlanzen mit leuchtend bunten Tüchern geschmückt, den Blick ihrer schwarzen Augen unerschütterlich auf den Feind gerichtet. Wenn die Schlacht begann, würden auch sie singen – ein Lied pfeifender Pfeile, schwingender Säbel und donnernder Hufe.
Auch die Verbündeten in Warunkh und Beylunkh hatten Hilfstruppen geschickt, leichtbewaffnete Flankier mit Kurzschwertern und Lederhelmen. Wußten sie nicht, was ihnen bevorstand, oder wollten sie sich Mut machen mit ihren Wettspielen mit den Wurfmessern? Zeugte ihre Freude vor der Schlacht von besonderer Nähe zur Göttin?
Zuletzt betrachtete König Arkos die Männer an seiner Seite. Die treuesten der Treuen hatten ihn in alle Schlachten der Vergangenheit begleitet, und auch in an diesem Tag der Entscheidung waren sie ihm nahe. Er sah ihre traditionsreichen Kettenhemden und Spitzhelme aus Bronze und Drachenschuppen, murmelte die Namen ihrer mit Ehre bedeckten Klingen und gönnte sich ein leichtes Lächeln, als er sich die Taten eines jeden Getreuen ins Gedächtnis rief. Auf sie konnte er sich ohne Sorgen verlassen – die Göttin stand ihnen nahe, und jeder von ihnen hätte mit Freuden Heim und Familie für die Ehre Rondras gegeben.
Und er selbst? Könnte er, König Arkos, der Einiger Araniens, an diesem Tag vor dem Auge der Ritterlichen Göttin bestehen? Viel hatte er in seinen jungen Jahren schon erreicht: den eigenen, rechtmäßigen Erbanspruch durchgesetzt, den umkämpften Thron für sich errungen, die zerstrittenen Geschlechter seiner Heimat versöhnt und die Feinde in blutigen Schlachten aus dem Herzland seines Reichs verdrängt. Stets war die Göttin mit ihm gewesen, stets hatte er Ehrbarkeit und Ritterlichkeit gezeigt und war nie vor einer Übermacht gewichen – nicht einmal vor einer solchen Zusammenballung unversöhnlicher Feinde wie jener. Tapfer und unerschütterlich waren die Seinen, doch keine fünfhundert an Zahl, während die gegnerischen Horden mehrere Tausend zählten. Doch der Wille Rondras mochte geschehen – wenn ihnen an diesem Tage kein Sieg zugedacht war, würde er seine ergebenen Untertanen zumindest in einen glorreichen Heldentod auf der Walstatt führen, ihren Lieben daheim zum stolzen Angedenken und Trost, wenn sie der siegreiche Feind bedrängte.
Das Schmettern der Fanfaren riß den König aus seinen dunklen Gedanken. Die Herolde meldeten, daß der Feind seinen Angriff begonnen hatte. Arkos hob den Kopf und blickte in die Ferne, wo am Horizont Staub aufstieg, den die schmutzigen Füße der Barbaren und die Hufe ihrer zottigen Pferdchen aufwirbelten. Ihnen schritten keine Herolde, keine Sänger und keine Troubadoure voran, die das Lob der Göttin verkündeten; nur dumpfer Trommelwirbel erinnerte an finstere Riten im Mondlicht und ließ die Felle unbekannter Kreaturen erdröhnen.
»Für Aranien! Für Rondra!« Laut schallte der Kriegsruf des Königs.
»Für Aranien! Für Rondra!« erklang die Antwort aus vielen hundert Kehlen. Die Krieger waren bereit, warteten auf den Beginn des tödlichen Waffentanzes.
Als die Heere aufeinanderprallten, war es ein Tosen wie Donnerschall. Feindesschreie, Schlachtrufe, Waffengeklirr und Rösserstampfen verschmolzen zu einem ruhmreichen Preislied der Rondra, wie es nur auf den Schlachtfeldern der Welt gespielt wird.
Lachend ritt König Arkos über die Walstatt, trug mit blitzender Lanze den Tod in die Reihen der Feinde, wankte und wich nicht, sondern drang unaufhaltsam vorwärts, seine Getreuen mitreißend, bis der Feind ins Wanken geriet.
Schon lange wußte der Kriegerfürst nicht, wie viele Barbaren er zur höheren Ehre Rondras in die Schatten gesandt hatte. Als der hinterhältige Hieb einer blutigen Steinaxt sein edles Roß zum Straucheln und zum Sturz brachte, erhob sich König Arkos ruhig aus dem geschmückten Sattel und setzte das Gefecht als Fußkämpfer fort; was ihm zuvor die Lanze gewesen war, war ihm nun das Schwert: ein göttergefälliges Werkzeug, um die Herrin der Schlachten zu preisen.
Einige Schritt entfernt ertönte unvermittelt ein heiseres Fluchen: »Stirb, Donneranbeter!« Elegant wirbelte der König herum, zerteilte dabei fast beiläufig einen dreckstarrenden Barbaren, der sich mit erhobener Keule auf ihn stürzen wollte – und erstarrte für einem Augenblick.
Dort, keinen Roßsprung entfernt, stand Durum Shahr, der Mann, der die treibende Kraft hinter den Barbareneinfällen war – und im Augenblick hatte er seine mörderischen Klauen um die Kehle von Herrn Gardiran geschlossen.
König Arkos sah seinen treuesten und besten Gefolgsmann zucken, als das Leben allmählich aus dessen Leib wich. Aus den Augenwinkeln nahm er den starken Doppelbogen wahr, der neben dem gerade besiegten Barbaren lag. Fürwahr, der Herrscher Araniens war ein guter Jäger und vorzüglicher Schütze. Doch dies war keine Jagd, sondern eine Schlacht, und nur der Feigling kämpfte auf der Walstatt aus sicherer Ferne. Der Rondragefällige focht mit dem blanken Stahl, und er, Arkos, würde nicht seinen eigenen und Herrn Gardirans bislang makellosen Ehrenschild beflecken, indem er nun zum Bogen griff. In seinem Herzen fühlte Arkos, daß ein Schlachtentod dem Getreuen willkommener wäre als eine unehrenhafte Rettung.
Ohne der Versuchung einen weiteren Blick zu schenken, schritt der Monarch mit erhobenem Schwert auf den Feind zu, nur gelegentlich die Hiebe seitlich anstürmender Barbaren parierend. Als der König den Häuptling erreichte, hatte Durum Shahr die Leiche Herrn Gardirans bereits fortgeschleudert und sich dem Herrscher Araniens zugewandt.
König Arkos hatte nun zum ersten Mal Gelegenheit, seinen großen Widersacher, den Feind der Schlachten von Tal Arabar und Bursilla, aus der Nähe zu betrachten. Während der König groß und gewandt war, war Durum Shahr untersetzt und gedrungen, fast zwei Köpfe kleiner als der Aranier. Doch seine Schultern waren fast doppelt so breit, und in der Rechten trug er eine schwere Steinkeule, die er scheinbar mühelos hin und her schwang.
Sein fast nackter Leib war mit Blut bedeckt, die Haare mit Fett aus der fliehenden Stirn zurückgestrichen. Der Blick der blutunterlaufenen Augen und die kleinen, aber nadelspitzen Zähne hätten jeden Schwächeren zum Erzittern gebracht. Aber König Arkos fühlte in seinen Adern nur den gerechten Zorn des Herrschers, der endlich den erbittertsten Gegner seines Reiches gestellt hatte: »Herrin Rondra, mein Leben ist in Deiner Hand – doch laß nicht dieses Ungeheuer das Werkzeug Deines Willens sein!«
Langsam, fast bedächtig, holte König Arkos zum ersten Schlag aus. Nun würde sich das Schicksal Araniens entscheiden.
»Arkos!« Die Frauenstimme war kaum mehr als ein Flüstern, und doch übertönte sie den Kampfeslärm mühelos. Unwillig schaute sich der König um – gegen die Stimme gab es keinen Widerstand. Vergessen war die tödliche Gefahr, die von Durum Shahr ausging; er mußte die Sprecherin finden.
Da stand sie inmitten des Kampfgetümmels, ganz in Schwarz gekleidet und doch herausleuchtend unter all den Fechtenden, die ihm mit jedem Herzschlag unwirklicher erschienen. »Prinz Arkos! Kommt herbei!«
Hinter ihm glitten die anderen in den Schatten. Die Feinde waren vergessen, die Gefolgsleute unwichtig, und selbst der mächtige Durum Shahr sank wieder in die Welt zurück, aus der die Träume stammten.
Aus dem unerschrockenen Monarchen im Silberharnisch wurde wieder ein junger, etwas linkischer Prinz im schlichten Waffenrock, der nur Augen für die verschleierte Dame hatte, die ihn erneut mit lockenden Worten zu sich rief: »Prinz Arkos! Hört mich an!«
Unter dem weiten Tulamidenschleier war ihre schlanke Gestalt nur zu erahnen, doch ihre Worte klangen ihm voll Süße und einer Verlockung, für die er keinen Namen fand. Nur auf die Frau achtend, stolperte der Mann durch die graue Traumlandschaft vorwärts – er mußte sie aus der Nähe sehen, um zu erfahren, wem eine solch himmlische Stimme gehören mochte.
Die Fremde war hochgewachsen und auf Tulamidenweise in schwarze Seidenschleier gehüllt, die sie fast völlig vor seinen Blicken verbargen. Fast völlig – doch was zu sehen war, paßte eigentlich weit besser in ganz andere Träume als die von ruhmreichen Schlachten, in Träume, deren Existenz sich der Träumer nicht eingestehen mochte.
Als er ihr auf wenige Schritte nahegekommen war und es nur noch die Fremde und ihn in der grauen Landschaft zu geben schien, stellte Arkos fest, daß er nackt war, daß er entblößt vor der Frau stand, deren Rufen ihn herbeigelockt hatte. Seine erste Sorge war, jemand könnte ihn bei diesem unentschuldbaren Bruch der Etikette beobachtet haben. Erst danach fürchtete er, die Dame im Schleier mit dieser entsetzlichen Kränkung zu beleidigen. Aber diese Angst verschwand, als er ihre ruhige Haltung und den überlegenen Blick ihrer Augen sah, und wich der tiefsten Furcht: der Angst um sich selbst, der er nackt und schutzlos mit dieser majestätischen Fremden in einem grauen Land gefangen war. Daß dies alles nur ein Traum war und er sogar darum wußte, verringerte seine Angst nicht im Geringsten – und wann immer er gedacht hatte, man müsse erwachen, wenn man zu träumen bemerkte, hier wurde ihm das Gegenteil bewiesen. Wenn er in einem solchen Traum starb, würde er sich auch in der Welt der Wachen nicht wieder erheben.
Doch dann lächelten die Augen der Fremden, und Arkos fühlte, wie eine neue Ruhe und Sicherheit die Angst aus seinem Geist vertrieben. Diese Frau würde ihm nichts zuleide tun – sie wollte allein sein Bestes und verdiente seinen höchsten Respekt. Ihre Stimme klang freundlich, durchwirkt mit leicht trockenem Humor: »Fürchtet Euch nicht, Prinz Arkos. Ich sehe durch Tore der Vergangenheit und der Zukunft und in die Herzen der Lebenden und Toten – wie soll mich das erschrecken, was ich unter Eurem Rock sehe?«
Beruhigung und Zuversicht hüllten den jungen Mann ein wie ein warmer Mantel, und als einzige Sorge blieb die Frage, wie er ihr danken, sich ihrer würdig erweisen könnte.
»Prinz Arkos, ich habe Euch aus Eurem Traum von Ruhm und Ehre gerissen, weil es bald diese Gaben in der Welt der Wachen zu erringen gibt. Ein neues Zeitalter für Helden wird anbrechen, und Ihr seid auserwählt, ihr Anführer zu werden, wie es der Heilige Arkos, dessen Namen Ihr tragt, vor Jahrhunderten war.«
Nun bestand kein Zweifel mehr, daß die Fremde in seinem Geist lesen konnte wie in einem offenen Buch, mehr noch: daß sie auch zwischen den Zeilen zu lesen imstande war und seine geheimsten Wünsche kannte.
Stumm hörte er zu, wie ihre sanfte Stimme weitersprach: »Doch auch die Finsternis erhebt sich, und es gibt nur wenige Streiter des Lichtes, die ihr entgegentreten können. Von diesen Götterlieblingen hängt es ab, ob das Land in einer langen düsteren Nacht versinkt oder mit der Schwerter Macht neuem Glanz entgegengeführt wird.«
Ein heißes Glücksgefühl durchströmte Arkos – so sollte es sein, so gehörte es sich. Die langen, öden Tage der Studien und Lektionen würden hinter ihm liegen, der ganze aranische Hof mit seinen Lehrmeisterinnen und Ministerinnen verblassen gegen die Farben von Kriegsbannern im Schlachtenwind und das Blitzen von Stahl auf dem Kampfplatz. Heldentum, der rondrianische Einsatz zum Schutze des Volkes und zum Ruhm der Göttin, das war seine Bestimmung, nicht trockene Staatskunst und Verwaltungslehre. Sein Herz sang vor Freude und Dankbarkeit für die schöne Dame im Schleier, die ihm solches verhieß, doch nach außen hin lauschte er weiter still ihren Worten.
»Einer unter den Dienern der Finsternis ist so mächtig und so gefährlich, daß nur Ihr, der Erwählte der Göttin, ihm trotzen könnt. Seid gewarnt vor Assarbad! Neues Übel erhebt sich im Süden, wo er einst brütete in seiner Bosheit; und nur Ihr könnt Euch dieser Gefahr entgegenstellen.« Der Blick ihrer strahlenden Augen war nun ernst, ja beunruhigt. »Ich frage Euch, Arkos von Aranien, seid Ihr bereit, die Bedrohung unseres Mutterlandes und der ganzen Welt zu besiegen?«
Prinz Arkos konnte nicht anders, er mußte diese Frage stellen: »Der ganzen Welt?« Es war nicht mehr als ein heiseres Flüstern.
Die Dame im Schleier nickte majestätisch, und für einen hastigen Herzschlag waren ihre ebenmäßigen Züge hinter der schwarzen Seide zu erahnen. »Assarbads Erbe kann ganz Aventurien vernichten, wenn er die Zeit hat, seine vollen Kräfte zu entwickeln. Darum dürft Ihr keinen Moment zögern, Arkos.« Ihr Blick wurde hart. »Seid mein Ritter! Nehmt Eure Queste an ohne Zaudern und Zagen!«
Plötzlich sah sich der Prinz wieder in einen Ringelpanzer von wolkenhafter Leichtigkeit gekleidet – wie ein schwereloses Silbergespinst umhüllte er die Glieder, und doch war zu spüren, daß er die vollendete Rüstung sein mußte. In der Rechten trug er ein mächtiges Breitschwert, wie er es aus alten Sagen kannte – mächtig und schwer, mit silbernen Bändern geschmückt.
Ohne nachzudenken, wußte der ritterliche Prinz, was zu tun war – und ohne Zögern kniete er vor der schönen Dame im Schleier nieder, streckte ihr den Griff seiner neugewonnenen Waffe entgegen. »Seid meine Gebieterin – ich will Euer Streiter sein. Ich werde Euren Wunsch erfüllen oder bei dem Versuch sterben!«
Sie neigte ihren Kopf: »Das ist wohl gesprochen – fürwahr mag es Euch das Leben kosten, denn der Feinde sind viel und der Freunde wenige. Hütet Euch vor übereiltem Vertrauen und geht unerschütterlich den Weg der Ehre und des Ritters. Sucht Assarbad in seiner Höhle auf und stellt Euch ihm entgegen, ehe er seine Kräfte sammeln kann – das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Zaudert und zagt nicht, deutelt und fragt nicht, sondern folgt Eurem Herzen, dann wird sich alles zum Guten wenden!«
Eine letzte Frage blieb, und Arkos faßte allen Mut zusammen, sie zu stellen: »Aber … ich war lange krank, in der Welt der Wachen, meine ich, und mein Leib ist noch immer geschwächt – kann ich es schaffen, und wird man mich gehen lassen?«
Streng schaute ihm die Dame in Augen, nein, tiefer, bis in die Seele. »Wer so zögert und zweifelt, kann es gewiß nicht vollbringen. Seid mutig und zuversichtlich! Was allerdings die Euren betrifft: Sie mögen wohl Widerstand leisten, doch laßt Euch nicht von ihren kleinmütigen Sorgen auf Eurem Weg aufhalten. Viele lieben Euch und meinen es nur gut, aber sie sind verzagt und furchtsam – andere hingegen sind bereits den Einflüsterungen Assarbads erlegen und zu Euren Feinden geworden. Eine schwere, harte Reise liegt vor Euch, doch wenn ihr nicht zaudert, wird das Licht danach umso heller scheinen!«
2. Kapitel
Mit seinen nicht einmal zweitausend Einwohnern war Bethana am Meer der Sieben Winde eine kleine und überschaubare Stadt. Vor Jahrtausenden hatten hier dankbare Seefahrer dem Meeresgott Efferd einen Schrein errichtet, und im Laufe der Generationen wurde aus der von allen Aufständen und Kriegen verschonten Klostersiedlung eine ruhige Hafenstadt mit Tempel, Akademie, überkragenden Fachwerkhäusern und engen Gassen. Nur in der Nähe der Molen und Kais herrschte stets Betriebsamkeit. Seefahrer kamen und gingen, Schauerleute löschten die Fracht oder beluden die Pötten und Galeeren im Hafenbecken.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























