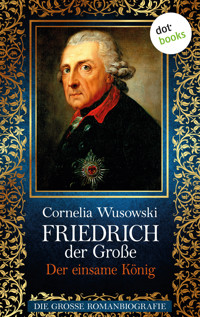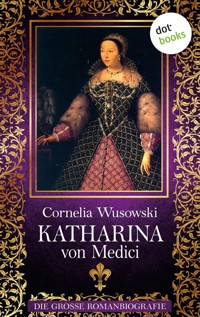Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Pau, 1572: Die Hugenottin Margot reist im Gefolge der Königin von Navarra nach Paris, um sich dort eine gut bezahlte Stelle zu suchen. Sie bemerkt rasch die unterschwelligen Spannungen zwischen Katholiken und Hugenotten. Um Pöbeleien zu entgehen, trägt sie die farbigen Kleider ihrer verstorbenen katholischen Mutter. Eines Tages begegnet sie dem Herzog von Guise. Seine Liaison mit der Prinzessin Margarete wurde von der königlichen Familie gegen seinen Willen beendet. Zu Margots Verderben könnte sie als Zwillingsschwester Margaretes durchgehen, was auch de Guise bemerkt. Die junge Hugenottin gerät in ein gefährliches Spiel aus Leidenschaft und Begierde …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cornelia Wusowski
Die Leidenschaft der Hugenottin
Historischer Roman
Impressum
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung von BookaBook,
Literarische Agentur Elmar Klupsch, Stuttgart
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »A Lady in Her Bath« von François Clouet, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_Clouet_-_A_Lady_in_Her_Bath_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=fr, sowie »Bartholomäusnacht« von Francois Dubois, commons.wikimedia.org/wiki/File:Francois_Dubois_001.jpg?uselang=de
ISBN 978-3-8392-4300-8
Widmung
Für Elmar Klupsch
Prolog
Der Nachmittag war heiß und schwül.
Kein Windhauch drang durch das geöffnete Fenster.
Die junge Frau stand in der Mitte eines Schlafzimmers, betrachtete das mit kostbaren Schnitzereien verzierte Himmelbett und die blutroten Samtvorhänge, die das Bett verbargen. Sie sah zu dem Mann, der lässig an einem der offenen Fenster lehnte und sie anlächelte.
Ein anderer Mann betrat durch eine in der Tapete versteckte Tür diskret das Zimmer.
Die junge Frau nahm ihn wahr, beachtete ihn aber nicht weiter.
Sie atmete schwer, und dann streckte sie plötzlich den rechten Arm in die Höhe, sah den Mann am Fenster zornig an und schrie: »Ich verfluche Euch, seid verflucht!«
Dann drehte sie sich um und eilte hinaus.
Der Mann am Fenster begann zu lachen. »Ein Fluch, das ist doch lächerlich! In unserer Zeit weiß ein jeder, dass ein Fluch ohne Bedeutung ist.«
1. Kapitel
An einem heißen Augustnachmittag im Jahr 1571 stand ein junges Mädchen namens Margot vor dem städtischen Backofen der kleinen Stadt Pau und beobachtete, wie der Bäcker einen dunklen runden Brotlaib nach dem anderen aus dem Backofen holte und in zwei Körbe legte.
»Wo bleibt der Brotkuchen?«, rief Margot ungeduldig, »der Teig, den ich Euch brachte, muss doch für einen Brotkuchen gereicht haben.«
»Geduld.« Er holte einen kleinen länglichen Brotlaib aus dem Ofen und legte ihn auf einen der Körbe.
Das Mädchen nahm aus ihrer Rocktasche einige Münzen, gab sie ihm und sagte: »Wisst Ihr, wie gut der Brotkuchen schmeckt, wenn man ihn mit Butter und Honig bestreicht?«
Der Bäcker lächelte. »Ich kann es mir vorstellen, aber schweigt besser über Eure Schlemmerei, die Königin isst den Brotkuchen trocken. Falls sie erfährt, dass in einem protestantischen Pfarrhaus solche Leckereien genossen werden, dann wird sie Euren Vater zu sich zitieren und ihn ermahnen, Calvins Vorschriften zu achten und sparsam zu leben.«
»Mein Vater weiß nichts davon. Unsere Dienerin Anne bestreicht den Brotkuchen heimlich damit, und dann esse ich ihn in einem Winkel des Gartens, wohin mein Vater nie kommt.«
»Ja, ja«, sagte der Bäcker bedächtig, »so versucht jeder in unserem Königreich Navarra, heimlich zu ein bisschen Genuss zu kommen. Arbeit und Gebet sind wichtig und notwendig, aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und Gebet. Was ich soeben sagte, habt Ihr nicht gehört.«
»Seid unbesorgt, ich kann schweigen.«
Sie legte über jeden Korb ein Leintuch, um das Brot vor den staubigen Straßen zu schützen, und ging langsam zurück zum Pfarrhaus.
Margot erinnerte sich an den Geschmack des frischen warmen Brotes, die kühle sahnige Butter, den herben würzigen Honig und ging rascher, weil sie ihre Lust auf diese Leckerei kaum mehr bezähmen konnte.
Vor dem großen Hoftor des Pfarrhauses stand eine Kutsche, vor die zwei Rappen und zwei Schimmel gespannt waren. Auf dem Bock saßen der Kutscher und ein Diener und dösten in der Hitze vor sich hin.
Margot blieb stehen und betrachtete den schweren Wagen, der zwar in den Pfarrhof einfahren, dort aber nicht wenden konnte, weil der Hof dafür zu klein war. Warum war der reiche Monsieur Blin zu ihrem Vater gekommen, ging es ihr durch den Kopf.
Auf der hinteren Seite lag der Stall, wo das einzige Pferd des Pfarrers, der schwarze Wallach Hiram, untergebracht war. Daneben befand sich ein Schuppen für den kleinen offenen Wagen, worin der Pfarrer bei gutem Wetter in die Umgebung der Stadt fuhr, um Gemeindemitglieder zu besuchen. Hinter dem Stall lag eine kleine Weide, wo Hiram tagsüber trabte, galoppierte oder gemächlich auf und ab lief.
Gegenüber dem Hoftor war ein kleines Holztor, das zum Hof hinter dem Haus führte. Dort standen der Ziehbrunnen, das Waschhaus und der Schuppen, in dem das Holz aufbewahrt wurde. Hinter diesem Hof erstreckte sich der Gemüse- und Obstgarten.
Ein halbwüchsiger Junge kam aus dem Pferdestall und schob einen Mistkarren über den Hof zum Gemüsegarten.
»Jacques«, rief Margot, »denk daran, dass Hiram bei dieser Hitze die doppelte Menge Wasser saufen muss.«
Der Junge nickte und schob den Karren in den Wirtschaftshof.
Als Margot über das Kopfsteinpflaster zum Hintereingang ging, der zur Küche führte, eilte ein mittelgroßes rundliches Mädchen auf sie zu.
»Margot, wo bleibst du? Ich warte schon seit mindestens einer halben Stunde auf dich, ich bin so aufgeregt. Ich habe meinen Vater begleitet, er bespricht jetzt mit deinem Vater die Einzelheiten meiner Trauung. Das Aufgebot wurde ja schon vor Wochen bestellt, jetzt geht es um den Inhalt der Predigt, die Musik und so weiter.«
Margot lächelte schmerzlich. »Corisande, ich freue mich für dich, dass du bald heiraten wirst.«
Sie ging zu dem Holztisch, der vor einer Bank stand, die am Haus angebracht war, stellte die Körbe auf den Tisch und betrachtete nachdenklich die dunkelblauen Glockenblumen und die weißen Margeriten, die dort in einem erdfarbenen Krug standen.
›Corisande wird heiraten, und ich? Wir sind fast gleichaltrig, sie ist schon siebzehn, ich folge am 20. Oktober. Bis jetzt ist noch kein Freier aufgetaucht. Nun ja, Corisande hat blaue Augen und blonde Haare, das gefällt den Männern wahrscheinlich besser.
Allerdings, es gibt eine Ausnahme: Graf Armand de Villiers, der Sohn des Oberhofmeisters der Königin, ist in mich verliebt, das spüre ich jedes Mal, wenn ich ihm begegne.‹
Corisandes Stimme unterbrach ihre Gedanken: »Was ist in den Körben?«
»Brot, ich habe es eben beim Bäcker geholt.«
Corisande betrachtete die duftenden dunklen Brotlaibe. »Warum esst ihr kein weißes Brot?«
»Roggenbrot ist billiger, und an der Tafel der Königin wird auch nur dunkles Brot gegessen. Zu ihren Grundsätzen gehört es, so bescheiden wie möglich zu leben, denn Bescheidenheit gehört zu den Pflichten der Protestanten.«
»Bescheidenheit, Arbeit und Gebet«, lachte Corisande, »ich weiß. An unserer Tafel gibt es jeden Tag weißes Brot. Warum beantragt dein Vater nicht den Bau eines eigenen Backofens? Er würde bestimmt die Erlaubnis erhalten, schließlich ist er der Pfarrer in Pau. Du müsstest dann nicht alle paar Tage den Teig zum Bäcker bringen und die fertigen Laibe holen.«
»Mein Vater findet, dass ein eigener Backofen zu luxuriös ist, im Übrigen hat meine Tante, die im Geld schwimmt, auch keinen Backofen.«
»Ein eigener Backofen ist sehr bequem, man kann jeden Tag backen, was man will und so viel man will.«
Margot nahm den Brotkuchen und hielt ihn Corisande unter die Nase. »Hast du schon einmal frischen Brotkuchen mit Butter und Honig gegessen?«
»Nein.«
»Er ist eine Delikatesse. Warte, ich werde Anne sagen, dass sie uns Butter und Honig bringt.«
Sie ging in die Küche, kehrte nach einer Weile mit einer Mohrrübe zurück, und dann setzten die Mädchen sich auf die Bank.
Corisande musterte erstaunt die Mohrrübe.
»Isst du jetzt rohes Gemüse, weil du schlank bleiben willst?«
»Die Rübe ist für Hiram. Er bekommt jeden Tag eine, entweder als Belohnung nach einem Ausritt oder als Trost, wenn ich ihn einen Tag lang nicht reiten konnte. Heute hatte ich keine Zeit für ihn.«
Corisandes Augen glitten neidisch über Margots Figur. Sie war schlank, kein Wunder, wenn man in ärmlichen Verhältnissen lebte. Sie straffte sich und sagte herablassend: »Unsere Pferde bekommen jeden Tag weißen Zucker zu fressen, das ist das Dessert nach dem Hafer.«
Margot spürte einen feinen Stich. Warum musste sie immer mit ihrem Reichtum protzen? Sie würde ihr zeigen, dass sie sie nicht darum beneidete.
»Wir können uns keinen Zucker leisten, aber Hiram weiß trotzdem, dass er geliebt wird, das ist viel wichtiger. Gehst du jeden Tag zu den Pferden, streichelst sie und sprichst mit ihnen?«
»Nein, um die Pferde kümmern sich die Stallknechte. Wird dein Hiram von Jacques gut versorgt? Sein Vater hat sich zu Tode gesoffen, und man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Er ist natürlich für euch eine billige Arbeitskraft. Ich nehme an, er bekommt keinen Lohn.«
»Jacques kümmert sich rührend um das Pferd. Er weiß genau, wie wichtig es für seine Zukunft ist, dass der Pfarrer mit ihm zufrieden ist. Die Fürsprache meines Vaters wird es ihm erleichtern, bei einem der Handwerker eine Ausbildung zu absolvieren. Er muss natürlich nicht umsonst bei uns arbeiten, er wird mit Naturalien entlohnt. Er isst mit uns zu Mittag, und am Abend gibt Anne ihm Obst, Gemüse, Brot, Milch, manchmal auch Eier oder Käse mit. Das ist für seine Mutter wichtiger als etwas Geld, weil sie davon nicht so viele Lebensmittel kaufen könnte. Der Lohn, den sie als Wäscherin bekommt, reicht kaum, um die sieben Kinder zu ernähren.«
»Das Leben ist merkwürdig«, sagte Corisande, »dein Vater hat in Paris und in Genf studiert, hat zwei Doktortitel erworben und muss trotzdem bescheiden leben. Was nutzt ihm sein Wissen?«
»Ein Mensch, der sich mit juristischen, philosophischen und theologischen Fragen und Problemen beschäftigt und auseinandersetzt, erweitert seinen Horizont«, überlegte Margot. »Er sieht das Leben und die Menschen anders als ein Kaufmann, der Geld scheffeln will und hartherzig gegenüber seinen Schuldnern wird.«
Sie schwieg und beobachtete zufrieden, dass Corisande die Augen senkte und leicht errötete. »Ich kann nichts dafür, dass mein Vater unbarmherzig das Geld eintreibt, das man ihm schuldet.«
In diesem Augenblick kam Anne mit einem Tablett und stellte zwei Holzteller, einen Teller mit Butter, einen Topf Honig, einen Krug Milch sowie zwei irdene Becher auf den Tisch und legte Besteck neben die Holzteller. »Guten Appetit, langt ordentlich zu.«
Corisande schnitt eine Scheibe von dem Brotkuchen ab, bestrich sie mit Butter, träufelte einen Löffel Honig darüber und biss hinein. Als sie die Scheibe gegessen hatte, sagte sie: »Du hast nicht zu viel versprochen, in Paris werde ich dafür sorgen, dass regelmäßig dunkles Brot gebacken wird.«
»Paris«, seufzte Margot, »freust du dich auf Paris? Die Stadt ist riesig, ich denke, es ist nicht einfach, sich dort zurechtzufinden.«
»Du stellst dir nicht vor, wie ich mich auf Paris freue. Ich kann es kaum erwarten, aus dieser Enge hier herauszukommen. Als die Königin zum protestantischen Glauben übertrat und der Protestantismus in Navarra zur Staatsreligion wurde, hat sie alles verboten, was Spaß macht: Tanz, weltlichen Gesang, Würfel- und Kartenspiele. Unter der Woche dürfen am Mittag und am Abend nur zwei Gänge serviert werden, an Sonn- und Feiertagen wenigstens drei. Wir Frauen dürfen keinen Schmuck tragen, außer einer Halskette mit einem Kreuz und dem Ehering. Ewig die schwarzen Kleider, die schwarze Haube, lediglich eine weiße Halskrause ist erlaubt, das ist alles. Ich würde so gern einmal bunte Kleider tragen.«
»Ich verstehe dich, wir waren beide zu klein, um uns an die Zeit zu erinnern, als Navarra katholisch war. Du weißt, dass meine verstorbene Mutter Katholikin war. Nach der Heirat mit meinem Vater und ihrem Übertritt zum Protestantismus packte sie alle farbigen Kleider und ihren Schmuck in eine Truhe. Die steht bei uns oben unter dem Dach. Nach dem Tod meiner Mutter konnte ich ohne Aufsicht durch das Haus streifen und entdeckte die Truhe und deren Inhalt. Hin und wieder gehe ich hinauf und betrachte die Kleider und den Schmuck. Du bist froh, dass du die Enge in Navarra verlassen kannst, aber in Paris wirst du auch als Protestantin leben müssen.«
»Gewiss, aber ich werde einen großen Haushalt leiten mit vielen Dienern. Die geschäftlichen Kontakte meines Mannes werden es mit sich bringen, dass man Bankette gibt. Ich werde viel luxuriöser leben als hier in Navarra. Mein Vater ist zwar wohlhabend, wir haben Diener, trotzdem muss meine Mutter den Haushalt überwachen und leiten. Ich hingegen werde einen Verwalter haben, der mir Bericht erstattet und dem ich Anweisungen gebe.«
Margot streifte die Freundin mit einem Seitenblick und überlegte, ob ihr ein solches Leben im Überfluss gefallen würde. Natürlich würde es ihr gefallen, dachte sie, aber das konnte doch nicht alles sein, was man vom Leben erwarten konnte.
»Liebst du deinen Mann?«
Corisande sah die Freundin erstaunt an. »Ob ich ihn liebe? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Es war die Entscheidung meiner Eltern, mich mit diesem Mann zu vermählen, weil es für meinen Vater und für meinen Mann geschäftlich von Vorteil ist. Außerdem gefalle ich ihm, und er möchte eine junge Frau an seiner Seite haben.«
»Wie alt ist dein Mann?«
»Er ist zweiundvierzig, fünfundzwanzig Jahre älter als ich. Er könnte natürlich mein Vater sein, seine Kinder sind erwachsen, und er hat schon einige Enkel. Ach, ich finde es herrlich, in einer Großfamilie zu leben, die Söhne und Schwiegertöchter wohnen natürlich bei ihm. Dann ist da noch eine unverheiratete Tochter, sie hat nach dem Tod der Mutter den Haushalt geführt.«
»Wann soll die Hochzeit sein?«
»Anfang September, und nach dem Hochzeitsmahl brechen wir sofort nach Paris auf. Ah, mein Vater! Leb wohl Margot, und vielen Dank für die Bewirtung.«
Margot sah ihr nachdenklich hinterher, dann nahm sie die Mohrrübe und lief zur Weide, wo Hiram gemächlich graste. Sie ging zu ihm, strich mit der rechten Hand über seinen Hals und beobachtete, wie er die Möhre aus ihrer linken Hand fraß. Er sah sie dabei mit seinen großen Augen zufrieden an, und Margot legte die Arme um ihn, presste ihr Gesicht an seinen Hals und begann zu weinen.
Nach einer Weile beruhigte sie sich und flüsterte: »Wie gern würde ich dir weißen Zucker geben, aber wir sind zu arm. Ich wünsche mir, einmal so viel Geld zu haben, dass ich mir das leisten kann, was sie besitzt. Ein großes Steinhaus, eine geräumige Kutsche, Diener, gutes Essen mit Fleisch, außer an den Fastentagen. Ich weiß, dass das nur Träume sind. Aber warum soll ich nicht träumen?
Hiram, an ein ärmliches Leben kann man sich gewöhnen, aber das Leben der Protestanten ist trist und ernst. Gebete, Gottesdienste und Arbeit, es gibt kein Vergnügen, worauf man sich freuen kann, keine Feste. Wie gern würde ich mich ein bisschen aufputzen mit farbigen Kleidern, bunten Bändern, etwas Schmuck. Manchmal möchte ich aus diesem Leben ausbrechen. Aber wo soll ich hin? Vielleicht heirate ich wie Corisande einen reichen Mann. Dann werden die Träume Wirklichkeit, und ich kann zumindest das ärmliche Dasein hinter mir lassen. Die religiösen Zwänge lassen sich im Wohlstand vielleicht leichter ertragen. Morgen reiten wir aus, Hiram, wir galoppieren durch die Landschaft. Wenn ich galoppiere, vergesse ich meine Träume.«
Sie ging zurück zum Haus und trug das Tablett in die Küche, wo die alte Dienerin Anne eifrig über dem offenen Herdfeuer in einem Suppentopf rührte. Margot betrachtete die Gemüsesuppe, in der kein Stückchen Fleisch schwamm. »Anne, wir sind Protestanten, warum fasten wir zur gleichen Zeit wie die Katholiken, also am Mittwoch, Freitag und Samstag, vor Weihnachten und die sechs Wochen vor Ostern?«
»Das ist ein Befehl unserer Königin, sie meint, Fastentage und -wochen sind eine Wohltat für Körper und Seele.«
»Unsere Königin scheint Gefallen an Entbehrungen zu finden, ich nicht. Morgen, am 24. August, sind es sieben Jahre her, dass meine Mutter starb. Seit damals hast du mir alle häuslichen Arbeiten beigebracht, Kochen, Nähen, Putzen, Waschen. Warum? Wenn ich einmal heirate, werde ich Diener und Mägde haben, die diese Arbeiten verrichten.«
»Euer Vater meinte, er wird Euch nicht reich verheiraten können, weil er keine große Mitgift bieten kann. Deswegen müsst Ihr alle Arbeiten, die in einem Haushalt anfallen, selbst ausführen können.«
»Corisande heiratet einen reichen Mann; manchmal beneide ich sie. Andererseits, dieser Monsieur Berne ist fünfundzwanzig Jahre älter als sie. Ich werde nie einen Mann heiraten, der mein Vater sein könnte.«
Anne hörte auf zu rühren und sah Margot ernst an. »Ihr werdet den Mann heiraten, den Euer Vater aussucht.«
»Ich weiß. Allerdings habe ich noch nicht bemerkt, dass er einen Gatten für mich gefunden hat.«
»Er kann Euch nicht mit irgendwem verheiraten. Ihr könnt nicht nur lesen, schreiben und rechnen, Ihr beherrscht Latein, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Ihr habt die Dichter dieser Länder gelesen, Ihr besitzt Kenntnisse in Geografie. Unter solchen Voraussetzungen ist es schwierig, in Navarra einen passenden Gatten für Euch zu finden.«
»Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn mein Vater mich weniger unterrichtet hätte. Die Männer mögen keine Frauen, die mehr wissen als sie.«
»Redet keinen Unsinn. Männer mögen keine dummen Frauen. Seht Eure Freundin Corisande. Worüber will ihr Mann sich mit ihr unterhalten? Sie hatte Unterricht, aber was hat sie gelernt?«
»Nicht viel, sie hat sich für nichts interessiert, doch sie bringt Geld in die Ehe. Wenn man Geld hat, muss man noch nicht einmal besonders hübsch sein.«
»Begreift endlich, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Die Protestanten versuchen viel Geld zu verdienen, aber das ergibt sich zwangsläufig aus dem Gebot, viel zu arbeiten. Eurer Mutter war es übrigens sehr recht, dass Ihr gelernt habt. Sie wusste auch viel, Euer Großvater hat dafür gesorgt, dass sie sorgfältig unterrichtet wurde, wie es sich für ein junges aristokratisches Mädchen ziemt.«
Es entstand eine Pause, dann sprach Anne weiter. »Ich glaube, es gibt einen Freier für Euch. Der junge Graf Armand de Villiers ist in Euch verliebt.«
»Ich weiß, aber ich nicht in ihn. Vom Alter her würde er passen, er ist Anfang zwanzig. Aber sonst? Ich mag keine blonden Männer, er neigt zur Fülle, seine blauen Augen sind nicht aufregend, er wirkt langweilig. Außerdem würde sein Vater nie einer Verbindung mit einem bürgerlichen Mädchen zustimmen, weil die Villiers zur alten Aristokratie Navarras gehören.«
»Das dürfte kein Hinderungsgrund sein. Eure Mutter war auch eine Aristokratin, eine Comtesse.«
»Sie hat unter ihrem Stand geheiratet, und ich bin bürgerlicher Abstammung. Aber das ist auch alles unwichtig. Armand gefällt mir als Mann nicht, er ist nicht aufregend genug … Wir reden und reden, ich muss den Tisch decken.«
Sie nahm drei Holznäpfe und drei Holzlöffel und ging hinüber in den Wohnraum, der auch als Esszimmer genutzt wurde.
Anne sah ihr nach und dachte, er ist zwar nicht aufregend genug. Doch aufregende Männer waren meist problematisch.
Nach einer Weile kam Margot zurück, nahm einen der frischen Brotlaibe und ein langes Messer und fing an, das Brot in dicke Scheiben zu schneiden. »Anne, als wir gestern die Wäsche im Fluss spülten, kamen zwei Frauen mit ihrer Wäsche und unterhielten sich leise, aber ich konnte alles hören. Eine sagte: ›Ich bin schon wieder schwanger, es ist entsetzlich, dieses Kind wurde nicht in Liebe gezeugt. Als mein Mann nach Hause kam, hat er mich geschlagen und mit mir Notzucht getrieben. Es war so demütigend, am liebsten würde ich mit meinen Kindern weggehen. Aber wohin? Ich muss bleiben, weil er unsere Kinder und mich ernährt. Was soll ich nur machen?‹ Die andere Frau antwortete, sie könne nichts machen, sie müsse ihren Mann erdulden. Sie schwiegen eine Weile und spülten ihre Wäsche, inzwischen kam eine dritte Frau dazu und erzählte von einem jungen Mädchen aus Pau, das heiraten muss, weil es ein Kind erwartet. Sie nannte es eine Schande, dass junge Mädchen ihre Jungfräulichkeit nicht bis zur Ehe bewahren können.« Sie machte eine Pause. »Anne, was ist Notzucht?«
»Es gibt Männer, die Frauen zwingen, sich ihnen hinzugeben. Sie nehmen sie mit Gewalt. Ich nenne Euch ein Beispiel: Wenn junge hübsche Landmädchen dem Grundherrn gefallen und sie ihm nicht zu Willen sind, schändet er sie.«
»Die Frau am Fluss war verheiratet, gibt es auch solche Schändungen in der Ehe?«
»Ja, das kommt öfter vor, als man glaubt.«
Margot sah Anne entsetzt an: »Ich dachte bisher, in einer Ehe gäbe es keine Gewalt.«
»Ihr habt nur die glückliche Ehe Eurer Eltern erlebt. Ich hoffe für Euch, dass Ihr einmal einen Mann heiratet, der einen anständigen Charakter hat.«
»Dafür wird mein Vater sorgen.«
»Gewiss, aber auch er wird letztlich nicht wissen, was im Kopf Eures künftigen Gatten vorgeht.«
Margot legte die Brotscheiben auf einen Holzteller, ging zur Tür, blieb stehen und sah Anne an. »Du hast schon öfter zu mir gesagt, dass ein anständiges Mädchen sich dem Mann erst in der Hochzeitsnacht hingibt, und ich bin fest entschlossen, meine Jungfräulichkeit bis zu dieser Nacht zu bewahren.«
Sie verließ die Küche. Anne sah ihr nach und sagte leise: »Sie kennt das Leben noch nicht, ich hoffe für sie, dass sie es nie kennenlernt.«
Pfarrer Nicolas Cauvin sprach das Tischgebet: »Gott, himmlischer Vater, segne uns und diese deine Gaben, die wir durch deine milde Güte zu uns nehmen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.« Dann füllte er nacheinander die Näpfe von Anne, seiner Tochter und seinen eigenen.
Er löffelte genießerisch die Gemüsesuppe und trank einen Schluck Rotwein. »Es geht doch nichts über ein einfaches, bescheidenes Leben, wobei man gleichzeitig gut lebt. In Navarra haben wir alles, was man genießen kann: Wein, Käse und Knoblauch.« Er sah zu Anne. »Ihr habt bei der Suppe mit Knoblauch gespart, Ihr wisst, dass Knoblauch sehr gesund ist.« Und zu Margot: »Nach deiner Geburt habe ich dich an unserem Wein riechen lassen und deine Lippen mit Knoblauch eingerieben.«
Margot sah den Vater erstaunt an. Er sprach vom Genuss, das erlebte sie zum ersten Mal, aber er war schließlich auch einmal ein junger Mann gewesen.
Sie betrachtete die große, hagere Gestalt und die dunklen Haare, die von silbernen Strähnen durchzogen wurden. Sie rechnete, dass der Vater fast siebenundvierzig Jahre alt war, und überlegte wieder einmal, warum er sich nach dem Tod der Mutter nicht noch einmal vermählt hatte. Es gab in Navarra, sogar in Pau, bestimmt viele junge Frauen, die gern die Frau des Pfarrers geworden wären. Ein Pfarrer war nicht reich, aber er besaß gesellschaftliches Ansehen. Das musste für wohlhabende Bauerntöchter doch reizvoll sein. Allerdings heirateten diese Mädchen wahrscheinlich lieber einen reichen Bauern, obwohl es derer nicht viele in Navarra gab. Der größte Teil der Landbevölkerung war arm und lebte von Ernte zu Ernte.
Der Vater unterbrach ihre Gedanken. »Margarethe, morgen ist es sieben Jahre her, dass deine Mutter im Kindbett starb. Das Kind kam tot zur Welt, es war Gottes Wille, dass du das einzige unserer Kinder warst, das heranwuchs. Ich war während der letzten Stunden deiner Mutter an ihrem Bett, sie starb gegen zwei Uhr morgens.
Das war für mich der größte Verlust meines Lebens, ich habe deine Mutter sehr geliebt, es war von beiden Seiten eine Liebesheirat. Ich wusste, dass ich eine Frau wie deine Mutter nie mehr finden würde. Deswegen heiratete ich nicht noch einmal.«
Er schwieg, und Margot überlegte. Warum erzählte er das jetzt vor Anne? Aber er hatte Margarethe gesagt, nicht Margot. Wenn er sie Margarethe nannte, dann hatte das etwas zu bedeuten, dann wollte er ihr etwas Wichtiges sagen. Sie spürte, wie ihr Herz klopfte.
Der Pfarrer lächelte seine Tochter an: »Margarethe, ich sagte bereits, dass deine Mutter und ich aus Liebe geheiratet haben. Sie wird dir bestimmt erzählt haben, was damals vor achtzehn Jahren geschah. Nun, eine Liebesheirat ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass die Eltern den Ehemann aussuchen. Du wirst in wenigen Wochen siebzehn Jahre, und ich war nicht müßig und habe mich nach einem passenden Gatten für dich umgesehen.
Da ich dir keine große Mitgift geben kann, war die Auswahl nicht groß. Dein künftiger Gatte muss die gleiche Bildung besitzen wie du, sonst kommt es in der Ehe zu Schwierigkeiten. Kurz, ein Pfarrer wäre die passende Partie.«
Er schwieg und gab Anne ein Zeichen, den zweiten Gang zu bringen. Ein Pfarrer! Margot spürte eine leise Enttäuschung. ›Ein Pfarrer, mein Vater hat recht, wer sonst kommt für ein Mädchen mit kleiner Mitgift infrage?‹
Anne brachte drei Portionen Ziegenkäse.
Margot sah den Vater an und fragte zögernd: »Wen habt Ihr für mich als Gatten erwählt?«
»Es ist der Pfarrer in Nérac, Monsieur Tartuffe, der dort seit einem Jahr amtiert. Er ist Anfang dreißig und seit über einem Jahr Witwer. Er hat zwei kleine Söhne, vier und fünf Jahre alt, und er wünscht sich für seine Kinder eine gute Mutter. Das ist für ihn wichtiger als die Höhe der Mitgift. Ich kenne ihn persönlich, er ist ein angenehmer Mann, du wirst es gut bei ihm haben.«
Margot glaubte nicht richtig zu hören: ein Witwer mit zwei kleinen Kindern? Sie mochte keine kleinen Kinder. Gewiss, irgendwann würde sie selbst welche haben. Aber das wäre dann etwas anderes.
»Vater, ich weiß nicht, ob ich reif genug bin, um kleine Kinder zu erziehen.«
Der Pfarrer sah sie streng an. »Keine Ausflüchte, Margarethe, man wächst mit den Aufgaben. Überdies wirst du wahrscheinlich nach dem ersten Ehejahr ein eigenes Kind haben. Das musst du auch erziehen.« Er schwieg und sagte nach einer Weile leise: »Liebes Kind, es war für mich ein schwerer Entschluss, mich nach einem Gatten für dich umzusehen. Ich hätte dich gern noch einige Jahre länger im Haus behalten. Denn je älter du wirst, desto ähnlicher wirst du deiner Mutter, nicht nur äußerlich. Aber ich muss an deine Zukunft denken.«
Nach der Mahlzeit falteten sie die Hände, und der Pfarrer sprach das Gebet: »Wir danken dir, Herr, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, unsern Herrn, für alle deine Wohltat, der du lebest und regierest in Ewigkeit. Amen.«
Anschließend ging Nicolas Cauvin in sein Arbeitszimmer, um die Predigt für den Sonntag noch einmal zu überarbeiten.
Margot half Anne beim Reinigen der Holznäpfe.
Die Dienerin sah die finstere Miene des jungen Mädchens. »Was habt Ihr gegen den Pfarrer? Ein Mann, der zum zweiten Mal heiratet, weiß, wie man eine junge Frau behandelt. Wenn er merkt, dass Ihr Euch liebevoll um die Kinder kümmert, habt Ihr es bestimmt gut bei ihm.«
Margot sah Anne mit funkelnden Augen an und schrie: »Ich mag keine kleinen Kinder!«
Anne zuckte zusammen. »Gütiger Himmel, was habt Ihr? Sprecht leiser, Euer Vater darf das nicht hören. Warum mögt Ihr keine kleinen Kinder? Sie sind süß, und es ist ein ganz besonderes Erlebnis zu sehen, wie sie heranwachsen und die Welt entdecken.«
Margot begann zu weinen. »Anne, was ich dir jetzt erzähle, weiß niemand. Du erinnerst dich, als ich sechs Jahre war, gebar meine Mutter einen kleinen Bruder, er war der erste Sohn nach den Mädchen. Meine Mutter war überglücklich und beschäftigte sich nur noch mit ihm. Ich war bis zu seiner Geburt das einzige Kind gewesen, weil die Geschwister alle nach wenigen Tagen starben. Nun sah ich, dass er am Leben blieb, größer und kräftiger wurde, und ich fühlte mich in den Hintergrund gedrängt. Als er laufen konnte, musste ich auf ihn aufpassen, das gefiel mir nicht, weil ich keine Zeit mehr fand, um in Ruhe zu lesen. Er lief umher, und wenn ich ihn zwang, sich zu setzen, fing er an zu brüllen. Meine Mutter befahl mir, liebevoller mit ihm umzugehen. Allmählich fing ich an, ihn zu hassen.
Als er sprechen lernte, wurde mir die Situation immer unerträglicher.
Meine Mutter war vernarrt in ihn und lobte beständig seine Intelligenz. Ich hingegen bekam harte Worte zu hören, wenn ich bei den Rechenaufgaben zu viele Fehler machte. Kurz, er war alles, ich war nichts.
Er starb im Alter von drei Jahren, und ich war glücklich über seinen Tod. Meine Mutter weinte wochenlang, erst allmählich wandte sie sich mir wieder zu. Ich war wieder das einzige Kind und genoss die neue Aufmerksamkeit. Verstehst du jetzt, warum ich keine Kinder, geschweige denn fremde mag?«
»Ich erinnere mich, dass Ihr nicht gern auf den kleinen Pierre aufgepasst habt. Ich glaube, er spürte Eure Abneigung, weil er schrie, wenn er Euch sah; er ließ sich von Euch auch nicht füttern. Ich verstehe jetzt Eure Abneigung gegenüber kleinen Kindern. Eure Mutter wünschte sich immer einen Sohn oder Söhne, weil sie dachte, dass es zwischen ihr und Töchtern nur Spannungen geben würde. Sie hatte zu ihrer Mutter kein gutes Verhältnis. Das erzählte sie mir einmal, und sie befürchtete, dass sie zu ihren Töchtern auch kein gutes Verhältnis haben würde.«
»Das wusste ich nicht. Anne, die erste Frau wird immer zwischen dem Pfarrer und mir stehen, er wird mich mit ihr vergleichen, und die Kinder sehen in mir wahrscheinlich die böse Stiefmutter. Ich weiß, dass ich mir den Ehemann nicht aussuchen kann. Corisande heiratet ebenfalls einen Witwer, aber sie wird im Wohlstand leben, während ich wahrscheinlich sparen muss. Wie gern würde ich einmal nicht knapsen müssen.«
»Alle Protestanten sparen, deswegen haben es viele auch zu Wohlstand gebracht. Ihr wurdet zur Bescheidenheit erzogen, es dürfte Euch also nicht schwerfallen, Euch in Nérac einzuleben. Viel schwieriger ist es, wenn man Wohlstand gewöhnt ist und sich plötzlich einschränken muss. Denkt an Eure selige Mutter. Sie wuchs in einem Schloss mit vielen Dienern auf, und dann, nach der Heirat, musste sie mit einem bescheidenen Pfarrhaus vorlieb nehmen.«
»Meine Eltern haben aus Liebe geheiratet, das war eine völlig andere Situation.« Sie überlegte kurz. »Anne, war meine Mutter hier in diesem bescheidenen Pfarrhaus wirklich glücklich? Sie hat aus Liebe geheiratet, aber sie vertauschte ja nicht nur ein Schloss mit einem einfachen Haus, sie wechselte von einem Leben mit Tanz und Gesang in ein Leben mit Gebet und Gottesdienst.«
»Ich weiß es nicht, ich kann Euch nur meinen Eindruck und meine Beobachtungen schildern. Als Eure Mutter 1554 nach Navarra kam, war der katholische Glaube die Staatsreligion. Die Protestanten wurden unter der Regierung des alten Königs geduldet, die Mehrheit der Bevölkerung war noch katholisch. Eure Mutter sah die Lebensweise der Katholiken, die sie kannte. Aber sie musste als Protestantin leben. Ich hatte den Eindruck, dass ihr das schwer fiel.
Dann starb der alte König, und Königin Johanna führte allmählich den protestantischen Glauben ein. Navarra war offiziell immer noch katholisch, doch die Protestanten gewannen gesellschaftlich an Einfluss.
Eure Mutter hatte als Pfarrfrau eine herausgehobene Position, man hörte auf ihre Ratschläge, man bewunderte sie, weil sie zum protestantischen Glauben übergetreten war. Ich hatte den Eindruck, dass sie in jenen Jahren glücklich war, trotz der bescheidenen Lebensverhältnisse. Sie genoss es, dass ihr Mann als Pfarrer beliebt war. Allerdings trauerte sie dem Luxus doch ein wenig nach. Ich beobachtete, dass sie manchmal auf den Dachboden ging, wo sie ihre farbigen Kleider verwahrte. Mehr kann ich Euch dazu nicht sagen.«
»Ich bin froh Anne, dass wir über meine Mutter gesprochen haben. Echte Liebe ist anscheinend eine Macht, die viel vermag. Wenn ich nach Nérac übersiedele, musst du mitkommen.«
»Ich würde gern, zumal ich hier außer meinem Bruder keine Verwandten habe. Aber wer kümmert sich um Euren Vater? In dem Pfarrhaus in Nérac gibt es bestimmt eine Dienerin, die Euch bei der Führung des Haushalts unterstützt.«
»Du hast recht«, überlegte Margot laut, »du musst dich um meinen Vater kümmern. Gute Nacht, Anne.«
»Gute Nacht, Margot.«
2. Kapitel
Margot ging langsam hinauf in ihr Zimmer. Sie entzündete die Lampe auf dem Tisch und überlegte, wann sie am nächsten Tag zum Grab der Mutter gehen sollte. Am Vormittag? Am Nachmittag? Nein, besser am frühen Abend, wenn es anfing, kühler zu werden.
Sie setzte sich an den Tisch und holte aus einer Schublade zwei Bücher, die sie während der letzten Tage gelesen hatte: Boccaccios Decamerone und Ovids Ars Amatoria.
Sie durfte sich in der Bibliothek ihres Vaters Bücher aussuchen, und er hatte ihr erlaubt, Boccaccio und Ovid zu lesen.
Margot ging mit den Büchern hinunter ins Arbeitszimmer des Vaters. Sie durfte den Raum auch betreten, wenn er an seiner Predigt arbeitete. Sie klopfte an, ging hinein, stellte die Bücher an ihren Platz, sah an der Reihe entlang und entdeckte ein dickes Heft, das neben den Büchern lag. Sie schlug es auf und sah eine handschriftliche Widmung der Königin Margarethe von Navarra.
Nicolas Cauvin beendete die Überarbeitung seiner Predigt und ging zu Margot.
»Aha, du hast die Erzählungen der Königin gefunden. Sie schenkte mir eine Abschrift der Geschichten, die damals fertig waren. Das Vorbild war übrigens das Decamerone, eine Rahmenerzählung mit hundert Geschichten, die in zehn Tagen erzählt werden sollten. Bei Margarethes Tod war allerdings erst die zweite Erzählung des achten Tages fertig. 1559 erschien eine Ausgabe der zweiundsiebzig Geschichten mit dem Titel Heptaméron. Im Decamerone hast du ein Welttheater gefunden mit Königen, Bauern, Amtsvertretern, Spitzbuben und Mönchen. Und Geschichten, deren Thema Liebe und Erotik sind. Im Heptaméron sind amouröse Verwicklungen das Hauptthema. Die Erzähler der Geschichten diskutieren nach dem Ende der Erzählung über deren Moral.«
Margot sah den Vater erstaunt an. »Ich dachte immer, dass Königin Margarethe sich ausschließlich mit theologischen und philosophischen Problemen beschäftigt hat.«
»Sie war eine Frau, die sich für alles interessierte, auch für Dichtkunst und Musik«, gab er lächelnd zurück. »Sie war weltoffen, liebte die heitere Seite des Lebens und alles, was zu den Freuden des Lebens gehört, eine gute Tafel, Tanz und Gesang. Lies die Geschichten, in ihnen spiegelt sich die Lebensfreude der Königin wider.«
»Vater, Ihr erlaubt mir, Liebesgeschichten zu lesen. Ich durfte Ovid lesen, warum? Die Tochter eines protestantischen Pfarrers darf für gewöhnlich Bibel und Gebetbuch lesen.«
»Ich bin gegen Verbote, Margot. Hätte ich dir die Lektüre des Ovid verboten, so hättest du die Ars Amatoria irgendwann heimlich gelesen. Stimmt es, oder habe ich recht?«
»Es stimmt, Vater.«
»Siehst du, Verbote reizen dazu, sie zu übertreten. Was ich dir jetzt sage, Margot, muss unter uns bleiben. Meiner Meinung nach verbietet unsere Königin zu viel. Das ist der Grund, warum sie in Navarra nicht beliebt ist. Wie reagiert die Bevölkerung auf die Verbote? Die Menschen verschaffen sich heimlich etwas Lebensgenuss. Wie oft erlebe ich das, und ich drücke dann beide Augen zu und sehe nichts.
Es gibt heimliche Messen im Wald. Wenn ich zu einem Sterbebett gerufen werde, ist manchmal Essenszeit, dann stehen mehrere Gerichte auf dem Tisch. Im Sterbezimmer hängt irgendwo in einer Ecke ein Marienbild. Ich weiß auch, wo die Männer sich treffen, um Karten zu spielen. Ich übersehe alles. Warum soll man den Menschen nicht ein bisschen Lebensfreude gönnen?«
Margot betrachtete das Heft, sah den Vater an und fragte zögernd: »Wie kam es, dass die Königin Euch ihre Erzählungen schenkte? Seid Ihr nach dem Ende Eures Studiums in Genf nicht nach Paris zu Montmorency gegangen und habt als Sekretär bei ihm gearbeitet?«
»Nein, Margot. Deine Mutter und ich haben dir erzählt, was du als Kind verstehen konntest. Die familiären Zwistigkeiten mit deiner Tante haben wir verschwiegen, du solltest ihr unbefangen gegenübertreten.«
»Das ist nur zum Teil gelungen. Seit der Beerdigung meiner Mutter mag ich Tante Johanna nicht mehr.«
Der Pfarrer führte Margot zu dem Stuhl vor dem Schreibtisch, ging zum Wandschrank, nahm eine Flasche Rotwein, zwei Zinnbecher und stellte alles auf den Tisch. Er füllte die Becher.
»Auf deine Zukunft, Margot. Ich erzähle dir, wie mein Leben nach dem Ende meines Studiums in Genf verlief.«
*
Am Johannistag des Jahres 1548 betrat Nicolas Cauvin den Hof des königlichen Schlosses in Pau. Er sah sich unschlüssig um und ging zu einem der Soldaten, die den Eingang zum Schloss bewachten.
»Verzeiht, ich hörte in der Stadt, dass die Königin an jedem Werktag zwischen zwei und vier Uhr Besucher und Bittsteller ohne Voranmeldung empfängt.«
»Das ist richtig, ich werde Euch zu ihr bringen.«
Sie gingen durch eine große Halle zu einer Terrasse. Dort begann der Schlosspark.
Der Soldat blieb stehen.
»Seht Ihr den Springbrunnen? Die Königin und ihre Damen verbringen dort die Nachmittage, weil die Wasserfontänen angenehme Kühle spenden.«
Nicolas schritt langsam zu dem Brunnen, ging um ihn herum, hörte plötzlich eine wohlklingende Stimme und blieb stehen.
»Sintemalen ich mir oft gewünscht hab, meine Damen«, begann die Rednerin, »Schicksalsgenoss desjenigen zu sein, von dem ich Euch jetzt berichten will, erzähl ich Euch hiermit, dass in der Stadt Neapel, zur Zeit des Königs Alphonse …«
Hier liest jemand eine Geschichte vor, dachte Nicolas, und ging ein paar Schritte weiter. Auf der steinernen Bank, die um den Brunnen führte, saß eine große schlanke Dame, die einige Bögen Papier in den Händen hielt.
Sie trug ein Kleid aus silbergrauer Seide, die Haare waren mit einer Haube aus rosa Seide bedeckt.
Zu ihren Füßen saßen ungefähr sechs junge Damen auf gepolsterten Schemeln und sahen andächtig zu der Vorleserin auf.
Nicolas betrachtete einen Augenblick das ovale weiße Gesicht der Dame, die längliche Nase, die vollen roten Lippen und atmete tief durch. Das war die Königin Margarethe von Navarra, sie musste inzwischen Mitte fünfzig sein. Er ging einige Schritte weiter und verneigte sich vor ihr.
Die jungen Damen fingen an zu kichern, und er hörte sie flüstern:
»Schon wieder einer in schwarzer Kleidung.«
»Schon wieder einer aus Genf.«
Nicolas spürte, wie er errötete.
Die Königin legte die Papiere neben sich und klatschte in die Hände. »Meine Damen, ich möchte mich mit dem Herrn unterhalten.«
Die Hofdamen eilten in den Park.
Margarethe lächelte Nicolas an. »Setzt Euch neben mich, was führt Euch nach Navarra?«
Der warme Ton ihrer Stimme und die gütigen blauen Augen wirkten beruhigend auf Nicolas.
»Majestät, mein Name ist Nicolas Cauvin, ich bin Franzose und habe vor einigen Wochen mein theologisches Studium an der Hochschule in Genf mit dem Doktorgrad abgeschlossen. Monsieur Calvin war so liebenswürdig, mir einen Brief für Euch zu geben.«
Er nahm das Schreiben aus seinem Wams, und während die Königin las, wartete er gespannt auf ihre Reaktion.
Nach einer Weile sah sie auf. »Es ist natürlich zu gefährlich für Euch, als protestantischer Prediger in Frankreich zu leben. Ich verstehe auch, dass Ihr Euch nicht zum Märtyrer berufen fühlt. Was ich nicht verstehe, ist die religiöse Intoleranz meines Neffen Heinrich. Seit seinem Regierungsantritt vor einem Jahr lässt er die Protestanten systematisch verfolgen. Warum? Der Grund dafür ist meiner Meinung nach nicht sein katholischer Glaube, sondern seine Mätresse, die ihm einflüstert, wie er regieren soll. Dieses Weib, diese Diane de Poitiers, die ihn seit Jahren umgibt, wird von der erzkatholischen Familie Guise gelenkt, mit der sie weitläufig verwandt ist. Diese Familie wird vom Machttrieb beherrscht, die Guisen wollen faktisch in Frankreich regieren und sehen in den Protestanten eine politische Gefahr.
Mein seliger Bruder Franz hat sich weder von einer Mätresse beherrschen lassen noch von einer Familie des Hochadels. Zurück zu Euch, Monsieur Cauvin, Ihr dürft selbstredend überall in Navarra die reformierte Lehre verkünden. Doch bevor Ihr Eure Reise durch mein Land beginnt, möchte ich Euch näher kennenlernen. Besucht mich bis zum Ende des Monats jeden Nachmittag. Ab vier Uhr bis zum Abend können wir uns über Religion, Philosophie und Literatur unterhalten.
Von Juli bis Ende September reist Ihr durch das Land, nach Eurer Rückkehr werdet Ihr in Pau predigen. Ich werde Euch oft zu mir bitten, um mich mit Euch über philosophische und theologische Probleme zu unterhalten.«
»Majestät, ich danke Euch von ganzem Herzen, dass Ihr mir in Navarra Asyl gewährt.«
»Das ist für mich selbstverständlich. Eine Frage müsst Ihr mir noch beantworten: Wie kam es, dass Ihr protestantischer Pfarrer wurdet?«
»Während meines Jurastudiums an der Sorbonne lernte ich deutsche Studenten kennen. Sie erzählten von der reformierten Lehre Martin Luthers. Ich war beeindruckt, lernte die deutsche Sprache und las Luthers Schriften.
In dieser Zeit breitete der reformierte Glaube sich allmählich auch in Frankreich aus. Der Name Calvin wurde bekannt in Europa. Ich schloss mein Studium mit dem Doktorgrad ab, und mein Vater schenkte mir zur Belohnung eine Reise durch Europa.
Mein Vater war damals ein reicher Seidenhändler in Paris. Mein älterer Bruder Charles sollte einmal das Geschäft übernehmen, ich hingegen, so der Wunsch meines Vaters, sollte als Jurist in den Staatsdienst treten.
Ich reiste zunächst nach Genf, weil ich Calvin persönlich kennenlernen wollte. Seine Lehre überzeugte mich, und ich begann, an der von ihm gegründeten Hochschule Theologie zu studieren mit dem Ziel, als Prediger zu arbeiten, woraufhin mein Vater mich enterbte. Er befürchtete wirtschaftliche Nachteile, wenn bekannt werden würde, dass sein Sohn zum protestantischen Glauben übergetreten war.
Neben dem Studium unterrichtete ich die Kinder der wohlhabenden Genfer Bürger und verdiente so meinen Lebensunterhalt.«
»Ich verstehe nicht, warum verschiedene Meinungen über den christlichen Glauben Familien entzweien können. Ihr seid kein Einzelfall. Lebt Euer Vater noch?«
»Er ist inzwischen gestorben, aber meine Mutter lebt noch. Sie schrieb mir damals, dass sie die Ansicht meines Vaters nicht teilt, sie seine Entscheidung aber akzeptiert.«
Ein Diener trat zu ihnen.
»Majestät, ein Bauer möchte Euch eine Bitte vortragen.«
»Er soll kommen!« Und zu Nicolas: »Wir sehen uns morgen, ich freue mich auf die Gespräche, die wir führen werden. Wenn es Euch interessiert, lese ich Euch einige meiner Geschichten vor, die ich in den letzten Jahren schrieb. Hättet Ihr in Pau eine Unterkunft?«
»Ja, Majestät, dort leben meine Verwandten. Meine Schwester Johanna heiratete vor zehn Jahren Monsieur Bouton, einen reichen Kaufherrn der Stadt.«
»Monsieur Bouton? Er soll sehr geschäftstüchtig sein.«
Einige Stunden später saßen Nicolas und sein Schwager Maximilien im Arbeitszimmer des Hausherrn beisammen und tranken Rotwein.
Maximilien musterte die groß gewachsene, schlanke Figur des Schwagers, die dichten schwarzen Haare und die ernsten dunklen Augen. »Wir haben uns vor zehn Jahren zum letzten Mal gesehen, damals warst du ein fünfzehnjähriger Junge. Du bist inzwischen ein Mann geworden.«
Er fing an, von seinen Geschäften zu erzählen. Nicolas langweilte sich, betrachtete die große beleibte Gestalt des Schwagers und dachte, dass er sich in den zehn Jahren nicht verändert hatte, seine Schwester hingegen, gütiger Himmel! Sie war nie schlank gewesen, aber jetzt war sie fett. Sie hofften immer noch auf Kinder, verständlich, sie wünschten sich einen Erben für das Handelshaus.
Maximilien sah nach einiger Zeit zur Uhr auf dem Kaminsims: »Es ist Zeit für das Diner.«
Als sie durch die Halle gingen, hörten sie aus dem Speisezimmer die schrille Stimme einer Frau:
»Schlampe! Ein Ei! Wie kann man ein Ei zu Boden fallen lassen! Ich werde dir den Lohn für die kommende Woche um die Hälfte kürzen, verschwinde jetzt!«
Die Tür des Speisezimmers öffnete sich, und ein junges Mädchen rannte weinend durch die Halle. Nicolas sah ihr erstaunt nach und empfand Mitleid mit der Gescholtenen.
Maximilien brummte: »Johanna hat recht, wenn sie die Diener hart bestraft. Dieses Volk ruiniert uns mit seiner nachlässigen Arbeit.«
Sie betraten das Speisezimmer.
Johanna kam ihnen mit hochrotem Kopf entgegen. »Mit der Dienerschaft hat man nur Ärger, aber nun wollen wir das Diner genießen.«
Nicolas betrachtete erstaunt den langen Eichentisch, der mit Damast, Silbergeschirr und Kristallgläsern gedeckt war. Auf dem Damast waren rote Rosenblätter verstreut. Vor dem Platz des Hausherrn stand eine Kristallkaraffe mit Rotwein.
Johanna beobachtete den Bruder und sagte: »An Sonn- und Feiertagen und wenn wir Gäste haben speisen wir von Silber, an Werktagen von Zinngeschirr. Du bist heute unser Gast, also Silber.«
Maximilien setzte sich auf den hohen gepolsterten Armstuhl am oberen Ende des Tisches, Johanna und Nicolas nahmen rechts und links von ihm Platz.
Maximilien goss Wein in die Gläser.
»Auf dein Wohl, Nicolas.«
»Ich danke euch für die Gastfreundschaft.«
Ein Diener servierte als ersten Gang eine cremige Spargelsuppe mit vielen Spargelstückchen. Als die Teller gefüllt waren, begann das Ehepaar gierig zu essen.
»Guten Appetit«, sagte Nicolas.
Maximilien und Johanna schwiegen.
Nicolas begann, langsam die Suppe zu löffeln, und musterte das rosafarbene Kleid der Schwester und die rosa Haube. Eine dunkle Farbe wäre kleidsamer bei ihrem Umfang, ging es ihm durch den Kopf.
Seine Augen wanderten durch das Zimmer. An einer Wand stand ein großer Eichenschrank, hinter dessen Glastüren Silber und Kristall funkelten. An einer anderen Wand sah er eine eichene Kommode, auf der zwei vielarmige Kerzenleuchter aus Zinn standen. An den Wänden hingen Gobelins. Auf einer Truhe prangte ein großer Strauß roter Rosen.
Er sah die Schwester an. »Dieses Zimmer erinnert mich an den Speiseraum unseres Elternhauses. Allerdings gab es dort keine teuren Glastüren vor den Schränken.«
Johanna lächelte geschmeichelt. »Im Herbst, wenn es anfängt, kühl zu werden, liegen in der Halle und in allen bewohnten Räumen gewebte Teppiche aus Persien.«
Während sie auf den zweiten Gang warteten, fragte Maximilien: »Wie lange willst du in Pau bleiben?«
»Zunächst bis Ende Juni, von Juli bis Ende September reise ich durch Navarra, um zu predigen. Dann werde ich hier als Pfarrer tätig sein.«
Der Schwager überlegte: »Du kannst nach deiner Rückkehr natürlich wieder bei uns leben, bis du eine Wohnung gefunden hast. Meine Frau und ich erwarten, dass du einen Unkostenbeitrag zum Haushalt leistest. Wir können es uns nicht leisten, jemand, auch wenn er zur Verwandtschaft gehört, einige Wochen oder sogar Monate kostenlos zu verpflegen.«
Nicolas war im ersten Moment sprachlos. Die Armut, überlegte er, fing anscheinend bei Glastüren und Perserteppichen an. Nach seiner Rückkehr würde er sich sofort eine eigene Wohnung suchen.
»Ich bin selbstverständlich bereit, für Kost und Logis zu bezahlen.«
Der zweite Gang wurde serviert. Spargel mit zerlassener Butter und geräuchertem Schinken.
»Ah«, rief Johanna, »das ist der letzte Spargel, der heute gestochen wurde.« Sie schob sich eine Stange nach der anderen in den Mund.
Maximilien füllte die Gläser erneut und gab sich dann ebenfalls den kulinarischen Genüssen hin.
Nicolas beobachtete das Paar und sagte nach einer Weile: »Wusstet ihr, dass die Königin von Navarra Geschichten schreibt?«
Die Verwandten schwiegen.
Der dritte Gang war Huhn in Mandelsauce. Nicolas dachte daran, dass sein Glaube ihm zwei Gänge erlaubte. War es nicht unhöflich gegenüber den Gastgebern, nach zwei Gängen aufzuhören?
Er verspeiste folglich ein Hühnerbein und sagte: »Die Königin möchte sich mit mir jeden Nachmittag über religiöse und philosophische Probleme unterhalten.«
Die Verwandten schwiegen nach wie vor.
Der vierte Gang war gefülltes Spanferkel.
»Danke«, sagte Nicolas zu dem Diener, als der eine Scheibe Fleisch auf den Teller legen wollte.
Johanna sah den Bruder erstaunt an. »Schmeckt es dir nicht?«
»Es ist alles köstlich zubereitet, aber ich bin nicht gewohnt, so viel zu essen. Du weißt ja, dass Calvin an Werktagen nur zwei Gänge erlaubt.«
»Dieser Calvin scheint ziemlich verschroben zu sein. Nur zwei Gänge, schwarze Kleider. Willst du bis an dein Lebensende nur noch Schwarz tragen?«
»Ja.«
»Nun, das ist deine Angelegenheit, das Leben ist dazu da, um es zu genießen.«
Nach dem Spanferkel wurden noch Fleisch in Gelee aufgetragen, Mandelcreme und Schichttorte mit Trockenfrüchten.
Nicolas atmete auf, als zum Abschluss des Mahls der Würzwein Hippokras und kandierte Früchte serviert wurden.
»Ich möchte noch einen Spaziergang machen, vor der Stadt, in der Natur.«
Maximilien sah zur Uhr. »Das ist jetzt nicht mehr möglich, die Stadttore wurden eben geschlossen. Es gibt einen Spazierweg entlang der Stadtmauer. Du gehst durch die Küche, über den Wirtschaftshof, durch den Garten, am Ende ist ein Tor. Dahinter liegt in einiger Entfernung die Stadtmauer.«
Nicolas ging durch die Halle zur Küche. Dort saß die Dienerschaft an einem langen Tisch bei der Abendmahlzeit.
»Guten Abend und guten Appetit«, sagte Nicolas, blieb stehen und betrachtete die Speisen.
Er sah Holznäpfe mit einer dünnen Gemüsesuppe, neben jedem Napf lag ein Stück dunkles Brot. Eine Ahnung stieg in ihm auf, und er fragte den Koch: »Ist dies alles, was ihr am Abend esst?«
»Ja.«
»Gibt es wenigstens etwas Fleisch in der Suppe?«
»Nein. Wir bekommen kein Fleisch zu essen.«
Nicolas betrachtete die Holzbecher. »Bekommt ihr wenigstens Wein zu trinken?«
»Nein, wir trinken Wasser. Der Metzger gibt mir manchmal ein paar Fleischabfälle, damit ich uns eine nahrhafte Mahlzeit kochen kann.«
»Das ist die Höhe, ihr müsst arbeiten, und um bei Kräften zu bleiben, müsst ihr auch gut essen. Ich werde ab morgen jeden Tag Fleisch kaufen, und ihr bereitet eine nahrhafte Mahlzeit zu.«
»Vielen Dank, Monsieur Cauvin«, sagte der Koch, und die Diener, die Mägde, der Kutscher und der Stallknecht riefen: »Vielen Dank, Gott schenke Euch ein langes Leben, Monsieur Cauvin.«
Als Nicolas an der Stadtmauer entlang spazierte, dachte er über seine Schwester nach. War sie schon immer geizig und hartherzig gewesen, oder war sie in der Ehe mit dem Geschäftsmann so geworden?
Dieses schweigsame Abendessen, das Paar war nur damit beschäftigt, Speisen in sich hineinzuschaufeln, widerlich.
Nach seiner Rückkehr im Herbst würde er mit Johanna reden und versuchen, der Dienerschaft das Leben zu erleichtern.
Am Nachmittag des 30. Juni saß Nicolas neben der Königin am Springbrunnen.
Margarethe lächelte ihm zu. »Ich danke Euch für die interessanten Gespräche, Monsieur Cauvin. Ein Problem beschäftigt mich nach wie vor, das Abscheiden der Seele vom Körper. Wie merkt man es, gibt es Anzeichen dafür?«
»Ein Mensch, der stirbt, spürt wahrscheinlich, wie seine Seele den Körper verlässt. Ist es für die Umgebung wirklich wichtig, dieses sehr persönliche Erlebnis zu beobachten?«
»Das ist ein neuer Gesichtspunkt, ich muss darüber nachdenken.«
Sie nahm ein neben ihr liegendes Heft und reichte es Nicolas: »Eine Hofdame hat meine Geschichten abgeschrieben. Ich hoffe, dass Ihr Euch nach einem Arbeitstag am Abend bei dieser Lektüre entspannen könnt. Nach Eurer Rückkehr im Herbst möchte ich mich mit Euch über die Geschichten unterhalten.«
Nicolas schlug das Heft auf, sah die handschriftliche Widmung und starrte die Königin an: »Majestät, was für eine Ehre! Eine Widmung von Eurer Hand, es fehlen mir die Worte, um Euch zu danken.«
»Ich schätze Euch als Mensch, Monsieur Cauvin.«
Auf dem Heimweg kaufte Nicolas Hammelfleisch und einige Knoblauchknollen, brachte alles zum Koch und sagte: »Heute ist mein letzter Abend in Pau. Ihr und die Dienerschaft sollen sich heute einmal an einem Hammelragout satt essen. Der Knoblauch macht das Fleisch bekömmlicher.«
»Herzlichen Dank, Monsieur Cauvin, allerdings mag meine Herrschaft keinen Knoblauch.«
Nicolas lachte. »Das Ragout mit Knoblauch sollt ihr und die Diener und Mägde essen, nicht die Herrschaft.«
Er ging durch die Küche in die Halle und blieb erstaunt stehen.
Johanna lief aufgeregt umher und schrie: »Eine Unverschämtheit! Was denkt dieses freche alte Weib, wer sie ist?«
Maximilien lehnte am Kamin und erwiderte: »Beruhige dich, sie wird nicht bei uns wohnen. Ich werde ihr noch heute schreiben und ihr mitteilen, dass wir es uns nicht leisten können, sie hier aufzunehmen.«
Nicolas erschrak. Bei dem alten Weib musste es sich um seine Mutter handeln. Maximiliens Eltern waren tot.
Er trat in die Mitte der Halle: »Was geht hier vor? Was ist passiert?«
Johanna drehte sich zu ihm und funkelte ihn zornig an. »Vorhin erhielt ich einen Brief unserer Mutter. Charles musste das Geschäft verkaufen, er ist darüber vor Kummer gestorben. Seine Witwe ist mit den Kindern zu ihren reichen Eltern nach Antwerpen gereist. Sie will mit unserer Familie nichts mehr zu tun haben. Unsere Mutter hat in dem verkauften Haus lebenslanges Wohnrecht. Sie lebt mit einer Dienerin im Erdgeschoss und ist bestens versorgt. Sie ist zwar kränklich, aber noch reisefähig. Sie bittet, dass ich sie in meinem Haus aufnehme. Sie will ihren Unterhalt bei uns bezahlen und eine Pflegerin, falls es notwendig werden sollte. Ich bin nicht bereit, eine alte Frau, die vielleicht nicht mehr ganz richtig im Kopf ist, hier aufzunehmen.«
»Wie, bitte? Johanna, diese alte Frau ist unsere Mutter. Ich rede jetzt nicht von christlicher Nächstenliebe, aber wir, die Kinder, sind moralisch verpflichtet, ihr zu helfen. Warum willst du sie nicht aufnehmen? Sie kann eine Pflegerin bezahlen und wird dir nicht zur Last fallen.«
»Ich kann den Anblick unserer Mutter nicht ertragen. Sie hat mich nie geliebt, sie liebte nur Charles und dich, dich vor allem. Ich hasse meine Mutter!«
Maximilien ging zu Nicolas. »Meine Schwiegermutter bleibt in Paris, das ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit.«
Nicolas starrte in Johannas gerötetes dickes Gesicht, das zu einer hässlichen Fratze verzerrt war. Sie war nicht mehr seine Schwester, er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben.
Er sah den Schwager an. »Du wirst meiner Mutter nicht schreiben, dass sie bei euch nicht leben kann. Ich reise morgen nach Paris und werde mich um sie kümmern.«
»Tu, was du nicht lassen kannst«, antwortete Maximilien spöttisch, »aber bedenke, dass die Protestanten in Frankreich verfolgt werden.«
»Das interessiert mich nicht.«
Die Abendmahlzeit verlief schweigend. Als der Diener Hippokras und kandierte Früchte servierte, wehte durch die Tür ein Duft von gebratenem Hammelfleisch und Knoblauch ins Zimmer.
Johanna schnupperte und sagte zu ihrem Mann: »Merkwürdig, ich habe nicht angeordnet, dass wir morgen Hammelfleisch essen, und dieser Knoblauchgeruch ist einfach widerlich.«
Nicolas sah die Schwester an.
»Am Tag meiner Ankunft beobachtete ich, dass du die Dienerschaft hungern lässt. Ich kaufte jeden Abend Fleisch, und der Koch bereitete eine nahrhafte Mahlzeit zu. Du hast bisher nichts gemerkt, weil Geflügel nicht so intensiv duftet wie Hammelfleisch.«
Johanna starrte den Bruder einen Augenblick an, dann fing sie an zu schreien: »Was fällt dir ein, dich in meinen Haushalt einzumischen? Es geht dich nichts an, wie ich die Dienerschaft behandele!«
Nicolas sprang auf. »Morgen verlasse ich dieses unchristliche Haus, und ich werde es nie mehr betreten. Gute Nacht.«
Er eilte aus dem Zimmer und warf die Tür hinter sich zu.
Maximilien begann zu lachen. »Lass deinen Bruder laufen, Johanna, er ist ein verschrobener Kerl.«
Nicolas eilte in sein Zimmer hinauf, nahm den Mantelsack und begann zu packen.
Als er fertig war, fielen ihm die Worte des Schwagers ein, und er sank entsetzt auf einen Stuhl. Die Protestanten wurden in Frankreich verfolgt, seine schwarzen Kleider würden ihn verraten. Was sollte er jetzt tun? Es gab nur einen Menschen, der ihm helfen konnte: die Königin. Er musste sofort zu ihr. Hoffentlich hatte sie Zeit, ihn zu empfangen.
Er nahm den Mantelsack, verließ das Haus, sattelte im Stall sein Pferd und ritt zum Schloss.
Margarethe saß in ihrem Arbeitszimmer und schrieb eine neue Liebesgeschichte. Sie sah erstaunt auf, als ein Diener den Pfarrer Cauvin meldete.
Als Nicolas eintrat, stand sie auf und ging auf ihn zu. »Monsieur Cauvin, ist etwas passiert? Ihr wirkt erregt.«
Sie führte ihn zu einer Bank und setzte sich neben ihn.
»Majestät, ich bitte um Vergebung, dass ich Euch zu dieser späten Stunde störe. Vorhin erfuhr ich, dass meine Mutter in Paris krank ist. Ich muss sofort zu ihr reisen und mich um sie kümmern.«
»Kann Eure Schwester sich nicht um die Mutter kümmern?«
Nicolas sah verlegen zu Boden.
»Ich verstehe, sie will sich nicht kümmern. Ihr könnt im Schloss übernachten, und morgen bekommt Ihr farbige Kleider, damit man Euch in Frankreich nicht als Protestanten erkennt.«
»Danke, Majestät, es gibt noch ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich in Paris meinen Lebensunterhalt verdienen soll. Als Anwalt kann ich nicht arbeiten, weil ich mich nach dem Abschluss meines juristischen Studiums nicht mehr mit der Rechtsprechung beschäftigt habe.«
»Anne de Montmorency ist der fähigste französische Heerführer«, überlegte die Königin. »Er war eng mit meinem seligen Bruder Franz befreundet. Die Montmorencys sympathisieren seit Jahren mit den Protestanten. Mein Neffe Heinrich toleriert das, weil er sich nicht mit einer Familie des französischen Hochadels verfeinden will.
Ich schreibe noch heute einen Brief an Montmorency, den Ihr ihm überreicht. Montmorency wird Euch helfen, und unter vier Augen könnt Ihr ihm sagen, dass Ihr protestantischer Pfarrer seid.«
*
Nicolas Cauvin sah seine Tochter an und lächelte.
»Genau betrachtet, habe ich es der Königin Margarethe zu verdanken, dass ich deine Mutter kennenlernte. Montmorency stellte mich als seinen persönlichen Sekretär ein. Ich wohnte in seinem Palais, speiste an seiner Tafel, wurde gut bezahlt und hatte genügend Zeit, mich um meine Mutter zu kümmern.
Am 21. Dezember 1549 starb die Königin von Navarra.
Der verwitwete König bat seine Tochter Johanna, die Erbin von Navarra, mit ihrem Gatten Anton von Bourbon in die Heimat zurückzukehren.
Einige Tage vor der Abreise besuchte Johanna Montmorency. Ich sah sie flüchtig und fand sie unsympathisch. Sie war und ist eine reizlose Frau. Das fahle blonde Haar, der graue Teint und der schmale verkniffene Mund gefielen mir nicht. Was mich aber besonders abstieß, war der fanatische Blick ihrer Augen.
Montmorency vertraute mir später den Inhalt der Unterredung an: Sie war entschlossen, allmählich den protestantischen Glauben in Navarra einzuführen und nach dem Tod des Vaters den Protestantismus zur Staatsreligion zu erklären und zu ihm überzutreten. Allerdings wollte sie für diesen wichtigen Schritt den richtigen politischen Zeitpunkt abwarten. Sie bat Montmorency, nach guten Predigern auszuschauen, die dann in Navarra als Pfarrer arbeiten sollten. Montmorency empfahl zunächst mich. Ich war erleichtert, dass sich für mich eine neue Perspektive eröffnete, denn die Arbeit als Sekretär war langweilig.
Im Spätsommer 1553 starb meine Mutter. Einige Wochen später traf ein Brief der Erbin von Navarra bei Montmorency ein mit der Bitte, mich zu Beginn des neuen Jahres nach Navarra zu schicken. Sie habe beschlossen, ich solle der Pfarrer in Pau werden.
Der alte König wurde immer schwächer, und sie rechnete damit, bald Königin von Navarra zu werden.
Im Herbst reiste Montmorency im Auftrag des Königs nach Orléans. Ich begleitete ihn. In Orléans lebte ein alter Freund Montmorencys mit seiner Familie. Es ergab sich bald ein reger gesellschaftlicher Kontakt, und wenn der Graf und die Gräfin de Menthon bei uns zur Tafel weilten, war ich ebenfalls anwesend und beteiligte mich an der Unterhaltung, soweit es meiner Stellung als Sekretär ziemte.
Mitte November erhielt Montmorency eine Einladung ins Palais des Grafen zur Geburtstagsfeier seiner einzigen Tochter am 24. November. Montmorency sollte mich mitbringen, weil der Graf beeindruckt davon war, welche geistigen Beiträge ich zur Unterhaltung beisteuerte.
An jenem Abend begegnete ich deiner Mutter zum ersten Mal, den Rest der Geschichte kennst du.«
Nicolas Cauvin schwieg, und Margot atmete tief durch.
»Was für ein aufregendes Leben Ihr hattet.« Sie trank einen Schluck Wein. »Vater, vorhin habt Ihr gesagt, ich würde meiner Mutter immer ähnlicher, nicht nur äußerlich. Wie meintet Ihr das?«
Der Pfarrer betrachtete die Tochter, und seine Gedanken wanderten zurück.
3. Kapitel
Der 1. Dezember 1553 war ein trüber, frühwinterlicher Tag. Es dämmerte schon, als Nicolas Cauvin die Kathedrale Sainte-Croix in Orléans betrat. Er tauchte zwei Finger der rechten Hand ins Weihwasserbecken, bekreuzigte sich und ging langsam zu einem der Seitenschiffe. Dort knieten einige Frauen und ließen eine Perle des Rosenkranzes nach der anderen durch die Hände gleiten.
Sie beteten das Ave Maria, das ihnen nach der Beichte als Sühne auferlegt wurde, und sie glaubten daran, dass ihnen ihre Sünden von Gott vergeben wurden. Fühlten sie sich auch von der Schuld befreit, die sie durch eine Sünde auf sich geladen hatten?
Eines wusste er: Angenommen, er hätte gebeichtet und die Absolution empfangen, das Gefühl der Schuld gegenüber Katharina würde immer noch auf ihm lasten.
Was war nur los mit ihm während der vergangenen Tage?
Am 24. November war Katharinas Geburtstagsfest gewesen. Sie hatten sich unterhalten, und plötzlich hatte die Liebe wie ein Blitz bei ihnen eingeschlagen.
Man konnte sich gegen die Liebe auf den ersten Blick nicht wehren, aber am nächsten Tag hatte er seine Gefühle nicht kontrolliert. Die Amme brachte ihm ein Billett, worin Katharina fragte, wann und wo sie sich treffen könnten. Statt ihr zu schreiben, dass es für sie beide keine Zukunft gebe, weil er – abgesehen vom Standesunterschied – protestantischer Pfarrer war, hatte er sich mit ihr getroffen. Er gab sich völlig dem Gefühl der Liebe hin. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er für ein Mädchen solch eine innige Zuneigung empfand. Und er dachte nicht an die Zukunft. Gestern, sieben Tage nach ihrer ersten Begegnung, erwachte er langsam aus seinem Traum … Der Garten hinter Montmorencys Palais, wo ihnen am Spätnachmittag niemand begegnen würde …
»Katharina, es gibt für uns keine Zukunft, denkt an den Standesunterschied! Euer Vater würde uns nie seinen Segen geben.«
»Der Standesunterschied interessiert mich nicht. Ich will den Mann heiraten, den ich liebe. Montmorency besitzt großen Einfluss am Hof, er wird dafür sorgen, dass der König Euch in den Adelsstand erhebt und Euch Ländereien schenkt.«
»Katharina, das ist unmöglich, weil …«
Er schwieg. Er brachte nicht die Kraft auf, ihr zu gestehen, dass er Protestant war.
»Es ist nicht unmöglich, es sei denn, Ihr liebt mich nicht aufrichtig.«
»Ich liebe Euch aufrichtig.«
Sie sah ihn an und lächelte: »Was zögert Ihr? Geht morgen zu meinem Vater und bittet ihn um meine Hand, versprecht es mir.«
»Ich verspreche es.«
In diesem Augenblick tauchte die füllige Gestalt einer älteren Frau auf.
»Meine Amme, hoffentlich vermisst man mich zu Hause nicht.« Katharina eilte zu der Frau. Er sah ihnen nach und beschloss, ihr am nächsten Tag zu gestehen, dass er Protestant sei.
Er sandte ihr ein Billett und bat sie, am nächsten Tag um fünf Uhr zur hinteren Seite der Kathedrale zu kommen. Er faltete die Hände und betete leise: »Lieber Gott, gib Katharina die Kraft, dass sie den Kummer, den ich ihr jetzt bereite, erträgt, gib, dass sie mich vergisst. Gib mir die Kraft, ihr die Wahrheit zu sagen, lieber Gott, vergib mir die Schuld, ich habe mich an dem jungen, unschuldigen Mädchen versündigt, weil ich mich nicht beherrschen konnte und mich meinem Liebesgefühl hingab.«
Er verließ die Kathedrale, und während er langsam zum Treffpunkt ging, hörte er die fünfte Stunde schlagen.
Als er um die Ecke bog, sah er im Halbdunkel zwei Frauen.
Katharina trug einen schwarzen Samtmantel und eine dunkelrote Samthaube. Ihr Gesicht war zur Hälfte mit einer schwarzen Maske verdeckt, auch die Amme trug an jenem Nachmittag eine schwarze Halbmaske.
Er ging zu ihnen, und Katharina sagte zu der Amme: »Madeleine, wir sind hier zwar ungestört, achte trotzdem darauf, dass niemand kommt.«
Die Amme entfernte sich, und Katharina umarmte Nicolas und presste ihr Gesicht an seine Brust.