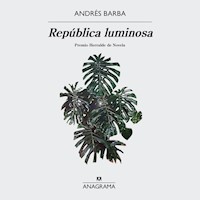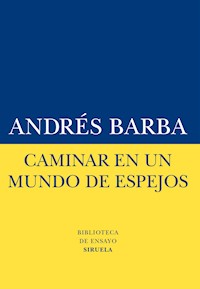14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andrés Barbas international gefeierter Roman ist eine mitreißende Geschichte über die drängenden moralischen Fragen unserer Zeit: die Angst vor dem Fremden, die Verletzlichkeit der Zivilisation und den schmalen Grat zwischen Vernunft und Paranoia.
Dichter grüner Regenwald, tropische Trägheit: San Cristóbal ist eine verschlafene lateinamerikanische Provinzstadt, bis eines Tages wildfremde Kinder von der anderen Seite des schlammig-breiten Eré-Flusses dort einfallen und die Ruhe stören. Niemand kennt sie. Niemand weiß, woher sie kommen. Niemand versteht ihre Sprache. Sie haben Hunger, sie stehlen, sie jagen den Menschen Angst ein.
Die Bewohner von San Cristóbal stehen zunehmend unter Druck: Wie lange wollen sie dem Ganzen tatenlos zusehen? Wie unschuldig sind Kinder? Darf man Böses mit Bösem vergelten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Die Tage sind tropisch-heiß. Das Leben geht seinen trägen Gang in San Cristobál bis zu jenem Tag, als 32 wildfremde Kinder in der Provinzstadt im argentinischen Regenwald auftauchen. Niemand kennt sie. Niemand weiß, woher sie kommen. Niemand versteht ihre Sprache. Die Kinder haben Hunger, sie stehlen, sie jagen den Menschen Angst ein. Und dann beginnen auch noch die eigenen Kinder der Stadtbewohner im Urwald jenseits des schlammig-braunen Eré-Flusses zu verschwinden …
Zwanzig Jahre später schreibt einer der Augenzeugen auf, was in jenem schicksalhaften Sommer geschah, als Angst die Stadt regierte, niemand die bösen Vorzeichen sehen wollte und die »Leuchtende Republik« der Kinder das Gewissen aller auf die Probe stellte.
Andrés Barbas international gefeierter Roman ist eine mitreißende Geschichte über die universelle Angst vor dem Fremden und die Verletzlichkeit unserer Zivilisation.
»Einer der größten zeitgenössischen Schriftsteller Spaniens«. Le Monde
»Überwältigend.« Colm Tóibín
Zum Autor
Andrés Barba, 1975 in Madrid geboren, zählt zu den »zehn besten zeitgenössischen Schriftstellern Spaniens« (Granta). Mit »Die leuchtende Republik« gelang ihm der internationale Durchbruch. Der Roman erscheint in 21 Sprachen. Er wurde außerdem mit dem Premio Herralde de Novela ausgezeichnet. Andrés Barba lebt in Argentinien.
Andrés Barba
Die leuchtende Republik
Roman
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
Luchterhand
Die spanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »República luminosa« bei Editorial Anagrama, Barcelona.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links und Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Übersetzung dieses Buches wurde von Acción Cultural Española (AC/E) unterstützt.
Copyright © 2017 Andrés Barba
Copyright © der deutschen Ausgabe
2022 Luchterhand Literaturverlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt
nach einem Entwurf von Luke Bird unter Verwendung
eines Motivs von © Anna Jonczyk/Arcangel;
Napon Tippayamontol / Alamy Stock Photo
Autorenfoto: © Eduardo Carrera
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-23710-3V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Für Carmen,
die aus roter Erde gemacht ist
Ich bin zwei Dinge, die niemals lächerlich sind:
ein Wilder und ein Kind.
Paul Gauguin
Fragt man mich nach den 32 Kindern, die in San Cristóbal umgekommen sind, variiert meine Antwort je nach Alter meines Gesprächspartners. Einem Gleichaltrigen antworte ich, dass unser Verstand zusammensetzt, was wir bloß bruchstückhaft gesehen haben, einen Jüngeren frage ich, ob er an böse Vorzeichen glaube. Fast jeder verneint das, als wäre dieser Glaube eine Missachtung der Freiheit. Ich dringe nicht weiter in sie, sondern erzähle ihnen meine Version der Ereignisse, denn mehr habe ich nicht, und es wäre sinnlos, sie davon zu überzeugen, dass es weniger um eine Bekräftigung der Freiheit geht als darum, nicht so naiv an die Gerechtigkeit zu glauben. Wäre ich etwas entschlossener oder nicht ganz so feige, würde ich meine Geschichte immer mit demselben Satz beginnen: Fast alle Welt bekommt, was sie verdient, und böse Vorzeichen gibt es. Und wie es sie gibt.
Als ich in San Cristóbal eintraf – zweiundzwanzig Jahre ist das her –, war ich als junger Beamter der Sozialbehörde in Estepí auf diesen Posten befördert worden. In nur wenigen Jahren war aus einem dünnen Jurastudenten ein frisch verheirateter Mann geworden, den das Glück gewiss besser aussehen ließ, als ihm von Natur aus gegeben war. Das Leben schien mir eine simple Folge relativ leicht zu überwindender Widrigkeiten zu sein, die schließlich in den Tod mündeten, ob leicht oder nicht, jedenfalls so unausweichlich, dass es nicht die Mühe lohnte, sich Gedanken darüber zu machen. Damals wusste ich nicht, dass auch die Freude nichts anderes ist, nichts anderes die Jugend, nichts anderes der Tod, und obwohl ich im Grunde nicht falschlag, lag ich doch in allem falsch. Ich hatte mich in eine Geigenlehrerin aus San Cristóbal verliebt, drei Jahre älter als ich, Mutter einer neunjährigen Tochter. Beide hießen sie Maia, beide hatten sie eindringliche Augen, eine kleine Nase und braune Lippen, die ich für den Gipfel der Schönheit hielt. Manchmal war mir, als hätten sie mich in geheimer Versammlung erwählt, so glücklich war ich, in ihr »Netz« gegangen zu sein, und als man mir den Posten in San Cristóbal anbot, rannte ich zu ihr, um es ihr zu erzählen, und machte ihr kurzerhand einen Heiratsantrag.
Die Stelle hatte man mir angeboten, weil ich in Estepí zwei Jahre zuvor ein Programm zur Integration indigener Gemeinschaften entworfen hatte. Die Idee war einfach und erwies sich als ein taugliches Modell. Sie bestand darin, den Ureinwohnern das Vorrecht auf den Anbau bestimmter Produkte abzutreten. Bei uns in der Stadt entschieden wir uns für Orangen und überließen der indigenen Gemeinde die Versorgung von fast fünftausend Menschen. Die Verteilung drohte zunächst im Chaos zu enden, aber dann lenkte die Gemeinde ein und formierte sich neu als kleine, solvente Genossenschaft, die noch heute einen Großteil ihrer Ausgaben finanzieren kann.
Das Programm war so erfolgreich, dass die Landesregierung über die Kommission für indigene Reservate mit mir in Verbindung trat, damit ich ein Gleiches mit den dreitausend Mitgliedern von San Cristóbals Ñeê-Gemeinde versuchte. Sie boten mir ein Haus und eine leitende Stelle in der Sozialbehörde. Maia nahm bei der Gelegenheit ihren Unterricht in der kleinen Musikschule ihrer Heimatstadt wieder auf. Sie gab es nicht zu, doch ich wusste, wie freudig sie unter so günstigen Bedingungen in die Stadt zurückkehrte, die sie notgedrungen hatte verlassen müssen. Sie bezahlten auch die Schule des Mädchens (ich nannte sie immer »das Mädchen«, und wenn ich mich direkt an sie wandte, »Mädchen«) und ein Gehalt, bei dem wir Geld beiseitelegen konnten. Was wollte ich mehr? Ich hatte Mühe, meine Freude zu bezähmen, und bat Maia, mir vom Urwald, vom Eré-Fluss, von San Cristóbals Straßen zu erzählen … Beim Zuhören tauchte ich ein in die dichte, erdrückende Vegetation und traf auf einen paradiesischen Ort. Sehr originell war meine Fantasie wohl nicht, aber niemand kann behaupten, sie wäre nicht optimistisch gewesen.
Wir trafen am 13. April 1993 in San Cristóbal ein. Die feuchte Hitze war gewaltig, der Himmel wolkenlos. Als wir mit unserem Familienkleinbus bergan fuhren, sah ich in der Ferne zum ersten Mal die gewaltigen braunen Wassermassen des Eré und San Cristóbals Urwald, dieses undurchdringliche grüne Ungeheuer. Ich war das subtropische Klima nicht gewohnt, mein Körper schweißgebadet, seit wir die rote Lehmstraße genommen hatten, die von der Autobahn Richtung Stadt abzweigte. Die Reise von Estepí (fast tausend Kilometer) hatte mich in eine Art Melancholie getaucht und benommen gemacht. Bei der Ankunft hatte sich zunächst ein Traumbild aufgetan, gleich wieder abgelöst durch das Schroffe der Armut. Ich war auf eine arme Provinz vorbereitet gewesen, aber die tatsächliche Armut hat nur wenig mit den Vorstellungen gemein, die man sich von ihr macht. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass der Urwald die Armut nivelliert, ausgleicht und in gewisser Weise sogar verschwinden lässt. Ein Bürgermeister der Stadt hatte einmal gesagt, San Cristóbals Problem sei es, dass das Heruntergekommene nur einen kleinen Schritt vom Pittoresken entfernt sei. Das stimmt aufs Wort. Die Gesichter der Ñeê-Kinder sind allzu fotogen, trotz des Drecks – oder vielleicht gerade deswegen –, und das subtropische Klima befördert das Trugbild, dass ihr Zustand etwas Unvermeidliches hat. Anders gesagt: Der Mensch kann gegen den Menschen kämpfen, aber nicht gegen einen Wasserfall oder ein Gewitter.
Doch vom Wagenfenster aus hatte ich noch etwas anderes festgestellt: San Cristóbals Armut ging bis auf die Knochen. Die Farben waren Grundfarben ohne Tiefe und glänzten verstörend: das intensive Grün des Urwalds, der sich an die Landstraße schmiegte wie eine pflanzliche Mauer, das leuchtende Rot der Erde, das Blau des Himmels mit diesem Licht, bei dem man ständig die Augen zusammenkneifen musste, das geballte Braun des Eré, vier Kilometer von Ufer zu Ufer, all das zeigte mir deutlich, dass meine geistigen Vorräte nichts aufzuweisen hatten, womit sich vergleichen ließ, was ich da zum ersten Mal sah.
Nach unserem Eintreffen in der Stadt gingen wir ins Rathaus, um die Schlüssel für unser Haus zu holen, und ein Beamter begleitete uns im Wagen und wies uns den Weg. Kurz bevor wir ankamen, tauchte auf einmal in zwei Metern Entfernung ein riesiger Schäferhund auf. Der Eindruck – bestimmt hervorgerufen von der Erschöpfung nach der Reise – glich fast einer Fata Morgana, als wäre der Hund nicht vors Auto gelaufen, sondern hätte plötzlich mitten auf der Straße Gestalt angenommen. Ich hatte keine Zeit zum Bremsen. Mit aller Kraft packte ich das Lenkrad, spürte an den Händen den Aufprall und dieses Geräusch, das man nur einmal hören muss und nie wieder vergisst: das eines Körpers, der gegen eine Stoßstange prallt. Hastig stiegen wir aus. Es war eine Hündin; schwer verletzt hechelte sie und mied unseren Blick, als schämte sie sich.
Maia beugte sich über sie und strich ihr mit der Hand über den Rücken, eine Geste, auf die die Hündin mit einem Schwanzwedeln antwortete. Wir beschlossen, sie zu einem Tierarzt zu bringen, und in dem Wagen, mit dem wir sie gerade angefahren hatten, überkam mich das Gefühl, dass dieses wilde Straßentier zwei entgegengesetzte Dinge darstellte: ein erbärmliches Vorzeichen und eine wohltätige Präsenz. Eine Freundin, die mich in der Stadt willkommen hieß, aber auch eine Botin, die eine furchtbare Nachricht brachte. Mir schien, selbst Maias Gesicht hatte sich seit unserer Ankunft verändert, zum einen war es gewöhnlicher geworden – noch nie hatte ich so viele Frauen gesehen, die ihr glichen –, zum anderen undurchdringlicher. Ihre Haut wirkte weicher und zugleich widerstandsfähiger, ihr Blick härter, aber auch weniger starr. Sie hatte die Hündin auf den Schoß genommen, und das Blut des Tiers sickerte langsam in ihre Hose. Das Mädchen saß auf dem Rücksitz, den Blick fest auf die Wunde gerichtet. Immer wenn der Wagen über ein Schlagloch fuhr, wand sich das Tier und gab ein musikalisches Stöhnen von sich.
Es heißt, San Cristóbal hat man im Blut oder nicht, ein Klischee, das jeder auf den eigenen Geburtsort anwendet, überall auf der Welt, aber hier erlangt es eine weniger geläufige Dimension, eine besondere Wirklichkeit. Denn gerade das Blut muss sich an San Cristóbal gewöhnen, seine Temperatur ändern, sich dem Gewicht von Urwald und Fluss ergeben. Sogar der Eré mit seinen vier Kilometern Breite ist mir oft vorgekommen wie ein großer Fluss aus Blut, und manche Bäume der Gegend haben einen so dunklen Saft, dass sie kaum Pflanzen zu sein scheinen. Das Blut durchläuft alles, erfüllt alles. Hinter dem Grün des Urwalds, hinter dem Braun des Flusses, hinter dem Rot der Erde ist immer das Blut, ein Blut, das dahinfließt und die Dinge vollendet.
So war es für mich wortwörtlich eine Taufe. Als wir beim Tierarzt eintrafen, lag die Hündin praktisch im Sterben, und als ich sie aus dem Auto hob, befleckte mich eine zähe Flüssigkeit, die sich bei der Berührung mit meiner Kleidung schwarz färbte und widerlich salzig roch. Maia bestand darauf, dass das Bein geschient und die Rückenwunde genäht wurde, und die Hündin schloss die Augen, als wollte sie nicht länger kämpfen. Ihre Augen schienen sich nervös hinter den Lidern zu bewegen wie bei träumenden Menschen. Ich versuchte, mir vorzustellen, was sie vor sich sah, was für ein Vagabundenleben im Urwald in ihrem Gehirn ablief, und ich wünschte mir, dass sie gesund würde und überlebte, als hinge meine Sicherheit an diesem Ort in nicht geringem Maße davon ab. Ich ging zu ihr und legte meine Hand auf ihre heiße Schnauze, mit der Gewissheit, ja fast mit der Überzeugung, dass sie mich verstand und bei uns bleiben würde.
Zwei Stunden später lag die Hündin mit tränenden Augen im Hof unseres Hauses, und das Mädchen stellte ihr einen Napf mit Reis und Essensresten hin. Wir setzten uns nebeneinander, und ich sagte dem Mädchen, sie solle sich einen Namen ausdenken. Sie zog die Nase kraus, ihre übliche Geste der Unschlüssigkeit, und sagte: »Moira.« Und so heißt sie immer noch, während sie nach all den Jahren ein paar Schritte von mir entfernt vor sich hin döst, eine greise Hündin, die sich in den Flur gelegt hat. Moira. Da sie allen Vorhersagen zum Trotz bereits die Hälfte meiner Familie überlebt hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch den Rest der Familie überleben wird. Erst jetzt begreife ich ihre Botschaft.
Wenn ich mich an diese ersten Jahre in San Cristóbal zu erinnern versuche, kommt mir ein Musikstück in den Kopf, mit dem Maia auf der Geige schwer zu kämpfen hatte: »Die letzte Rose« von Heinrich Wilhelm Ernst, eine irische Weise, die auch Beethoven und Britten vertont hatten und die zweierlei zu verbinden scheint: eine etwas sentimentale Melodie mit einer überwältigenden Darbietung von Virtuosität. Der Kontrast zwischen Urwald und San Cristóbal war wie der zwischen diesen beiden Wahrheiten: auf der einen Seite die allzu unerbittliche, allzu unmenschliche Realität des Urwalds, auf der anderen eine ganz einfache, vielleicht weniger wahre Realität, die jedoch praktischer war und uns zu leben half.
Man kann auch nicht behaupten, San Cristóbal wäre eine große Überraschung gewesen: eine Provinzstadt von zweihunderttausend Einwohnern mit ihren eingesessenen Familien (die man hier »alt« nennt, als wären manche Familien älter als andere), ihren politischen Affären und ihrer subtropischen Lethargie. Ich gewöhnte mich besser und schneller ein, als ich angenommen hatte. Nach wenigen Monaten wetterte ich schon wie ein Einheimischer gegen den Eskapismus der Beamten, die Straffreiheit einiger Politiker und die Missstände in der Provinz, die in der Regel althergebracht, verzwickt und vollkommen unlösbar sind. Abgesehen von ihrem Unterricht an der Musikschule, gab Maia auch Señoritas aus San Cristóbals gehobener Gesellschaft Musikstunden, hochmütigen Mädchen, fast immer bildhübsch. Sie hatte sich wieder mit zwei, drei Freundinnen zusammengetan, die immer verstummten, sobald ich ins Haus trat, obwohl ich kurz vor dem Hereinkommen das Durcheinander ihrer lebhaften Stimmen gehört hatte. Sie unterrichteten klassische Musik wie Maia, stammten alle aus der Ñeê-Gemeinde und hatten ein Streichtrio gebildet, mit dem sie Konzerte in der Stadt und in den Provinzdörfern gaben, mit umwerfendem Erfolg, nicht so sehr wegen ihres guten Spiels, sondern weil niemand sonst solche Konzerte gab.
Jahrelang hatte mich dieser Widerspruch bei meiner Frau amüsiert, dass sie sich der klassischen Musik widmete, aber echte Musik für sie nur die war, nach der man tanzen konnte; doch nun verstand ich es vollkommen. Die klassische Musik war (für sie wie für all die Leute, die ihre Konzerte besuchten) weniger Musik als eine Art Stagnation. Sie war unter allzu fernen Bedingungen entstanden und für allzu unterschiedliche Gemüter, als dass es anders hätte sein können, doch das bedeutete nicht, dass sich dieses Publikum nicht von ihr bewegen ließ. Wenn Maia ihre Stücke spielte, setzten die Leute immer die gleiche konzentrierte Miene auf, als hörten sie eine besonders verführerische, doch deshalb nicht weniger unverständliche Fremdsprache. Sie widmete sich dem Spielen und Unterrichten so leidenschaftlich, weil sie unfähig war, eine Gefühlsbeziehung zu ihr aufzubauen. Für Maia war die klassische Musik etwas, was nur im Gehirn stattfand, während die andere Musik – Cumbia, Salsa, Merengue – in ihrem Körper, ihrem Bauch entstand.
Manchmal glaubt man, um tief in die Spalte der menschlichen Seele hinabzutauchen, brauche man ein mächtiges U-Boot, und am Ende erforscht man im Taucheranzug den Grund der Badewanne. Mit den Orten geht es ebenso. Kleinstädte zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie sich gleichen wie eine Wanze der anderen. Die einen wie die anderen perpetuieren die gleichen Mechanismen des ewigen Machterhalts, die gleichen Kreisläufe der Legalisierung und Vetternwirtschaft, die gleiche Dynamik. Ebenso bringen sie in regelmäßigen Abständen ihre kleinen Helden hervor: einen außergewöhnlichen Musiker, eine Richterin aus einer besonders revolutionären Familie oder eine Mutter Courage; aber selbst diese kleinen Helden scheinen Teil des Organismus zu sein, der mit ihrer Rebellion rechnet, um immer weiter fortzudauern. Das Kleinstadtleben ist gewöhnlich regelmäßig und vorhersehbar wie ein Metronom, dem zu entrinnen manchmal so undenkbar ist wie ein Sonnenaufgang im Westen. Aber eben das geschieht manchmal: Die Sonne geht im Westen auf.
Alle halten den Überfall auf den Dakota-Supermarkt für den Ursprung des Konflikts, doch das Problem hatte viel früher begonnen. Woher waren die Kinder gekommen? Der bekannteste Dokumentarfilm zu dem Thema, Valeria Danas’ tendenziöser, ja oft falscher Film Die Kleinen, beginnt mit diesem hochtrabenden Satz im Off zu den blutigen Bildern im Supermarkt: Woher waren die Kinder gekommen? Und doch ist das die große Frage. Woher? Hätte es keine Zeit ohne sie gegeben, man hätte fast denken können, sie wären schon immer durch unsere Straßen gestrichen, verdreckt, doch mit dieser seltsamen, winzigen Würde, das Haar zerzaust, die Gesichter sonnenverbrannt.
Schwer zu sagen, wann sich unser Blick an sie gewöhnte oder ob ihr erstes Auftauchen Überraschung bei uns ausgelöst hatte. Die am wenigsten absurde Theorie stammt vielleicht von Víctor Cobán, der in einer seiner Kolumnen in El Imparcial sagt, die Kinder seien in die Stadt »getröpfelt«, und man habe sie zunächst mit den Ñeê-Kindern verwechselt, die Zitronen und wilde Orchideen an den Ampeln verkauften. Manche Termitenarten können zeitweise ihre Erscheinung verändern und die anderer Arten annehmen, um in ein fremdes Milieu einzudringen; ihre wahre Erscheinung zeigen sie erst, wenn sie sesshaft geworden sind. Vielleicht hatten auch diese Kinder – mit der vorsprachlichen Intelligenz der Insekten – diese Taktik ergriffen und sich den Ñeê-Kindern angeglichen, die uns vertraut waren. Doch selbst wenn es so gewesen wäre, die Frage bliebe immer noch unbeantwortet: Woher waren sie gekommen? Und vor allem, warum waren sie alle zwischen neun und dreizehn?
Die einfachste (aber auch am wenigsten haltbare) These besagt, es seien geraubte Kinder aus der ganzen Provinz gewesen, die ein Netz von Menschenhändlern irgendwo im Urwald am Eré zusammengetrieben hatte. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Einige Jahre zuvor, 1989, hatte man sieben junge Mädchen befreit, die gerade über die Bordelle im ganzen Land »verteilt« werden sollten, und die Polizeifotos von der kleinen Farm mitten im Urwald, nur drei Kilometer von San Cristóbal entfernt, waren uns noch frisch im Gedächtnis. Wie manche Erlebnisse im Leben für immer die Naivität vertreiben, markierte dieses Bild in San Cristóbals Bewusstsein ein Vorher und Nachher. Man musste nicht nur einer unbestreitbaren sozialen Wirklichkeit ins Auge sehen, sondern die Scham, die sie hervorrief, hatte sich so tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt wie traumatische Ereignisse ins Wesen mancher Familien: stillschweigend.
Aus diesem Grund hatte man damals vermutet, die Kinder seien aus einem ähnlichen »Lager« geflohen und hätten sich über Nacht in der Stadt eingefunden. Die These – noch einmal: ohne jede Grundlage – stützte sich auf die wenig ehrenhafte Auszeichnung, dass wir bei Kindesraub unter den Provinzen im Land die erste Stelle einnahmen, doch hatte sie den Vorteil, die angeblich »unverständliche« Sprache zu erklären, die die 32 sprachen und die man für eine Fremdsprache hielt. Niemand schien damals eine simple Tatsache zu berücksichtigen: Diese These setzte voraus, dass es über Nacht plötzlich siebzig Prozent mehr bettelnde Kinder gab und niemand sich darüber beunruhigte.
Ich bin die Sitzungsprotokolle der Sozialbehörde durchgegangen (deren Leiter ich war, wie gesagt), die ganzen fraglichen Monate, und stelle fest, dass bettelnde Kinder am 15. Dezember 1994 zum ersten Mal als Tagesthema auftauchen, also gut zwei Wochen vor dem Angriff auf den Dakota-Supermarkt. Was so viel heißt – wenn man bedenkt, wie lange es in San Cristóbal dauert, bis die Behörden sich mit einem realen Problem befassen –, dass die Kinder wenigstens zwei, drei Monate vor diesem Datum in der Stadt aufgefallen sein mussten, das heißt, im September oder Oktober desselben Jahres.
Die These von einer Massenflucht aus einem Sammellager im Urwald ist in sich so widersprüchlich, dass sie fast glaubwürdiger wirkt als die »magische These« von Itaete Cadogán – dem Vertreter der Ñeê-Gemeinde –, über die so viel gelacht wurde und die besagt, die Kinder seien dem Fluss »entsprossen«. Nimmt man das Wort »entsprießen« nicht wörtlich, ist seine Annahme vielleicht nicht ganz so unsinnig, ihr Bewusstsein habe sich plötzlich verbunden und sie in der Stadt San Cristóbal zusammengführt. Heute wissen wir, dass zwar über die Hälfte der Kinder aus Städten und Dörfern im Umkreis von San Cristóbal gekommen war (nur ein sehr geringer Teil von ihnen geraubte Kinder), jedoch andere unerklärlicherweise über tausend Kilometer zurückgelegt hatten, von Städten wie Masaya, Siuna oder San Miguel del Sur. Nach Identifizierung der Leichen stellte sich heraus, dass zwei von ihnen aus der Hauptstadt stammten, Kinder, deren Verschwinden man Monate vorher den Behörden gemeldet hatte und in deren Umgebung bis zu ihrer »Flucht« nichts Verdächtiges geschehen war.
Außergewöhnliche Situationen zwingen unserem Denken eine andere Logik auf. Jemand hatte das Erscheinen der Kinder einmal mit dem faszinierenden Synchronflug der Stare verglichen: Schwärme von bis zu sechstausend Vögeln, die in Sekundenschnelle eine dichte Wolke bilden, die sich unisono bewegen kann, selbst bei Spitzkehren. Mir fällt ein Vorfall ein, der aus irgendeinem Grund all die Zeit unversehrt in meinem Gedächtnis überlebt hat. Es war in einem der Monate, in denen sie aufgetaucht sein mussten. Ich fuhr mit Maia frühmorgens ins Büro im Rathaus. Wegen der Hitze folgt San Cristóbal einem strengen Rhythmus, die Leute stehen um sechs Uhr früh auf, und das Leben beginnt buchstäblich mit dem Morgendämmern, die Öffnungszeiten sind von sieben bis eins, dann ist die Hitze gewöhnlich unerträglich. Während der schlimmsten Stunden – in der Regenzeit von eins bis halb fünf – wird die Stadt von subtropischer Benommenheit erdrückt, doch früh am Morgen ist man in San Cristóbal so tatkräftig wie nur möglich, was allerdings nicht allzu viel heißen will. Maia begleitete mich an dem Morgen, weil sie etwas in der Musikschule zu erledigen hatte, und als wir die Ampel vor dem Stadtzentrum erreichten, sahen wir eine Gruppe von Kindern zwischen zehn und zwölf, die um Geld bettelten. Sie waren wie alle anderen und doch wieder nicht. Waren nicht wie sie schlicht und weinerlich, sondern hatten eine andere Haltung, einen fast aristokratischen Hochmut. Maia suchte im Handschuhfach nach Münzen, fand aber keine. Eines der Kinder wandte den Blick nicht von mir. Das Weiß in seinen Augen glänzte kalt und eindringlich, ein solcher Kontrast zu dem dreckigen Gesicht, dass ich für einen Moment sprachlos war. Die Ampel wurde grün, und ich merkte, dass ich die ganze Zeit den Fuß auf dem Gaspedal gehabt hatte, als könnte ich nicht schnell genug wegkommen. Bevor ich es durchtrat, wandte ich mich ein letztes Mal zu ihm. Blitzartig lächelte mich das Kind ganz offen an.
Was für ein Geheimnis steckt dahinter, dass manche Bilder sich einprägen, manche nicht? Es wäre eine tröstliche Vorstellung, dass das Gedächtnis so willkürlich ist wie unsere Vorlieben und unsere Erinnerungen mit der gleichen Zufälligkeit auswählt, mit der unser Gaumen beschließt, dass wir Fleisch mögen, aber keine Meeresfrüchte, und doch haben wir die vage Gewissheit, dass sogar das, ja gerade das einem geheimen Code gehorcht, der entschlüsselt werden muss und keineswegs zufällig ist. Das Lächeln dieses Kindes verstörte mich, weil es bestätigte, dass es eine Verbindung zwischen uns gegeben, dass ich etwas ausgesandt hatte, was in ihm angekommen war.
Im Laufe der Jahre habe ich feststellen können, dass diese Begegnung an der Ampel den Erfahrungen von San Cristóbals Einwohnern entsprach. Wenn man fragt, erzählen alle ähnliche Episoden, ja sogar identische. Kinder, die sich gerade dann umdrehen, wenn man sie ansieht, oder die auftauchen, wenn man an sie denkt, eine reale Gegenwart oder eine gespenstische, die in die Träume vordringt und einen am nächsten Tag an ebender Stelle erwartet, an der man sie geträumt hat … Aber vielleicht ist es am Ende nicht ganz so verwunderlich, dass wir uns, wenn jemand uns anblickt, anspricht oder einfach nur an uns denkt, unweigerlich dieser Quelle der Aufmerksamkeit zuwenden. Die Kinder – damals noch so wenige, dass sie nicht auffielen – begannen in San Cristóbal wie eine Art Energieträger zu wirken, alle achteten wir auf sie und wussten es nicht.