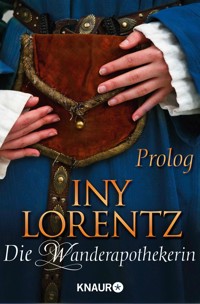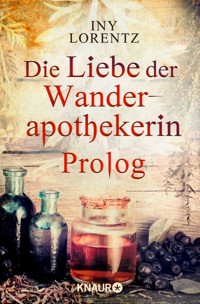1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erfolg geht in Serie: Die Fortsetzung des grandiosen Bestsellers »Die Wanderapothekerin« von Iny Lorentz! Nach geglückter Flucht folgen Klara und Tobias der einzigen Spur, die sie bis jetzt entdeckt haben. Ihr Erfolg ist geringer als erhofft, bringt ihnen aber erste Anhaltspunkte auf den geheimnisvollen Feind im Hintergrund. Von dem Weimarer Geheimrat Janowitz erfahren sie schließlich mehr, doch sie scheinen zwischen Scylla und Charybdis geraten zu sein. Zuletzt sieht Tobias nur noch eine Möglichkeit. Er muss sich opfern, damit Klara, ihr gemeinsamer Sohn und ihr ungeborenes Kind überleben. »Eine erste Spur« ist der fünfte Teil des sechsteiligen eSerials »Die Liebe der Wanderapothekerin«. Der zweite Teil der historischen Familiensaga um die (ehemalige) Wanderapothekerin Klara aus Thüringen ist spannender Krimi und bewegender Historienroman in einem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Liebe der Wanderapothekerin 5
Eine erste Spur
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Erfolg geht in Serie: Die Fortsetzung des grandiosen Bestsellers »Die Wanderapothekerin« von Iny Lorentz!
Nach geglückter Flucht folgen Klara und Tobias der einzigen Spur, die sie bis jetzt entdeckt haben. Ihr Erfolg ist geringer als erhofft, bringt ihnen aber erste Anhaltspunkte auf den geheimnisvollen Feind im Hintergrund. Von dem Weimarer Geheimrat Janowitz erfahren sie schließlich mehr, doch sie scheinen zwischen Scylla und Charybdis geraten zu sein. Zuletzt sieht Tobias nur noch eine Möglichkeit. Er muss sich opfern, damit Klara, ihr gemeinsamer Sohn und ihr ungeborenes Kind überleben.
»Eine erste Spur« ist der fünfte Teil des sechsteiligen eSerials »Die Liebe der Wanderapothekerin«.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Die Liebe der Wanderapothekerin 5 – Personen
Historischer Überblick
Alle Teile von »Die Liebe der Wanderapothekerin«
1.
Graf Tengenreuths Vertrauter Ludwig blickte mit brennenden Augen zu Schloss Rodenburg hinüber. Dort war er aufgewachsen, hatte seine Ulla kennengelernt und sie geheiratet. Auch sein Sohn war hier geboren worden. Er verband viele gute Erinnerungen mit dem stattlichen Gemäuer – und nun sollte er hier Justus von Mahlstett töten.
Zwar verstand er, dass Graf Hyazinth die Männer hasste, die ihn um Besitz und Vermögen gebracht hatten. Seiner Ansicht nach wäre die Rache an dem Buckelapotheker- und Laborantengesindel aus Königsee und anderen Orten Thüringens jedoch vorrangig gewesen. Bei Rodenburg ging es nur um Geld, bei den Königseer Giftmischern aber um verlorene Leben.
Mit zusammengebissenen Zähnen ging er weiter auf das Schloss zu. Auch diesmal trug er die Tracht eines Wanderhändlers und hatte verschiedene Gläser einfacher Machart in seiner Kiepe verstaut. Sein Ziel war der kleine Pavillon im hinteren Teil des Parks, der vom Schloss aus nicht eingesehen werden konnte. Dort würde er die Nacht abwarten und dann mit Hilfe eines Schlüssels, der sich noch in Tengenreuths Besitz befunden hatte, in das Gebäude eindringen und sein Werk vollbringen.
Am Teich, an dessen Ufer der Pavillon stand, streckten Trauerweiden ihre Äste ins Wasser. Für Ludwig war es das Symbol seines verlorenen Glücks. Eigentlich hätte er sich sofort in dem kleinen, etwas vernachlässigten Holzgebäude verstecken müssen. Die Erinnerung hielt ihn jedoch am Ufer fest. Er stellte seine Kiepe ab und setzte sich auf die Bank, die neben einer besonders schönen Trauerweide stand. In ihm stiegen die Bilder seiner Frau und seines Sohnes auf, und er spürte, wie ihm die Tränen über die Wangen rannen.
»He, du da! Was hast du hier zu suchen? Mach, dass du verschwindest!«
Eine barsche Männerstimme riss Ludwig aus seinen Erinnerungen. Ärgerlich drehte er sich um und sah einen Diener auf sich zukommen. Die Farben seiner Livree waren dunkelblau und golden und damit ungewohnt, dennoch erkannte Ludwig ihn sofort.
»Till, du?«
Der Mann war mit eiligen Schritten herangestürmt, hielt nun aber inne und starrte den Eindringling an.
»Ludwig? Bist du es wirklich? Bei Gott, ich glaube es kaum! Wie geht es dir?« Dabei musterte er mitleidig den abgetragenen Rock des Wanderhändlers und schüttelte den Kopf.
»Bist also Hausierer geworden! Hättest halt doch besser im Dienst des neuen Herrn bleiben sollen. Uns geht es nämlich gut. Herr von Mahlstett hält sich zumeist in Kassel auf, so dass wir hier auf Rodenburg ein leichtes Leben haben.«
»Mein Großvater hat einem Tengenreuth gedient, ebenso mein Vater. Ich durfte ihm die Treue nicht brechen«, antwortete Ludwig mit kratzender Stimme.
»Es hat dir aber nicht viel gebracht, wenn du als Wanderhändler dein Leben fristen musst. Was machen Ulla und euer Junge?«
Mit einer fahrigen Bewegung wischte sich Ludwig über die feuchten Augen. »Sie sind tot! Ebenso die Gräfin und ihre Kinder.«
»Du Ärmster! Hat Graf Hyazinth dich nicht in seinen Diensten behalten, weil du durch die Lande ziehen musst?«
Ludwig begriff, dass er sich auf dünnem Eis bewegte. Wie es aussah, war Mahlstett nicht in seinem geraubten Schloss. Also konnte er seinen Auftrag hier nicht erfüllen. Er würde den Ort verlassen und auf eine andere Gelegenheit warten müssen. Andererseits war es wichtig, mehr über sein erkorenes Opfer zu erfahren.
»Ich trage mein Schicksal, so wie du das deine trägst«, antwortete er ausweichend und stand auf.
»Willst du nicht mit ins Schloss kommen? Es würden sich einige freuen, dich wiederzusehen«, fragte Till.
»Mir wäre es lieber, sie würden mich nicht sehen.«
Nach einem Blick auf die schäbige Kleidung Ludwigs nickte Till. »Das verstehe ich! Aber sag, wolltest du heute Nacht im Pavillon schlafen?«
Ludwig nickte, da ihm keine andere Ausrede einfiel.
»Hier am Teich ist es immer feucht und kühl. Es würde dir gewiss nicht behagen. Komm mit ins Schloss!«, schlug Till vor.
»Ich sagte doch, dass mich niemand sehen soll!«, rief Ludwig ungehalten.
»Das wird auch keiner«, versprach Till. »Weißt du was? Du lässt deine Kiepe im Pavillon. Keine Sorge, die stiehlt dir schon niemand. Ich bringe dich durch die Hinterpforte ins Schloss und zu meiner Kammer. Die liegt gleich in der Nähe. In der bleibst du, bis ich mit meiner Arbeit fertig bin. Ich bringe dir was zu essen sowie einen guten Krug Wein, dann reden wir von alten Zeiten. Was weißt du eigentlich von Graf Hyazinth? Wie geht es ihm?«
Ludwig spürte, dass nicht Anteilnahme, sondern Neugier den Lakaien dazu brachte, nach seinem früheren Herrn zu fragen. Damit war Till ein Verräter, ebenso alle anderen, die hiergeblieben waren und nun für Mahlstett arbeiteten. Sie gehören bestraft, durchfuhr es ihn. Sie gehören genauso bestraft wie die Laboranten und Buckelapotheker und alle anderen, die sich gegen seinen Herrn und ihn verschworen hatten.
Mit der linken Hand strich er sanft über seine Kiepe. Wie immer hatte er auch diesmal ein wenig von dem Gift dabei, weil er, wenn er tatsächlich verhaftet würde, damit der Folter und einer grausamen Hinrichtung entgehen wollte. Nun würde er es für etwas anderes benutzen.
»Nun, was ist?«, fragte Till, da Ludwig so lange zögerte.
»Es wäre schön, wenn du mich heimlich ins Schloss bringen könntest. Hier wäre es doch arg kalt in der Nacht.«
»Dann stell deinen Tragkorb im Pavillon ab. Aber willst du wirklich keinen der alten Freunde treffen?«, fragte Till.
Ludwig schüttelte den Kopf. »Es wäre zu schmerzhaft, wenn sie sähen, wie herabgekommen ich bin. Sie sollen mich so in Erinnerung behalten, wie ich damals im Gefolge unseres Grafen das Schloss verlassen habe.«
»Das verstehe ich!« Tills Miene verriet jedoch deutlich, dass er von dieser Begegnung berichten und sie ausschmücken würde.
Als Ludwig das begriff, erlosch auch das letzte Fünkchen Mitleid. Er brachte die Kiepe in den Pavillon, zog dort die Giftflasche heraus und steckte sie in seine Rocktasche. Dann trat er wieder heraus und nickte Till zu. »Ich bin so weit. Wir können gehen!«
2.
Im Schloss hatte sich, soweit er das feststellen konnte, kaum etwas verändert, und diese Erkenntnis bereitete Ludwig beinahe körperliche Schmerzen. Während er in Tills Kammer saß und dem Brot und den Würsten zusprach, die dieser im gebracht hatte, spürte er, dass die alten Wunden erneut bluteten. Hier waren Ulla und er glücklich gewesen, doch dieses Glück war später wie Glas zersprungen.
Mit einem Mal kam ihm der Gedanke, dass seine Frau und sein Sohn noch leben könnten, wenn er damals nicht mit Tengenreuth gegangen wäre und sie mitgenommen hätte. Andere wie Till waren geblieben und lebten nun in Freuden, weil ihr neuer Herr sich nur selten auf seinem Besitz aufhielt. Zuerst packten ihn Verzweiflung und Wut auf die Schlingen des Schicksals, dann aber der Neid auf jene, die es besser getroffen hatten als er.
Till hatte neben dem Essen auch für Wein gesorgt. Ein wenig davon trank Ludwig, ließ aber den größten Teil stehen und wartete auf den einstigen Freund. Draußen sanken die Schatten der Nacht hernieder, und am Himmel leuchteten die ersten Sterne auf. Ludwig ging zum Fenster und blickte zu ihnen empor. Irgendwo weit über den Sternen befand sich jener Gott, der ihn wie einen zweiten Hiob prüfte.
Wie lange er so gestanden hatte, hätte er hinterher nicht zu sagen vermocht. Erst das Geräusch der sich öffnenden Tür riss ihn aus seinen trüben Gedanken.
»Bei Gott, hier ist es ja so finster wie in der Hölle. Weshalb hast du die Lampe nicht angezündet? Im Flur brennt doch eine Öllampe«, hörte er Till sagen.
»Ich wollte nicht, dass jemand hier Licht sieht, während du noch im Schloss arbeitest«, antwortete Ludwig.
»Wenn du meinst!« Till tastete im Schein des trüben Lichts, das durch die Tür hereinfiel, nach der Specksteinlampe und ging noch einmal hinaus, um den Docht an der Laterne im Flur anzuzünden. Dann kehrte in die Kammer zurück, stellte die Lampe auf den kleinen Tisch und griff nach einem Becher.
»Jetzt habe ich Durst! Auf dein Wohl, Ludwig, und darauf, dass dein Los sich wieder zum Besseren wendet«, sagte er, als er sich eingeschenkt hatte.
»Darauf trinke ich gerne«, antwortete Ludwig mit einem gezwungenen Lachen. »Der Wein ist übrigens gut. Bei unserem alten Herrn haben wir schlechteren bekommen.«
»War auch arg klamm, der Tengenreuth. Kein Wunder, nachdem sein Großvater so viel Geld ausgegeben hat, um seine Kriegszüge zu finanzieren. War eben mehr Soldat gewesen als Gutsherr. Hat ja auch etliche seiner Knechte zu den Soldaten geholt. Mein Vater kam in Flandern um. Auf seine ewige Seligkeit!«
Till goss seinen Becher erneut voll und überließ es Ludwig, sich selbst einzuschenken. Erneut stießen sie an und erzählten einander von Zeiten, in denen ihre Väter erwachsene Männer gewesen waren und sie erst Knaben.
Ludwig ließ Till reden. Nach einer Weile übernahm er das Einschenken und schüttete jedes Mal, wenn sein ehemaliger Freund nicht hinsah, etwas von dem Gift in dessen Becher. Es dauerte nicht lange, dann kniff Till die Augen zusammen und rieb sich über die Stirn.
»Wie es aussieht, habe ich schon zu viel getrunken«, stöhnte er und presste sich die rechte Hand gegen den Bauch. »Es brennt auf einmal so, ich …« Ein Röcheln erstickte die Worte, die er noch sagen wollte, und er sank auf sein Bett zurück.
Eine gewisse Zeit blieb Ludwig noch sitzen und hielt seinen eigenen Becher so fest umklammert, als wolle er ihn erwürgen. Schließlich stand er auf, stellte das Trinkgefäß beiseite und beugte sich über Till. Dessen kurze, stoßweise Atemzüge verrieten, dass er noch lebte. Einen Augenblick lang überlegte Ludwig, ihm noch eine Portion Gift in den Schlund zu träufeln, um sicher zu sein, dass er ihn nicht mehr verraten konnte. Dann aber fiel ihm etwas Besseres ein. Wenn er das Schloss in Brand steckte und damit all die vernichtete, die seinen Herrn und ihn verraten hatten, würde Till als einer der Ersten sterben.
»Sie haben es verdient!«, sagte er. »Alle haben es verdient! Während ich treu war und meinem Herrn gefolgt bin, sind sie hiergeblieben und haben sich mit seinem Feind gemeingemacht. Sie mussten nicht Leid und Qual ertragen so wie ich.«
Noch während er vor sich hin murmelte, stapelte er alles brennbare Material in der Mitte der Kammer und zündete es an. Nach einem letzten Blick auf Ludwig, der nur noch schattenhaft hinter den lodernden Flammen zu erkennen war, verließ er den Raum. Draußen nahm er die Laterne an sich und suchte die Gemächer des Herrn auf. Da dieser in der Ferne weilte, fiel es ihm nicht schwer, auch hier Feuer zu legen. Die Räumlichkeiten seiner ehemaligen Herrin kamen als Nächstes dran. Als er damit fertig war, brannte bereits der Flur, und von weiter hinten erklang eine entsetzte Frauenstimme.
Ludwig ließ sich dadurch nicht beirren. Wie ein Racheengel schritt er durch die Korridore des Schlosses und setzte alles in Brand, was er erreichen konnte. Als schließlich auch die Holzverkleidung des großen Saals die Flammen nährte, öffnete er ein Fenster, stieg auf den Fenstersims und kletterte nach unten. Während die wenigen Diener und Mägde, die rechtzeitig wach geworden waren, vergebens gegen das an vielen Stellen lodernde Feuer ankämpften, erreichte Ludwig den Pavillon, holte seine Kiepe heraus und eilte mit langen Schritten davon. Der Mond erhellte seinen Weg, und so kam er gut voran. Als er sich auf der Kuppe eines Hügels umschaute, stand hinter ihm das gesamte Schloss in Flammen.
»Mein ist die Rache, spricht der Herr!«, murmelte er und dachte an jenes Haus in Königsee, das seine Handlanger August und Karl in Brand gesteckt hatten. Nun wünschte er sich, er hätte es selbst getan und die verzweifelten Schreie der verbrennenden Menschen mit eigenen Ohren vernommen.
3.
Nach Hüsings Verhaftung hatte Kathrin Engstler einen neuen Richter bestimmen müssen. Ihre Wahl war auf den Magistratsbeamten Jonathan gefallen, der bisher mit der Aufsicht über die Stadtbüttel betraut gewesen war. Der junge Mann wollte es der Jungfer besonders recht machen und rief seine Untergebenen bereits in aller Herrgottsfrühe zusammen.
»Da der abgesetzte Richter säumig war, müssen wir alles für die Hinrichtung der Delinquenten vorbereiten«, erklärte er den Männern.
»Weiß man schon, wie die Gefangenen hingerichtet werden?«, fragte einer der Männer. »Werden sie nur gehängt, steht der Stadtgalgen dafür bereit, und Stricke liegen auch schon dort.«
Genau das wusste Jonathan nicht. Da Kathrin Engstler jedoch erklärt hatte, die Mörder ihres Vaters müssten leiden, nahm er an, dass wenigstens einer oder zwei der Gefangenen gevierteilt oder gerädert werden würden.
»Bereitet alles vor, samt dem Rad, und schafft auch Pferde zum Galgenhügel, falls das gnädige Fräulein einen der Kerle auseinanderreißen lassen will«, sagte er.
Die anderen nickten, doch als die Männer das Rathaus verließen, spie einer draußen aus. »Die beiden Ausländer kümmern mich nicht, doch der Richter und der Apotheker waren stets aufrechte Männer. Es wird Gott nicht gefallen, wenn sie hingerichtet werden.«
»Aber der Jungfer gefällt’s – und die hat hier das Sagen«, antwortete ein Kamerad und klopfte ihm auf die Schulter.
»Ja, schon!«, meinte der, um dann etwas anderes anzusprechen. »Was mich wundert: Klaas war heute Morgen nicht anwesend, als der neue Richter seinen Vortrag gehalten hat. Oder hast du ihn gesehen?«