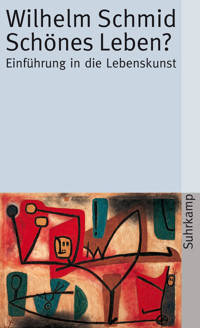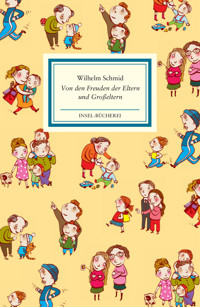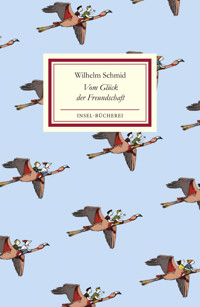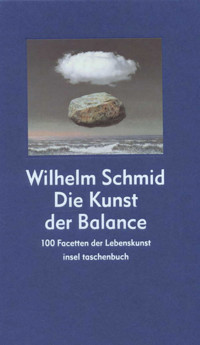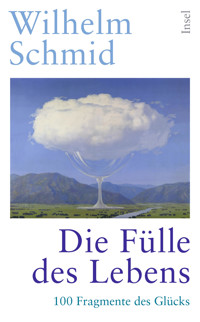19,99 €
Mehr erfahren.
Die Liebe ist schwierig geworden. Alles soll sie leisten: uns unendliche Glücksgefühle, unbändige Leidenschaft und ewige Lust bescheren – allerdings ohne uns in unserer Freiheit einzuschränken. Kein Wunder also, daß sie diesem Erwartungsdruck kaum noch standhält: Die Liebe erstickt, wenn sie immer nur Liebe sein muß. Manche sprechen daher schon verzweifelt vom »Ende der Liebe«, viele arrangieren sich mit der alltäglichen Tristesse dessen, was doch einmal Liebe war, und wieder andere wollen eine neue »Nüchternheit«, aber die wird die Herzen nicht wärmen. Ja, die Liebe ist kompliziert geworden, aber ist das etwa ein Grund, von ihr zu lassen? Wohl eher nicht, denn die Liebe ist sinnstiftend wie kaum etwas sonst. Nach dem Ende der Liebe liegt daher ein Neuanfang nahe, eine Renaissance der Liebe unter veränderten Vorzeichen. Es ist Zeit, die Romantik zu retten, sie auf neue Weise lebbar zu machen, die Liebe also neu zu erfinden: als atmende Liebe, die zu einer pragmatischen Romantik in der Lage ist. Der Bestsellerautor Wilhelm Schmid (Glück, 2007) fragt in seinem neuen Buch danach, warum die Liebe in unserer Zeit so selten glückt, und zeigt Wege auf, wie sie dennoch gelingen kann. Seine »Kunst des Liebens« zielt durch alle Schwierigkeiten hindurch auf eine neue Leichtigkeit der Liebe und des Lebens. »Wilhelm Schmid, philosophischer Fachmann in Sachen Lebenskunst« Thomas Medicus, Die literarische Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wilhelm Schmid
Die Liebe neu erfinden
Von der Lebenskunst im Umgang mit Anderen
Suhrkamp Verlag
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk
und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in
irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Ver-
fahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, ver-
vielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-74000-2
www.suhrkamp.de
Erste Auflage 2010
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Von der Liebe und anderen Beziehungen
Nur wer die Sehnsucht kennt: Vom Sinn des Sehnens
Wenn Liebe geschieht: Eine Erfahrung und ihre Beschreibung
Was Liebe ist: Eine Emotion und ihre Definition
Liebe und andere Beziehungen: Die Spannung zwischen Freiheit und Bindung
Aus sich herausgehen, dem Leben Sinn geben: Ekstatisches Menschsein in Beziehungen
Leben in Konstellationen: Vernetzung und Verstrickung in Beziehungen
Leben in Polaritäten: Zur Logik des Lebens in Beziehungen
Beharrung und Veränderung: Zur Statik und Dynamik von Beziehungen
Vertrauen und Misstrauen: Zur Bedeutung der Vorsicht in Beziehungen
Und wenn es Ärger gibt? Die alltägliche Polarität von Gefühlen
Männlich-weibliche Polarität: Sind Frauen die besseren Lebenskünstler?
Die Kunst, ein Mann zu sein: Müssen Männer sich neu erfinden?
Von der Liebe der Liebenden
Allein oder zu zweit? Die Frage nach dem erfüllten Leben
Ist die Liebe ein Spiel? Von der Umwerbung und Verführung zur Kunst des Liebens
Die Schönheit der Liebe und der Liebenden: Bejahen und Bejahtwerden
Die Kunst des Schenkens: Hingabe und Hinnahme in der Liebe
Widersprüche der Liebe: Gewissheit und Angst, Treue und Verrat
Was es heißt, Glück in der Liebe zu haben
Sex und Erotik: Die körperliche Kunst des Liebens
Gefühl und Berührung: Die seelische Kunst des Liebens
Gespräch und Deutung: Die geistige Kunst des Liebens
Göttliche Erfahrung: Die transzendente Kunst des Liebens
Pragmatische Romantik: Die Kunst des Liebens im Alltag
Warum die Liebe so schwierig ist: Fragen der Macht
Gibt es ein Recht, geliebt zu werden? Recht und Gerechtigkeit zwischen zweien
Und wenn die Liebe endet?
Zum Autor
Vorwort
Aller Umgang mit Anderen hat mit Liebe zu tun. Und mit ihrer Entbehrung. Am schmerzlichsten ist die Entbehrung bei der Art von Liebe, die in den Augen vieler »die Beziehung« schlechthin darstellt. Unproblematisch war diese Beziehung wohl nie, problematisch aber aus immer anderen Gründen. Zum Problem wird in moderner Zeit ausgerechnet die hart erkämpfte Freiheit der Liebe, nach ihrer Befreiung von religiösen Normen, traditionellen Rollenverteilungen, konventionellen Vorstellungen, auch vom Naturzweck, der Menschen lange um der Fortpflanzung willen lieben ließ: Die freie Liebe erweist sich als schwierig und zieht immer vernehmlicher die Frage nach dem Warum und Wozu nach sich. Für eine historische Weile beantwortet die romantische Liebe die Sinnfrage noch mit dem Versprechen unendlicher Glücksgefühle, bevor sie selbst zerrieben wird zwischen dem Wohlgefühl, das von ihr erwartet, und den Problemen, die nicht in ihr vermutet werden; immer häufiger gerät sie in Konflikt mit der Endlichkeit, mit der sie sich nicht befassen will. Die erhoffte Verschmelzung ihrer Ichs, die die Liebenden in ihr suchen, kollidiert heillos mit dem Anspruch auf Freiheit ihrer Ichs, bei der sie keine Einschränkung dulden, und bei jedem Scheitern steht rasch sehr viel mehr in Frage als die Liebe selbst: Auch die Beziehung zum Leben, zur Welt überhaupt. So mutiert die romantische Liebe im Laufe der Moderne zu einer Monsterqualle, die mit unsichtbaren Fäden zarte Wesen umgarnt, sie zersetzt und verschlingt. Manche glauben weiterhin mit religiöser Inbrunst an sie, Andere sind restlos enttäuscht von ihr, viele arrangieren sich mit der alltäglichen Tristesse dessen, was doch einmal Liebe war, und begnügen sich mit der Erkenntnis, dass Liebesgefühle aus einem Cocktail von Molekülen bestehen, von dem nichts bleibt, wenn der Rausch verflogen ist.
Vielleicht kann, neben anderen Disziplinen, die Philosophie bei der Klärung und Lösung der Schwierigkeiten der Liebe behilflich sein. Es trifft sich gut, dass sie selbst eine Art von Liebe ist, wörtlich eine Liebe zur Weisheit, eine philia, auf sophia gerichtet, von ihr inspiriert, wenngleich ohne Aussicht darauf, die Geliebte jemals vollständig in Besitz nehmen zu können. Begehrenswert an der Weisheit erscheinen das gründlichere Verstehen, die größere Umsicht, das überlegtere Handeln, das bewusstere Lassen. Das Philosophieren ist ein Innehalten und Nachdenken, um gemachten Erfahrungen nachzugehen, Schlüsse aus ihnen zu ziehen und sich damit auf künftige Erfahrungen vorzubereiten. Diese immer neue Orientierung des Lebens im Denken ist eine Grundidee der Philosophie seit Sokrates, ein ausdrückliches Anliegen der Aufklärung seit Kant. Wer philosophiert, bemüht sich darum, Zusammenhänge besser zu verstehen, um im Leben besser damit umgehen zu können. Die Orientierung im Denken ermöglicht schließlich eine bewusste Lebensführung, eine Lebenskunst, auch wenn kein Leben in ständiger Bewusstheit damit gemeint sein kann, nur eines, das die »lichten Momente« nutzt, die sich im Leben immer wieder von selbst ergeben.
Die Orientierung im Denken, die hier nun der Liebe gelten soll, zielt darauf, brauchbare Antworten auf drängende Fragen zu finden, auf deren endgültige Beantwortung kaum zu hoffen ist: Warum die Liebe so schwierig ist und wie sie dennoch gelebt werden kann. Abschließendes zur Liebe sagen zu wollen, wäre von Anfang an verfehlt, aber die Orientierung im Denken kann dem Einzelnen helfen, mit mehr Klarheit von ihr zu lassen oder wieder zu ihr zu finden, sie auch neu zu erfinden, wenn es erforderlich erscheint. Dazu will dieses Buch beitragen, um möglichst das zu erreichen, was Sokrates in Platons Symposion, diesem ältesten philosophischen Buch »Über die Liebe« (Peri erotos), einst für sich in Anspruch nahm: »Stark zu sein in Liebesdingen«. Die gleichgeschlechtliche Liebe, in sokratischer Zeit noch akzeptiert, dann bis weit in die Moderne hinein geächtet, ist dabei von vornherein mit gemeint. Und wo immer im vorliegenden Buch vom »Anderen« die Rede ist, steht dies auch für »die Andere«. Die Einzahl wiederum soll keineswegs eine Mehrzahl oder Vielzahl von Anderen, die geliebt werden können, ausschließen, aber auch beim Plural hat der Liebende meist mit je einem singulären, bestimmten Anderen zu tun.
Der Weg der Philosophie ist ein Weg der Besinnung, des »Sinnierens« im Wortsinne: Es geht dabei um das Suchen, Finden und Herstellen von Sinn. Die Notwendigkeit dazu gerät dann in den Blick, wenn Zusammenhänge entschwinden und in der entstehenden Leere spürbar wird, welche Ressourcen damit dem Leben fehlen. Immer sind es Zusammenhänge, die »Sinn machen«, aber sie stehen nicht einfach objektiv und definitiv fest, sondern sind stets von Neuem zu durchdenken und zu deuten. Bei dieser hermeneutischen Vorgehensweise der Philosophie sind nicht beliebige Deutungen von Interesse, sondern solche, die plausibel sind, da sie nachvollziehbar und überzeugend erscheinen, und ein besonderer Sinn namens Bedeutung zeigt sich, wenn Wert und Wichtigkeit eines Phänomens überzeugend erfasst werden. Darauf zielen die philosophischen Fragen, hier in Bezug auf die Liebe: Was ist sie eigentlich, woher kommt sie, wozu dient sie, wie funktioniert sie, welche Bedeutung hat sie fürs Leben? Welche Bedeutung hat bereits die Sehnsucht nach ihr? Die Liebe steht wiederum nicht für sich allein, sondern hat Bedeutung im Rahmen einer ganzen Kultur und Gesellschaft: Was haben Beziehungen allgemein mit Liebe zu tun? In was für Zusammenhänge ist sie selbst eingebettet? An welchem Ort im Ideenhimmel einer Kultur und Gesellschaft ist sie angesiedelt, welche Rolle kommt ihr jeweils zu, und wie konnte sie solche Bedeutung gewinnen, dass Menschen den Sinn des Lebens in ihr sehen, bei ihrem Schwinden aber an der Sinnlosigkeit des Lebens verzweifeln? Und wenn das Denken und Deuten sich von geläufigen Sichtweisen lösen kann, lässt sich auch danach fragen, welche anderen Vorstellungen von Liebe noch möglich sind und welche Veränderungen zu ihrer Realisierung nötig wären.
Voraussetzung für alles Denken und Deuten aber ist die Bereitschaft, so genau wie möglich hinzusehen: Auf dem Weg zur Weisheit wird die Philosophie zur Schule der Aufmerksamkeit, um das fragliche Phänomen möglichst achtsam wahrzunehmen und zu beschreiben, ohne Scheu vor einer anfänglichen Naivität. Diese phänomenologische Vorgehensweise dient hier dazu, die verschiedensten Aspekte des Phänomens Liebe zu erfassen und zu rekonstruieren, um schließlich ein verändertes Verständnis zu ermöglichen: Was wird als Wirklichkeit der Liebe vorgefunden, und was geschieht, wenn Menschen glauben, dass sie geschieht? Wie und warum ist sie so geworden, wie sie ist, mit allen Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten? Die Phänomenologie geht von Erfahrungen aus, wie der Einzelne und viele Menschen sie machen, und bringt möglichst alle Aspekte des Phänomens zum Vorschein. Sie bezieht auch die künstlerische Verarbeitung von Erfahrungen mit ein, die sich in filmischen, literarischen, theatralischen, musikalischen, malerischen, plastischen, tänzerischen Werken niederschlägt. Und sie achtet auf die wissenschaftliche Erforschung von Erfahrungen, um auch genetische, epigenetische, biologische, biochemische, neurobiologische, psychologische, soziologische, ethnologische, kulturhistorische, theologische Aspekte des Phänomens zu berücksichtigen. Wichtig sind die beiläufigen (akzidentellen) Aspekte ebenso wie die wesentlichen (substanziellen) – ohne dass zweifelsfrei zu klären wäre, was im Einzelfall wesentlich oder nur beiläufig ist. Wichtig ist zudem, das Phänomen nicht nur als Anwesendes, sondern auch als Abwesendes zu sehen, um Schlüsse daraus zu ziehen: Was geschieht, wenn die Liebe schwindet? Ist ein Leben ohne Liebe möglich? Ist eine Liebe ohne ihre notorischen Schwierigkeiten möglich? Ist ein Leben ohne Liebesschwierigkeiten ein besseres Leben? Warum noch an die Liebe glauben? Brauchen Menschen Liebe? Und wenn ja, wozu?
Liebe ist zunächst nur ein Wort. Entscheidend ist, was darunter verstanden wird. Dieses Verständnis, anfänglich nur eine vage Idee, ein unklarer Gedanke, gewinnt deutlichere Konturen in einem Begriff, der mehr ist als ein Wort, ein Wort plus x, plus all das, was an Erfahrungen, Sehnsüchten, Befürchtungen, Vorstellungen mitschwingt und mitgedacht wird. Die Philosophie macht dieses Implizite explizit und versucht, den Begriff zu klären und vielleicht neu zu prägen. Der Begriff (lateinisch terminus) ist ihr Handwerkszeug, mit der »Arbeit am Begriff« geht sie terminologisch vor: Das Begreifen dient dem besseren Erfassen von Zusammenhängen, von Sinn, und erleichtert den Zugriff darauf, um sich gegebenenfalls an Veränderungen zu versuchen. Die Bedeutung dieser Arbeit wird leicht übersehen, aber Begriffe gehören zum innersten Kern eines Menschen, der sich in seinem Leben ständig von Begriffen leiten lässt, etwa von seinem Begriff der Freiheit (»an meine Freiheit lasse ich nicht rühren«). Unverzichtbar sind Begriffe auch als Instrumente der Kommunikation, wenngleich sie häufig Missverständnisse hervorrufen, denn Andere haben andere Begriffe, die sich tückischerweise in denselben Worten verbergen. Was die Liebe angeht, verfügen keine zwei Menschen über denselben Begriff, setzen allerdings genau das oft voraus und richten Erwartungen aneinander, die dem je Anderen aufgrund seines Begriffs fremd sein müssen. Nichts an einem Begriff versteht sich von selbst, daher wäre immer neu danach zu fragen, auf welche Erfahrungen, Sehnsüchte, Befürchtungen, Vorstellungen er zurückgeht, ob er überhaupt noch einen realen Gehalt hat oder schon zum Selbstzweck geworden ist. Äußerstenfalls wäre er zu verändern, um den Erfahrungen besser zu entsprechen, anderen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen und Möglichkeiten zu neuen Erfahrungen zu eröffnen: Wie kann die Liebe noch anders begriffen werden, um besser mit ihr zurechtzukommen?
Im Umgang mit dem Wirklichen, auf der Suche nach dem Möglichen gelangt die Philosophie auf dem Weg zur Weisheit schließlich an den Punkt, von dem aus es möglich ist, das gesamte Phänomen im Zusammenhang zu sehen, also synoptisch vorzugehen: Die Philosophie öffnet den Blick fürs Ganze und kann für einen Moment die Verengung der Wahrnehmung wieder auflösen, die sich in der alltäglichen Bewusstlosigkeit des Lebens unweigerlich einstellt. Für die Liebe erfordert dies eine Erweiterung des Blicks auf sämtliche Arten von Liebe, denn das Phänomen reicht über die Liebe der Liebenden weit hinaus und umfasst auch die familiäre Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern ihrerseits, zwischen Großeltern und Enkeln; darüber hinaus die Liebe zu Freunden im engeren und weiteren Sinne, zu Kollegen und zu »Nächsten« allgemein, auch zu Feinden; schließlich die Liebe zu Tieren und zu aller Natur, zu Dingen, materiellen wie ideellen, zum Leben und zur Welt überhaupt; und von Bedeutung kann für Menschen, wenngleich nicht für jeden, auch die Liebe zu einer Dimension der Transzendenz, zum Kosmos, zu Gott sein. Derjenige, der auch nur ansatzweise das gesamte Spektrum für sich erschließt, muss nie an Liebe Mangel leiden und sich nicht vom Gelingen oder Misslingen einer einzigen Beziehung abhängig fühlen.
Bei aller Lust am Erfassen, Betrachten und Begreifen eines Phänomens wie der Liebe im Detail und im Ganzen kommt es auf dem Weg zur Weisheit aber zuletzt darauf an, für ein überlegtes Verhalten im Umgang damit nach Gründen zu suchen und sie abzuwägen. Bei diesem argumentativen Vorgehen kann die Philosophie behilflich sein, indem sie zur Poristik wird, zur Suche nach dem richtigen Weg (poros im Griechischen): Sie hilft, all das zu bedenken, was für und gegen eine Wahl spricht, unter Wahrung der Optionalität, ohne Normativität, die den Einzelnen zu sehr festlegen würde. Der jeweilige Mensch trifft selbst seine Wahl, sinnvollerweise jedoch mit Gründen, die er im Denken und Fühlen ausreichend abgewogen hat und für überzeugend hält: Er selbst muss mit seinem gesamten Leben auch für die Konsequenzen einstehen. Die Gründe kann er allein abwägen, klugerweise aber mit Anderen, um mehr als nur die eigenen Gründe zu berücksichtigen und eine größere Gewissheit zu gewinnen. Sehr viel hängt davon ab, eine Wahl möglichst gut zu begründen, denn nur das, was gut begründet ist, kann auch durch vielerlei Schwierigkeiten des Lebens und Liebens hindurch Bestand haben. Als gute Gründe kommen dabei nicht nur Überlegungen, sondern auch Gefühle in Betracht, und nicht nur allgemeine Gründe sind von Belang, die etwa für und gegen Beziehungen und insbesondere die Beziehung der Liebe sprechen, sondern auch besondere Gründe für und gegen diese Beziehung.
Und wozu das alles? Wenn Menschen lieben, kann offenkundig eine Fülle von Sinn, von Zusammenhängen entstehen, auf verschiedenen Ebenen des Menschseins; sogar die Negation der Liebe verweist noch auf dieses Sinnpotenzial: Die Entbehrung, aus der heraus sie ersehnt wird, der Hass, in dem sie verflucht wird, die Enttäuschung, die dazu führt, nichts mehr von ihr wissen zu wollen. »Gebt die Liebe auf«, forderte Kasimir Malewitsch in vorrevolutionärer Zeit und sah darin die Voraussetzung zu einer neuen Kultur. Sollte aber eine kulturelle und, als Voraussetzung dafür, individuelle Erneuerung erstrebenswert erscheinen, wird die Liebe als Quelle von Sinn dafür gebraucht, und so kommt es darauf an, sie wieder zu finden und auch neu zu erfinden: Die Neuerfindung der Liebe in Zeiten der Verzweiflung an ihr. Gerade das Scheitern einer überkommenen Idee kann zum Anfang einer neuen werden, ganz so, wie der Maler Malewitsch zu dem Zeitpunkt, als er mit der alten Kunst am Ende war, mit dem Schwarzen Quadrat eine neue zu begründen vermochte. Auch in der Liebe sollte man zur Idee zurückgehen, um sich an ihrer Veränderung zu versuchen. Überall dort, wo eine Wirklichkeit zum Problem wird, kann ein Grund dafür die Idee sein, die an der Wirklichkeit mitgestrickt hat. Und wenn die Liebe von Grund auf eine unmögliche Idee ist? Dann ist das wohl erst recht kein Grund, von ihr zu lassen: Der Weg der Menschheit ist gepflastert mit Unmöglichkeiten, die dennoch wirklich werden. Ein Problem besteht lediglich darin, dass aus jeder Idee, die mit gnadenloser Logik verfolgt wird, eine Ideologie werden kann: Das scheint mit der Idee der romantischen Liebe geschehen zu sein, der Idee eines Glücks, das den Liebenden gute Gefühle bis in alle Ewigkeit verspricht, während sich im Alltag die Ichs mit weniger guten Launen wechselseitig im Weg stehen.
Die Liebe erstickt, wenn sie immer nur Liebe sein muss. Eine andere Idee, die die Liebe lebbarer machen könnte, ist die einer atmenden Liebe – vorausgesetzt, eine lebbare Liebe erscheint noch wünschenswert. Die Liebe neu zu erfinden, ist gleichbedeutend damit, sie atmen zu lassen. Atmen kann sie, wenn die Liebenden sich nicht nur miteinander, sondern auch mit ihrem je eigenen Selbst befassen,* und wenn sie zwischen mehreren Ebenen der Liebe hin- und hergehen können, um sich auf immer andere Weise einander zuzuwenden. Atmen können muss die Liebe zwischen Gegensätzen, die den romantisch Liebenden so große Probleme bereiten: Zwischen Nähe und Distanz, Freude und Ärger, Lust und Schmerz, Ekstase und Alltag, Ungewöhnlichem und Gewöhnlichem, Gefühl und Gewohnheit, Möglichkeit und Wirklichkeit, Sehnsucht nach einer Welt, die erträumt wird, und Anpassung an die missliche Welt, die vorgefunden wird, in der jedoch die Arbeit an einer anderen Welt im Kleinsten und Alltäglichsten möglich ist. Atmen kann die Liebe, die einerseits der nüchternen Pragmatik Raum gibt, andererseits aber die gefühlvolle Romantik nicht preisgibt, denn die bloße Nüchternheit wird niemanden wärmen: Die Liebe erstickt auch, wenn sie nie Liebe sein darf. Eine pragmatisch-romantische Liebe antwortet auf den neuerlichen Ansturm der Pragmatik in fortgeschrittener moderner Zeit und versucht sich an einer Rettung der Romantik, nicht jedoch durch die Abwehr, sondern durch die Aufnahme pragmatischer Elemente, um mit Ärger, Alltag, Verrat, Streit, Liebesentzug und anderen Herausforderungen besser zurechtzukommen.
Die andere, atmende Liebe wird das Signum einer anderen Moderne sein, und unter veränderten Vorzeichen kann eine erneuerte Kunst des Liebens zum Element der Lebenskunst vieler werden. Sie sollte alle Spielarten von Liebe und alle Arten von Beziehungen umfassen, beginnend, nicht endend, mit der Liebe zwischen zweien. Die Bindung zwischen ihnen, die einst von scheinbar objektiven Kräften der Religion, Tradition, Konvention und Natur gewährleistet wurde, ist nun auf die subjektiven Kräfte eines großen Wohlwollens füreinander angewiesen; anders wird jedenfalls unter Bedingungen der Freiheit eine länger währende Liebe kaum noch möglich sein. Erst wenn die Herausforderungen der Moderne durchgestanden sind, wird sich eine neue Leichtigkeit des Liebens einstellen, die der anstrengenden Bewusstheit nicht mehr bedarf. Die Neuerfindung der Liebe und die Neubegründung einer Kunst des Liebens ist letztlich jedoch eine Sache der Liebenden selbst, die von ihren je eigenen Bedingungen ausgehen, um die Möglichkeiten dieser sonderbaren Existenzweise neu zu erkunden, zu erproben und auszuschöpfen. Für die Versuche, die sie wagen, müssen sie keine allgemeine Verbindlichkeit im Blick haben. Eine Philosophie der Liebe und der Lebenskunst kann ihnen theoretische Impulse vermitteln, entscheidend aber ist ihre eigene praktische Kreativität, um der Liebe stets von Neuem ein Gesicht zu geben. Und ihre Geschichte ad infinitum fortzuschreiben.
* Wilhelm Schmid, Mit sich selbst befreundet sein. Von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst, Frankfurt am Main 2004, Taschenbuch 2007.
Von der Liebe und anderen Beziehungen
Nur wer die Sehnsucht kennt: Vom Sinn des Sehnens
Am Anfang der Liebe ist die Sehnsucht nach ihr, von Sehnsucht wird sie begleitet, und von ihrem Ende kündet erneut eine Sehnsucht, nach einer anderen Liebe, einem anderen Leben. Liebe wird oft nicht als das, was ist, erfahren, sondern als das, was fehlt; Menschen sind enttäuscht von ihr, entbehren sie und sehnen sich nach ihr. Der Mangel macht Hunger, die Sehnsucht nach Sättigung setzt Menschen in Bewegung (motus im Lateinischen), motiviert sie also, zueinander hin, voneinander weg, bewegt von einer Energie, die ihre Intensität aus der Spannung und Spannweite zwischen dem Sehnenden und dem Ersehnten bezieht. Und nicht nur auf andere Menschen hin und von ihnen weg richtet sich Sehnsucht, sondern auch auf andere Wesen, auf Natur, auf Orte etwa in Gestalt von Fernweh, von dort wieder zurück in Form von Heimweh. Sie gilt künftigen Zeiten in Form von Utopie, dann wieder vergangenen Zeiten in Gestalt von Nostalgie, und nicht etwa nur Liebe, sondern zahllose materielle und immaterielle, bestimmte und unbestimmte Dinge können die Sehnsucht beflügeln: Ein Kleidungsstück, Schönheit, ein gesichertes Einkommen, Freiheit, eine Wohnung, Frieden, ein Auto, Sicherheit, ein Haus, Geborgenheit. Menschen sehnen viele Möglichkeiten herbei, dann wieder eine überschaubare Wirklichkeit. Sie sehnen sich nach Leben, nach Welt überhaupt, nach Gott – und wieder davon weg.
Sehnen ist die innere Bewegung, die sich in der Sehnsucht zur Haltung verfestigt, ohne dass dies im Sprachgebrauch voneinander unterschieden würde. Dem konkreten Wünschen, Begehren, Wollen geht meist das vage Sehnen voraus; es leitet die Suche an, die in der Sehnsucht mitschwingt. Ganz von selbst entsteht ein Ziehen, das im Inneren spürbar wird, unwillkürlich und unreflektiert, dem bewussten Zugriff entzogen. Es treibt das Selbst aus sich heraus und über sich hinaus, sucht nach der Begegnung mit dem Anderen in jeder Hinsicht und hält Anderes als das Bestehende für möglich; den Sinn dafür hält es wach. Im begrenzten Raum der Gegenwart können Enge und Mangel empfunden werden, das Sehnen aber spürt zielsicher den freien Raum des Künftigen auf, in dem ein anderes und besseres Leben möglich erscheint, mit mehr Glück, größerer Fülle, tieferem Sinn, vollkommener Schönheit. Mit Blick darauf gelingt es, die körperliche Gebundenheit an die gegebene Wirklichkeit zu lockern, die Gefühle schon mal vorauszuschicken und die Gedanken dorthin zu bewegen und beispielsweise die schönere Wohnung zu suchen, die das bessere Leben ermöglicht, das möglichst nie enden soll. Das gefühlte und gedachte Sehnen richtet sich, auch wenn es um bestimmte Dinge geht, immer von Neuem auf etwas Unbestimmtes, Ungegenwärtiges, Unbegrenztes, vielleicht, weil Menschen sich dort beheimatet wissen, auf jeden Fall aber, weil sie es im Bestimmten, Bestehenden, Begrenzten nicht aushalten können.
Was wäre, wenn es keine Sehnsucht gäbe? Menschen würden sich mit dem gegebenen Stand der Dinge bescheiden, ihrem Leben würden entscheidende Impulse fehlen, die gesamte menschliche Geschichte wäre anders verlaufen. Eine Geschichte der Sehnsucht könnte vor Augen führen, wie schon das Entstehen der Menschheit an das Aufkommen dieses Gefühls gebunden war: Mit dem ersten Bewusstwerden und dem folgenden Erschrecken über die Endlichkeit brach wohl schon die Sehnsucht auf, die über jede Endlichkeit hinaus will, denn Endlichkeit ist Enge, und Enge, die nicht gewollt ist, macht Angst. Ursprünglich vielleicht nur durch eine zufällige Mutation entstanden, wurde die Sehnsucht im Laufe der Zeit zum Erfolgsmodell des Tieres Mensch, das ohne sie nicht geworden wäre, was es ist: Ein »Erfahrungstier« (Michel Foucault, Gespräch, 1978), immer bereit zum Aufbruch in andere Räume, zur Erkundung neuer Möglichkeiten. Auch wenn Menschen nicht zu allen Zeiten und in allen Kulturen in gleichem Maße davon erfasst sind, ist die Sehnsucht das immer wieder aufbrechende Bedürfnis, im Fühlen und Denken und gelegentlich im Handeln zu einem Anderssein zu gelangen, mit Blick auf ein fernes Schönes, das wie ein Leitstern über dem Leben steht. Worauf das sehnsüchtige Verlangen, Eros im Griechischen, sich richte, das sei das Schönste, sang im 6. Jahrhundert v. Chr. schon die Dichterin Sappho. Durch die gesamte Geschichte der Menschheit irrlichtert die Sehnsucht, und solange es Menschheit gibt, wird es Sehnsucht geben.
Dass sie über das hier und jetzt Bestehende, letztlich über alles Wirkliche und Endliche hinaus zielt, macht die Sehnsucht zu einem transzendenten Vermögen im Wortsinne des lateinischen transcendere, mit dem das Überschreiten einer Schwelle bezeichnet wird. Die Schwelle, die die Sehnsucht überschreitet, ist die vom Wirklichen zum Möglichen, sei es, um eine bedrückende Wirklichkeit, eine Unmöglichkeit von Andersheit hinter sich zu lassen, oder um einfach der Leidenschaft für all das Mögliche, das nicht schon wirklich ist, zu frönen. Worauf auch immer sie sich richtet: Immer ist die Sehnsucht ein ontologisches Streben von einer Ebene des Seins (on im Griechischen) zur anderen, von der Ebene der Wirklichkeit, die faktisch endlich ist, zur Ebene der Möglichkeit, die potenziell unendlich ist. Dieses Streben teilt die Sehnsucht mit der Melancholie und der Liebe, die ebenfalls danach suchen, über die Enge der Wirklichkeit und Endlichkeit hinaus zu gelangen. Sehnsucht, Melancholie und Liebe: Das ist immer nur ein anderes Wort für das Verlangen nach – Gott, diesem traditionellen Inbegriff der Dimension des Möglichen und Unendlichen. Augustinus bemerkte im 4./5. Jahrhundert n. Chr. gegen Ende des 10. Buchs seiner Bekenntnisse, wie das Sehnen Besitz von ihm ergreift und ihn von der gegebenen Wirklichkeit zur möglichen Unendlichkeit hin zieht, aber auch, wie elend er sich fühlt, da er immer wieder ins Gegebene zurückstürzt: »Hier, wo ich sein kann, will ich nicht sein; dort, wo ich sein will, kann ich nicht sein.« In der Sehnsucht kommt das Leben nicht zur Ruhe, die christliche Theologie hat daher nicht sie, sondern die ruhigere Hoffnung, die sich mit dem bloßen Blick auf das Mögliche begnügt, den wichtigsten transzendenten Vermögen (»Kardinaltugenden«) namens Glaube und Liebe beigesellt.
Willkommener erschien die Sehnsucht einer anderen Zeit, in der sie in einem Maße an Bedeutung gewann wie nie zuvor; die Bewegung der Romantik sorgte dafür: Sehnsucht ist das romantische Gefühl par excellence, eine Romantik ohne sie gibt es nicht. Mit den Anfängen der westlichen Moderne im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert haben die Romantiker vieler Länder die Sehnsucht zu ihrem Programm gemacht, sie vorsätzlich gepflegt und gestärkt, überzeugt davon, dass der Geist »nichts Höheres finden kann« (Friedrich Schlegel, Lucinde, 1799, »Sehnsucht und Ruhe«). Die unbändige Sehnsucht der Bettine von Arnim, geborene Brentano, beinahe egal wonach, steht dafür: »Die Sehnsucht hat allemal Recht« (Auswahlband, 2007, 98). Jedem Versuch zum Rückzug aufs Weltliche und Endliche setzt die Romantik eine Potenzierung ins Unendliche entgegen, von der vor allem Novalis träumte. Just am Beginn der Epoche, die eigentlich auf den transzendenten Horizont eines Jenseits verzichten wollte, zünden die Romantiker im Diesseits den Sprengsatz, der den Zugang zur Transzendenz erneut aufreißt. Auf weltliche Weise wird ein Darüberhinaus wieder gewonnen, das sowohl im Traum des Individuums wie auch in der Vision der Gesellschaft von einem anderen Leben weit über den gegenwärtigen Moment, den momentanen Ort und die gegebenen Verhältnisse hinausgeht. Die Sehnsucht ist das romantische Medium zur »Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln« (Rüdiger Safranski, Romantik, 2007, 393), und diese säkulare Religiosität sprengt das etablierte Triumvirat der Transzendenz: Neben Glaube, Liebe, Hoffnung vertrauen fortan viele auf die Sehnsucht, wenn es zu eng wird in der Endlichkeit, sowohl im Leben des Einzelnen wie auch in der Geschichte der Gesellschaft; und neben Melancholie, Traum und Vision bleibt ein transzendentes Urvermögen weiterhin der Rausch, vermutlich die Urform aller Religiosität.
Ihre Intensivierung der Sehnsucht verstanden die Romantiker als eine Kritik an der Moderne, aber sie trugen damit selbst wesentlich zum Prozess der Modernisierung bei. Die Romantik geht folglich nicht darin auf, nur »antimodern« zu sein, vielmehr motiviert sie Individuen und ganze Gesellschaften auf der Suche nach dem Neuen und befördert damit die moderne Bewegung der Befreiung von Bindungen der Religion, Tradition, Konvention und Natur. Die Sehnsucht wird zum Inbegriff der Freiheit des Menschen, nichts mehr so belassen zu müssen, wie es ist, vielmehr alles in Bewegung setzen zu können, und das treibt die moderne Wissenschaft, Technik, Politik und Wirtschaft an: Die Wissenschaft wird angestachelt von der Sehnsucht, sämtliche Zusammenhänge erkennend zu durchdringen. Mithilfe des gewonnenen Wissens lassen sich Techniken bauen, die der Sehnsucht vieler Menschen nach Überwindung natürlicher Grenzen Genüge tun, etwa mit Autos und Flugzeugen, die eine grenzenlose Bewegung ermöglichen, auch mit Raketen, deren eigentlicher Brennstoff die Sehnsucht ist, sogar die Grenzen des Planeten noch hinter sich zu lassen. In der Politik sollen endlose Reformen und Revolutionen die ersehnte »beste aller Welten« herstellen. Und die Wirtschaft offeriert immer neue Produkte, an denen sich die Sehnsucht der Konsumenten entzünden kann (Eva Illouz, Konsum der Romantik, 1997; Wolfgang Ullrich, Habenwollen, 2006).
Das ewig unbefriedigte Sehnen befeuert den Fortschritt, die stetige Vorwärtsbewegung der modernen Zeit – und wird doch regelmäßig unterbrochen von der Gegenbewegung, die dem Vorwärtsdrang wieder Zügel anlegt: Jede Befreiung von Bindungen der Religion, Tradition, Konvention und Natur mündet in eine neuerliche Sehnsucht nach ihrer Wiederherstellung. Die Romantik selbst, die sich vom Wirklichen wegsehnt, wird postwendend zur Sehnsucht nach der verlorenen Wirklichkeit, um sie, kaum wiedergefunden, erneut zu überwinden. Ihr Sehnen unterläuft nicht nur jedes Arrangement mit dem Wirklichen mit Blick auf das Mögliche, sondern wendet sich auch wieder zurück auf das Wirkliche, in dem allein das Leben gelebt werden kann: Von der Enge weg und wieder zu ihr hin, vom momentanen zu einem anderen Leben und wieder zurück, aus dem Leben heraus und wieder ins Leben zurück. Auch politisch eröffnet die Romantik gegensätzliche Perspektiven zwischen der utopischen Sehnsucht nach neuen, idealen Verhältnissen und der nostalgischen Sehnsucht nach einer Wiederherstellung alter, realer Verhältnisse, und dann wieder von vorne. Diese ständige Polarisierung ins Gegensätzliche erzeugt eine Schaukelbewegung des Lebens, die nie aufhört. Im Hin und Her dazwischen geschieht die Entwicklung als kaum wahrnehmbarer Übergang einer schlechteren Gegenwart zu einer besseren Zukunft. Dem dualen Anliegen, wenn nicht gar dem Dilemma der Romantik zwischen Potenzierung und Polarisierung verlieh Friedrich Hölderlin in seinem Hymnenentwurf Mnemosyne um 1805 den gültigen Ausdruck: »Und immer / Ins Ungebundne gehet eine Sehnsucht. Vieles / aber ist / Zu behalten.«
Der Überschwang der Sehnsucht, die über die endliche Wirklichkeit hinaus den unendlichen Raum der Möglichkeiten auftut, erschwert allerdings auch jede Rückkehr zur Wirklichkeit, in der allein sie erfüllbar ist. Gerade dann, wenn die Unendlichkeit und Unbegrenztheit der Möglichkeiten erfahren worden sind, werden die Endlichkeit und Begrenztheit der Wirklichkeit besonders schmerzlich empfunden. Aus diesem Grund folgt nicht etwa nur der unerfüllten, sondern auch der erfüllten Sehnsucht eine Enttäuschung, denn das unendliche Streben, das sein Ziel erreicht, wechselt die ontologische Ebene und verschließt damit den Horizont des Unendlichen. Sich nach Liebe zu sehnen, ist Eines, ein Anderes aber, sie wirklich zu erfahren, denn das macht alsbald die Bedingungen der Endlichkeit wieder spürbar. Sehnsuchtsvoll erwartet, gewinnt der geliebte Andere eine ideale Gestalt, mit allen wünschenswerten Eigenschaften, reichhaltigen Möglichkeiten, göttlichen Konturen: Sein Blick, seine Stimme, sein Geruch, seine Gestik, seine Eigenart, sein Wohlwollen. Die wirkliche Begegnung aber macht klar, dass die reale Gestalt des Anderen eine bestimmte, begrenzte Wirklichkeit verkörpert, mit den üblichen Einbußen und Misslichkeiten. Zwar birgt der Andere, wie ich selbst, einigen Reichtum an Möglichkeiten in sich, die nacheinander, im Laufe der Zeit entfaltet werden können. Aber der Gedanke daran liegt im Moment ganz fern und ändert nichts an der Enttäuschung der Erfüllung jetzt. Ich laste sie dem Objekt der Sehnsucht an, das »nichts bringt«, oder mir selbst, da ich mich vom untauglichen Objekt »täuschen ließ«, seltener mir eingestehe, in der eigenen Wirklichkeit sehr begrenzt zu sein. Niemand trägt Schuld daran, es geschieht nicht böswillig, nicht zufällig, sondern zwangsläufig, da die Ontologie, die Logik des Seins, es so will und auf der Differenz von Möglichkeit und Wirklichkeit beharrt. Alle Wirklichkeit kann immer nur eine endliche, begrenzte sein, nie kann sie den unendlichen, unbegrenzten Möglichkeiten entsprechen.
Mit der Erfüllung verliert die Sehnsucht zu allem Überfluss noch ihren Sinn, der teleologisch geprägt ist: Ihre Ausrichtung auf ein Ziel (telos im Griechischen), das Erfüllung verspricht, vermittelt einen starken Sinnzusammenhang, und je intensiver der Sehnende das Ziel verfolgt, desto schmerzlicher entbehrt er den Sinn, wenn es erreicht ist: Plötzlich erscheint das Ersehnte leblos und leer. Solange es ersehnt wurde, war es groß, mit dem Erreichen aber fällt es der Verachtung anheim: Da es erreicht wurde, kann es nicht wirklich groß gewesen sein. Die größte Gefahr, die der romantischen Sehnsucht droht, ist aus diesem Grund die Erfüllung, denn sie stellt ihre Existenz in Frage. Mit Erfüllung rechnen Romantiker daher lieber nicht, auf sie stellen sie sich nicht ein. Erfüllung kann es für Momente geben, nicht jedoch auf Dauer. Das ist der eigentliche Grund für die Unstillbarkeit der romantischen Sehnsucht, darauf antwortet die Erfindung der ziellosen Sehnsucht, saudade im Portugiesischen, die im Fado hörbar wird und der Erfüllung gar nicht bedarf, vielmehr den Weltschmerz der Unerfüllbarkeit nährt und aus tiefstem Herzen »das ablehnt, was man die Wirklichkeit nennt« (Eduardo Lourenço, Mythologie der Saudade, 2001, 23). Immer von Neuem soll die Sehnsucht aufbrechen und das Selbst sich nach Anderen und Anderem sehnen; dafür steht in der deutschen Romantik das Symbol der »blauen Blume«. Aus der Haltung zur Unerfüllbarkeit ergeben sich fortan Glück und Verzweiflung der Sehnsucht: Glück ist möglich, wenn das Sehnen selbst, erst recht das Erreichen des Ersehnten trotz aller Einbußen als erfüllend empfunden werden kann. Verzweiflung überkommt das Selbst, wenn das Nichterreichen des Ersehnten und sein Erreichen als existenzieller Mangel erscheinen.
Bei all dem ziehenden Schmerz des Sehnens kann der, der sich sehnt, dennoch in der verführerischen Lust schwelgen, sich Möglichkeiten auszumalen, die jede Wirklichkeit verblassen lassen. Mit ausgreifender innerer Bewegung kann er die Sehnsucht als großes Gefühl erfahren, das das alltägliche Maß an Gefühlen hinter sich lässt, ganz so wie die euphorische Freude, die kalte Wut, das basse Erstaunen, die feierliche Erhabenheit, die bittere Enttäuschung, die abgrundtiefe Traurigkeit. Was im engen Alltag fehlt, kann in den weiten Raum der Möglichkeiten projiziert werden, und bedingungslos kann das Selbst sein Leben darauf ausrichten, das Entbehrte zu erlangen. Ohne Sehnsucht droht ein gleichförmiges, spannungsloses Leben, mit wachsender Sehnsucht aber wird die Form des Selbst rasch zu klein für die große Bewegung, die es in sich fühlt, im Innersten bis zum Zerreißen gespannt. Menschen, die sich sehnen, beginnen an ihrer Sehnsucht zu leiden, die jedes Maß sprengt; nicht von ungefähr wurden Goethes Verse (Wilhelm Meister, Lied der Mignon) zum geflügelten romantischen Wort, von Franz Schubert vertont: »Nur wer die Sehnsucht kennt, / Weiß, was ich leide!« Umgekehrt beginnen Menschen, die zu wenig Sehnsucht fühlen, an diesem Mangel zu leiden. Und ganz so, wie jede Nichterfüllung der Sehnsucht leidvoll ist, zieht auch jede Erfüllung ein Leiden nach sich, nämlich am Verlust des Horizonts, der ins Unbegrenzte und Unendliche geht, sodass nur noch der Überdruss am Begrenzten und Endlichen übrig bleibt. Ein geschlossener Kreis des Leidens steht somit zur Verfügung: Leiden am Übermaß der Sehnsucht, Leiden an ihrem Mangel, Leiden an ihrer Nichterfüllung, Leiden auch an ihrer Erfüllung. Mochte die Moderne die Zeit sein, die allem Leiden zu entkommen hoffte, um sich der Lust allein widmen zu können – die romantische Sehnsucht trägt Sorge dafür, dass es kein Entrinnen gibt.
Wenn aber die Melancholie der Erfüllung wie der Nichterfüllung nicht endet und auch nicht enden soll, kann aus Sehnsucht Sucht werden, der Übergang ist fließend. Vor lauter Sehnen wird das Selbst krank, siech, zu heilen nur durch die Erfüllung, mit der das Sehnen jedoch von Neuem beginnt. Die Spannweite zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, die eine Quelle schöpferischer Kraft ist, wird überspannt und kippt ins Zerstörerische. Dazu trägt ein ontologisches Missverständnis bei, nämlich der Glaube, der Unterschied von Wirklichkeit und Möglichkeit sei aufhebbar, die Begrenztheit des Daseins könne durch »Entgrenzung«, durch ein Leben in der unbegrenzten Weite des Seins überwunden werden. Eine Sucht kann viele Gründe haben: Genetische Ausstattung, Prägung der Kindheit, individuelle Anfälligkeit, soziales Umfeld, Verfügbarkeit von Suchtmitteln, deren gesellschaftliche Akzeptanz oder Ablehnung, die Gewöhnung und die darauf folgenden neuronalen Veränderungen, die vor allem bei stoffgebundenen Formen der Sucht kaum je rückgängig zu machen sind. Aber ontologische Gründe kommen hinzu, die in Begriffen festgehalten werden und entsprechende Gefühle wachrufen: Das Selbst will sich auflösen im »ganz Anderen«, in dem das »wahre Leben« vermutet wird, das nur als dauerhaftes Angeregtsein, Erregtsein, ekstatisches Außer-sich-Sein vorstellbar ist. Dieses Leben, das lange Zeit kulturell einem Jenseits zugeschrieben wurde, wird in moderner Zeit individuell ins Diesseits zurückverlegt. Hier aber ist es definitiv unerfüllbar, und das wird der Wirklichkeit zum Vorwurf gemacht, die im Lichte der »anderen Bewusstseinsebene« von Grund auf fragwürdig erscheint, denn nie entspricht sie dem ersehnten möglichen Leben. Statt sich von der Sehnsucht zu Möglichkeiten inspirieren zu lassen, auf veränderte Weise in der Wirklichkeit zu leben, wird das wirkliche Leben für das betroffene Selbst ebenso unmöglich wie ein Leben nur in Möglichkeiten.
Vielleicht geht alle Sucht aus einer Sehnsucht hervor (Werner Gross, Hinter jeder Sucht ist eine Sehnsucht, 2002). Die Sucht ist jedenfalls die andere Seite des Sehnens und gehört der »schwarzen Seite« der Romantik zu. Problematisch können sämtliche Komponenten der Sehnsucht werden: Motiv, Ziel und Mittel zur Erlangung des Ziels. Zum Motiv wird es, die störende Präsenz des Wirklichen hinter sich zu lassen, auch wenn das unmöglich ist. Zum Ziel avanciert das Glück des ewig lustvollen Wohlgefühls, ohne Beimischung von Unlust und Unwohlsein, auch wenn das kein sinnvolles Verständnis von Glück sein kann. Und was die Mittel zur Erfüllung angeht, so kommen, je geheiligter das Ziel, desto bedenkenloser alle Mittel in Betracht, auch deren gewaltsame Beschaffung; selbst Menschen werden zu bloßen Mitteln, etwa um die ersehnte Liebe zu erlangen. Der gewöhnlichen Sehnsucht nach Liebe folgt immer mal wieder ein Moment der Erfüllung, der Sucht aber rasch die anhaltende Lieblosigkeit. Der herkömmlichen Sehnsucht erscheinen alle Hürden auf dem Weg zur Erfüllung überwindbar, die Sucht aber gräbt den Eindruck gänzlicher Aussichtslosigkeit in einen Menschen ein. Eine Gnadenlosigkeit der Existenz wird erfahrbar, auf die ein romantisches Selbst am allerwenigsten vorbereitet ist. Zum letzten Ziel wird der erlösende Tod, um der ewigen Unerfülltheit ein Ende zu setzen und ohne Umwege direkt in die Unendlichkeit zu gelangen, die als wahres Leben erscheint.
Dennoch, trotz aller Gefahr der Sucht, ist die Sehnsucht unverzichtbar: Das Menschsein braucht die Energie, die sie freisetzt, und die Möglichkeiten, die sie erschließt. Um der Sucht zu entgehen, bedarf es einer Anstrengung der bewussten Lebensführung, die zuallererst darin besteht, sich die unaufhebbare Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit vor Augen zu führen. Die Akzeptanz der Differenz ermöglicht die Mäßigung der Sehnsucht, ihre Entlastung von maßlosen Erwartungen, die nicht nur im besonderen Fall, sondern von Grund auf, ontologisch, unerfüllbar sind. Die begrenzte Erwartung ermöglicht, mit der Begrenztheit der Erfüllung besser leben zu können. Es liegt am Selbst, sich bei jeder Idealisierung des Ersehnten darüber im Klaren zu sein, dass jede Realisierung auch weniger ideale Seiten zum Vorschein bringt. Der Einzelne kann damit einverstanden sein, dass keine einzige Möglichkeit ohne Einbußen zu verwirklichen ist, dass zudem jede Verwirklichung den Bedingungen des Lebens in der Zeit unterworfen ist und dass schon aus diesem Grund nicht alle Möglichkeiten verwirklicht werden können. Alles Leben ist ein Abschiednehmen von Möglichkeiten, auch in Gestalt verpasster Gelegenheiten, und ein Neuanfang im Sehnen.
Das Sehnen selbst ist unverfügbar, verfügbar ist nur die Haltung dazu: Etwa dem spontan entstehenden Sehnen zu folgen – oder es ins Leere gehen zu lassen. Situationen können geschaffen werden, die seiner Entstehung förderlich sind, etwa Ziele ins Auge zu fassen, auf die es sich richten kann – oder eben darauf zu verzichten. Liebende können ihre Sehnsucht nach dem Anderen anstacheln, etwa durch die zeitweilige Trennung voneinander, und können sie kulminieren lassen, um sie durch ausgiebige Erfüllung zu befriedigen, und dann wieder von vorne. So kann es gelingen, die Sehnsucht atmen zu lassen und sie dadurch lebbarer zu machen: Das atmende Maß der Sehnsucht ist ein Aspekt der Atmung der Liebe. Von einer Mäßigung der Sehnsucht zu sprechen, soll keineswegs die Extreme des Untermaßes (eines pragmatischen Lebens ohne Sehnsucht) oder des Übermaßes (eines romantischen Lebens nur für die Sehnsucht) unmöglich machen, sofern die Extreme der eigenen Lebenshaltung besser entsprechen. Möglich werden sollen jedoch auch die vielen Abstufungen dazwischen, die die gesamte Skala des Sehnens erfahrbar machen und sich bestens dazu eignen, ein romantisches Übermaß abzubauen oder ein pragmatisches Untermaß aufzufüllen. Atmen können soll das Maß auch zwischen einer episodischen Sehnsucht, die sich gelegentlich einstellt und beiläufig zu befriedigen ist, und einer epochalen Sehnsucht, die zeitlich weit ausgreift, selbst über das eigene Leben hinaus, ohne je nach Erfüllung zu fragen. Die Wahl zwischen den Optionen trifft jeder Einzelne für sich, um die Sehnsucht in einem Maß zu halten, das den Horizont des Lebens öffnet und die Spannung des Lebens intensiviert, aber nicht ruinös auf das eigene Leben und das Leben Anderer zurückwirkt. Das Resultat ist nicht nur individuell von Bedeutung, sondern auch kulturell, denn es wirkt auf die Zeit zurück: Jede Mäßigung der Sehnsucht mäßigt auch die Moderne, die auf die Absolutheit der Sehnsucht gesetzt hat.
Lässt sich die Sehnsucht aber wirklich mäßigen, wenn es um Liebe geht? Ist die Größe der Aufgabe klar, ist ein Scheitern daran weniger problematisch. Romantisch inspiriert, zielt die Sehnsucht in moderner Zeit auf eine Liebe, die eine große Liebe sein soll, ohne irgendwelche Alltäglichkeit, die das Gefühl abflauen ließe, ohne Pragmatik, die die Romantik verstellen würde; zugleich eine wahre Liebe, ohne Enttäuschungen, in denen eine Täuschung über den Zustand der Liebe ans Licht käme, und eine reine Liebe, ohne Beimischung anderer Interessen oder Affekte, die der Liebe widersprächen, ohne Andere, die mit im Spiel sein könnten. Der großen, wahren, reinen Liebe wollen die Liebenden ihr Leben widmen, das vom jeweils Anderen vollständig besetzt werden darf. Wird die Liebe dann wirklich gelebt, machen sie jedoch Erfahrungen, die ihren Vorstellungen nicht restlos entsprechen. Die Vorstellungen wie die Erfahrungen scheinen sehr individuell geprägt zu sein, in Wahrheit aber sind sie eingebettet in eine kulturelle Geschichte, in der die romantische Liebe nur eine Phase ist, nicht der Anfang, erst recht nicht das Ende der Geschichte.
Wenn Liebe geschieht: Eine Erfahrung und ihre Beschreibung
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen machen Menschen Erfahrungen, die sie mit dem Wort »Liebe« benennen, meinen damit aber nicht immer dasselbe. Einen Eindruck vom Reichtum der Bedeutungen geben die überlieferten Beschreibungen der Erfahrungen. Die Geschichte der Liebe ist eine eigene Art von Liebesgeschichte, die davon erzählt, was durch die Zeiten hindurch als Liebe angesehen worden ist: »Ständig das gleiche und doch immer etwas anderes« (István Ráth-Végh, Die Geschichte der Liebe, 1941). Kulturelle Besonderheiten treten dabei hervor, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet haben und vielleicht auch klimatisch bedingt sind, wie Montesquieu meinte (Vom Geist der Gesetze, 1748, 14, 2), sodass l’amour in der französischen Kultur eine Leidenschaft sein kann, die im Zweifelsfall auf Treue verzichtet, während die »wahre Liebe« in der deutschen Kultur traditionell an Treue gebunden ist. Jede einzelne europäische Kultur pflegt ihr Verständnis von Liebe, das sich von anderen europäischen sowie asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Kulturen unterscheidet (Denis de Rougemont, Die Liebe und das Abendland, 1939). Noch deutlicher, subjektiv gesehen, fallen die Unterschiede zwischen den Regionen innerhalb einer Kultur aus, auch zwischen Land und Stadt, erst recht zwischen einzelnen Individuen innerhalb einer Kultur, die je nach Veranlagung, Erfahrung und Überlegung ihre eigene Vorstellung von Liebe entwickeln und verwirklichen.
Die Anfänge der Geschichte der Liebe liegen im Dunkel des Mythos verborgen. Platon lässt in seinem Symposion im 4. Jahrhundert v. Chr. den Komödiendichter Aristophanes davon erzählen, dass die Menschen einst Kugelwesen waren, vollkommen eins mit sich selbst, vorstellbar vielleicht wie Hochschwangere, die auf andere Weise die Einheit einer Zweiheit in sich erfahren. Die göttliche Vollkommenheit der Kugelwesen schlug jedoch in Übermut um, und so versuchten sie, den Himmel zu stürmen, um endlich den Göttern ebenbürtig zu sein. Zeus aber, der oberste Gott, bestrafte sie für die Anmaßung, indem er sie in der Mitte zerspaltete, um sie »kraftloser« zu machen. Fortan war jede Hälfte damit beschäftigt, nach ihrem Gegenstück zu suchen, um mit ihm wieder zur Einheit zu verschmelzen. Die Hälften aber, die sich fanden, glitten aneinander ab, das Wehklagen war groß. Aus Mitleid ordnete Zeus daraufhin ihre Geschlechtswerkzeuge so an, dass sie sich wenigstens zeitweilig wieder verkoppeln und die ursprüngliche Einheit erleben konnten; »zwischendurch« sollten sie ihrer Arbeit nachgehen. So nahm die Geschichte der Separierung der Menschen ihren Lauf, seither ist jeder auf der Suche nach seiner anderen Hälfte, mit der er die Feste der Einheit feiern kann: »Das Verlangen und Streben nach dem Einssein freilich nennt man Liebe.«
Auch andere Kulturen kennen Geschichten von einer ursprünglichen Einheit, nach der die Menschen sich zurücksehnen, meist verbunden mit der Vorstellung einer Einheit auch der verschiedenen Ebenen von Liebe, sodass die Begegnung zwischen zweien die sinnliche Vereinigung der Körper ebenso wie das gefühlte Einssein der Seelen, die geistige Übereinstimmung in Gedanken und die transzendente Erfahrung des Unendlichen umfassen kann. Alle Ebenen spricht die Bildersprache im »Lied der Lieder Salomos«, dem hebräischen Hohelied an, dieser erstaunlichen Sammlung von Versen im Alten Testament (herrlich illustriert 1911 von Lovis Corinth), die aus wechselnder Perspektive die Liebe besingen, mit starkem Hang zur Sinnlichkeit: »Ein Myrrhenbündel ist mein Liebster mir, das zwischen meinen Brüsten ruht.« »In seinem Schatten verlangt’s mich zu sitzen, seine Frucht ist süß meinem Gaumen.« Aber die Sehnsucht nach der erfüllten Liebe, nach dem Genuss ihrer Früchte auf allen Ebenen, kommt auch in anderen Überlieferungen zum Ausdruck, in der griechischen Dichtung etwa bei Sappho: Körperlich, seelisch, geistig, göttlich soll die Liebe sein, die Eros und Aphrodite den Menschen schenken. Auf allen Ebenen spielt auch die Geschichte von Krishna und Radha in der Sanskrit-Dichtung Gitagovinda des bengalischen Hofdichters Jayadeva, der damit alte erotische und mythologische Motive wieder aufnimmt. Die abendländische Geschichte aber entfaltet sich als eine Geschichte der Fragmentierung der Liebe, bei der jeweils eine oder zwei Ebenen das Ganze vertreten sollen und es doch nicht können. Einige Phasen dieser Geschichte lassen sich anhand markanter Neuerungen skizzieren, die sich, einmal eingeführt, nicht mehr verlieren, sondern zu Facetten im Mosaik werden, aus dem das Bild der Liebe zu jeder Zeit besteht.
1. In der Antike hebt Platon die Liebe auf eine geistige Ebene, um den Enttäuschungen zu entgehen, die von vergänglichen äußeren Reizen und wankelmütigen Gefühlen verursacht werden können. Die Rede der Diotima, die Sokrates im Symposion vorträgt, präsentiert den Entwurf dessen, was als »platonische Liebe« Eingang in die Geschichte finden sollte: In Gedanken soll der Liebende sich seiner Liebe bemächtigen, um sie von ihrem Verlangen nach körperlicher Schönheit und seelischer Attraktivität abzubringen; allein die Schönheit des Geistigen soll sie motivieren, um schließlich in Gedanken die unbewegte, unvergängliche, »überhimmlische« Idee des Schönen anzuschauen. Der Aufstieg zur Anschauung der Idee ist mit einer nachdrücklichen Abwertung der körperlichen und seelischen Ebene verbunden, auch die ursprüngliche Besetzung der transzendenten Ebene wird geleugnet: »Eros ist kein Gott.« An die Stelle des Gottes tritt nun die Idee des Schönen und animiert den Menschen, der es erblickt, zur »Niederkunft im Schönen« (tokos en kalo), zum Hervorbringen von Schönem, zur geistigen Kreativität. Mit dieser Orientierung sind zwei in der Lage, gleich welchen Geschlechts, eine Beziehung auf gleicher Ebene zueinander zu unterhalten, bei der beide sich durch Besonnenheit auszeichnen, und vielleicht ist ein ungewöhnliches Paar diesem Ideal wirklich nahe gekommen: Perikles, der athenische Politiker, und die schöne und gebildete Aspasia, der die dichterische Gestalt der Diotima nachempfunden sein könnte. Auf jeden Fall vollzieht sich mit Platon eine signifikante Veränderung in der Bedeutung von »Liebe«, wenngleich die gewöhnlichen ehelichen und außerehelichen Beziehungen von den philosophischen Überlegungen wohl eher unberührt blieben.
2. Im frühen Christentum weisen vom ersten Jahrhundert an verschiedenste Autoren, Platon und dem Neuplatonismus folgend, die körperliche Liebe weitgehend ab und richten die seelisch-geistige Liebe auf eine jenseitige Instanz aus. Die transzendente Ebene wird wieder mit Liebe besetzt, anstelle des sinnlich konnotierten Eros nun jedoch mit geistiger Agape im Griechischen, Caritas im Lateinischen, inkarniert vom Gott des Christentums: »Gott ist Liebe« (1. Johannesbrief, 4, 16), die Verschmelzung mit ihm ist das oberste Ziel. Als legitime Form der Liebe zwischen zweien erscheint in dieser Perspektive allein die eheliche Bindung zwischen Mann und Frau, die vor Gott eingegangen wird und die der Mensch nicht trennen soll. Der Eindruck einer gleichberechtigten Beziehung wird von Aussagen konterkariert, die Paulus im Epheserbrief macht: Der Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst, »die Frau aber fürchte den Mann«, denn er ist ihr »Haupt«, so wie Christus das Haupt der Kirche sei. Die körperliche Liebe ist im Rahmen der Ehe zum Zweck der Fortpflanzung erlaubt und sogar geboten, die gleichgeschlechtliche Liebe hingegen gilt als verwerflich: All das prägt die Erfahrung der Liebe in der abendländischen Kultur für lange Zeit. Augustinus, der selbst eine imposante Wegstrecke der Liebeserfahrung von der körperlichen über die seelisch-geistige hin zur göttlichen Ebene zurücklegt, gibt der christlichen Liebe im 4./5. Jahrhundert n. Chr. schließlich die historisch gültige Form, beschrieben im 10. Buch seiner Bekenntnisse, mit deutlichem Rückbezug auf Platon: Die Liebe zu Gott ist Liebe zur ewigen Schönheit, die Freude daran führt zum glücklichen Leben, die Gottesliebe ist der transzendente Sinn der Liebe, die Nächstenliebe ist ihre weltliche Erscheinungsform.
3. Im Mittelalter ist die Dominanz der transzendenten Ebene allerdings schon nicht mehr durchsetzbar, das Bedürfnis nach weltlicher Erfahrung der Liebe zumindest auf seelisch-geistiger Ebene erwacht erneut; von Gefühlen, denen unbedingt zu folgen ist, singt die Lyrik: Liebe hat es so befohlen (Bernd Prätorius, 2004), und viele Minnesänger unterhalten eine platonische Beziehung zu der Geliebten, die ihnen als Inkarnation der Schönheit erscheint. Die hohe Minne verlangt ihnen ab, in der Sehnsucht zu verharren, Erfüllung nur zu erträumen und auf dem Weg dazu mannhafte Selbstbeherrschung, absolute Diskretion und ewige Treue unter Beweis zu stellen. Andere, wie Walther von der Vogelweide, rühmen die ebene Minne, die ausgeglichene Liebe, zu der auch die körperliche Erfüllung zählt, die für sich allein nur niedere Minne wäre. Selbst die vormals rauen Ritter bemühen sich nun um Gefühle für ihre Dame und bezeugen sie mit den Farben ihrer Kleidung bei Turnieren: Grün-rot für die Liebe, die hell auflodert, schwarz-weiß für den Schmerz, der sie dennoch hoffen lässt.
Entschieden gefördert wird die neue Liebeskultur von Eleonore von Aquitanien, die im 12. Jahrhundert ein äußerst bewegtes Leben führt, Gattin des französischen Königs Ludwig VII., mit dem sie zwei, dann des englischen Königs Heinrich II., mit dem sie acht Kinder hat. Von ihm verstoßen, hält sie, bevor sie ihr Leben als Nonne beschließt, viele Jahre lang Hof in Poitiers und ist an Minnegerichten beteiligt, die über Liebesstreitigkeiten befinden. Die dabei angewandten Regulae amoris, nebst einigen Schiedssprüchen überliefert von Andreas, Kaplan des französischen Königs, handeln davon, dass in der Ehe Pflichterfüllung vorherrschen solle, die wahre Liebe aber die außereheliche sei, in der die Liebenden sich aus freien Stücken alles gewähren, eine begehrte Freude in der mittelalterlichen Welt des Leids und der Verzweiflung. Die ritterliche Aufwertung der Frau wird im Christentum mit der Verehrung Marias nachvollzogen. Christliche Mystikerinnen, denen der Mund von der Erfahrung Gottes übergeht, lassen Unterschiede zum Liebesakt kaum erkennen: »Herr, minne mich gewaltig, und minne mich oft und lang!«, bittet Mechthild von Magdeburg: »Je gewaltiger Du mich minnest, umso schöner werde ich« (Das fließende Licht der Gottheit, I, 23).
4. In der Renaissance wird deutlich, dass die Liebe sich auch mit der seelisch-geistigen Ebene nicht begnügen kann: Sie drängt auf die Entfaltung aller Ebenen. Eine Ahnung davon vermitteln bereits im 12. Jahrhundert Héloïse und Abälard, deren Beziehung zum Inbegriff der Liebe auf körperlicher, seelischer, geistiger und transzendenter Ebene wird. Die Macht der Sinnlichkeit, die sich anfänglich in ihnen Bahn bricht, lässt sich der Gegenmacht christlicher Normen nur noch mit Gewalt unterwerfen, nämlich mit der Entmannung Abälards, die der innigen Beziehung gleichwohl nichts anhaben kann. Viele Briefe aus dem Kloster adressiert Héloïse weiterhin an ihren Geliebten, der seinerseits die gemeinsame Liebe zur Transzendenz beschwört. Inspiriert von der multiplen Liebe, unter neuerlicher, nun aber melancholischer Berufung auf die »Herrschaft« des Eros, dessen sinnliche Seite ihn irritiert, besingt Petrarca im 14. Jahrhundert im Gedichtzyklus Canzoniere seine Beziehung zur geliebten Laura, schillernd auf allen Ebenen, und die nie geklärte Frage, ob es sich dabei um eine reale Gestalt handelt, hält die Wirkungsgeschichte wach und führt zu einer regelrechten »Wiedergeburt der Liebe« (Ingeborg Walter und Roberto Zapperi, Das Bildnis der Geliebten, 2007).
Die Maler der Zeit stellen Frauen mit üppiger Sinnlichkeit, inniger Beseeltheit, geistvollem Ausdruck dar, entrückt in die Transzendenz des antiken Götterhimmels, wie etwa die 1538 gemalte Venus von Urbino (Florenz, Uffizien) des Venezianers Tizian. Die realen Frauen der Renaissance beanspruchen Gleichberechtigung zumindest im Liebesleben, nach der bereits bekannten Grundformel von ehelicher Pflichterfüllung und außerehelichem Lustgewinn. Zugleich ist dies die Zeit einer offen gelebten Bisexualität, sowie einer jedes Maß sprengenden Prostitution. Die große Freiheit in Liebesdingen spricht aus den Werken von Pietro Aretino, François Villon, François Rabelais. Dass selbst das Personal der christlichen Kirche den Versuchungen der Zeit nicht widerstehen kann, bereitet den Boden für Luthers Rückbesinnung auf das wahre christliche Leben, zu dem in seinen Augen die Ehe gehört: Sie ist der einzig richtige Ort der Sexualität, ja, Mann und Frau haben geradezu einen »ehlichen Dienst« aneinander zu verrichten, nicht unwillig, sondern freudig, »sintemal Gott Mann und Weib, sich zu besamen und zu mehren, geschaffen hat« (Vom ehelichen Leben, 1522).
5. In der frühen Neuzeit nötigt das erfolgreiche Zurückschneiden der bunten Triebe die Liebe zur neuerlichen Vergeistigung, die nun aber ganz anders ausfällt als einst bei Platon. Im 17./18. Jahrhundert und bis weit in die Moderne hinein hat die Wertschätzung der geistigen Ebene keine überhimmlische Schönheit, sondern die weltliche Nützlichkeit der Beziehung zwischen zweien im Blick: Die Liebe als Geschäft. Zum nüchternen Kalkül gehören materielle Versorgung und soziale Absicherung, ökonomischer Erfolg und gesellschaftlicher Aufstieg, zu deren Zweck eine formale Liebe arrangiert und in die Form eines Ehebündnisses gegossen wird. Ihr körperlicher Vollzug befriedigt die Bedürfnisse des Mannes und sichert idealerweise die männliche Erbfolge, Gefühlsregungen oder ein anspruchsvoller geistiger Austausch sind dafür nicht von Belang; der Rest ist Melancholie, wie Robert Burton sie im dritten Buch seiner Anatomie der Melancholie (1621) beschreibt. Diese Liebe, die keiner Person gilt, sondern günstigen Bedingungen für die Mehrung materieller Güter, ist maßgeblich an der »innerweltlichen Askese« und »rastlosen Berufsarbeit« beteiligt, die Max Weber als Triebkräfte der Kapitalakkumulation identifizierte (Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus, 1904/05). Mit der Festlegung dieser Liebe auf eine den Konventionen entsprechende bürgerliche Ehe, die den religiösen Segen erhält und außereheliche Verhältnisse moralisch ächtet, brechen zugleich die Blütezeiten der Doppelmoral an. Vorweg in der Aristokratie, sodann im Bürgertum macht sich außerhalb der ehelichen Verbindung eine erotische Freizügigkeit breit, von der zahllose zeichnerische und literarische Darstellungen künden. Die blühende Phantasie und zügellose Libertinage gipfeln in den unkonventionellen Praktiken eines Marquis de Sade und überdauern in verborgener Gestalt mühelos auch Biedermeierzeit und Viktorianisches Zeitalter im 19. Jahrhundert.
6. In der Frühromantik beziehen junge Menschen aus dem Erschrecken über die gefühllos gewordene Liebe den Antrieb, mit ausdrücklichem Rückbezug auf das Mittelalter, aber mit dem modernen Anspruch auf Liebe in der Ehe, vor allem die seelisch-geistige Ebene zu erneuern. In frontaler Entgegensetzung zum prosaischen Kalkül entwerfen die Romantiker poetische Konzepte der Liebe als Gefühl und als Traum, Friedrich Schlegel in Lucinde (1799), Dorothea Schlegel in Florentin (1801). Dem Gefühl kommt gottähnliche Funktion zu, es sorgt für die Erfahrung von Unendlichkeit und begründet die romantische Religion der Liebe, mit der Konsequenz freilich, dass sein Ausbleiben auch die Trennung nahelegt. Wie tödlich der Konflikt zwischen der Liebe als Geschäft und der Liebe als Gefühl ausfallen kann, führt der Realist Theodor Fontane in Effi Briest (1895) vor. Die gefühlsbestimmte Liebe, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts enorm an Popularität gewinnt, ist der gewagte Versuch zu einem zärtlichen Leben, das den Härten der Existenz ganz entgehen will. Es wird zum Zufluchtsort vor den gefühlten Bedrohungen durch die Moderne, die vielen als Zeit der Lieblosigkeit erscheint, beherrscht von gefühlloser Rationalität, Technik und Ökonomie.
Im romantischen Laboratorium der Liebe machen jedoch schon die Frühromantiker selbst gemischte Erfahrungen mit Gefühlen, die auflodern und wieder verglimmen, und Träumen, die zu Albträumen werden. Sie sehen sich stürmischen Verwicklungen ausgesetzt, die für Liebeserfahrungen zu allen Zeiten typisch sein mögen, nun aber an neuer Dynamik gewinnen: Eindrucksvoll das lange Sehnen, das Clemens Brentano zu Sophie Mereau hin treibt und von ihr nach ebenso langem Zögern, dann aber mit aller Unbedingtheit erwidert wird, bevor sich das leidenschaftliche Gefühl mit der Zeit in der Endlichkeit und Begrenztheit eines blassen Alltags verliert und schließlich nur noch bittere Enttäuschung hinterlässt. Die romantisch Liebenden sprengen religiöse, traditionelle und konventionelle Fesseln, scheitern aber am Versuch, der freien Liebe selbst den Charakter einer verlässlichen Bindung zu geben. Das raubt ihnen schließlich den Glauben an die Gefühle. Übrig bleiben die Körper.
7. In der fortgeschrittenen Moderne des 20. Jahrhunderts wird die körperliche Ebene tonangebend, eine historische Neuerung in später Revolte gegen die philosophische und christliche Abwertung der körperlichen Seite der Liebe. Die Psychoanalyse deckt unbewusste und unterdrückte sexuelle Wünsche auf (Martin S. Bergmann, Eine Geschichte der Liebe, 1987), und mit wissenschaftlichem Anspruch wird nun die gesamte Sexualität offen gelegt, breitenwirksam in den Kinsey-Reports von 1948 und 1953; Handbücher schildern detailliert, wie Gebrauch von ihr zu machen sei (Günter Amendt, Das Sex Buch, 1979). Was einen enormen Gewinn an Möglichkeiten des Lebens und Liebens mit sich bringt, verleitet viele auch dazu, die verkürzte Sexualität, Sex, allein mit Liebe zu identifizieren. Wo noch ein Gefühl damit einhergeht, gilt es in Anlehnung an die ökonomische Sphäre letztlich als riskantes »Investment«. Ein Leben ohne Sex erscheint kaum noch vorstellbar, und auch außerhalb des Bettes muss immer alles »geil« sein: Geiles Auto, geile Frisur, geiler Job.
Die moderne Gesellschaft kenne eine Sexualwissenschaft, aber keine Kunst des Liebens mehr, postulierte Michel Foucault 1976 in seinem Buch Der Wille zum Wissen. Die Befreiung von einer »repressiven Sexualmoral« führt eben nicht von selbst schon zur erhofften Erfüllung in einer freien Liebe, eher zur Entleerung von Menschen in verschiedener Hinsicht, zur Vereinsamung der Seelen in nie gekanntem Ausmaß. Welches Verhängnis ein bloß sexuelles Verhältnis mit sich bringen kann, offenbaren unfreiwillig Cicciolina, die Pornodarstellerin, und Jeff Koons, der Künstler, der dem körperlichen Vollzug ihrer Liebe ein bleibendes Denkmal in Bildern und Skulpturen setzt (Made in Heaven, 1990/91): Nach der baldigen Trennung bleibt nur der erbitterte Kampf um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn übrig. Aber wirksamer als je zuvor können Frauen in dieser Zeit ihre Gleichberechtigung geltend machen; ihre Befreiung von der Fron der Fortpflanzung mithilfe einer unscheinbaren Pille spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und auch die gesellschaftlich lange verworfene gleichgeschlechtliche Liebe kann in die moderne Normalität integriert werden, denn je weniger der Sex der Fortpflanzung zu dienen hat, desto mehr kann er seinen Sinn darin finden, sinnliches Genussmittel zu sein, unabhängig von der geschlechtlichen Orientierung.
8. In andersmoderner Zeit erscheint eine Renaissance der Liebe wünschenswert, die allen Ebenen gerecht werden kann, bevor das Spiel der Fragmentierung von Körper, Seele, Geist und Transzendenz irgendwann von Neuem beginnt. Allerdings wird eine erneuerte Kunst des Liebens mit alten Konstanten des Phänomens konfrontiert sein, die sich durch die gesamte Geschichte der Liebe ziehen: Vorweg mit der schieren Uferlosigkeit des Phänomens, die auch nach dem Ende der Liebe (Sven Hillenkamp, 2009) auf eine Liebe ohne Ende verweist. Von der Geburt bis zum Tod umhüllt sie, fehlt sie, fesselt sie jede und jeden in jeder Hinsicht. Die »schönste Nebensache der Welt« ist in Wahrheit die Hauptsache. Wo es vordergründig um Anderes geht, blitzt hintergründig stets »das Eine« auf, selbst in scheinbar liebesfernen Disziplinen wie Politik und Ökonomie, auch unter Bedingungen des Krieges und inmitten des Elends. Alle Menschen sind mit Liebe befasst, nicht immer im Modus des Erlebens, oft in dem des Traums oder der Erinnerung. Häufiger als die Erfüllung ist die Entbehrung erfahrbar, und dennoch bleibt die Liebe das beherrschende Thema menschlicher Verhältnisse: Nichts ist faszinierender, gerade weil kaum etwas enttäuschender ausfallen kann. Ereignet sie sich, scheint das Leben sinnerfüllt zu sein, bleibt sie aus, erscheint es sinnlos und leer. Ob sie sich ereignet oder ausbleibt, lässt sich beeinflussen, aber nicht beliebig steuern. Warum spielen Menschen dieses Spiel? Offenkundig, weil ihnen noch kein spannenderes eingefallen ist.
Angemessen, mit Blick auf die Uferlosigkeit der Liebe, erscheint eine Haltung, die eher vom Verlust jeglicher Haltung kündet: Fassungslosigkeit angesichts des Phänomens. Es ist unvorhersehbar, wann, wo, wie und bei wem die Liebe auftaucht und wieder verschwindet. Es ist absonderlich, wie umfassend ihre Präsenz ist, was ihr Einfluss bewirkt, welche Macht ihr innewohnt, die sie gegen alle anderen Formen von Macht ins Spiel zu bringen vermag, und wie sehr sie auch selbst von Machtbeziehungen durchdrungen ist. Enorm ist ihre spezifische Macht der Wiederholung, die repetitive Potenz der Liebe, nicht nur was ihre Freuden, sondern auch ihre Leiden angeht – da capo scheint ihr Prinzip zu sein: Immer noch einmal und immer wieder, Liebe ohne Ende auch aus diesem Grund. Zauberhaft sind die Wandlungen, die mit Menschen geschehen, die verliebt sind, schauderhaft die Wandlungen, wenn sie sich entlieben: Jeder Perspektivwechsel, jede Meinungsänderung, jede Untreue, jeder Verrat, jede Tat und Untat kommen dabei in Betracht. Menschen werden über sich hinaus getrieben, bis sie sich selbst nicht mehr kennen. Alles verändert die Liebe, ihre Entbehrung ebenso. Unmögliches geschieht am ehesten, und man könnte versucht sein, mit Shakespeare (Ein Sommernachtstraum, Akt 3, Szene 2) auszurufen: »Lord, what fools these mortals be!« – würde man nicht selbst zu diesen Verrückten gehören. Welcher Platz soll angesichts dessen den »Dingen der Liebe« eingeräumt werden? Lohnt sich die immer neue Auseinandersetzung um der Liebe willen? Kann man sich gegen Liebe auch wehren?
Der Fassungslosigkeit des Subjekts entspricht die des Objekts, der Liebe selbst: Eigenartig ist die gänzliche Unfassbarkeit des Phänomens