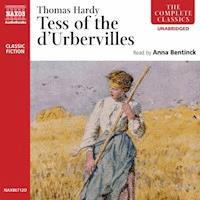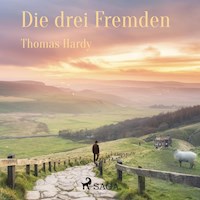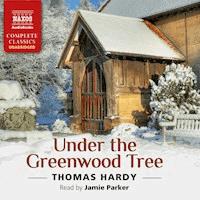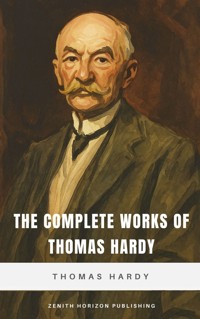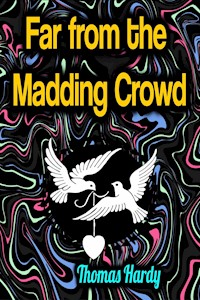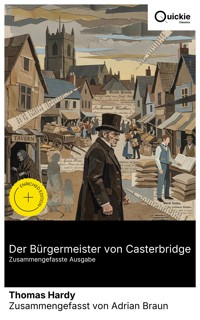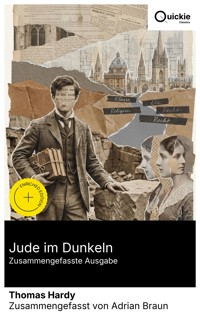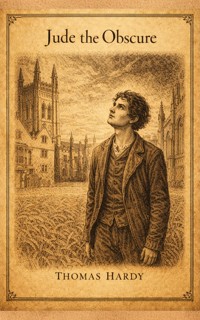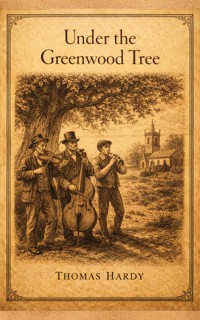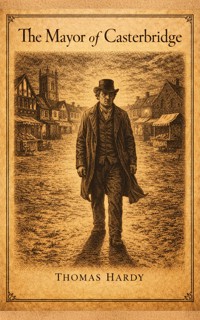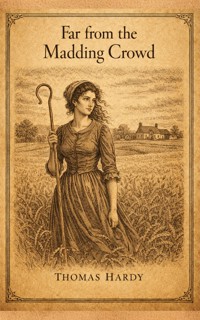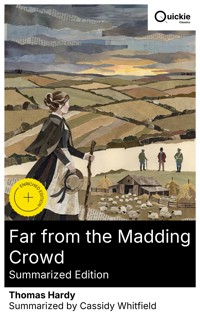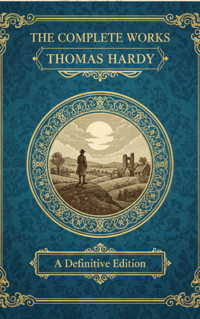22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hardys letzter Roman erstmals auf Deutsch Raue Landschaften, tragische Schicksale, geprägt von einer tiefen Melancholie – so kennt und liebt man die literarische Welt von Thomas Hardy. Umso erstaunlicher ist es, dass sein letzter Roman bislang unübersetzt geblieben ist. Er erzählt die Geschichte des Bildhauers Jocelyn Pierston, der glaubt, die Liebe seines Lebens in drei verschiedenen Frauen gefunden zu haben: in seiner Jugendliebe Avice, zwanzig Jahre später in ihrer Tochter, und am Ende in ihrer Enkelin … - Ein episches Drama über Liebe, Schönheit, Kunst – und die Kluft zwischen Ideal und Realität - Der Abschluss der großen Wessex-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Hardy
Die Liebe seines Lebens
Skizze eines Temperaments
Reclam
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Well-Beloved (1897)
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAM Nr. 962400
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Abbott Handerson Thayer, Cornish Headlands (Landzungen von Cornwall, 1898) – akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun.GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962400-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011527-5
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Kapitel
Zitat
Vorwort
Erster Teil: Ein junger Mann von zwanzig Jahren
Ein Trugbild
Die Erscheinung wird für wahr genommen
Die Verabredung
Eine einsame Fußgängerin
Plötzliche Verantwortung
Auf der Kippe
Ihre früheren Erscheinungen
»Es gleicht zu sehr dem Blitz«
Vertraute Phänomene auf Abstand
Zweiter Teil: Ein junger Mann von vierzig Jahren
Ein junger Mann von vierzig Jahren
Dritter Teil: Ein junger Mann von sechzig Jahren
Sie kehrt zurück zur neuen Saison
Zweifel an der neuen Verkörperung
Das neue Bild brennt sich ein
Die Jagd auf die letzte Inkarnation
Fast schon im Besitz
Wo ist die Liebe seines Lebens?
Ein alter Schrein in neuem Licht
»Weh diesem grauen Schatten, einst ein Mann«
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Nachwort: Thomas Hardys letzter Roman
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
»One shape of many names.«
Percy B. Shelley
Vorwort
Die von der Zeit aus einem riesigen Felsen gemeißelte Halbinsel, auf der die meisten der folgenden Szenen sich abspielen, war seit Jahrhunderten die Heimat eines seltsamen, ganz speziellen Stammes, der eigenartige Ansichten und einzigartige Sitten hatte, die heute fast alle abgeschafft worden sind. Vorstellungen, die so wie manche Sträucher im stillen Frost des Binnenlandes sterben, aber am Meer das raueste Wetter ertragen, scheinen hier zu gedeihen, besonders bei Bewohnern, die an der harten Arbeit der »Insel« nicht aktiv beteiligt sind. So ist sie ein Ort, der genau solche Charaktere wie den hier nur unvollkommen skizzierten Mann hervorbringt, den vielleicht eingeborensten aller Eingeborenen. Manche mögen ihn einen Phantasten nennen (soweit sie ihm überhaupt die Ehre erweisen, ihn zu beachten), andere erkennen vielleicht, dass er versucht hat, einen heiklen Traum weiterzuträumen, zu vergegenständlichen und zu benennen, der in der einen oder anderen Weise allen Menschen gemeinsam ist. Allen, die so wie Platon denken, ist das natürlich nichts Neues.
Jene, die mit der hier beschriebenen, weit ins Meer hinausragenden Ecke Englands vertraut sind, wo man die große Rennbahn des Ärmelkanals mit all ihrer Zweideutigkeit überblickt und bis in den Februar die milde Luft des Golfstroms genießen kann, wundern sich immer wieder, dass der Felsen nicht schon lange zum Refugium von Malern und Dichtern geworden ist, die nach Inspiration suchen. Zumindest für ein oder zwei Monate im Jahr, und vielleicht sogar eher in den stürmischen als in den sonnigen Jahreszeiten. Ein Winkel dort ist zwar auf Kosten des Staates von Genies aus anderen Bereichen besetzt, aber ihre Gegenwart ist kaum zu merken. Und womöglich ist es auch ganz gut, dass nicht zu viele Künstler die Insel besuchen, sonst würde man bald nichts mehr von den kleinen, mit soliden Steinen gebauten Häusern aus dem sechzehnten Jahrhundert und noch älter hören, die man dort für ein paar hundert Pfund kaufen kann, komplett mit gemauerten Fenster- und Türrahmen, Mauerkronen und Kragsteinen. Solche Transaktionen wurden übrigens nach altem Inselbrauch bis vor kurzem noch in der Kirche vor der versammelten Gemeinde vollzogen.
Hinsichtlich der Geschichte selbst lohnt es sich vielleicht, darauf hinzuweisen, dass sie im Gegensatz zu den meisten oder allen anderen Wessex-Romanen auf einen idealen, subjektiven und frei erfundenen Gegenstand abzielt, die Wirklichkeitsnähe wurde diesem Ziel untergeordnet.
Die Erstveröffentlichung dieses Werks in Buchform erfolgte 1897, es war aber bereits 1892 unter dem Titel The Pursuit of the Well-Beloved in Zeitschriften erschienen. Einige Kapitel der damaligen experimentellen Fassung sind für die gegenwärtige und endgültige Form neu geschrieben worden.
August 1912, T. H.
Erster Teil
Ein junger Mann von zwanzig Jahren
Now, if time knows
That Her, whose radiant brows
Weave them a garland of my vows;
Her that dares be
What these lines wish to see:
I seek no further, it is She.
Nun, wenn es so weit ist,
Wird ihre strahlende Stirn
Eine Girlande aus meinen Versprechungen tragen.
Diejenige, die wagt zu sein,
Was diese Zeilen wünschen,
Führt mich ans Ziel der Suche: Es ist Sie.
Richard Crashaw (1613–1649)
Kapitel 1
Ein Trugbild
Der Mann, der die steile Straße von Street-of-Wells auf das Vorgebirge hinaufging, unterschied sich durchaus von den Einheimischen. Das meerumspülte »Gibraltar von Wessex«, dieser einzigartige Felsen, der früher eine Insel gewesen war und noch immer so genannt wird, streckt sich in den Ärmelkanal wie der Kopf eines Vogels. Mit der Küste ist er durch eine lange, schmale, »von der Wut der See« aufgetürmte Kiesbank verbunden, die in Europa ganz einmalig ist.
Der junge Mann war genau das, was er zu sein schien – ein Bewohner von London und anderen europäischen Städten. Gegenwärtig war ihm nicht anzusehen, dass sein urbaner Habitus ihm nur wie ein Kleidungsstück um die Schultern hing. Er hatte sogar ein schlechtes Gewissen, wenn er daran dachte, dass drei Jahre und acht Monate vergangen waren, seit er seinen Vater auf diesem einsamen Felsen besucht hatte, auf dem er geboren war. Die Zwischenzeit hatte er an vielen verschiedenen Schauplätzen mit anderen Gesellschaftsordnungen, Völkern und Sitten verbracht.
Was ihm ganz üblich erschienen war, als er noch auf der Insel lebte, sah nach all diesen Eindrücken sonderbar und kurios aus. Mehr denn je schien der Ort das zu sein, was er der Sage nach einmal gewesen war: Vindilia, Heimat der Steinschleuderer. Der hohe Felsen, die übereinandergestapelten Häuser, bei denen die Treppen vor den Türen des einen über dem Schornstein des Nachbarn aufragten, die Gärten, die vom Himmel herabhingen, und das Gemüse, das auf nahezu senkrechten Beeten wuchs, die ganze massive Kompaktheit der Insel, die aus einem einzigen, vier Meilen langen Klotz aus Kalkstein bestand, waren keine gewöhnlichen und vertrauten Eindrücke mehr für ihn. All das stand jetzt einzigartig, blendend und weiß vor der blauen See, und die Sonne glitzerte auf den Felswänden aus Schichten von oolithischem Kalkstein und den »traurigen Resten von abgebrochenen Lebenskreisen« – in einer Klarheit, die sein Auge mindestens ebenso faszinierte wie jeder andere berühmte Anblick, der ihm begegnet war.
Nach dem mühsamen Aufstieg erreichte er die Hochfläche und marschierte in Richtung des östlichen Dorfes. Es war Sommer, ungefähr zwei Uhr mittags, die Straße flimmerte grell und staubig, und als er in die Nähe seines Vaterhauses kam, setzte er sich in die Sonne.
Der Stein neben ihm fühlte sich warm an, als er die Hand darauf ausstreckte. Das war die ganz persönliche Wärme der Insel im Mittagsschlaf. Er lauschte und hörte das Surren der Sägen. Das war die Stimme der Insel – das Lärmen der Männer im Steinbruch.
Gegenüber von seinem Sitzplatz stand ein geräumiges Cottage. Wie alles hier war es nahezu völlig aus Stein gebaut. Auf der Insel waren nicht nur die Mauern, sondern auch Fensterstöcke, Dächer und Schornsteine, Zauntritte, Zäune, Stallungen, Schweineställe und fast auch die Türen aus Stein.
Er wusste, wer dort früher und möglicherweise immer noch wohnte: die Familie Caro, das heißt die »Roan-Mare«-Caros, wie sie zur Unterscheidung von anderen Zweigen der Familie genannt wurden, denn es gab auf der Insel nur eine Handvoll amtlicher Vor- und Nachnamen. Er überquerte die Straße und warf einen Blick in die offenstehende Tür. Ja, sie waren noch da.
Mrs. Caro hatte ihn durchs Fenster gesehen, kam an die Tür, und sie begrüßten sich in traditioneller Höflichkeit. Einen Augenblick später flog die Tür eines hinteren Zimmers auf, und ein Mädchen von siebzehn oder achtzehn Jahren sprang über den Flur.
»Herrje, das ist ja der liebe Joce!«, rief sie, rannte auf ihn zu und gab ihm einen Kuss.
Dieser Auftritt der jungen Frau mit ihren glänzenden haselnussbraunen Augen und braunen Locken war natürlich sehr lieb, aber für einen Mann aus der Stadt doch so unerwartet und plötzlich, dass er unbewusst etwas zurückwich, und als er ihren Kuss erwiderte, wirkte er leicht verkrampft. »Meine hübsche kleine Avice!«, sagte er. »Wie geht es dir nach so langer Zeit?«
Ein paar Sekunden lang war sich ihre stürmische Unschuld seiner Überraschung gar nicht bewusst; aber Mrs. Caro, ihre Mutter, hatte sie gleich bemerkt. Sie errötete vor Verlegenheit und wandte sich ihrer Tochter zu. »Aber Avice, mein Liebling! Was machst du denn? Weißt du gar nicht, dass du eine junge Frau geworden bist, seit Jocelyn – Mr. Pierston – das letzte Mal hier war? Du kannst dich heute nicht mehr benehmen wie vor drei, vier Jahren!«
Die so entstandene Befangenheit ließ sich auch mit Pierstons Versicherung nicht beseitigen, dass er hoffe, Avice werde ihre kindliche Übung auch weiterhin beibehalten, und es folgten einige Minuten mit allgemeiner Konversation. Pierston ärgerte sich aus tiefster Seele, dass ihn seine unbewusste Bewegung verraten hatte, und als er ging, wiederholte er, dass er Avice nicht verzeihen würde, wenn sie ihn jetzt anders behandeln würde als früher. Sie verabschiedeten sich in aller Freundschaft, aber ihr Bedauern über den Zwischenfall stand Avice ins Gesicht geschrieben. Jocelyn trat zurück auf die Straße und ging zum nahen Haus seines Vaters. Mutter und Tochter blieben allein zurück.
»Ich habe mich sehr über dich gewundert, mein Kind!«, sagte die Mutter. »Ein junger Mann aus London, der an die strengsten gesellschaftlichen Manieren und Damen gewöhnt ist, die wohl ein breites Lächeln schon für vulgär halten! Wie konntest du nur, Avice?«
»Ich … Ich habe nicht daran gedacht, dass ich jetzt älter bin«, sagte die junge Frau schuldbewusst. »Ehe er von hier wegging, hab ich ihn immer geküsst, und er mich auch.«
»Aber das ist Jahre her, meine Liebe!«
»Ja, ja, und einen Moment lang hab ich’s vergessen! Er schien mir ganz derselbe wie damals.«
»Nun ja, es lässt sich nicht rückgängig machen. Aber du musst vorsichtiger sein in der Zukunft. Ich könnte wetten, es gibt viele junge Frauen für ihn, und er hat nicht viel Zeit, an dich zu denken. Es heißt, er wäre jetzt Bildhauer, und die Leute sagen, dass er ein großes Genie in der Branche werden will.«
»Na, ich hab’s nun mal gemacht, das kann ich nicht ändern«, seufzte die junge Frau.
Jocelyn Pierston, der aufstrebende Bildhauer, hatte mittlerweile das Haus seines Vaters erreicht, der ein Mann des Handwerks und Handels ohne irgendein Kunstverständnis war, von dem Jocelyn im Hinblick auf seinen künftigen Künstlerruhm aber eine jährliche Zahlung gern akzeptierte. Der Vater, der von dem bevorstehenden Besuch gar nichts wusste, war allerdings nicht zu Hause, um seinen Sohn zu empfangen. Jocelyn musterte die vertraute Umgebung, warf über die Allmendewiese einen Blick auf die großen Werkhöfe, auf denen die ewigen Sägen die ewigen Blöcke zersägten. Dieselben Blöcke und Sägen, die er gesehen hatte, als er das letzte Mal hier war, so schien es ihm jedenfalls. Er durchquerte das Haus und ging in den Garten.
Wie alle Gärten auf der Insel war auch dieser von einer Trockenmauer aus abgesplitterten Steinen umgeben. Der hinterste Winkel grenzte an den Garten der Caros, und als er ihn schließlich erreichte, hörte er Weinen und Schluchzen hinter der Mauer. Es war die Stimme von Avice, die einer Freundin ihr Herz ausschüttete.
»Ach, was soll ich machen? Was soll ich bloß machen?«, rief sie bitterlich. »Warum bin ich so schamlos und dreist gewesen? Was hab ich mir dabei gedacht? Das wird er mir nie verzeihen, er wird mich nie wieder mögen! Er wird mich jetzt für ein dreistes Flittchen halten, dabei hab ich doch nur vergessen, wie groß ich geworden bin. Aber das glaubt er mir nie!« Es klang, als wäre sie sich ihrer Weiblichkeit zum ersten Mal bewusst geworden und als hätte diese ungewollte Eigenschaft sie beschämt und geängstigt.
»War er denn böse deswegen?«, fragte die Freundin.
»Nein, böse nicht! Viel schlimmer: kalt und hochnäsig. Er ist so ein Weltmann geworden, ist gar kein Inselmann mehr. Hat keinen Sinn, darüber zu reden. Am liebsten wäre ich tot!«
Pierston zog sich hastig zurück. Zutiefst bedauerte er den Zwischenfall, der dieser unschuldigen Seele solche Schmerzen bereitet hatte; zugleich aber verspürte er dabei ein vages Gefühl der Lust. Er kehrte ins Haus zurück, und nachdem auch sein Vater eingetroffen war und ihn begrüßt hatte, nahmen sie ein gemeinsames Mahl ein. Danach ging Jocelyn noch einmal aus, erfüllt vom ernsten Wunsch, die Besorgnisse seiner jungen Nachbarin in einer Art zu beruhigen, wie sie es kaum erwarten konnte. Um die Wahrheit zu sagen, war seine Zuneigung allerdings weniger die eines Liebhabers, sondern die eines Freundes. Er war sich keineswegs sicher, dass die schwer greifbare, rastlos wandernde Verklärung, die er Liebe nannte, jetzt tatsächlich im Körper von Avice Caro ihren Wohnsitz genommen hatte. Viel zu oft war sie seit seiner Kindheit schon von einer weiblichen Gestalt zur anderen geflogen.
Kapitel 2
Die Erscheinung wird für wahr genommen
Obwohl das Problem auf der Insel in der Regel darin bestand, sich nicht ständig über den Weg zu laufen, hatte Pierston plötzlich Schwierigkeiten, Avice zu treffen. Die Befangenheit, die ihre impulsive Begrüßung ausgelöst hatte, hatte sie zu einer anderen gemacht, und obwohl sie in unmittelbarer Nachbarschaft wohnten, gelang es ihm nicht, ihr zu begegnen. Kaum streckte er die Nase aus der Tür, verschwand sie wie eine Füchsin in ihrem Loch und flüchtete in ihr Zimmer im oberen Stock.
Pierston aber war so begierig, Avice nach der unabsichtlichen Beleidigung, die er ihr zugefügt hatte, zu beruhigen, dass er ihre Ausweichmanöver nicht lange ertragen konnte. Die Sitten auf der Insel waren schlicht und direkt, auch bei den Wohlhabenden, und als er sie an einem der nächsten Tage wieder einmal verschwinden sah, ging er einfach hinter ihr her und folgte ihr ins Haus bis an die Treppe.
»Avice!«, rief er.
»Ja, Mr. Pierston.«
»Warum rennst du so eilig nach oben?«
»Ach, ich wollte etwas holen.«
»Na, wenn du’s jetzt hast, kannst du ja wieder runterkommen.«
»Nein, das geht nicht.«
»Bitte komm! Du weißt doch, du bist meine liebe Avice.«
Keine Antwort.
»Na ja, wenn du nicht willst, dann eben nicht!«, sagte er. »Ich will dir ja nicht zur Last fallen.« Damit ging Pierston wieder hinaus.
Er bewunderte noch die altmodische Blumenpracht an der Gartenmauer, als er eine Stimme hinter sich hörte.
»Ich war nicht böse auf Sie, Mr. Pierston. Aber als Sie weggegangen sind, dachte ich, Sie hätten mich missverstanden, und es gehört sich, Sie wissen zu lassen, dass ich Sie nach wie vor als meinen Freund betrachte.«
Als er sich umdrehte, sah er die errötende Avice dicht vor sich. »Du bist ein liebes, braves Mädchen!«, sagte er, griff nach ihrer Hand und setzte ihr einen Kuss auf die Wange, ganz so, wie er das schon am Tag seiner Ankunft hätte tun sollen.
»Liebe Avice, verzeih mir die Kränkung, die ich dir zugefügt habe! Sag, dass du mir verzeihst! Dann werde ich dich fragen, was ich noch keine andere Frau, lebendig oder tot, je gefragt habe: Willst du mich zum Mann nehmen?«
»Ach! Mutter sagt, ich wäre nur eine von vielen.«
»Das bist du nicht, Liebes. Du hast mich schon gekannt, als ich noch ein kleiner Junge war, das gilt für andere nicht.«
Ihre Einwände wurden bald überwunden, und obwohl sie nicht gleich ihre Einwilligung gab, ihn zu heiraten, erklärte sie sich bereit, später am Nachmittag mit ihm spazieren zu gehen. Tatsächlich wanderte sie mit ihm zum Beal, der südlichen Spitze der Insel, die von Fremden meist Bill genannt wurde. Am Blasloch der tückischen Höhle, dem Cave Hole, aus dem manchmal die Gischt herausspritzte, machten sie eine Pause, ganz so wie damals, als sie noch Kinder waren. Pierston bot ihr seinen Arm an, damit ihr nicht schwindlig wurde, wenn sie hinunterschaute. Als Kamerad hatte er sie hundertmal so berührt, jetzt war sie zum ersten Mal eine Frau.
Sie schlenderten weiter zum Leuchtturm, wo sie wohl noch länger geblieben wären, wenn Avice nicht plötzlich eingefallen wäre, dass sie heute Abend in Street-of-Wells, dem Dorf, das den Zugang zur Insel beherrschte und heute eine richtige kleine Stadt ist, Gedichte vortragen musste.
»Ein Vortrag!«, sagte Pierston. »Wer hätte gedacht, dass hier auf der Insel mal jemand Vorträge hält? Außer natürlich der niemals schweigenden See, die immer etwas zu sagen hat …«
»Oh, wir sind jetzt sehr gebildet. Besonders im Winter. Aber, Jocelyn, komm bitte nicht zu meinem Vortrag, ja? Wenn du da wärst, würde das meinen Auftritt verderben, und ich will ja nicht schlechter sein als die anderen.«
»Wenn du das nicht willst, werde ich nicht hingehen. Aber ich warte am Ausgang auf dich und bring dich nach Hause.«
»Gut!«, sagte Avice und blickte zu seinem Gesicht auf. Sie war jetzt vollkommen glücklich, obwohl es seit dem peinlichen Tag seiner Ankunft undenkbar für sie gewesen war, dass sie je mit ihm glücklich sein könnte. Sie trennten sich, als sie die Ostseite der Insel erreichten, damit sie noch rechtzeitig ihren Platz auf der Bühne einnehmen konnte. Pierston ging nach Hause, und erst nach Einbruch der Dunkelheit, als es Zeit war, sie abzuholen, machte er sich auf den Weg nach Street-of-Wells.
Er war voller Bedenken. Er kannte Avice schon so lange, dass auch seine jetzigen Gefühle weniger mit Liebe als mit kameradschaftlicher Gewohnheit zu tun hatten. Die Konsequenzen dessen, was er heute Morgen so spontan gesagt hatte, erschreckten ihn plötzlich gewaltig. Es erschien allerdings unwahrscheinlich, dass eine der vollendeteren und raffinierteren Frauen, die ihn bisher gelockt hatten, sich zur Unzeit zwischen sie stellen würde. Denn er hatte sich längst von dem Gedanken befreit, das Idol seiner Träume könne integraler Bestandteil einer realen Person sein, auch wenn er es in manchen Frauen für längere oder kürzere Spannen erblickt hatte.
Seinem Ideal war er immer treu gewesen, aber es hatte viele Verkörperungen gehabt. Die Individuen namens Lucy, Jane, Flora, Evangeline oder was auch immer waren stets nur aufeinanderfolgende Übergangsstadien seines Idols gewesen. Das war aus seiner Sicht keine Entschuldigung oder Verteidigung, sondern einfach bloß eine Tatsache. Seinem Wesen nach hatte sein Idol gar keine greifbare Substanz, es war nur eine Stimmung, ein Traum, ein Rausch, ein Begriff, ein Duft, die Essenz des Geschlechts in einem Leuchten der Augen oder sich öffnenden Lippen. Gott allein wusste, wer diese ideale Frau wirklich war. Pierston jedenfalls wusste es nicht. Sie war unbeschreiblich.
Weil er nie richtig darüber nachgedacht hatte, dass sie ein subjektives Phänomen war und ihre Existenz vermutlich den fragwürdigen Wirkungen seiner Abstammung und seines Geburtsortes verdankte, hatten das Geisterhafte ihres Wesens, die Unabhängigkeit von physikalischen Gesetzen und deren offene Missachtung ihm gelegentlich sogar Angst gemacht. Er wusste nie, wo sie als Nächstes auftauchen und wohin sie ihn führen würde, denn sie hatte Zugang zu allen Gesellschaftsschichten, Klassen und Aufenthaltsorten der Menschen. Nachts träumte er manchmal, dass sie Aphrodite persönlich, die unerbittliche, ränkeschmiedende Tochter des hohen Zeus sei, die ihn für alle Sünden gegen ihre Schönheit bestrafte, die er in seiner Kunst begangen hatte. Er wusste, dass er sie in allen Verkleidungen lieben würde, wo immer er sie entdeckte, egal ob ihre Augen blau, schwarz oder braun waren und ob sie sich groß, zart oder üppig zeigte. Sie war nie an zwei Stellen gleichzeitig; aber sie war auch nie lange an einer Stelle geblieben.
Indem er das schon vor einiger Zeit für sich geklärt hatte, hatte er sich jede Menge hässliche Selbstvorwürfe erspart. Es war einfach so, dass die ideale Geliebte, die ihn lockte und an einem seidenen Faden führte, wohin sie wollte, auf ihrem bisherigen Weg nicht immer dasselbe fleischliche Tabernakel bewohnt hatte. Ob sie sich jemals niederlassen würde, wusste er nicht zu sagen.
Wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass sein Idol sich in Avice manifestierte, hätte er sich nur allzu gern eingeredet, dass sie der Endpunkt seiner Wanderungen war, sich damit zufriedengegeben und sein Versprechen gehalten. Aber sah er in Avice denn die Liebe seines Lebens? Die Frage war ein wenig verstörend.
Er hatte die Kuppe des Berges erreicht und ging die lange, schnurgerade Römerstraße hinunter, wo er alsbald auch die hellerleuchtete Halle fand. Die Vorstellung war noch nicht zu Ende, und als er um das Gebäude herumging und sich auf einen kleinen Hügel stellte, konnte er bis auf die Bühne sehen. Fast sofort kam der zweite Auftritt von Avice. Ihre niedliche Verlegenheit beim Anblick des Publikums verscheuchte die Zweifel. Sie war wirklich ein nettes Mädchen; sehr verlockend, aber vor allem nett – eine von der Art, bei denen das Risiko einer Ehe fast gegen Null tendierte. Ihre intelligenten Augen, ihre breite Stirn und ihre wohlüberlegte Haltung überzeugten ihn, dass er unter all den anderen noch kein charmanteres und solideres Mädchen gefunden hatte als Avice Caro. Das war auch keine bloße Vermutung – er kannte sie ja lange und gründlich genug, mit all ihren Gemütslagen und Stimmungen.
Ein vorbeifahrendes schweres Fuhrwerk ließ ihre kleine, leise Stimme unhörbar für ihn werden; aber das Publikum war entzückt, und sie errötete bei dem Applaus. Er bezog jetzt seinen Posten am Ausgang, und als die Leute herausgeströmt waren, sah er, dass sie drinnen auf ihn wartete.
Sie stiegen nach Hause die Old Road hinauf. Dabei hielt sich Pierston am Geländer neben der steilen Straße fest und zog Avice an seinem Arm mit. Als sie oben waren, blieben sie stehen und sahen sich um. Zur Linken war der Himmel ein Fächer von Leuchtturmstrahlen, und vor ihnen erhob sich im Viertelminutentakt ein hohler Donner mit einem langanhaltenden, rasselnden Knirschen dazwischen, als würden Knochen von gewaltigen Hundezähnen zermahlen. Das war die Brandung von Deadman’s Bay, die auf den Kiesstrand krachte.
Die Abend- und Nachtwinde waren hier mit etwas geladen, das sie sonst nirgends mit sich trugen, fand Pierston. Es kam mit den Geräuschen aus der düsteren Bucht herauf, die sie jetzt hörten. Sie waren ein geisterhaftes Echo der vielen Toten, die dort unten lagen. Mit Kriegsschiffen waren sie untergegangen, mit Indienfahrern, Frachtkähnen, Zweimastern und der Armada – ausgewählte, gewöhnliche und erniedrigte Menschen, deren Hoffnungen und Interessen so weit auseinandergelegen hatten wie Nord- und Südpol. Auf dem ruhelosen Meeresgrund waren sie hin und her gerollt worden, bis alle eins waren. Man spürte förmlich, wie ihr großer, zusammengemischter Geist als formlose Woge über die Insel rollte und nach einem gütigen Gott schrie, der sie voneinander erlöste.
Zusammen wanderten sie durch diese Nacht mit ihren Eindrücken – bis zum alten Kirchhof Hope, der in einer Schlucht über dem Meer lag. Bei einem Erdrutsch war die Kirche den Abhang hinuntergerissen worden und schon lange nur noch eine Ruine. Man hätte fast glauben können, dass sich das Christentum in diesem letzten Hort des Heidentums nur mühsam behaupten konnte. An diesem feierlichen Ort küsste Pierston sie.
Diesmal ging der Kuss ganz und gar nicht von Avice aus. Ihr früherer Überschwang steigerte jetzt ihre Zurückhaltung.
Dieser Tag war der erste eines angenehmen Monats, den sie fast ständig gemeinsam verbrachten. Er stellte fest, dass sie nicht nur Gedichte bei gebildeten Versammlungen vortragen, sondern auch gut singen und sich dazu selbst auf dem Klavier begleiten konnte.
Bald wurde ihm klar, dass die für ihre Erziehung Verantwortlichen vor allem darauf abgezielt hatten, sie so weit wie möglich von ihrem natürlichen und individuellen Wesen als Bewohnerin der Insel zu entfernen und zu einem Abziehbild zehntausender anderer Frauen zu machen, in deren Lebensumständen es nichts Besonderes, Eigenes oder Originelles gab. Die Kenntnisse ihrer Vorfahren sollte sie alle vergessen; die örtlichen Balladen sollten von den Schlagern der Saison übertönt werden, die von den Musikgeschäften in Budmouth verkauft wurden, und die örtliche Sprache von einem Gouvernantenvokabular, das gar kein Land hatte. Sie wohnte in einem Haus, das jeder Maler als Glücksfall betrachtet hätte, und lernte dort, Londoner Vorstadtvillen nach Druckvorlagen zu zeichnen.
Avice hatte das alles erkannt, noch ehe er sie darauf hinwies. Aber als braves Mädchen hatte sie es sich gefallen lassen. Vom Wesen her war sie bodenständig bis auf die Knochen, dem Zeitgeist hatte sie sich nicht entziehen können.
Jocelyns Abreise rückte rasch näher, und sie betrachtete das Datum traurig, aber gelassen, da ihre Verlobung jetzt feststand. Pierston erinnerte sich in diesem Zusammenhang durchaus an den besonderen Brauch, der sowohl in seiner als auch in ihrer Familie seit Generationen üblich gewesen war. Der Zustrom von Auswärtigen oder Kimberlins (wie die Fremden vom Festland genannt wurden) hatte zwar dazu geführt, dass dieser Brauch von vielen nicht mehr geübt wurde; aber Jocelyn vermutete, dass unter dem Firnis ihrer Erziehung auch bei Avice vielleicht diese traditionelle Vorstellung schlummerte. Und er fragte sich, ob sie neben ihrer natürlichen Traurigkeit über seine bevorstehende Abreise nicht auch ein Bedauern darüber empfand, dass die praktische Bestätigung ihrer Verlobung nach Art der Väter und Großväter nicht stattfand.
Kapitel 3
Die Verabredung
»Ja«, sagte Jocelyn. »Jetzt sind wir am Ende meiner Ferien angekommen. Drei oder vier Jahre bin ich nicht in meiner alten Heimat gewesen, weil ich dachte, dass es sich nicht lohnt. Und jetzt diese schöne Überraschung!«
»Musst du morgen wirklich fahren?«, fragte sie ängstlich.
»Ja.«
Es lastete etwas auf ihnen, das sie beide mehr bedrückte als die Trauer über eine Trennung, die gar nicht lang sein sollte, und Jocelyn hatte beschlossen, nicht schon wie geplant am Vormittag abzureisen, sondern den Postzug von Budmouth am Abend zu nehmen. Das würde ihm erlauben, den Steinbrüchen seines Vaters noch einen Besuch abzustatten, und wenn sie wollte, hatte Avice Gelegenheit, ihn am Strand bis zu der Burg zu begleiten, die Heinrich VIII. erbaut hatte. Da konnten sie dann verweilen und zusehen, wie der Mond über dem Meer aufging. »Ja, ich glaube, da kann ich kommen«, sagte sie.
Den nächsten Tag verbrachte Jocelyn also in den Steinbrüchen bei seinem Vater und bereitete seine Abreise vor. Zur verabredeten Zeit machte er sich auf den Weg. Er verließ das steinerne Haus, in dem er auf dieser steinernen Insel auf die Welt gekommen war, und gedachte, auf dem langen Strand nach Budmouth-Regis zu wandern. Avice war schon früher aufgebrochen, um Freunde in Street-of-Wells zu besuchen, und wollte dann nachkommen.
Der Abstieg führte ihn rasch hinunter zu den letzten Häusern der Insel und den Ruinen des Dorfes, das der Novembersturm von 1827 zerstört hatte. Dann ging er auf dem schmalen Streifen Land nach Norden. Nach etwa hundert Metern hielt er inne und setzte sich auf die Kiesbank, welche den Strand nach Westen abschirmte, um auf Avice zu warten.
Zwischen ihm und den Schiffen, die in der Bucht vor Anker lagen, gingen jetzt langsam zwei Männer in derselben Richtung vorbei, die auch er nehmen wollte. Der eine erkannte Jocelyn und sagte guten Abend. »Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer Wahl, Sir«, fügte er hinzu. »Ich hoffe, dass die Heirat bald stattfinden kann!«
»Danke, Seaborn. Wir werden sehen, was Weihnachten bringt.«
»Heute Morgen noch hat meine Frau gesagt: Lieber Gott, ich hoff, ich erleb’s noch, dass die zwei heiraten. Ich kenn sie ja, seit sie krabbeln konnten.«
Dann gingen sie weiter, und als sie außer Hörweite waren, sagte der andere der beiden Männer: »Wer war dieser junge Kimberlin? Scheint keiner von uns zu sein.«
»Doch, doch, das ist er. Vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist Mr. Jocelyn Pierston, der einzige Sohn des Steinbruchbesitzers in East Quarriers. Er soll ein sehr niedliches junges Ding heiraten. Die Mutter ist Witwe, sie ist auch im Steingeschäft, aber ihr Umsatz ist höchstens ein Zwanzigstel dessen, was Pierston hat. Er verdient Abertausende, sagen die Leute, lebt aber immer noch auf die alte Art da oben in dem alten Haus. Der Sohn macht tolle Dinge in London als Bildschnitzer. Ich weiß noch, wie er angefangen hat, Spielzeugsoldaten aus Kalksteinstücken zu schnitzen, die unten im Steinbruch seines Vaters herumlagen; dann hat er Schachfiguren geschnitzt und immer so weiter. Er ist in London ein richtiger junger Gentleman, hab ich gehört. Man fragt sich, warum er zurück auf die Insel gekommen ist, um sich die kleine Caro zu schnappen – auch wenn sie ein nettes Mädel ist … Hoppla, es scheint so, als gäbe es bald ein Unwetter!«
Der Gegenstand dieser Beobachtungen wartete unterdessen am vereinbarten Treffpunkt. Um sieben sollte seine Verlobte kommen, so war es verabredet. Und fast genau um diese Zeit sah er eine Gestalt im Licht der Laterne am Fuße des Berges. Allerdings erwies sie sich als ein kleiner Junge, der ihn fragte, ob er Mr. Pierston sei, und ihm dann einen Brief aushändigte.
Kapitel 4
Eine einsame Fußgängerin
Als der Junge weg war, ging Jocelyn zu der Laterne und las den Brief.
Mein Liebster,
ich würde es sehr bedauern, wenn es Dich kränken sollte, was ich Dir über unser heutiges Treffen am Sandsfoot Castle mitteilen muss. Aber mir ist klar geworden, dass unsere häufigen Begegnungen in der letzten Zeit Deinen Vater wohl dazu veranlasst haben, Dich als seinen Erben davon zu überzeugen, dass Du vor unserer Verlobung darauf bestehen musst, dem alten Inselbrauch zu folgen … Ihr gehört ja zu einer der ältesten Familien auf der Insel mit ununterbrochenem Stammbaum. Um die Wahrheit zu sagen: Meine Mutter vermutet, dass Dein Vater aus natürlichen Gründen darauf drängt, dass wir es tun sollen. Das aber widerstrebt meinen Gefühlen: Der Brauch ist ja fast schon ganz abgeschafft, und ich halte ihn auch nicht für gut, selbst wenn es, wie in Deinem Fall, ein großes Vermögen gibt, das ihn in gewissem Maß rechtfertigen würde. Ich möchte lieber auf die Vorsehung vertrauen.
Insgesamt gesehen ist es also schon um des Anstands willen besser, wenn ich heute nicht zu einer Verabredung komme, deren Ort und Zeitpunkt auf den Brauch hindeuten. Auch für andere, soweit sie noch davon wissen.
Ich bin sicher, dass Dich diese Entscheidung nicht sonderlich stört, sondern dass Du meine modernen Gefühle verstehst und mich deshalb nicht weniger magst. Und noch etwas: Wenn wir es versuchen würden, mein Lieber, und kein Glück dabei hätten, würde der alte Familiensinn, der in uns und Deinem Vater lebt, am Ende dazu führen, dass wir wie unsere Vorfahren glauben, wir könnten nicht heiraten. Und dann würden wir bestimmt unglücklich.
Aber Du bist ja bald wieder hier, nicht wahr, Jocelyn? Und dann kommt auch bald die Zeit, in der es keinen Abschied mehr geben wird.
Für immer die Deine, Avice
Jocelyn las den Brief und war überrascht, wie viel Naivität sich darin zeigte und wie schlicht und altmodisch Avice und ihre Mutter offenbar dachten. Glaubten sie wirklich, dass so ein barbarischer historischer Brauch immer noch ein ernst zu nehmendes, operatives Prinzip für jemanden war, der gar nicht mehr auf der Insel lebte? Als Geschäftsmann hatte sein Vater vielleicht tatsächlich bestimmte praktische Vorstellungen über Nachkommenschaft, die den Vermutungen der beiden Frauen eine gewisse Glaubwürdigkeit verlieh. Aber die hatte er gegenüber Jocelyn nie geäußert, auch wenn er noch so altmodisch war.
Es amüsierte Jocelyn, dass sich Avice für modern hielt, aber er war auch enttäuscht und ein wenig verärgert, dass dieser unerwartete Umstand ihn ihrer Gesellschaft beraubte. Wie doch die alten Vorstellungen trotz der neuen Erziehung fortwirkten!
Die geneigten Leserinnen und Leser mögen bitte bedenken, dass die hier geschilderten Ereignisse in der Geschichte der Insel zwar relativ neu waren, aber nun doch schon vierzig Jahre zurückliegen.
Der Abend war der Finsternis gewichen, aber Jocelyn hatte keine Lust, noch einmal zurückzugehen und ein Gefährt zu mieten, und ging stattdessen allein weiter. Auf dem exponierten Strand wehte ein böiger Wind, und hinter der Kiesbarriere tanzte und kickte die See in komplexen Rhythmen, die mal wie Sturmangriffe klangen und mal wie Kirchenlieder.
Nach ein paar Minuten erkannte Pierston auf dem blassen Fahrweg vor sich eine weibliche Gestalt und erinnerte sich, dass jemand hinter ihm vorbeigekommen war, als er den Brief gelesen hatte. Jetzt sah er die Person vor sich.
Einen Augenblick lang hoffte er, dass Avice ihre Meinung geändert hatte. Aber sie war es nicht, und auch niemand, der ihr geähnelt hätte. Die Gestalt war größer und eckiger als seine Verlobte, und obwohl es erst Anfang Herbst war, trug sie einen Pelz oder dicke Kleidung aus schwerem Stoff.
Er hatte sie rasch eingeholt und konnte jetzt ihr Profil im Schein der Lichter auf der Reede sehen. Es war edel und faszinierend wie das einer echten Juno. Noch nie hatte er ein so klassisches Profil gesehen. Sie ging mit schwingenden, leichten Schritten, aber doch mit so viel Kraft, dass es minutenlang kaum einen Unterschied in ihrer Geschwindigkeit gab, und in dieser kurzen Spanne beobachtete er sie und stellte seine Vermutungen an. Er wollte sie gerade überholen, als sie ihn plötzlich ansprach.
»Mr. Pierston, aus East Quarriers, nicht wahr?«
Er bestätigte es und sah zugleich, was für ein schönes, gebieterisches Gesicht sie hatte – ganz im Einklang mit ihrer stolzen Stimme. Seiner Einschätzung nach war sie eine Erscheinung ganz neuen Typs; und sie hatte auch keinen so örtlichen Akzent wie Avice.
»Können Sie mir sagen, wie spät es ist?«
Er entzündete ein Streichholz, warf einen Blick auf seine Uhr und sagte, dass es Viertel nach sieben sei. Dabei stellte er im flüchtigen Licht fest, dass ihre Augen erhitzt und ein wenig gerötet aussahen, als ob sie geweint hätte.
»Mr. Pierston, bitte entschuldigen Sie eine Frage, die Ihnen vermutlich sehr merkwürdig vorkommen muss: Können Sie mir für ein paar Tage etwas Geld leihen? Ich habe dummerweise mein Portemonnaie auf der Kommode liegen lassen.«
Die Frage war tatsächlich merkwürdig, aber die Eigenart ihrer Persönlichkeit überzeugte Jocelyn sofort, dass sie keine Betrügerin war. Er kam ihrer Anfrage ohne Zögern nach und schob seine Hand in die Tasche. Da blieb sie dann für einen Moment. Was meinte sie mit etwas Geld? Ihr junonisches Auftreten führte dazu, dass er sich um der Harmonie willen impulsiv fügte und ebenso souverän reagierte. Er witterte eine Romanze. Er gab ihr eine Fünf-Pfund-Note.
Seine Großzügigkeit löste keine erkennbare Überraschung bei ihr aus. »Das ist völlig genug, vielen Dank«, sagte sie leise, als er ihr die Summe nannte, weil es vielleicht zu dunkel für sie war, um sie zu erkennen.
Während des Überholmanövers und der Unterhaltung hatte Jocelyn nicht beachtet, dass der Wind zugenommen hatte: vom Schnauben zum Knurren und vom Knurren zum Heulen mit der hier üblichen Geschwindigkeit. Und was er mit diesen wechselnden Launen angekündigt hatte, war Regen. Gleich die ersten Tropfen hatten sie von der Seite getroffen wie Schrotkugeln, und jetzt war daraus ein heftiger Beschuss geworden, der bereits Jocelyns linken Ärmel durchnässte. Die hochgewachsene junge Frau wandte sich um und schien recht besorgt wegen des Angriffs, den sie bei ihrem Aufbruch offenbar nicht hatte kommen sehen.
»Wir müssen in Deckung gehen«, sagte Jocelyn.
»Und wo?«, fragte sie.
Auf der Windseite erstreckte sich die lange, monotone Barriere der Kiesbank, die allerdings zu nachlässig aufgetürmt war, um wirklichen Schutz zu bieten, und dahinter hörte man das Zähnefletschen der Brandung mit ihren knirschenden Kieseln. Rechts lag die innere Bucht, auf der in einiger Entfernung die Positionslichter der vor Anker liegenden Schiffe flimmerten. Blitze und Wetterleuchten unter dem niedrigen Himmel zeigten hin und wieder, wo sich die Insel erhob. Vor ihnen zeigte sich gar nichts, denn da gab es auch nichts. Die wackelige hölzerne Brücke zum Ufer war noch eine Meile entfernt, und die Ruinen der Burg von Heinrich VIII. waren noch weiter weg.
Aber auf dem Scheitel der Kiesbank lag, mit dem Kiel nach oben, ein Lerret am Strand. Es war offensichtlich zum Schutz vor den Wellen so weit nach oben gezogen worden, und als sie es erblickten, rannten sie beide gleichzeitig darauf los. Erst als sie auf der Böschung standen, wurde ihnen bewusst, dass es schon lange dort liegen musste. Das breite alte Ruderboot bot weit mehr Schutz, als sie aus der Entfernung gedacht hatten. Die Fischer benutzten es wohl als Lagerraum, und das Dach war eigens geteert worden. Sie krabbelten unter den Bug, der auf der Leeseite aufgebockt worden war und die Kiesbank ein Stück überragte, und ertasteten im Dunkel Ruderbänke, Ruder und einen Haufen trockener Netze. Darauf ließen sie sich nieder, denn stehen konnten sie unter dem Boot nicht.
Kapitel 5
Plötzliche Verantwortung
Der Regen fiel auf den Kiel des Bootes wie von einem gewaltigen Sämann geschleudert, und die Dunkelheit wurde zum tiefsten Schatten.
Sie saßen so dicht zusammen, dass er ihren Pelz an sich spürte. Weder er noch sie hatten gesprochen, seit sie den Weg verlassen hatten, bis sie mit bemühter Beiläufigkeit sagte: »Das ist wirklich misslich.«
»Das stimmt«, gab er zu. Und nachdem sie noch einige weitere Worte gewechselt hatten, kam er zu dem Ergebnis, dass sie tatsächlich geweint haben musste, denn ihre Äußerungen waren immer wieder von einer unterdrückten Atemlosigkeit und Leidenschaft begleitet.
»Vielleicht ist es für Sie noch misslicher als für mich«, sagte er. »Und das tut mir sehr leid.«
Darauf sagte sie nichts, und er fügte hinzu, dass die Straße auf dem Strand ein recht trostloser Aufenthaltsort für eine Frau sei, besonders wenn sie allein und zu Fuß unterwegs war. Er hoffe doch sehr, dass es nichts Schlimmes gewesen sei, was sie zu dieser unpassenden Stunde hinausgetrieben habe.
Sie schien zunächst aber nicht geneigt zu sein, über ihre Angelegenheiten zu sprechen, und er konnte über ihren Namen, ihre Geschichte und woher sie ihn kannte weiter nur spekulieren. Als der Regen keinerlei Neigung zum Aufhören zeigte, sagte er schließlich: »Ich glaube, wir müssen zurückgehen.«
»Niemals!«, sagte sie, und man spürte ihre Entschlossenheit in der Art, wie sie die Lippen zusammenpresste.
»Warum denn nicht?«, fragte er.
»Es gibt dafür gute Gründe.«
»Was ich nicht verstehe: Woher kennen Sie mich, während ich keine Kenntnis von Ihnen habe?«
»Sie kennen mich durchaus. Zumindest vom Hörensagen.«
»Nein. Wie sollte ich? Sie sind eine Kimberlin.«
»Nein, bin ich nicht. Ich bin von der Insel. Oder war es zumindest. Haben Sie nie von der Best-Bed Stone Company gehört?«
»Und ob! Die haben meinen Vater ruinieren und das ganze Geschäft an sich reißen wollen. Jedenfalls der Gründer, der alte Bencomb, hat das versucht.«
»Das ist mein Vater.«
»Wirklich! Tut mir leid, dass ich so respektlos von ihm gesprochen habe. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Als er das Unternehmen verkauft hatte, ist er nach London gegangen, nicht wahr?«
»Ja. Unser Haus ist in South Kensington, also seins. Mir gehört es nicht. Wir wohnen da schon seit Jahren. Aber diesen Sommer haben wir die Villa Sylvania hier auf der Insel gemietet. Der Besitzer ist außer Landes.«
»Dann habe ich ja ganz in Ihrer Nähe gewohnt, Miss Bencomb. Das Haus meines Vaters liegt noch ein Stück weiter draußen. Es ist allerdings viel bescheidener.«
»Aber er könnte sich ein größeres leisten, wenn er wollte.«
»Sagt man das? Ich weiß es nicht. Mein Vater erzählt mir nicht viel von seinen Geschäften.«
»Mein Vater«, platzte es plötzlich aus ihr heraus, »schimpft dauernd mit mir. Heute war es schlimmer denn je. Er sagt, meine teuflische Verschwendung beim Einkaufen ginge weit über das hinaus, was er mir zugebilligt habe.«
»War das heute Abend?«
»Ja. Der Streit war so heftig, dass ich gesagt habe, ich wolle mich für den Rest des Abends zurückziehen. Aber dann bin ich einfach weggerannt. Ich gehe nie wieder nach Hause zurück.«
»Was haben Sie denn vor?«
»Als Erstes werde ich zu meiner Tante nach London fahren, und wenn die mich nicht aufnimmt, muss ich eben für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Meinen Vater habe ich jedenfalls für immer verlassen! Was ich getan hätte, wenn ich Sie nicht getroffen hätte, weiß ich allerdings auch nicht. Dann hätte ich wohl den ganzen Weg nach London laufen müssen. Jetzt kann ich den Zug nehmen.«
»Falls wir es in diesem Gewitter überhaupt bis zum Bahnhof schaffen.«
»Ich bleibe einfach hier sitzen, bis es vorbei ist.«
Und so saßen sie da auf den Netzen. Pierston wusste, dass Bencomb der bitterste Feind seines Vaters gewesen war. Er hatte schon viele der kleineren Steinbruchbesitzer geschluckt, nur Jocelyns Erzeuger war ein bisschen zu groß für ihn gewesen und bis heute noch der Hauptkonkurrent der Best-Bed Company. Merkwürdig, dachte Jocelyn, dass ich jetzt vom Schicksal in dieselbe Lage versetzt worden bin wie der Sohn der Montagues gegenüber der Tochter der Capulets.
Bei ihrem Gespräch hatten sie instinktiv beide die Stimmen gesenkt, und so zwang das Brüllen des Sturms sie, noch näher zusammenzurücken. Während eine Viertelstunde nach der anderen verging, schlich sich eine gewisse Zärtlichkeit in ihren Tonfall, und sie vergaßen die Zeit. Schließlich fuhr die junge Frau hoch, weil die Situation sie beunruhigte.
»Regen oder nicht, ich kann hier nicht bleiben«, erklärte sie.
»Bleiben Sie!«, sagte er und griff nach ihrer Hand. »Ich bringe Sie wieder zurück. Mein Zug ist längst weg.«
»Nein, ich gehe auf jeden Fall weiter. Ich kann ja ein Zimmer in Budmouth nehmen, wenn ich da je hinkomme.«
»So spät, wie es jetzt ist, hat in Budmouth nichts mehr offen, außer dieser kleinen Absteige neben dem Bahnhof. Da wollen