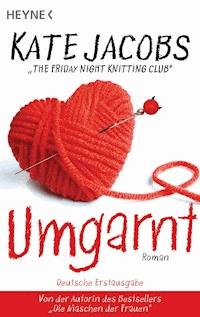Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe THE FRIDAY NIGHT KNITTING CLUB erschien 2007 bei G. P. Putnam’s Sons, New York
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: © Eisele Grafik Design, München
ISBN : 978-3-641-01854-2V003
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
1. Kapitel – Geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10.00 – 20.00 Uhr GARANTIERT!
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Darwins erster Schal!
Dakotas Haferflocken-Heidelbeer-Orangen-Muffins
Danksagung
Copyright
Das Buch
Georgias Tochter Dakota wächst ohne ihren Vater James auf, weil der sich noch während der Schwangerschaft aus dem Staub gemacht hat. Mit Rat und Tat steht der Strickladenbesitzerin seither die »Ersatz-Großmutter« Anita zur Seite, die im Laden aushilft. Als zufällig jeden Freitag einige Frauen in den Laden kommen, um sich von den zwei Expertinnen Strick-Tipps zu holen, ist der Freitags-StrickClub geboren. Von nun an treffen sie sich jede Woche. Nebenher dröseln die Strickerinnen die verwickelten Fäden ihres Lebens auf. Als James unerwartet auf der Bildfläche auftaucht, muss auch Georgia wieder alte Fäden in ihrem Leben aufnehmen.
Rührend, humorvoll, warm – das sind Kate Jacobs Die Maschen der Frauen.
»Dieser luftige Roman zieht einen in den Bann.« USA Today
»Ein zutiefst schönes und bewegendes Porträt von Frauenfreundschaften.
Man lacht und weint mit den Frauen, und man wünscht
sich, auch stricken zu können.« Kristin Hannah
Die Autorin
Kate Jacobs, geboren in Kanada, studierte an der New York City University, bevor sie in Manhattan als Redakteurin unter anderem für Family Life und Working Woman arbeitete. Sie lebt in New York und Los Angeles. Die Maschen der Frauen ist ihr Debütroman, der bei Erscheinen sofort auf die internationalen Bestsellerlisten einstieg. Weitere Informationen sind zu finden unter www.katejacobsbooks.com und www.walkeranddaughter.com.
Die Vorbereitung
Die Wahl des Strickgarns ist eine höchst anspruchsvolle Angelegenheit: Ein überwältigendes Sortiment an Farben und Garntypen verleitet schnell dazu, sich die schon fertige Jacke oder Mütze vorzustellen (und erst die vielen Komplimente, die man dafür bekommen wird). Allerdings wird dabei leicht übersehen, dass nur harte Arbeit ans Ziel führt. Ausschlaggebend sind Geduld und Sorgfalt – und nicht zu vergessen: Durchhaltevermögen. Herausforderungen sind zwar spannend, dennoch sollten Sie sich nicht für ein Muster entscheiden, das Ihre Fähigkeiten übersteigt. Sparen Sie niemals an der Garnqualität. Und testen Sie in aller Ruhe, welche Nadeln am besten in der Hand liegen; ich habe von jeher Bambusnadeln den Vorzug gegeben. Noch immer erlebe ich es als kleines Wunder, dass aus diesem Sammelsurium – weiches Garn, spitze Nadeln, eine schriftliche Anleitung sowie Kreativität, Können und Vorstellungskraft – etwas erschaffen werden kann, in das ein Stück der eigenen Seele eingeflossen ist.
Aber es funktioniert.
1. Kapitel
Geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10.00 – 20.00 Uhr GARANTIERT!
Gut sichtbar standen die Öffnungszeiten von Walker and Daughter: Strickbedarf in leuchtend bunter Schrift auf dem Reklameschild über dem Treppenabsatz. Allerdings kam es so gut wie nie vor, dass Georgia Walker abends vor Viertel nach acht die Ladentür verriegelte. Oft wurde es sogar viel später. Und selbst dann hatte sie noch längst nicht Feierabend, sondern sammelte auf den Boden gefallene Wollfäden ein, bereitete die nächste Stunde ihres nachmittäglichen Strickkurses vor und rechnete die Kasse ab.
Sie saß auf dem Stuhl hinter der Verkaufstheke, schaltete ab vom Straßenlärm des unten vorbeiführenden Broadways und addierte die Zahlen auf einem Zettel. Das Geschäft läuft ganz gut, könnte aber noch besser sein, dachte sie seufzend und zupfte an ihren langen kastanienbraunen Locken herum. Eine Angewohnheit, die sie einfach nicht ablegen konnte. Am Ende eines stressigen Tages stand ihr Pony manchmal in alle Richtungen ab. Sobald die Buchhaltung erledigt war, strich sie ihr Haar glatt und klopfte sich die Radiergummireste von Jeans und Jerseytop. Etwas blass im Gesicht – sie arbeitete zu viel und war selten in der Sonne – erhob sie sich zu ihren stolzen 1,82 Meter (dank der 7,5 Zentimeter hohen Absätze ihrer abgetragenen Cowboystiefel aus braunem Leder).
Dann drehte sie noch eine Runde durch den Laden und fuhr dabei über die nach Farben sortierten Garne – von Pastell- bis zu sattem Grasgrün, Rost- bis leuchtend Erdbeerrot, Eis- bis Königsblau, Zitronengelb bis Bernsteinfarben sowie alle erdenklichen Nuancen von Grau, Beige, Schwarz und Weiß. All das gehörte ihr. Und natürlich Dakota – deshalb hieß der Laden ja auch Walker und Tochter -, die mit ihren zwölf Jahren ständig die Anweisungen ihrer Mutter ignorierte und sich lieber am Farbenspiel der Wolle erfreute.
Dakota war das Ladenmaskottchen, maßgebende Farbexpertin (mehr Glitzergarne!) und beeindruckend geübt im Umgang mit den Stricknadeln. Georgia staunte oft darüber, wie flink ihre Tochter strickte und wie souverän sie mit heruntergefallenen Maschen umging. Mehr als einmal hatte Georgia beobachtet, wie ihr gar nicht mehr so kleines Mädchen selbstbewusst zu einer Kundin sagte: »Warten Sie, ich helfe Ihnen. Mit einer Häkelnadel kriegen wir das wieder hin …«
Wenn Georgia dann endlich das Licht löschen wollte, war es praktisch an der Tagesordnung, dass eine Kundin atemlos die Treppe zum Geschäft im ersten Stock hinaufgelaufen kam und ihr zurief: »Könnte ich noch kurz reinkommen? Es dauert wirklich nur eine Minute …« Bevor Georgia überhaupt eine Chance hatte, zu sagen, dass bereits geschlossen sei, war die Kundin schon im Laden. »Kommen Sie nur herein«, sagte sie für gewöhnlich und lief dann eben erst später die wenigen Stufen hinauf in ihr spärlich möbliertes Appartement. Allerdings ließ sie an Schultagen niemanden länger als bis neun im Laden bleiben, weil Dakota sonst nicht mit ihren Hausaufgaben fertig wurde. Aber Georgia schickte niemals eine potenzielle Kundin weg.
Sie würde überhaupt nie jemanden wegschicken. Mit einem erschöpften Lächeln, das die ersten Fältchen um ihre grünen Augen sichtbar werden ließ, bat Georgia die Nachzüglerin herein. Auf ein Neues, schien ihr Blick zu sagen. Aber letztendlich war sie dankbar für jeden, der durch diese Ladentür kam. Und sie nahm sich ausreichend Zeit für die Beratung, denn was das Geschäftsleben betraf, hatte Georgia handfeste Vorstellungen: »Jeder Verkauf zieht einen weiteren nach sich – vorausgesetzt, man stellt den Kunden zufrieden.« Mit Theorien wie dieser ging sie Dakota regelmäßig auf die Nerven.
»Du kannst ruhig schon gehen«, würde sie dann über die Schulter hinweg zu Anita sagen, die immer bis nach Geschäftsschluss blieb. Georgia hatte ihr gegenüber manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn es so spät wurde. Aber Anita, die in ihrem Chanel-Hosenanzug noch genauso frisch und munter wirkte wie nachmittags um drei, schüttelte lächelnd den Kopf – und ihr silbergrauer Bob lag danach wieder genauso perfekt wie vorher.
Anita teilte Georgias Leidenschaft für Strickmuster und Garne. Und sie genoss es, mit den Kundinnen von Walker and Daughter über das Handarbeiten zu plaudern.
Das Stricken hatte Anita von dem Moment an begeistert, als ihre Großmutter – »Bubbe« hatte Anita sie genannt – ihr zum ersten Mal einen Strang dicker, weicher Wolle in die Hände gedrückt hatte. Gebannt hatte sie zugeschaut, wie durch flinkes Klappern mit den Nadeln aus dem jagdgrünen Faden eine kleine, kuschelige Strickjacke entstand – mit dicken Knöpfen, die Anita mit ihren winzigen Fingern schon greifen konnte. Schon bald legte sie ihre Hände auf die der Großmutter, wollte unbedingt mitmachen. Irgendwann zog sie selbst den Faden durch die Schlaufe und erlebte schließlich den aufregenden Moment, zum ersten Mal Maschen aufzunehmen. Als junge Frau strickte sie sich Twinsets aus Angorawolle, die die Eltern ihr nicht kaufen konnten. Später produzierte sie am laufenden Band flauschige Decken und Söckchen für ihre Kinder, während ihr Mann mit dem Aufbau seiner Firma beschäftigt war. Anita blieb dem Stricken treu, auch nachdem ihr Mann längst so gut verdiente, dass er seiner Familie ein mehr als angenehmes Leben bieten konnte. Schließlich – sie hatte die Lebensmitte bereits weit überschritten – schob Anita die Bücher mit Strickvorlagen beiseite und begann, mit Farben zu experimentieren und eigene Muster zu entwerfen.
Inzwischen war sie fast sechzig, Mutter dreier erwachsener Söhne und Großmutter von sieben hübschen und aufgeweckten Enkelkindern.
»Anita ist eine Künstlerin«, pflegte Stan zu sagen, wenn die Leute seine Westen bewunderten, ohne die er nicht ins Büro ging. Stan. Er war immer stolz auf sie gewesen und hatte sie damals ermutigt, den Job bei Georgia anzunehmen. Anita hingegen hatte befürchtet, dass die Leute es für verrückt hielten, wenn sie in ihrem Alter plötzlich arbeiten ging.
»Wie war’s?«, wollte Stan nach ihrem ersten Arbeitstag wissen. »Gut, sehr gut sogar«, hatte sie versichert und sich in seine Arme gekuschelt. »Dann mach es auf jeden Fall«, hatte er gemurmelt.
Von da an arbeitete Anita einmal wöchentlich nachmittags im Laden. Mit der Zeit wurde die kleine Dakota für sie wie ein weiteres Enkelkind. Und zwar eines, dass sie sehen konnte, wann immer sie wollte – im Unterschied zu ihren eigenen Kindern und Enkelkindern, die alle weit weg gezogen waren: nach Israel, Zürich und Atlanta. Man schrieb sich natürlich und telefonierte, aber das war nicht das Gleiche. Anita konnte sie nicht besuchen – sie litt schon seit Ewigkeiten unter Flugangst, gegen die alle Psychologen und Beruhigungsmittel dieser Welt nichts ausrichten konnten. Zwischen den einzelnen Wiedersehen verging so viel Zeit, dass Anita jedes Mal das Gefühl hatte, fremden Menschen gegenüberzustehen.
Eines Tages war auch Stan von ihr gegangen. Während sie morgens noch mit Toastkrümeln an den Lippen am Frühstückstisch saß, gab er ihr einen flüchtigen Abschiedskuss. Kurz darauf erlitt er im Fahrstuhl seines Bürohauses einen Herzinfarkt. Anita erhielt einen Anruf, sie solle sofort ins Krankenhaus kommen. Doch man hatte nichts mehr für ihn tun können.
Stan hatte mit der gleichen Umsicht für diese Situation vorgesorgt, wie er es immer im Leben gemacht hatte. Aber finanziell abgesichert zu sein war nicht alles. Anita war jetzt allein, mutterseelenallein. Sie blieb in der ersten Zeit nach Stans Tod fast ausschließlich im Bett, weinte viel, schlief, und die Zeitschriftenberge um sie herum wurden immer höher. Ungefähr einen Monat nach der Beerdigung stand sie auf. Sie zog sich die Lippen nach, legte ihre Perlen an und machte sich auf den Weg zu Georgia.
»Du hast mit jedem Tag mehr Kunden und kommst mit deinen Aufträgen kaum noch nach, Georgia«, sagte sie. »Du brauchst jemanden, der dich im Laden unterstützt. Und ich brauche wieder eine Aufgabe – nicht nur an einem Tag in der Woche.« Das stimmte. Dakota war damals gerade zwei geworden und Georgia hatte begonnen, zusätzlich zu der Anfertigung von Strickwaren auch Garne und Kurzwaren zu verkaufen. Sie hatte hart gearbeitet, um ihr Geschäft zum Laufen zu bringen, und zusätzlich morgens von sechs bis zwölf unten im Souterrain in Martys Deli Bagel getoastet und Kaffee ausgeschenkt. Wenn sie mit dem Laden genug verdiente, könnte sie ihren Zweitjob bald aufgeben und mehr Zeit mit Dakota verbringen.
Sie vereinbarten, dass Anita von nun an jeden Nachmittag im Laden helfen sollte. Georgia wollte sie unbedingt bezahlen, aber das lehnte Anita strikt ab. Sie wollte kein Geld – sondern Garn.
Tatsächlich war der Laden – dank sorgfältiger Planung, steter Expansion und einer guten Portion Hoffnung – richtig gut angenommen worden. Im Laufe der Jahre wurde er sogar mehrfach in der Lokalpresse als Geheimtipp genannt; und kürzlich hatte es im New York Magazine einen Artikel über Mompreneurs – Mütter als Unternehmensgründerinnen – gegeben, in dem Walker and Daughter vorgestellt wurde.
»Das bringt uns deine Klassenkameradinnen samt ihren Müttern in den Laden«, hatte Georgia gesagt, als Dakota den Zeitungsartikel mit in die Schule nahm. Wie jeden Morgen brachte sie Dakota zur Schule. Sie umarmten einander kurz und Dakota marschierte davon. Sie war schon fast an der Tür angelangt und hatte den Reißverschluss ihres Anoraks bereits geöffnet, sodass ihr leuchtend türkisfarbener Pullover zum Vorschein kam – eine von Georgias Kreationen, die Dakotas milchkaffeebraunen Teint so schön zur Geltung brachte -, da drehte sie sich noch einmal um. »Ich bin stolz auf uns, Mom!«, rief Dakota und zeigte triumphierend auf den Artikel. Dann stürmte sie ins Gebäude.
Georgia erlebte den Rückweg wie in Trance. Mit zitternden Händen fingerte sie den Schlüssel ins Schloss der Ladentür, und dann war ihr Gesicht plötzlich nass von Tränen. Sie weinte all die Jahre voller Existenzangst und harter Arbeit aus sich heraus, während ihr Dakotas Worte noch in den Ohren klangen.
Anita blieb dabei, nur Wolle als Bezahlung zu akzeptieren. Wenn sie etwas Neues beginnen wollte, ging sie an die Regale und suchte sich Wolle aus. Sie strickte immer noch eine Weste nach der anderen, obwohl Stan bereits seit zehn Jahren nicht mehr lebte. Und wenn sie das Bedürfnis nach einer Umarmung hatte, drückte sie Dakota an sich. Das genügte ihr als Lohn.
Anita atmete jedes Mal auf, wenn in letzter Minute noch eine Kundin in den Laden kam. Ein paar Minuten mehr, die sie gebraucht wurde, ein kleiner Aufschub, bis sie zurückmusste in ihr viel zu großes Appartement im San Remo an der Upper West Side. »Kommen Sie nur herein«, übertönte sie Georgias angedeuteten Protest und eilte auf die Kundin zu. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
So kam es, dass die Ladentür von Walker and Daughter immer noch ein bisschen länger geöffnet blieb.
Es dauerte nicht lange, da nahmen ein paar Stammkundinnen die Angewohnheit an, am Ende einer harten Arbeitswoche mit dem Strickzeug unterm Arm vorbeizukommen – Pullover, Schals und Handyhüllen. Sie wollten sich Rat holen wegen der Fehler, die ihnen beim Stricken in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit unterlaufen waren. Fragen wie:
»Ich bekomme dieses Knopfloch einfach nicht hin!«, oder »Warum lasse ich ständig Maschen fallen?«, und »Ob ich es bis Weihnachten fertig habe?«, waren an der Tagesordnung.
Ohne dass Georgia es forciert hätte, wurden diese Abende zur festen Gewohnheit. Die Frauen saßen an dem großen runden Tisch mitten im Laden, plauderten, strickten und holten sich bei Anita fachmännischen Rat. Und dann, eines Freitags im letzten Herbst, wurde es offiziell. Gewissermaßen.
Lucie, eine Frau mit kurzem, rotblondem Haar und großen blauen Augen, die eine Vorliebe für Schildpattbrillen und flippige Outfits hatte, kaufte anfangs nur gelegentlich bei Walker and Daughter. Sie tauchte alle paar Monate im Laden auf und arbeitete jedes Mal an demselben Stück: einem dicken Herrenpullover mit Zopfmuster. Frauen wie Lucie fanden oft den Weg in den Laden – Frauen, deren Fähigkeiten nicht mit ihren Strickambitionen Schritt hielten.
Mit der Zeit schaute Lucie immer öfter vorbei. Manchmal betrat sie den Laden mit Lederaktentasche und Kostümjacke über dem Arm, als käme sie direkt von einem wichtigen Meeting. Dann wieder wirkte sie betont lässig in ihren schmal geschnittenen Fitnesshosen und mit der Fahrradkuriertasche quer vor dem Bauch. Aber nie fehlte die Tüte mit Lebensmitteleinkäufen, den Zutaten für ein einfaches Abendessen, die sie vorsichtig auf die Theke stellte, während sie das Garn bezahlte. Nachdem sie sich ein paar Mal mit Lucie unterhalten hatte, erkannte Anita, dass diese Frau im Umgang mit den Nadeln durchaus geschickt war, es aber nicht schaffte, sich die Zeit dafür zu nehmen.
»Sie können jederzeit hier stricken«, bot Anita ihr spontan an. Und eines Freitags setzte sich Lucie tatsächlich an den Tisch und begann zu stricken. Dakota, die ziellos durch den Laden streifte und gejammert hatte, dass ihr langweilig sei und sie ins Kino wolle, setzte sich sofort neben sie.
»Der ist aber schön«, hatte das Mädchen gestaunt und vorsichtig den Ring mit dem funkelnden roten Edelstein berührt, den Lucie an der rechten Hand trug.
»Ja, den habe ich mir selbst geschenkt.« Lucie lächelte, wie in Erinnerung an glückliche Zeiten, sagte aber nichts weiter. Dakota begutachtete mit Kennerblick den dicken Pullover, den Lucie auf Rundstricknadeln arbeitete, und sagte bestimmt: »Ich bin nämlich schon ziemlich gut, müssen Sie wissen.« Lucie lachte.
»Bestimmt bist du das«, erwiderte sie, ohne von ihren klappernden Nadeln aufzublicken.
Anita, die Dakota gern ein bisschen im Auge behielt, setzte sich dazu. Auch andere Kundinnen gesellten sich mit an den Tisch. Aus einer Laune heraus zog Lucie die Schachtel mit Gebäck, die sie sich eigentlich am Wochenende gönnen wollte, aus der Einkaufstüte und ließ sie herumgehen. Eine Frau nach der anderen lehnte dankend ab, aber Dakota erklärte, dass sie sehr gern ein Plätzchen nehmen würde. Alle lachten und griffen dann doch zu, nahmen erst einen Keks und dann noch einen. Sie plauderten und zeigten einander, woran sie gerade strickten.
Anita gab Ratschläge zu Knopflöchern und heruntergefallenen Maschen und bot schließlich an, frischen Kaffee zu kochen. Es wurde spät. Die Frauen packten ihre Sachen zusammen, zögerten jedoch, zu gehen. Und schließlich war es Dakota, die erklärte, sie würde für das nächste Treffen Muffins backen. Das nächste Treffen? Könnte sein, dass ich schon etwas vorhabe … hieß es. Das kann ich nicht versprechen … Da muss ich erst in meinem Kalender nachsehen … Doch als der nächste Freitag kam, stand nicht nur Lucie wieder pünktlich auf der Matte. Dakota präsentierte stolz ihre Muffins, und selbst Georgia setzte sich mit an den Tisch. Der Freitagabend-Strickclub war geboren.
Sechs Monate später war der Club zu einer festen Institution geworden, und daran änderte sich auch nichts, als der Winter allmählich in den Frühling überging. Lucie hatte den Pullover fertig und begann einen neuen. Dakota verwüstete regelmäßig die Küche oben im Appartement mit ihren Backexperimenten: von Rollenkeksen über Brownies mit weißer Schokolade bis zu kleinen verzierten Kuchen. »Schon mal von June Cleaver gehört, der berühmten Fernsehköchin?«, zog Georgia sie auf. Dakota stöhnte genervt.
»Ja, Mom, ich hab auch schon mal ferngesehen!«
Doch am Freitag darauf schlug sie vor: »Wir könnten meine Plätzchen vielleicht verkaufen?«
Es amüsierte Georgia, dass ihre Tochter bereits so viel Unternehmergeist an den Tag legte. Dennoch wurden Dakotas Gebäckverkaufspläne nicht in die Tat umgesetzt – »Oh, nein, Dakota, noch habe ich hier das Sagen!«
Der Strickclub wuchs. Die Frauen erzählten im Freundeskreis davon, neue Frauen schauten vorbei. Manche kamen einfach mal in den Laden, nachdem sie irgendwo eine Kleinigkeit gegessen hatten. Der Club war plötzlich »in« – gerade exotisch genug, um cool zu sein, und allein deshalb so erfrischend, weil es an diesem Ort ausnahmsweise mal nicht darum ging, Männer kennenzulernen.
Eine der Besucherinnen hatte beiläufig ihrer Cousine Darwin Chiu davon erzählt, und so betrat diese eines Freitagabends den Laden, unterhielt sich flüsternd mit Georgia und setzte sich dann mit ernster Miene und Notizblock an den Tisch. Darwin war keine gewöhnliche Kundin; tatsächlich konnte sie nicht einmal stricken. Sie hatte gerade ihr Examen gemacht und recherchierte jetzt für ihre Doktorarbeit im Bereich der Frauenforschung. Nun machte sie den Strickclub zu ihrem Untersuchungsfeld.
Darwin war Ende zwanzig, Amerikanerin asiatischer Abstammung und gab sich betont sachlich. Sie lächelte so gut wie nie und kritzelte fieberhaft auf ihrem Block herum. Schließlich ging sie dazu über, die Mitglieder des Strickclubs über ihre »Strickleidenschaft« zu befragen.
»Wie passt Stricken zu Ihrer Vorstellung von Weiblichkeit?«, fragte Darwin eine etwas schüchterne Ärztin, die eines Abends nach der Arbeit hereingeschaut hatte – und den Laden später niemals wieder betrat.
»Erleben Sie sich wegen Ihres Alters als Außenseiterin gegenüber jungen Trendsettern?«, wandte sie sich an Anita.
»Nein, Liebes, es gibt mir das Gefühl, wieder jung zu sein«, antwortete die. »Jedes Mal, wenn ich die Maschen für eine neue Arbeit aufnehme, spüre ich die Kraft, etwas Wunderschönes zu schaffen.«
Georgia tolerierte Darwin, weil sie die Ernsthaftigkeit, mit der diese junge Frau ihre Studien betrieb, ebenso amüsierte wie bewunderte. Außerdem erfüllte es sie mit Stolz, dass jemand Walker and Daughter für wichtig genug hielt, um dort wissenschaftliche Forschungen zu betreiben. Aber nach einer Weile musste Georgia doch ein Machtwort sprechen.
»Darwin, Sie belästigen meine Kundinnen«, versuchte sie ihr klarzumachen. »Entweder Sie hören mit dieser Fragerei auf, oder ich kann Sie hier nicht länger dulden.«
»Finden Sie es nicht beunruhigend, dass diese neue Popularität des Strickens einem alarmierenden Rückschritt für die Emanzipation gleichkommt? Können Frauen, die ihre Zeit mit altmodischen Beschäftigungen wie Stricken verplempern, überhaupt ihr berufliches Potenzial verwirklichen?«, erwiderte Darwin, die den Sinn von Georgias Worten offenbar überhaupt nicht begriffen hatte.
»Beunruhigt? Nein, angespornt trifft es wohl eher! Es macht mir Hoffnung, Dakota eines Tages nach Harvard schicken zu können.« Georgias Mund war nur ein schmaler Strich. »Meine Liebe, ich fürchte, Sie halten mein Geschäft davon ab, sein wirtschaftliches Potenzial zu entfalten!«
Die beiden Frauen schauten einander regungslos an. Dann machte Darwin auf dem Absatz kehrt und verließ das Geschäft.
Zwei Wochen später war sie wieder da. Pünktlich zum Strickclub betrat sie den Laden und blickte sich unsicher nach Georgia um. Die warf ihr einen Blick zu – die Botschaft war eindeutig: Du kannst bleiben, aber verärgere nur ja nicht meine Kundschaft. Darwin nickte unmerklich. Sie probierte sogar einen von Dakotas Muffins – mit Möhrenstückchen -, was sie zuvor nie getan hatte. »Hey, die sind ja fantastisch!«, entfuhr es ihr überrascht. Dakota freute sich und schlug Darwin großzügig vor, die Geschmacksrichtung für das nächste Treffen auszuwählen.
»Wie schön, dass Sie wieder da sind«, sagte Anita. Darwin schaute hoch, aber statt des erwarteten Sarkasmus entdeckte sie in Anitas Augen nur Herzlichkeit. Darwin grinste über das ganze Gesicht. Sie gab es nur ungern zu, aber sie war froh, zurück zu sein.
Georgia behauptete, sie fände diese Clubabende irritierend. »Ihr sitzt einfach nur herum, und niemand kauft etwas!«, beklagte sie sich bei Anita. Wenn besonders viele Frauen da waren, zog sich Georgia hinter die Theke zurück. Sie konnte nur schwer damit umgehen, diese Gruppe lachender, schwatzender Menschen hier zu haben. Ihr Leben hatte sich jahrelang ausschließlich auf die Arbeit und ihre kleine Tochter konzentriert. Georgia war schlichtweg aus der Übung, wenn es darum ging, Spaß zu haben und sich nett zu unterhalten. Sie war in ihrem Element, wenn sie eine Kundin beraten konnte, wie viele Knäuel Wolle für ein bestimmtes Muster nötig waren, aber sobald sich die Gespräche um andere Themen drehten, wurde Georgia unsicher. Es gefiel ihr jedoch, dass Anita jetzt eine Aufgabe für die Vormittage hatte und dann vollauf damit beschäftigt war, das nächste Clubtreffen vorzubereiten. Außerdem hatte Dakota viel mehr Spaß daran, Freitagabends im Laden zu sein, statt oben vor dem Fernseher zu sitzen.
Dass Dakota glücklich war und es ihr gut ging – nichts war Georgia wichtiger. Und mit ihrer Tochter hatte all das hier auch angefangen, schon allein deshalb gehörte der Laden ihnen beiden. Jeder Abend, mit dem ein erfolgreicher Geschäftstag zu Ende ging, war für Georgia ein kleiner Sieg. Als sie damals feststellte, dass sie schwanger war, drehte sie vor Angst fast durch. Sie war gerade erst mit dem College fertig und für einen Hungerlohn als Assistentin in einem Verlag beschäftigt. James, ihr Freund, hatte ihr einen Monat zuvor den Laufpass gegeben. So eine feste Beziehung sei wohl doch nicht sein Ding. Tatsächlich hatte er längst etwas mit einer Frau in seiner Firma angefangen. Und nicht mit irgendeiner: Er vögelte seine Chefin, die Chefarchitektin eines großen Büros in Manhattan.
Georgia hatte James von dem Moment an gewollt, als sie ihm im Le Bar Bat das erste Mal begegnet war. Sie fühlte sich sofort hingezogen zu diesem großen, schlanken, gut aussehenden Schwarzen. Sie hatte an ihren Locken gezupft, sich vor ihn gestellt und ihm ein ziemlich eindeutiges Angebot gemacht: »Ich mag zum Frühstück am liebsten Rührei – und du?« Das Spiel war eröffnet, jetzt musste er den nächsten Schachzug tun. James hatte lässig gegrinst. Ihm gefiel offenbar, was er sah. Sie stellten sich ein bisschen abseits und unterhielten sich trotz des Lärms bis mitten in die Nacht. Georgia fühlte sich auserwählt und meinte die neidischen Blicke der anderen zu spüren. Sie verließen den Club gemeinsam und landeten im Bett. Das war alles andere als typisch für Georgia, aber sie hatte nun mal das Gefühl, sie beide seien füreinander bestimmt. Ohne groß darüber zu reden, wurden sie ein Paar. Sie gingen zusammen auf Partys oder ins Kino und trafen sich direkt nach der Arbeit, um essen zu gehen.
James war voller Energie und überraschender Einfälle. Er liebte es, mehr als einen Monat lang zu sparen, um Georgia dann in luxuriöse Restaurants wie das Le Cirque auszuführen oder lange anzustehen, um Karten zum halben Preis für eine Broadwayshow zu ergattern. Manchmal blieben sie auch einfach nur zu Hause. Georgia las im Bett Manuskripte, und James arbeitete an dem alten, abgenutzten Zeichentisch, der fast sein ganzes Wohnzimmer einnahm. Sie waren jung, meistens pleite und voller Energie und Leidenschaft – typische junge Leute in New York. Ihre Beziehung war unkompliziert, angenehm und aufregend. Acht Monate lang pendelten sie zwischen ihren Appartements hin und her, diskutierten bis tief in die Nacht, wessen Möbel sie behalten wollten, wenn sie zusammenzogen, oder spazierten Hand in Hand durch die Straßen und stellten sich vor, wo sie gern leben würden. Sie entschieden sich für die Upper West Side. Georgia erinnerte sich an Nächte, als sie neben James im Bett lag, ihre helle Hand auf seiner dunklen Brust. Sie hatte Linien auf seine Haut gezeichnet und gesäuselt: »Und es macht deiner Familie wirklich etwas aus, dass ich weiß bin?« James hatte gelacht. »Allerdings!« Sie kitzelten einander lachend und waren voller Zuversicht – nachdem sie einander gerade noch leidenschaftlich geliebt hatten -, dass nichts ihrer Beziehung etwas anhaben könnte.
Seine Eltern hatte sie nie kennengelernt. Aber das fiel ihr erst auf, nachdem er bereits weg war.
James hatte seine Sachen tagsüber aus ihrem Appartement geholt und dafür alles auf das Sofa gestapelt, was sie in seiner Wohnung gelassen hatte. Weinend rief Georgia ihn an, flehte, er solle zu ihr zurückkommen. Sie aß und schlief nicht mehr. Dann, von einem Tag auf den anderen, begann sie riesige Mengen in sich hineinzustopfen. Schokoladenriegel, Chips, dick mit Rahmkäse bestrichene Bagels, Limonade, Eiskrem, Pizza und Kuchen. Sie aß, was sie gerade finden konnte.
»Wenn du weiter so frisst, werden alle denken, dass du schwanger bist«, bemerkte ihre spindeldürre, nervige Arbeitskollegin, mit der sie sich ein Bürokabuff teilte.
Schweigen. Georgia rechnete: Ihre Periode war spät dran. Sehr spät sogar. Und dann wusste sie es.
Sollte sie es mit Fassung tragen und zurück nach Pennsylvania gehen? Könnte sie die Demütigung ertragen, wieder bei ihren Eltern einzuziehen, eine alleinerziehende Mutter mit vierundzwanzig, deren erhoffte Karriere in der Großstadt kläglich gescheitert war? Oder sollte sie ihren Arzt anrufen und dafür sorgen, dass diese Schwangerschaft abgebrochen wurde? Zwischen dem Kopieren endloser Manuskripte, dem Vorsortieren der Post und dem Besorgen fettfreier Muffins, die ihre Chefin dann doch nicht aß, wägte Georgia die spärlichen Alternativen gegeneinander ab.
Sie grübelte so lange, dass es sich irgendwann von allein entschied – sie und dieses Kind würden zusammenbleiben. Und dann kam der Tag, an dem sie, unübersehbar schwanger, einen letzten Spaziergang durch den Central Park machte. Nach diesem Wochenende würde sie zu ihren Eltern fahren. Als es ohnehin keinen Weg zurück mehr gab, hatte Georgia sie angerufen und sich dabei gleichzeitig mutig gefühlt und leidgetan.
»Wir freuen uns, dich wieder hier bei uns zu haben«, sagte ihr Vater pathetisch, bevor er den Hörer an seine Frau übergab.
»Es war dumm von dir, diesem Mann zu vertrauen, Georgia«, belehrte ihre Mutter sie. »Ganz offensichtlich hat er nur das eine gewollt. Und du hast jetzt einen schweren Weg vor dir – nicht jeder wird dieses Kind so willkommen heißen wie wir.«
Georgia konnte die schmal zusammengepressten Lippen ihrer Mutter förmlich vor sich sehen. Ihre Eltern fingen an zu debattieren, welchen Zug Georgia am besten nehmen sollte, während sie sich so elend fühlte, dass sie kaum etwas mitbekam.
An jenem Tag war es unerträglich heiß gewesen. Die Klimaanlage in ihrem Appartementhaus an der Upper West Side hatte den Geist aufgegeben und Georgia schweißgebadet ihrem Schicksal überlassen. Ihr dunkles Haar hatte sich noch stärker als sonst gekräuselt und ihr im Nacken geklebt. Der dicke Bauch stach von ihrer schlanken Figur ab, ihre Finger waren geschwollen, die Augen verheult. Nach langem Hin und Her hatte sie in der Nacht zuvor den Mut aufgebracht, James anzurufen und ihm von der Schwangerschaft zu erzählen. James war entsetzt, ärgerlich, voller Bedauern … und lag gerade mit seiner neuesten Freundin im Bett. Nein, nicht seine Chefin. Es war bereits die nächste. »Das ist jetzt ein bisschen ungünstig … vielleicht könnten wir uns morgen treffen? Im Park?« Und so kam es, dass sich Georgia am nächsten Morgen aufmachte, mit der halb fertigen Babydecke, an der sie gerade strickte, auf eine Bank unter den Bäumen setzte und wartete. James tauchte nie auf.
»Ein bemerkenswertes Muster, an dem Sie da arbeiten.« Georgia schreckte auf und hob den Kopf. Vor ihr stand eine elegante Dame. Ein breitkrempiger Sonnenhut umrahmte ihr Gesicht, und ihr Leinenkostüm wirkte trotz der Hitze duftig frisch. Georgia lächelte schüchtern, sie schämte sich wegen ihrer billigen Kleidung und ihres dicken Bauches.
Die Dame setzte sich und begann, von den Decken zu erzählen, die sie für ihre eigenen Kinder gestrickt hatte, und wie sehr die Arbeit mit den Nadeln ihr immer dabei geholfen hatte, mit sich ins Reine zu kommen. Georgia wünschte, die Frau würde endlich gehen. Aus reiner Höflichkeit tat sie so, als würde sie zuhören, während ihr Tränen der Wut und Enttäuschung in die Augen traten. »Man findet nicht viele Menschen, die so gleichmäßig und präzise arbeiten können«, hörte sie die Frau sagen, während sie das Maschenbild eingehend studierte. »Es ist eine aussterbende Kunst, und ich könnte mir vorstellen, dass manch einer bereit wäre, sich so gute Arbeit etwas kosten zu lassen.« Sie tätschelte Georgias linke Hand, an der kein Ring steckte, was der Frau längst klar war.
»An Ihrer Stelle würde ich mich mal umhören, ob nicht der eine oder andere gern einen Strickpullover oder -schal hätte – zum Beispiel als Geschenk. Vielleicht könnten Sie in dem Geschäft für Babyausstattung drüben an der Ecke Broadway und 76th einen Aushang machen? Schalten Sie eine Kleinanzeige im New Yorker – bei Lillian Vernon hat es funktioniert, ihr Versandunternehmen wurde ein Riesenerfolg.«
Georgia saß einfach nur da, sprachlos, verwirrt und skeptisch. Die Frau erhob sich. Sie winkte einem Mann zu, der noch ein ganzes Stück von ihnen entfernt war, und wollte gehen.
»Sie besitzen eine Gabe, mein Liebes – ich habe einen Blick für Talent.« Sie reichte Georgia eine cremefarbene Visitenkarte. »Und um es Ihnen zu beweisen, werde ich Ihren ersten Pullover kaufen. Machen Sie ihn aus Kaschmir und liefern Sie ihn mir bald. Rufen Sie mich an, wenn er fertig ist.« Sie ging, und das leise Klacken ihrer Absätze auf dem Weg verhallte allmählich.
Georgia drehte die Karte um.
Anita Lowenstein. The San Remo.
212-555-9580.
2. Kapitel
Marty Popper konnte die Uhr danach stellen: Jeden Nachmittag um Punkt zehn vor zwei drückte Anita die schwere Glastür zu seinem im Erdgeschoss gelegenen Deli auf.
Wie an jedem Wochentag während der letzten zehn Jahre wartete er mit einer Kanne frisch gebrühten Kaffees hinter der Theke. Der Hochbetrieb zur Mittagszeit war vorbei, und Marty konnte durchatmen. In der Vitrine fanden sich noch ein paar einsame belegte Bagels, im Kühlfach lagerten Schinken und geräucherte Truthahnbrust ordentlich neben dem Schweizer Käse. Und an der Wand lehnte der Besen, mit dem Marty gerade den Boden gekehrt hatte. Er war ein großer, stabiler Mann und ständig in Bewegung, sodass sein Bauch erst gar keine Gelegenheit bekam, aus der Form zu geraten. Marty genoss die momentane Ruhe und ließ den Blick über sein Reich schweifen, das einst seinem Vater gehört hatte. Er liebte diesen Job, mochte es, dass die Leute auf dem Weg zur Arbeit bei ihm einen Zwischenstopp einlegten, er ihnen einen Snack und einen Scherz mit auf den Weg geben konnte. Und es gefiel ihm, Tag für Tag mit den gleichen vertrauten Gesichtern aus der Nachbarschaft ein Schwätzchen zu halten. Das Deli hatte ihm und seinem jüngeren Bruder Sam immer das Auskommen gesichert. Es langte für eine hübsche Wohnung an der West Side, eine Dauerkarte bei den Yankees und jeden Sommer ein paar Wochen an der Küste von Jersey. Und dann kam der Tag, an dem sein Bruder sich einen lang gehegten Traum erfüllte und nach Delray Beach zog, dem Dauerferienort in Florida für eine ganze Rentnergeneration. Das war im letzten Jahr gewesen, und Marty hatte Sam ausgezahlt. Er selbst dachte gar nicht daran, das Geschäft zu schließen oder an eine Kette zu verkaufen; er hatte nie geheiratet und keine Notwendigkeit gesehen, Pläne für den Ruhestand zu machen. Innerhalb der Familie war es ein gängiger Witz: Onkel Marty hing an seinem eigenen Rockzipfel.
Eigentlich hätte sein Leben anders verlaufen sollen. Sein Vater wollte ihm ein College-Studium finanzieren, und damit hätte Marty die Chance auf eine Karriere in der Finanzwelt gehabt. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge auf eine Weise, die sich die Menschen heute nur schwer vorstellen können. Marty war heimlich auf und davon, um im Pazifikkrieg zu kämpfen. Er war noch minderjährig gewesen, aber zu einer Zeit, als jeder Soldat zählte, sah man bei seiner Anwerbung diskret darüber hinweg.
Was Marty dann an der Front erlebte, war unmenschlicher und schrecklicher, als er sich je hatte vorstellen können. Nachdem er wieder zu Hause war, hatte das College für ihn jeglichen Sinn verloren. Er wollte sich nur noch verkriechen und diese furchtbaren Bilder loswerden, die ihn Tag und Nacht verfolgten. Er litt unter einer posttraumatischen Persönlichkeitsstörung, wie es so schön hieß. Das würde sich schon wieder legen, sagte man. Tat es auch, irgendwann. Aber bis dahin war längst klar, dass Marty nicht die Karriereleiter irgendeines Unternehmens hinaufklettern würde, obwohl ihm dank eines damals neu erlassenen Gesetzes als Kriegsteilnehmer der Universitätszugang offenstand. Tatsächlich belegte er auch ein oder zwei Kurse am College.
»Ich glaube, ich will einfach nur hier bei dir sein, Pop«, hatte er dann aber vor mehr als fünfzig Jahren gesagt. Für seine Eltern war das in Ordnung. Sie waren froh, dass er heil von der Front zurückgekommen war. Ihre Haltung machte es ihm leichter, in sein altes Leben zurückzukehren. Er lebte bei seinen Eltern, versorgte die beiden bis zu ihrem Tod (nie hätte er seine Mom und seinen Pop in einem Altersheim untergebracht!) und überließ Sam das familieneigene Appartement. Marty war die Art Onkel, der den Sonntagnachmittag mit seinen Nichten und Neffen auf Coney Island verbringt, damit gestresste Eltern für ein paar Stunden verschnaufen können. Marty ist ein echt netter Kerl, sagten die Leute über ihn. Und das war er. Aber heiraten – das brachte er nicht fertig, nicht nach all dem, was er im Krieg gesehen hatte. Er hatte keine Scheu vor festen Bindungen, tatsächlich hatte Marty sich immer eine Frau und Kinder gewünscht. Du wärst ein toller Dad, pflegten seine Nichten und Neffen zu sagen. Aber für ihn gehörte mehr dazu. Freunde der Familie stellten ihn ihren Töchtern, Nichten und Cousinen vor – nette Mädchen, später waren es dann sympathische Damen und schließlich ältere Fräulein -, aber für Marty kam eine Ehe nur infrage, wenn er bis über beide Ohren verliebt wäre. Er hatte durchaus ernstere, sogar leidenschaftliche Beziehungen gehabt, aber eben nicht diese eine besondere Liebe. Ich habe das Schrecklichste gesehen, sagte er seinem Bruder, und jetzt warte ich auf das Beste.
Und dann kam jener Tag vor zehn Jahren, an dem »sie« sein Deli betrat. Marty war sofort überwältigt vom zarten Citrus-Duft ihres Parfums, ihrer maßgeschneiderten Garderobe, den schimmernden Augen, den zarten Händen, die er immer nur flüchtig berührte, wenn er ihr die Bestellung reichte.
Mr Marty Popper, Kriegsveteran und stets gut gelaunter Onkel, hatte sich Hals über Kopf verliebt. Das Problem war nur, dass er ihr nichts davon sagte. Kein einziges Wort in all den Jahren.
Anita ging an Tischen vorbei, die aufgereiht an der Wand standen. Fünf oder sechs Schulkinder lümmelten sich auf Plastikstühlen, erschöpft vom Schleppen der schweren Schultaschen. Sie stärkten sich mit Schoko-Cookies für die anstehenden Hausaufgaben und das abendliche Fernsehprogramm. Die Kids bequatschten, wer mit wem ging, seit wann und warum. Hin und wieder schauten sie Richtung Theke, um sich zu vergewissern, dass niemand sie belauschte.
»Ein großer Kaffee, mit Milch!«, rief Marty einen Tick zu laut. Der blaue Plastikbecher wirkte in seinen riesigen Pranken winzig. Anita hatte den einen Dollar schon passend in der Hand und lächelte Marty an, während sie zahlte. Vorsichtig nahm sie einen kleinen Schluck von dem dampfenden Getränk.
»Vielen Dank, der Herr hat es sich gemerkt.« Das sagte sie jedes Mal, dabei hatte Marty seit dem Tag, an dem sie zum ersten Mal in seinem Deli gewesen war und einen Medium zum Mitnehmen bestellt hatte, nie wieder vergessen, wie sie ihren Kaffee mochte. Anita blieb die eleganteste Frau, die ihm in seinem Leben jemals begegnet war.
»Das tue ich immer, Ma’am«, erwiderte Marty strahlend. Dann reichte er ihr schweigend einen weißen Plastikdeckel und sah zu, wie sie genießerisch einen zweiten Schluck trank. Marty hatte es schon vor langer Zeit aufgegeben, sie zu einem Doughnut oder Biscotti überreden zu wollen. Für mich bitte nur Kaffee, antwortete sie dann immer. Wie gewöhnlich schnitt er sofort ihr gemeinsames Lieblingsthema an:
»Übrigens war Dakota vor einer Viertelstunde hier und hat gemeint, sie würde recherchieren.«
»Könnte ein Vorwand gewesen sein. Ich glaube, sie sucht eine Absatzquelle für ihre Muffins. Jedenfalls feilt sie gerade an einem Werbebrief, den sie an den Fernsehsender Food Network schicken will. Sie will denen eine Sendung über jugendliche Kochkünstler schmackhaft machen.« Anita neigte den Kopf zur Seite. Sie war stolz auf Dakotas pfiffige Ideen. Erst am Vortag hatte die Kleine Georgia gebeten, ihr ein Fahrrad zu kaufen, damit sie ihre Produkte an Jogger im Central Park verkaufen könnte. Und wer begleitet dich dabei?, hatte Georgia sofort gefragt und offenbar versucht, ihre Tochter auf mögliche Probleme bei ihrer Geschäftstüchtigkeit aufmerksam zu machen.
Anita wusste, wie sehr Georgia ihr kleines Mädchen anhielt, hinauszugehen in diese Welt und sie sich zu erobern – deshalb hatte sie ihr auch den Namen Dakota gegeben. Georgia meinte, dass es schon mal ein Anfang wäre, wenn mehrere Staaten zwischen ihnen lagen.
Anita kannte diesen Impuls gut. Sie erinnerte sich gut daran, wie sie ihre eigenen Kinder im Arm gehalten und sich geschworen hatte, nie deren Selbstverwirklichung im Weg zu stehen. Aber sie wusste auch, dass Georgia damit zu kämpfen hatte, wie schnell ihre Tochter erwachsen wurde. Sie sagte, sie habe Angst, Dakotas Entwicklung zu behindern, wenn sie ihr zu viele Grenzen setzte. Natürlich hatte es Phasen gegeben, in denen sich Dakota widerspruchslos fügte, und Georgia sich für ihre Strenge hasste. Allerdings war die Situation zunehmend angespannter geworden. Letzten Sommer wurde es dann richtig schwierig. Dakota verzog sich immer häufiger in ihr Zimmer und machte die Tür zu. »Ich brauche meinen Freiraum«, hatte sie Georgia mitgeteilt und benahm sich eher wie eine gestresste Erwachsene als eine Präpubertierende, wenn sie erklärte: »Ich muss nachdenken.« Georgia hatte Dakotas Privatsphäre immer respektiert, das gehörte zu ihren Prinzipien. Nie würde sie ins Zimmer ihrer Tochter stürmen, ohne vorher anzuklopfen. Dass ihr kleines Mädchen sie anscheinend ausgerechnet in dieser Hinsicht als unsensibel erlebte, überraschte sie. Auch Georgias Vorschläge stießen zunehmend auf Ablehnung:
Georgias lieb gemeintes »Sollen wir uns eine DVD anschauen?« wurde lediglich mit einem »Kann gerade nicht« beantwortet.
Oder es war gar ein schroffes: »Bin beschäftigt.«
Dann wiederum gab es Abende, an denen Dakota aus ihrem Zimmer gestürzt kam, um ihrer Mutter das Herz auszuschütten. Georgia war von den Berichten ihrer Tochter über die Mitschüler gleichermaßen fasziniert wie überrascht. Mal waren die einen Kids in, dann wieder andere – ein niemals endendes Drama, das sich ständig im Kreis drehte.
»Du weißt nicht, was Stress ist«, erklärte ihr Dakota eines Abends, als sie mit einer Schale Popcorn auf Georgias Bett lagen. »Bei dir ist alles so easy. Aber mein Leben ist das reinste Chaos. In der siebten Klasse zu sein, ist echt hart.«
Und als wären die täglichen Herausforderungen des Erwachsenwerdens noch nicht genug, war eine zusätzliche Komplikation aufgetaucht. Kurz nach Beginn des laufenden Schuljahres entschied sich James plötzlich und aus unerklärlichen Gründen, mehr tun zu wollen, als nur Geld zu schicken. Über zwölf Jahre war er in der Versenkung verschwunden gewesen, und jetzt verlangte er auf einmal, an ihrem Leben teilzuhaben.
Er war nach New York City zurückgekehrt und hatte offenbar vor, sich den Weg in Dakotas Herz zu erkaufen. Dabei brauchte er sich gar nicht übermäßig anzustrengen, so verzweifelt wie sich Dakota James’ Zuneigung wünschte. Georgia hatte immer angenommen, sie müsse die Elternrolle nur genügend ausfüllen, dann würde ihr kleines Mädchen James überhaupt nicht vermissen.
Schließlich hatte sie ihren Vater nie kennengelernt.
Aber Georgia musste erfahren, dass es bei Kindern anders läuft. Dakota war außer sich vor Freude, als ihr Vater auftauchte.
Zuerst hatte Georgia versucht ihn abzuwimmeln, indem sie es mit dem »Ich bin beschäftigt« ihrer Tochter probierte. Sie spekulierte darauf, dass er schnell wieder das Interesse verlieren würde – so wie damals auch.
Aber James entpuppte sich als sehr hartnäckig. Die Bestimmtheit, mit der er auf das Recht pochte, seine Tochter sehen zu dürfen, hatte etwas Aggressives. Er rief ständig an, tauchte im Laden auf und lauerte Georgia vor Martys Deli auf, nachdem sie Dakota zur Schule gebracht hatte. Auf diese Weise hatte sie überhaupt erfahren, dass er wieder in der Stadt war: Als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, stand er plötzlich vor ihr und sagte Hallo. Ihr erster Impuls war, laut zu schreien und auf ihn einzuschlagen. Aber dann entschied sie sich für den bewährten Grundsatz: Gute Miene zum bösen Spiel machen und ihn mit charmantem Lächeln ins Leere laufen lassen. Sie erwiderte seinen Gruß, als wäre es keine große Sache, den ehemaligen Liebhaber zu sehen, und ging erhobenen Hauptes die Treppe zu ihrem Laden hinauf, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen.
Im Geschäft angekommen, schloss sie die Tür ab, stürmte in ihr Büro im hinteren Teil des Ladens, presste sich ein Kissen vors Gesicht und schrie ihre ganze Enttäuschung, Angst und Wut heraus.
Georgia traute diesem Mann keinen Zentimeter über den Weg und gestand Anita, dass sie Angst hatte. Womöglich war er imstande, gerichtliche Schritte einzuleiten, wenn sie ihn ständig hinhielt. Deshalb willigte sie schließlich auch ein, mit Dakota über ihn zu reden. Also klopfte sie an diese verdammte, mal wieder verschlossene Tür. Während sie im Flur zwischen den beiden Schlafzimmern wartete, konnte sie in Ruhe das sorgfältig mit einer Schablone gemalte Schild »Zutritt nur nach Aufforderung« bewundern. Die Tür wurde mit Schwung aufgerissen, und das Mädchen stand vor ihr.
»Ja? Bitte?«
»Hier ist deine Mutter«, antwortete Georgia trocken. »Ich hatte gehofft, kurz mit dir sprechen zu können.«
Jahrelang hatten sie das Thema »James« nur vage berührt. Georgia hatte Dakota erklärt, dass er in Übersee arbeite und sie beide sich noch vor Dakotas Geburt freundschaftlich getrennt hätten. Freundschaftlich! Georgia staunte, dass sie ihrer Tochter bei diesen Worten tatsächlich in die Augen sehen konnte. Und nie hatte sie in Dakotas Anwesenheit schlecht über ihn geredet – eine Entscheidung, die sie jetzt bitter bereute, wenn sie sah, wie erpicht Dakota war, diesem Schürzenjäger zu begegnen, der sich ihr Vater nannte.
Bei ihrem ersten Treffen zu dritt waren sie unten bei Marty gewesen und hatten Limonade getrunken. Georgia hatte die Zähne zusammengebissen und mit wachsender Besorgnis registriert, wie James Dakota mit seinem ach so herzlichen Lachen und den unzähligen Komplimenten um den Finger wickelte. Während der ersten Wochen dieser Vater-Tochter-Wiedervereinigung zählte für Dakota nur die Freude darüber, dass er zurückgekehrt war – und zwar ihretwegen.
Sicher hegte Dakota durchaus widersprüchliche Gefühle für James, aber Fragen und jegliche Feindseligkeit behielt sie sich für Georgia vor.
»War es deine Schuld, dass er damals wegging?« Dakota saß vor einer Schale Cornflakes und starrte ihre Mutter an. (In Momenten wie diesen betete Georgia im Kopf Anitas Rat wie eine Zauberformel herunter: Die Wahrheit über ihren Vater würde Dakota nur verletzen – und dich wird sie dafür hassen, dass du es ihr gesagt hast.) Also druckste Georgia herum und faselte etwas von Beziehungen, die nicht funktionieren, betonte, dass Dakota geliebt wurde und keinesfalls der Grund für die Trennung gewesen sei.
Aus dem Herbst wurde Winter, und die Schuldzuweisungen prasselten weiter auf Georgia ein:
»Du hast ihn vielleicht nicht geliebt – und ich wurde dafür bestraft.« Allmählich fragte Georgia sich, ob ihre Tochter heimlich Selbsthilferatgeber las, die sie in den Schutzumschlägen ihrer Kochbücher versteckte.
Dakota begann, die Geduld ihrer Mutter auch in anderen Dingen zunehmend auf die Probe zu stellen. Sie verlangte, erwachsenere Kleidung tragen zu dürfen und wollte mit Lidschatten und Wimperntusche geschminkt in die Schule. Außerdem bestand sie darauf, allein mit ihren Freundinnen in Horrorfilme zu gehen. Und eines Abends hörte Georgia, wie sich Dakota mit einer Freundin über einen Lehrer an ihrer Schule unterhielt. Die Sätze strotzten nur so von der großzügigen Verwendung des »F«-Wortes.
»Ich schätze es nicht, wenn du solche Ausdrücke benutzt«, bemerkte Georgia am nächsten Abend beiläufig, während sie das Geschirr spülte. Dakota verzog das Gesicht und brach in Tränen aus.
»Belauscht du jetzt schon meine privaten Gespräche?«, schrie sie. »Für wen hältst du dich? Die CIA?«
Sie stampfte in ihr Zimmer und schlug die Tür so heftig hinter sich zu, dass das Schild auf den Boden flatterte.
Unvorstellbar, dass dies einmal das kleine sanftmütige Mädchen gewesen war, dass sich gern knuddeln ließ und es liebte, wenn man mit ihm auf dem Sofa herumtobte. Lag es am siebten Schuljahr? Am Hormonchaos der Pubertät? Oder daran, dass James so plötzlich in ihr Leben geschneit war?
»Ich will doch nur, dass sie mich gern hat«, hatte Georgia schluchzend zu Anita gesagt, nachdem sie Dakota das heiß begehrte Fahrrad abgeschlagen hatte. Dieses teure Ding, das an die 1500 Dollar kostete – und vermutlich genauso schnell passé sein würde wie das Keyboard und der Musikunterricht, den Dakota als Neunjährige unbedingt haben musste. Damals hatte sie ihre Mutter immerhin noch für cool gehalten. »Sie kommt ins Teenageralter – besser, sie hasst dich jetzt und liebt dich später«, hatte Anita geantwortet und Georgias widerspenstige Lockenmähne glatt gestrichen.
Anita betrachtete Marty unauffällig, bewunderte sein dichtes, grauschwarz meliertes Haar, die gepflegten Nägel seiner großen starken Hände, die Andeutung eines Grübchens links neben dem Mund.
»Sie werden es nicht glauben, aber unsere junge Dame hat herausgefunden, dass ich nicht Fahrrad fahren kann – und beschlossen, es mir beizubringen, sobald es warm genug ist.« Kopfschüttelnd seufzte Anita: »Sie weiß nicht, dass man einem alten Hund keine neuen Kunststücke mehr beibringen kann.«
»Nicht alt.« Martys Augen waren voller Wärme. »Und mit mehr als nur ein paar Kunststückchen in der Hinterhand – darauf gehe ich jede Wette ein.«
Und so sprachen Marty und Anita wie jeden Nachmittag über Dakota, die Brücke ihrer Zuneigung. Sie war die Enkeltochter, die Marty sich immer gewünscht hatte, und stellvertretend für die Enkelkinder, die Anita so gut wie nie zu Gesicht bekam. Und ein ungefährliches Thema.
Durch die gesamte Entwicklung des Mädchens hatten sie sich hindurchgeplaudert: Windeln, den ersten Schultag, das Ferienlager. Seit Jahren berichtete Anita ihm ausführlich, wenn sie mit Dakota ins Kino ging oder sie zu einem Luxus-Eisbecher ins Serendipity an der East Side einlud. Und jedes Mal machte Marty den – durchaus ernst gemeinten – Vorschlag, dass Anita und er ins Film Forum gehen und sich einen für ihre Generation spannenderen Film ansehen sollten oder im Café Lalo eines der raffinierten Desserts probieren könnten. Vielleicht ein Stück ihres berühmten Schokoladenkuchens. Anita stimmte immer begeistert zu, lachte wie über einen Scherz und erklärte, dass Dakota sie schließlich jung hielt. Nie ging einer von ihnen so weit, tatsächlich eine Verabredung auszumachen. Oder gar die Telefonnummern auszutauschen.
Und dann war der Augenblick auch schon wieder vorbei, ein neuer Kunde betrat den Laden und bestellte eine Flasche Wasser, oder eines der Schulkinder kam herangeschlurft, um sich eine Packung Kaugummi zu holen. Ich sollte mich wohl auf den Weg machen, um rechtzeitig oben im Laden zu sein, pflegte Anita dann zu sagen.
Marty rief ihr noch ein »Schönen Gruß …« nach, aber Anita war schon aus der Tür, berauscht von dem Gefühl, begehrt zu sein. Den Kaffee in der Hand eilte sie die Treppe hinauf zu Walker and Daughter, wobei ihre flachen Absätze auf den Betonstufen leise klackten.
Und dann durchbrach Marty ihr eingefahrenes Ritual: Er räusperte sich, ließ etliche Hms und Ähms folgen und bat Anita, mit ihm Essen zu gehen.
Diese hatte plötzlich das Gefühl, sämtlicher Sauerstoff wäre aus dem Raum gesaugt worden.
»Heute ist Freitag«, rief sie mit schriller Stimme und verschüttete beinahe den ganzen Kaffee, weil sie hektisch nach Handtasche und Mantel griff. Sie eilte auf kürzestem Weg zum Ausgang, überwältigt von einer Mischung aus glühendem Zorn – wie konnte Marty es wagen, ihre übliche Routine über den Haufen zu werfen! – und einem Glücksgefühl im Bauch. »Der Strickclub fängt an. Die Mädchen brauchen mich. Ich muss los.«
Und weg war sie.
Ein Rotschopf stürmte zum siebten Mal an diesem Tag in den Laden. Aus ihrer Fahrradkuriertasche ragte ein brauner Briefumschlag, und auf dem Kopf trug sie eine Zeitungsjungenkappe.
Ab dem dritten Besuch hatte Georgia es aufgegeben, zu fragen, ob sie ihr behilflich sein könne. Seit dieser Zeitungsartikel erschienen war, tauchte eine Menge neugieriges Volk im Laden auf, und Georgia war nicht sicher, ob sie das nun gut oder schlecht finden sollte.
Sie warf ihrer Vormittagsaushilfe Peri einen fragenden Blick zu, die gerade hinten aus dem Büro kam und in einem neuen Strickbuch schmökerte. Georgia war dankbar, Anita zu haben – aber sie war auch froh, dass Peri, eine junge Frau in den Zwanzigern, all die körperliche Arbeit verrichtete, die für Anita zu anstrengend war.
Peri verbrachte den Vormittag meistens damit, hinten im Büro Kartons zu öffnen und den Warenbestand zu katalogisieren. Davon abgesehen war sie auch vorn im Laden eine Bereicherung, immer gut über die neuesten Modetrends informiert und begierig, diese auszuprobieren.
»Jetzt sieh dir das an«, flüsterte Georgia ihr zu und wies kaum merklich mit dem Kopf in Richtung der Rothaarigen. »Sie kauft in einem fort dasselbe Maßband und bringt es wieder zurück.« Die Fremde mit dem feuerroten Haar sah sich hektisch im ganzen Raum um, stellte sich dann neben eine Brünette mit langem Haar und musterte diese von oben bis unten. Schließlich machte sie abrupt kehrt und marschierte zur Kasse: »Ich möchte dieses Maßband zurückgeben«, sagte sie und ließ den Blick unablässig durch den Laden schweifen.
»Hat mit den Maßen etwas nicht gestimmt?« Georgia verzog keine Miene. Das Mädchen sah sie ausdruckslos an, ging zum Tisch, setzte sich und trommelte mit den Fingern auf der Platte herum. Einige der anwesenden Kundinnen wirkten leicht irritiert.
»Was hat das zu bedeuten?«, flüsterte Peri.
»Seit ich heute Morgen den Laden aufgemacht habe, ist sie stündlich hier aufgetaucht – und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie am Dienstag unten im Deli gesehen habe«, erwiderte Georgia leise. »Keine Ahnung, ob sie einen Knall hat oder eine Performancekünstlerin ist, die irgendeine Reaktion provozieren will.«
Nachdem sie zehn Minuten am Tisch gesessen hatte, stand das Mädchen auf und schlich wie in Zeitlupe Richtung Ausgang, wobei sie unterwegs jede Kundin genauestens in Augenschein nahm. Einen Augenblick später kam Anita durch die Tür gestürmt, ein bisschen außer Atem und die Wangen leicht gerötet.
»Wir sollten vielleicht auch Benimm-Kurse anbieten«, keuchte sie ärgerlich. »Ich bin eben gerade auf der Treppe von einem Mädchen mit einer riesigen Handtasche beinahe umgerannt worden!«
»Dann hast du soeben Bekanntschaft mit unserer geheimnisvollsten Kundin gemacht – oder auch Nicht-Kundin.« Georgia zuckte mit den Schultern. »Sie hat sich den ganzen Vormittag hier herumgetrieben, ich habe mich schon gefragt, ob sie was klauen will. Sicherheitshalber habe ich ihr das Regal mit den Restbeständen gezeigt und gesagt, da könne sie sich kostenlos bedienen.« Georgias Miene blieb zwar ungerührt, ihr Blick verriet jedoch Besorgnis. Der Laden zog zwar allerlei Volk an, aber normalerweise waren keine Verrückten darunter, höchstens Nervensägen. »Dann hat sie ein Maßband gekauft, es zurückgebracht und kurz darauf dasselbe Band zum zweiten Mal gekauft – und so ging es immer weiter. Vielleicht will sie sich hier drinnen aufwärmen?«
»Drogen, ganz klar. Die ist total übergeschnappt«, meinte Peri entschieden. »Meine Damen, ich rate Ihnen, auf Ihre Handtaschen aufzupassen und sich mit Stricknadeln zu bewaffnen. Ich muss los und den Zug erwischen, sonst komme ich zu spät zu meinem Kurs.« Sie knöpfte ihre rote Strickjacke zu und zog einen Marineparka an, dessen Taschen prallvoll gestopft waren. Um sich gegen den eisigen Märzwind zu schützen, stülpte sie eine Strickmütze über ihre dunkle Afro-Flechtfrisur. Dann warf sie einen prüfenden Blick in den Spiegel neben dem Eingang, fuhr mit den Fingerspitzen über ihre mokkafarbene Haut und erneuerte den Lippenstift: tiefrot. Zum Abschluss schnell noch ein Spuren hinterlassender Schmatz auf Dakotas Wange. Die kam gerade aus der Schule, wie jeden Tag in Begleitung ihrer Freundin. Winkend verschwand Peri durch die Tür. Anita war Dakotas Wunschgroßmutter – und Peri ihr zum Leben erwachtes Modeidol.
»Scheint ihr gut zu gehen«, bemerkte Anita zufrieden. Georgia nickte. Angestellte kamen und gingen – seit sie das Geschäft führte, hatte Georgia meistens Studentinnen eingestellt, die froh waren, trotz geringer Bezahlung stundenweise bei ihr zu arbeiten. Georgia akzeptierte wiederum, dass ihr Laden nur eine Zwischenstation darstellte, bis sich etwas Besseres für die Mädchen fand. Ihre Aushilfen mochten noch so nett und fleißig sein, auf Dauer konnte Georgia sie nicht halten. Aber bei Peri Gayle verhielt es sich anders. Nachdem sie vor drei Jahren ihren Collegeabschluss gemacht hatte, war sie nach New York gekommen, um an der Universität Jura zu studieren. Zuvor wollte sie den Sommer über bei Walker and Daughter jobben und die Stadt kennenlernen. Als sich Georgia gerade darauf einrichtete, mal wieder eine neue Aushilfe zu suchen, hatte Peri gefragt, ob sie bleiben könne. Peris Familie war entsetzt gewesen; ihre Mutter kam von Chicago herübergeflogen und sprach persönlich bei Georgia im Laden vor: Werfen Sie meine Tochter raus, dann muss sie zur Uni gehen – appellierte sie. Aber Peri weigerte sich hartnäckig, ihren Job aufzugeben. Georgia hoffte, dass Peri bei dem geringen Verdienst die Luft ausginge und sie die Aussicht verlockend fände, irgendwann in Downtown zu sitzen und 325 Dollar die Stunde zu verdienen. Aber Peri blieb, arbeitete jeden Vormittag im Laden, strickte nach Geschäftsschluss Pullover auf Bestellung und las, wenn im Laden mal nichts los war, jede neue Ausgabe der VOGUE – die britische, französische, italienische und die amerikanische. Sie war kreativ und temperamentvoll – und ihre Chefin liebte es, sie um sich zu haben. Denn Peri war hip, jung und dynamisch. Und sie war etwa so alt wie Georgia damals, als sie schwanger wurde. Vielleicht, so dachte sie schuldbewusst, wollte sie Peri unbedingt behalten, um ihre eigenen Twenties noch einmal zu erleben – ohne Kind. Wenn Peri amüsanten Tratsch aus ihrem Leben erzählte, gab Georgia immer vor, äußerst beschäftigt zu sein – sie fand es unprofessionell, sich interessiert zu zeigen. Anita dagegen schwatzte gern mit Peri oder einer der zahlreichen Frauen Anfang zwanzig, die kurz im Laden bei ihrer jungen Angestellten vorbeischauten, um das Neueste loszuwerden. Peri verfügte über die Gabe, aus Kundinnen Freunde zu machen. Das entging Georgia nicht.
Und insgeheim liebte sie die Geschichten über Peris Clique: Streifzüge durch Champagnerbars und Speed-Dating-Veranstaltungen sowie Schlittschuhlaufen auf dem Wollman Rink im Central Park. Georgia konnte sich noch gut an die Zeiten erinnern, als sie auf das Frühstück verzichtet hatte, sich 1,35 Dollar fürs Mittagessen bewilligte (ein Müsliriegel mit Erdbeergeschmack und eine Dose Root Beer) und abends nur eine Scheibe Brot aß, um das Essensgeld zu sparen. Und am Wochenende zog sie dann mit ihren Kolleginnen in die Webster Hall oder einen anderen Nachtclub. Es hatte mehr als eine Nacht gegeben, da war sie trotz eisiger Kälte den ganzen Weg nach Hause gelaufen, weil sie sich den Dollar für die U-Bahn nicht leisten konnte. Völlig abgebrannt, aber kein bisschen traurig war sie mit vom Alkohol vernebelten Erinnerungen an einen schönen Abend nach Hause gegangen. Dann hatte sie James kennengelernt, und sie machten es sich zu Hause gemütlich. Damals erschien ihr das selbstverständlich. Das musste Liebe sein! Im Nachhinein erkannte sie, dass sie lediglich ein bisschen »Familien-Idyll« spielten. Hatten sie jemals über das Bezahlen von Rechnungen debattiert oder gestritten, wer das Bad sauber machen musste? Nein, sie bestellten sich Pizza nach Hause, hatten fantastischen Sex, lachten viel und hingen vor der Glotze. Mit vierundzwanzig war das Georgias Vorstellung von Monogamie gewesen: Videofilme ansehen statt ins Kino zu gehen. Und wenn sie ausgingen, hatte sie das Geld mit Taxifahrten verprasst, die sie sich eigentlich nicht leisten konnte. Sie hatte sich teure Designerschuhe zugelegt (aber Qualität machte sich bezahlt – diese Cowboystiefel hielten immer noch, und sie trug sie verdammt oft) und an Räucherlachs satt gegessen, obwohl es cleverer gewesen wäre, eine Dose Thunfisch zu kaufen. Natürlich hatte es Momente gegeben, da machte sie sich insgeheim Sorgen (James wurde von seiner Chefin ganz schön in Beschlag genommen, und ob es mit ihrer eigenen Beförderung jemals klappte?), aber all das wurde überlagert von ihrem Vertrauen in eine strahlende Zukunft mit einer stabilen Partnerschaft.
Ha! Nach James hatte sie von diesen sogenannten Liebesziehungen die Finger gelassen. Dieses Scheusal hatte ihr nicht nur das Herz gebrochen, er war auch Schuld daran, dass sie niemandem mehr trauen konnte.
Seit James hatte es für sie keine romantische Beziehung mehr gegeben. Teufel, sie war ja kaum in der Lage, Freundschaften einzugehen, egal, ob mit Frauen oder Männern. »Ich bin wie gelähmt«, hatte sie einmal zu ihrer langjährigen Freundin K.C. gesagt, die sich bei ihr gerade über ihr jüngstes fehl geschlagenes Sexabenteuer beklagte. Während der Schwangerschaft hatte Georgia Anita kennengelernt, und etwa um die gleiche Zeit war sie in das Appartement über Martys Deli gezogen. Ein paar Monate später kam dann Dakota zur Welt … das war’s an neuen Bekanntschaften. Im Laden gab sich Georgia fachkundig, freundlich und selbstbewusst. Sie konnte stundenlange Gespräche über Strickmuster führen. Aber sich einfach so unterhalten? Georgia hielt sich zurück, während Anita – und Peri – mit den Kundinnen über Haustiere, Ehemänner und Schwiegereltern schwatzten. Ms Walker war eine Zuhörerin, aber keine Gesprächspartnerin. Und genau das machte sie einsam.
Peri um sich zu haben, war für Georgia wie ein Glas kühlen Wassers an einem dieser stickigen New Yorker Sommertage. Es war mehr als nur erfrischend, es war lebenserhaltend.
Und dennoch, nachdem Peri ein Jahr bei Walker and Daughter gearbeitet hatte, wurden Georgias Mutterinstinkte so stark, dass sie entschied, mit Peri ein ernstes Gespräch zu führen. Natürlich könnte sie weiterhin im Laden arbeiten, aber war es das, was sie wirklich wollte? Und dann rückte Peri mit der Sprache heraus: Sie wollte die nächste Kate Spade werden und träumte davon, eine eigene Designfirma für Accessoires zu gründen. Seit einiger Zeit besuchte sie heimlich Kurse am Fashion Institute of Technology. Vormittags arbeitete sie im Laden und danach drückte sie die Schulbank. Sie feilte sogar schon an einer eigenen Website – Perihandtaschen.com -, die allerdings noch brachlag, weil Peri bisher nicht herausgefunden hatte, wie man sie zum Laufen bekam. (Sie hatte extra einen Computerkurs belegt und bot Georgia an, unter Walkeranddaughter.com eine Website für den Laden zu entwerfen.) An Ideen mangelte es ihr wirklich nicht. Aber Peri klagte darüber, dass ihre Eltern von ihr erwarteten, einen seriöseren Beruf zu ergreifen. Folglich behielt sie ihre Designambitionen für sich. Was den Laden anging, nun, das war einfach ein guter Job – und ein Fuß in der Tür zur Modewelt. Sie plante, eine eigene Stricktaschenlinie zu entwerfen, wenn Georgia also nichts dagegen hätte, eine in ihrer Auslage …
Georgia hatte überhaupt nichts dagegen.
»Ich möchte einfach nicht die nächsten fünfzig Jahre lang von meiner Mutter zu hören bekommen: ›Ich hab’s dir ja gesagt‹«, gestand Peri ihr. »Wenn es nicht funktioniert, werde ich einfach behaupten, eine Selbstfindungsphase durchgemacht zu haben, und bewerbe mich erneut um einen Platz an der juristischen Fakultät. Sehen wir es doch mal realistisch: Ich war ein Ass auf dem College, mein Ergebnis beim Zulassungstest für die juristische Fakultät war überdurchschnittlich gut, ich bin karibischer Herkunft und eine Frau. Ein doppelter Pluspunkt für die Quotenfreaks und ein Bonus für die Professoren.«
Georgia bewunderte die Kühnheit, mit der Peri es wagte, Chancen zu ergreifen. Jetzt, zwei Jahre später, besuchte Peri immer noch Kurse, und die Website befand sich nach wie vor im Aufbau. Aber Peri hatte begonnen, ihre selbst gefertigten Strick- und Filzhandtaschen im Laden zu verkaufen und stellte sich häufig mit ihren Produkten auf Flohmärkte. Und wenn Dakota nicht gerade eine Karriere als Bühnenschriftstellerin, Chef-Konditorin oder Archäologin ins Auge fasste, beabsichtigte sie ernsthaft, Peris Geschäftpartnerin zu werden. Oder das Starmodel ihrer Werbekampagne. Da war sie noch unentschieden, wie sie ihrer Mutter mitteilte.