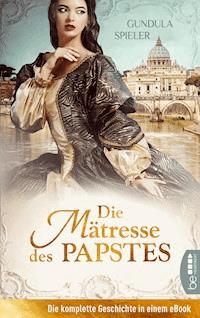
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rom, 1773: Die junge Antonia erregt durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit von Papst Pius VI. Er nimmt sie zu sich, sorgt dafür, dass ihr eine für ein Mädchen in dieser Zeit ungewöhnlich gute Bildung zukommt - und macht sie zu seiner heimlichen Mätresse. Von jetzt an ist Antonia von Luxus umgeben, aber sie ist einsam und muss ein Leben im Verborgenen führen. Und doch gibt es jemanden, der Liebe und Leidenschaft in ihr entfacht - und zugleich einer der größten Gegenspieler des Papstes ist.
Mit dem Ausbruch der Französischen Revolution 1789 jedoch werden Kirche und Papst in ihren Grundfesten erschüttert. Antonias Leben im Vatikan findet ein jähes Ende, als der Papst in französischer Gefangenschaft schließlich stirbt. Sie muss ein neues Leben beginnen - aber ganz anders, als sie gedacht hatte -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumMottoPrologKapitel 1 – KindertageKapitel 2 – Die AudienzKapitel 3 – Der Heilige VaterKapitel 4 – Die FluchtKapitel 5 – Dunkle ProphezeiungKapitel 6 – Geheimnisvolle RoseKapitel 7 – Reise nach WienKapitel 8 – Kaiser Joseph II.Kapitel 9 – Der Doge und das MeerKapitel 10 – Ein unrühmlicher EmpfangKapitel 11 – Die SommerresidenzKapitel 12 – Wege des SchicksalsKapitel 13 – Am ScheidewegKapitel 14 – StudentenlebenKapitel 15 – FamilienbandeKapitel 16 – RevolutionKapitel 17 – Der große KriegKapitel 18 – Die BesatzerKapitel 19 – Ein Kaufmann aus VenedigKapitel 20 – Erste BandeKapitel 21 – SalonlebenKapitel 22 – Das GeheimnisKapitel 23 – Der BesuchKapitel 24 – Karneval in VenedigKapitel 25 – Die MädchenschuleKapitel 26 – Tiefste Nacht der SeeleKapitel 27 – Das VerbrechenKapitel 28 – Baron BorgesioKapitel 29 – Die Reise nach RomKapitel 30 – Neue MachthaberKapitel 31 – Der letzte KelchEpilogÜber dieses Buch
Rom, 1773: Die junge Antonia erregt durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit von Papst Pius VI. Er nimmt sie zu sich, sorgt dafür, dass ihr eine für ein Mädchen in dieser Zeit ungewöhnlich gute Bildung zukommt – und macht sie zu seiner heimlichen Mätresse. Von jetzt an ist Antonia von Luxus umgeben, aber sie ist einsam und muss ein Leben im Verborgenen führen. Und doch gibt es jemanden, der Liebe und Leidenschaft in ihr entfacht – und zugleich einer der größten Gegenspieler des Papstes ist.
Mit dem Ausbruch der Französischen Revolution 1789 jedoch werden Kirche und Papst in ihren Grundfesten erschüttert. Antonias Leben im Vatikan findet ein jähes Ende, als der Papst in französischer Gefangenschaft schließlich stirbt. Sie muss ein neues Leben beginnen – aber ganz anders, als sie gedacht hatte …
Über die Autorin
Gundula Spieler wurde 1970 in Hannover geboren und wuchs in Niedersachsen auf. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Sozialwissenschaften. Heute lebt sie in der Nähe von Trier und widmet sich dem Schreiben, vorzugsweise zu historischen Themen. Ihre Inspirationen aus vielen Aufenthalten in Italien sowie die intensiven Recherchen zum 18. Jahrhundert und zur Kirchengeschichte verarbeitete sie in dem Roman »Die Mätresse des Papstes«.
Gundula Spieler
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Beke Ritgen, Bonn
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Kiselev Andrey Valerevich|Tatyana Vyc|Nejron Photo|Dragana Jokmanovic
E-Book-Erstellung:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-1700-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sic transit gloria mundi.
Fürwahr vergänglich ist weltlicher Ruhm.
Aus der Krönungszeremonie für einen neuen Papst, verfasst von Augustinus Patricius (Agostino Patrizi Piccolomini) im Jahre 1516.
Prolog
Meine Geschichte ist eine Geschichte, die es nicht geben dürfte. Denn wenn die Wahrheit nicht den Vorstellungen der Mächtigen entspricht, dann wird, was geschieht, diesen Vorstellungen angepasst. So war es und so wird es auch in Zukunft sein. Aber selbst die Mächtigen können schnell zu Ohnmächtigen werden, auch das habe ich erfahren. So mancher hat mich bewundert, noch mehr haben mich für das verachtet, was sie über mich wussten oder zu wissen glaubten. Aber wie konnten sie über mich urteilen, ohne die ganze Geschichte zu kennen? Lange schwieg ich und hatte Grund dazu. Die Zeit war noch nicht gekommen, um meine Geschichte zu erzählen, und der Feind war allgegenwärtig. Mein Leben war eine Provokation für die, die noch an die Moral der Kirche glaubten und sich von ihr täuschen ließen, aber auch für jene, die in mir eine Verfechterin der alten Ordnung sehen wollten. In Wahrheit bin ich weder der einen, noch der anderen Seite wirklich zugetan. Auch hasse ich die Kirche nicht, ich habe nur zu viel von der Wahrheit gesehen. Es gibt für mich nicht nur schwarz oder weiß, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Bald werden sie zurückkehren, die Maskierten, die mir nach dem Leben trachten und mir den letzten Kelch bringen, den Becher mit dem tödlichen Gift. Ich habe keine Angst mehr vor ihnen, ich widersetze mich nicht mehr. Ich bin stolz darauf, wenn ich in meinem Leben nur ein paar Menschen etwas Gutes tun konnte, denn das, so habe ich inzwischen gelernt, ist das Einzige, was wirklich zählt. Der Mann, der mich dies lehrte, war einer der ganz Großen unserer Zeit und sicherlich der beste Monarch seit Langem.
Manche mögen von meiner Geschichte schockiert sein und sie unmoralisch finden. Aber was ist Unmoral? Eines Tages, wenn die Welt eine andere sein wird, wird meine Geschichte vielleicht erzählt, und vielleicht werde ich dann verstanden.
Kapitel 1
Kindertage
Ich wurde im Jahr 1764 in Rom geboren, in der ›Ewigen Stadt‹, wie man sagt. Wir wohnten ganz in der Nähe des Petersdoms, im Stadtteil Borgo, in einem Haus an der Piazza Scossacavalli. Mein Vater, Francesco Bernini, war Tischlermeister und hatte es mit seinem Familienbetrieb zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Er war ein hochgewachsener Mann mit dichten, schwarzen Locken und glühenden Augen, vor dem wir Kinder uns immer ein wenig fürchteten. In alter Familientradition fertigte mein Vater kunstvolle Möbel an und besaß einen guten Ruf im ganzen Land. Sogar der Papst ließ Möbel in seiner Werkstatt fertigen, worauf mein Vater besonders stolz war. Meine Mutter Josefina kümmerte sich um alles andere und uns Kinder. Sie war eine herzensgute und fröhliche, eine sehr fromme Frau und fürsorgliche Mutter. Sie war fleißig und bescheiden. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen und war harte Arbeit von Kindheit an gewohnt; Müßiggang und Prahlerei waren ihr fremd und nicht nur, weil sie der Kirche als Todsünden galten. Niemals wäre ihr in den Sinn gekommen, sich mit dem erworbenen Wohlstand meines Vaters zu brüsten. Meinem Vater ordnete sie sich manchmal derart unter, dass es mich von Anfang an, schon als ganz kleines Mädchen irritierte. Waren Mutter und Vater nicht gleich, wie ihr Ton untereinander es mich sonst glauben machte, große Leute eben, beide gleichermaßen erwachsen? Dass sich dann der eine dem anderen unterordnete, ergab für mich keinen Sinn. Wenn ich sie danach fragte, bekam ich zur Antwort:
»Weil eine Frau ihrem Manne zu gehorchen hat.«
Diese Antwort befriedigte mich keineswegs, aber ich hielt den Mund, weil ich damals schon begriff, dass darüber mit meiner Mutter zu streiten zu nichts geführt hätte.
Ich war gern in Gesellschaft meines Vaters und deshalb auch gern in seiner Werkstatt. Dort gab es so viele spannende Dinge zu sehen. Es war ein schmaler, nicht sonderlich heller Raum, an dessen Wänden zumeist Unmengen Bretter unterschiedlicher Größe standen. In der Mitte des Raumes befand sich ein runder, kleiner Werkstattofen aus Gusseisen, der im Winter für Wärme sorgte. Oft bestaunte ich die kunstvoll gedrechselten Rundhölzer, die später zu Beinen von Tischen und Betten, Stühlen und Sesseln wurden. Es war für mich ein kleines Wunder, wie aus unscheinbarem Holz solch herrliche Möbelstücke entstehen konnten. Oft glitt meine Hand über die fertigen, auf Hochglanz polierten Möbel aus edlem Eichen- oder Mahagoniholz und ich staunte über die rotbraune Farbe und die spiegelglatte Oberfläche.
Mein Bruder Valentino war drei Jahre älter als ich, meine Schwester Sophia zwei Jahre jünger. Mein Bruder hatte die Sturheit meines Vaters geerbt. Er ärgerte mich gern, zog mich an Haaren und Kleidern oder versteckte meine Spielsachen. Mich erboste das sehr, und ich beschimpfte ihn dann nicht selten lautstark. Meine jüngere Schwester wirkte auf mich eher wie ein Engel auf einem dieser Gemälde, die man oft in den Kirchen Roms sehen konnte, nicht wie ein menschliches Wesen. So ruhig saß sie, blond gelockt wie sie war, in ihren Kleidchen und den gerüschten Pantalletes oft da. Unser Vater schickte meinen Bruder auf eine kirchliche Schule; es stand fest, dass er einmal in seine Fußstapfen treten sollte. Mein Vater wachte sehr streng über die schulischen Leistungen seines einzigen Sohnes und Nachfolgers. Er schlug ihn, wenn er schlechte Leistungen in der Schule zeigte. Auch uns Mädchen behandelte er sehr streng und züchtigte uns, wenn wir ungehorsam waren. Auf die schulische Bildung der Mädchen legte unser Vater keinen Wert; es reichte ihm aus, wenn wir sonntags mit unserer Mutter die heilige Messe besuchten und zur Frömmigkeit erzogen wurden. Mädchen bräuchten nicht zur Schule zu gehen. Meine Mutter war zwar der Meinung, dass es auch für Mädchen aus gutem Hause von Nutzen sein könnte, wenn sie lesen und schreiben lernten. Einmal unternahm sie sogar den Versuch, für uns ein Kinderfräulein zu finden, das uns darin unterrichtete. Aber dieser Versuch scheiterte. Mein Vater entließ das Kinderfräulein wieder, noch bevor ich wirklich Gelegenheit hatte, etwas von ihr zu lernen. Einmal stritten meine Eltern darüber, als wir beim Essen saßen. Zaghaft versuchte meine Mutter, meinem Vater zu erklären, dass lesen und schreiben zu können auch für Mädchen gut wäre. Mein Vater antwortete ihr in barschem Ton: »Mädchen brauchen nicht lesen und schreiben zu können, Mädchen heiraten ja sowieso.«
»Aber es könnte einer Frau auch im Haushalt hilfreich sein, wenn sie zum Beispiel Kochrezepte lesen kann.«
Mein Vater donnerte mit der Faust auf den Tisch.
»Die Weiber lernen das Kochen von ihren Müttern und Großmüttern. Dazu brauchen sie nicht lesen und schreiben zu können. Du kannst doch auch wundervoll kochen ohne das. Lesen und Schreiben, das setzt den Mädchen doch nur Flausen in den Kopf.«
»Antonia ist schon neun, bald reift sie zur Frau heran. Wir sollten jetzt schon daran denken, sie gut zu verheiraten.«
»Dazu haben wir ja noch ein paar Jahre Zeit.«
»Antonia ist ein ungewöhnlich schönes Kind von großer Anmut. Vielleicht können wir für sie einen hochgestellten Ehemann finden, vielleicht einen reichen Kaufmann oder vielleicht sogar einen Adligen.«
»Die Schönheit allein macht es nicht, Frau. Glaubst Du ernsthaft, ich könnte die Mitgift aufbringen, die ein adeliger Ehemann verlangen würde? Nein, selbst mit meinen guten Einkünften wäre ich dazu nicht in der Lage. Der Adel, nein, Frau, das ist ein wahrhaft zu hoch gestecktes Ziel.«
Doch meine Mutter sprach ständig weiter davon und war nicht davon abzubringen. Sie sprach davon beim Kochen, sie sprach davon, wenn sie mir half mich anzukleiden, und sie sprach davon, wenn sie mich frisierte. Ich hatte langes Haar, schwarz wie die Nacht und so dicht, dass es Mühe machte, es zu kämmen. Meine Mutter liebte es, mir Zöpfe zu flechten und zu kunstvollen Frisuren aufzustecken, was ich meistens murrend ertrug. Gern sprach sie, wenn sie mich frisierte, von meiner ungewöhnlichen Schönheit und ihrem großen Traum, einen Ehemann von Ansehen für mich zu finden. Das war offenbar alles, was ein Mädchen sich erhoffen durfte: einen guten Ehemann zu finden, der für sie sorgte und dem sie Kinder gebar. Doch schon bald sollte sich mein wahres Schicksal offenbaren.
Kapitel 2
Die Audienz
Hätte ich an jenem Tag nicht am Brunnen auf dem großen Platz vor unserem Haus gespielt, wäre mein Leben wahrscheinlich völlig anders verlaufen. Denn an jenem Tag am Brunnen entschied sich mein Schicksal. Aber vielleicht war es auch das Leben, das mir der Allmächtige vorherbestimmt hatte, der einzige Herr, vor dem ich noch das Knie beuge. Vielleicht war es Sein Wille, Sein unergründlicher Plan, den Er mit mir hatte.
Es war an einem warmen Sommertag im Jahr 1775. Ich war damals gerade elf Jahre alt. Die Sonne schien vom Himmel und brannte auf die Pflastersteine auf der Piazza Scossacavalli. Meine Eltern waren wohlhabend genug für Gesinde. So mussten wir Mädchen nur gelegentlich im Haushalt helfen, zum Beispiel am Waschtag, beim Plätten der Wäsche und beim Zusammenlegen des Leinens. Da wir Mädchen nicht zur Schule gingen, hatten wir viel freie Zeit, Zeit, in der uns niemand sonderlich zu beachten schien. So liefen wir an diesem Tag über die Piazza Scossacavalli, um an dem Brunnen zu spielen. In der Nachmittagshitze zog es uns zum Wasser, denn es versprach Kühlung. Den Brunnen umgab ein Ring aus steinernen Pfosten, miteinander verbunden durch ein eisernes Geländer, als ob Kinder sich beim Ringelreihen an den Händen fassten. Der Brunnen selbst hatte ein großes Wasserbecken von bauchig geschwungener Form, in dessen Mitte sich auf einer verzierten Säule ein zweites kleineres, rundes Becken erhob. Das Wasser lief von dem höheren Becken hinab in das untere. Meine kleine Schwester versuchte, Wasser mit einem schadhaften Becher aus dem Brunnen zu schöpfen. Ihre widerspenstigen Locken glänzten dabei in der Sonne wie Gold. Es machte uns viel Spaß, wenn das Wasser aus dem Loch in dem Becher auf die heißen Pflastersteine lief. Übermütig rafften wir die Chemisenkleider und rannten immer um den Brunnen herum, sodass uns der Wassernebel in der Luft am Brunnen tatsächlich ein wenig Kühlung an unseren nackten Beinen verschaffte. Ins Spiel vertieft, bemerkte ich gar nicht, was um uns herum vor sich ging. Ich sah die Sänfte nicht, die auf den Platz getragen wurde, sah die vier Träger nicht und auch nicht das Gefolge. Die drei Männer, die neben der Sänfte einherschritten, trugen lange, dunkle Gewänder, wie ich sie von den katholischen Priestern der umliegenden Gemeinden kannte. Die Sänfte hatte schwere Vorhänge aus teurem Brokat. Die Vorhänge wurden ein Stück zur Seite gezogen, und ein Mann, sicher schon über fünfzig, was mir damals uralt vorkam, mit leicht ergrautem, aber immer noch vollem Haar, beugte sich würdevoll aus der Sänfte heraus, winkte mir zu und rief: »Hallo, mein Kind, gesegnetes Kind, komm zu mir! Komm zum Heiligen Vater!«
Der feierliche Ernst, mit dem er das tat, seine Stimme, seine Haltung – alles an ihm flößte mir Ehrfurcht ein. Mein Herz pochte mit einem Mal noch viel wilder, als es das während unseres Brunnenlaufs getan hatte. Gott musste es besonders gut mit mir meinen, mich besonders lieben! Eilig lief ich zu der Sänfte hin. Wie oft hatte ich zu der Muttergottes gebetet und zum Herrn Jesus, sie mögen mich segnen und mich zu einem frommen Kind machen. Meine Gebete waren anscheinend erhört worden. Der Heilige Vater kam auf den Platz vor unserem Haus und rief mich zu sich!
Meine Mutter musste die Szene vom Haus aus beobachtet haben, denn sie eilte hinaus auf den Platz. Sie war an jenem Tag einfach und schlicht gekleidet, eine Schürze über dem grauen Kleid. Sie war mit Arbeit in Haus und Küche beschäftigt gewesen, das hellbraune Haar hochgesteckt. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie sie nach ein paar hastigen Schritten vor dem Haus stehen blieb. Der Blick des Papstes ruhte allein auf mir. Mir war, als könnte ich diesen Blick auf der Haut spüren. Zögernd trat ich auf die Sänfte zu. Der Papst musterte mich eindringlich und sagte:
»Welch edle Gesichtszüge … welch Anmut der Gestalt … welch vollkommene Physiognomie …«
Er löste den Blick von mir und sah prüfend zu meiner Mutter hinüber. Dann wandte er sich wieder mir zu.
»Mein Kind, wie ist denn Dein Name?«
»Antonia Francesca Bernini«, erwiderte ich laut und deutlich.
»Ein schöner Name.«
Etwas verlegen und scheu musterte ich den Mann in der Sänfte, den mächtigsten Fürsten der Kirche. Ich vermeinte eine geheimnisvolle Aura zu spüren, die ihn umgab. Er trug ein weißes Gewand, nicht die bei gewöhnlichen Priestern übliche schwarze Soutane, darüber einen leichten roten Mantel; ich sah Goldstickereien aufblitzen. Auf dem Kopf trug er ein Pileolus, eine kleine, runde Kappe, die ebenfalls weiß war. Sanft berührte er mit der rechten Hand meine Wange und sagte:
»Du bist ein gutes Kind, ein braves, bist ein sehr schönes Mädchen. Deine Eltern können wirklich stolz auf dich sein.«
Bei den letzten Worten blickte er hinüber zu meiner Mutter, als wüsste er, wer sie war. Immer mehr neugierige Menschen wurden auf die Szene aufmerksam und kamen herbei. Der Papst gab den Sänftenträgern ein Zeichen, schloss den Vorhang, und die Sänfte wurde davongetragen. Noch lange schaute ich der Sänfte nach, so verwundert war ich.
In der folgenden Zeit fragte ich mich häufig, ob ich die Begegnung mit dem Heiligen Vater nur geträumt hatte oder ob sie sich wirklich ereignet hatte. Im Nachhinein erschien mir alles so unwirklich. Doch dann, einige Wochen später, geschah etwas Unerwartetes, so unerwartet, dass meine Eltern den ganzen Tag von nichts anderem mehr sprachen: Es wurde uns eine Audienz beim Papst gewährt. Eine Audienz war ein großes Privileg, und meine Eltern waren unglaublich stolz darauf. Sie wähnten sich auserwählt von Gott. Meine Mutter überlegte immer und immer wieder aufs Neue, welches Kleid wohl bei der Audienz angemessen und schicklich wäre und wie sie sich zu verschleiern habe.
Die Audienz fand im Apostolischen Palast in einem großen, zu diesem Zweck eingerichteten Saal statt. Schüchtern betrat ich mit meiner Familie den prunkvoll ausgestatteten Raum. Mein Vater trug über einer Weste seinen besten Justaucorps, einen Rock aus schwarzem Moiré, und wirkte noch steifer und strenger darin als sonst. Meine Mutter trug eine grau-schwarz geblümte Contouche, ein lockeres Gewand mit schwarzer Borte, und die dazu passende Jupe, den Reifrock, über gleich mehreren Unterröcken, damit der Reif nicht einmal zu erahnen wäre. Das Dekolleté bedeckte sie mit einem Brusttuch. Ein schwarzer Spitzenschleier bedeckte das Haar, wie es für nicht-adelige Frauen bei einer Papstaudienz üblich war. Der Schleier stand ihr nicht gut zu Gesicht; er ließ sie älter erscheinen als sie eigentlich war. Auch wir Kinder trugen unsere besten Kleider; meiner Schwester und mir hatte man die Haare zu kunstvollen Frisuren aufgesteckt; meine allerdings verbarg ein schwarzer Schleier. Weil meine Mutter fand, meine Schwester sei noch zu jung dafür, brauchte sie noch keinen Schleier zu tragen. Ich war ganz von dem Anblick gefangen, der sich mir im Palast bot: Vergoldeter Stuck, verzierte Decken und Wände, die herrlichste Gemälde zierten. Der Prunk überwältigte mich und wirkte zugleich einschüchternd auf mich. Außer uns waren noch andere Privilegierte zur Papstaudienz gekommen, die sich alle in den Raum drängten. Papst Pius VI. saß auf einem mit goldener und roter Seide bespannten Thron, gekleidet in ein weißes Gewand, das so wunderbar fiel, dass der Stoff nur von auserlesener Qualität sein konnte. Er winkte uns mit würdevoller Geste zu sich. Seine Haare waren formvollendet frisiert, der Pileolus saß, als wäre der Kopf des Heiligen Vaters für keine andere Kopfbedeckung gemacht. Außer dem Fischerring trug er noch einen zweiten Ring. Ich kniete vor ihm nieder, küsste den Ring und verneigte mich tief vor dem Heiligen Vater. Er legte mir die Hände auf den Kopf und sprach einen Segen. Meine zwei Geschwister knieten ebenfalls nieder und taten es mir gleich, danach meine Eltern; auch sie erhielten den päpstlichen Segen. Die vielen anderen Leute hinter uns drängten sich zum Papstthron vor, aber ich bemerkte es kaum. Pius VI. war ein hochgewachsener Mann mit edlen Gesichtszügen und zwei wachen braunen Augen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich ihn trotz seines Alters damals für einen schönen Mann hielt. Er strahlte obendrein so viel Würde aus, dass ich vor lauter Ehrfurcht wie erstarrt war. Der Papst wandte sich mit väterlichen Worten an meinen Vater. Er sprach ihn mit ›mein Sohn‹ an und lobte überschwänglich seine vortreffliche Handwerkskunst. Er sagte ihm, dass er beabsichtige, noch mehr Möbel für seine Privatgemächer bei ihm fertigen zu lassen, und ihn dafür reich entlohnen werde. Dann fragte der Heilige Vater nach uns Kindern. In seiner tiefen melodischen Stimme lag Wärme. Meine Mutter ergriff das Wort, als habe sie nur auf das Stichwort gewartet. Sie hatte wohl die ganze Zeit über nur darauf gehofft, mit dem Heiligen Vater über das zu sprechen, was sie am meisten beschäftigte: meine Heirat. Der Sohn werde Nachfolger des Vaters, antwortete meine Mutter mit gesenktem Blick. Nur um mich mache sie sich Sorgen. Ich sei die Älteste und sie müsse bald daran denken, mich zu verheiraten, und es sei schwer, für mich einen guten Ehemann zu finden. Der Papst richtete seinen Blick fest auf mich; mir war, als sähe er direkt in meine Seele.
»Kannst Du lesen und schreiben, Antonia?«
»Ich … nein«, stotterte ich, unfähig einen zusammenhängenden Satz hervorzubringen. Am liebsten wäre ich in diesem Moment im Boden versunken. Zum Glück sprang mir meine Mutter bei: »Sie ist ein kluges Mädchen, Eure Heiligkeit, mein Mann war nur der Meinung, lesen und schreiben zu lernen sei für ein Mädchen nicht von Nutzen.«
Mit demütig gesenktem Kopf fügte sie hinzu: »Ich kann es auch nicht, Eure Heiligkeit.«
»Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen«, sagte nun der Papst.
»Liebe Antonia«, wandte er sich an mich, »weißt Du, wo ich lebe?«, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort:
»Würdest Du dort auch gern leben?«
Er lächelte mich an und machte eine Handbewegung, die den Audienzsaal und den ganzen Palast einzuschließen schien: »In so schönen Räumen, in meinem Palast.«
Mir verschlug es die Sprache. Irritiert suchte ich den Blick meiner Eltern, und nun richtete auch der Heilige Vater seinen Blick auf meinen Vater. Doch dann sprach er mich erneut an: »Würdest Du denn auch gern lesen und schreiben lernen, vielleicht auch rechnen?«
»Ja, das möchte ich gern, Heiliger Vater.«
Wieder blickte er zu meinen Eltern:
»Ich wollte deine Eltern bitten, dich in meine Dienste und Obhut zu geben. Du wirst ein eigenes Zimmer erhalten und schöne Kleider. Denn Du bist ein ganz besonderes Kind. Das habe ich schon bemerkt, als ich dich am Brunnen zum ersten Mal sah.«
Nach diesen Worten wandte er sich wieder meinem Vater zu.
»Antonia soll eine ihr angemessene Bildung erhalten, sie soll zu Frömmigkeit und Tugend angehalten werden, und wenn die Zeit dazu reif ist, werde ich persönlich einen Ehemann für sie aussuchen. Im Gegenzug wird sie kleinere Schreibarbeiten und die Pflege des Gartens übernehmen. Nach ihrer ersten heiligen Kommunion möchte ich sie zu mir nehmen.«
Mein Vater nickte nur stumm und murmelte: »Ja, Eure Heiligkeit«. Dann verneigte er sich tief. Die uns gewährte Audienz war zu Ende. Uns wurde bedeutet, dass wir nun den anderen, die ebenfalls wünschten, mit dem Heiligen Vater zu sprechen, Platz machen sollten.
Wir kehrten nach Hause zurück. Den ganzen Weg über herrschte Schweigen. Mir war klar, dass meine Eltern als fromme Katholiken sich dem Willen des Papstes nicht widersetzen würden, egal, was sie selber darüber dachten. Sein Wille wurde von ihnen mit dem Willen Gottes gleichgesetzt. Schließlich brach mein Vater das Schweigen und meinte, es sei sicher zu meinem Besten, mich in die Obhut des Papstes zu geben. Meine Mutter war stolz darauf, dass der Heilige Vater ihre Tochter auserwählt hatte, und man merkte ihr diesen Stolz deutlich an. Sicherlich würde Pius VI. später einen guten Ehemann für mich auswählen.
Einige Zeit lang ging unser Familienleben wie gewohnt weiter. Keiner sprach mehr über die Audienz, über den Papst und die Vereinbarung, die meine Eltern mit dem Heiligen Vater getroffen hatten. Es war fast so, als wäre das alles nie passiert. Meine Mutter kümmerte sich um Haus, Gesinde und uns Kinder, mein Vater ging seinen Aufgaben in der Werkstatt nach und fertigte kunstvolle Möbelstücke für seine zahlreiche Kundschaft. Mein Bruder ging zur Schule, und wir Mädchen verbrachten die meiste Zeit zu Hause. Doch dann rückte der Zeitpunkt meiner Erstkommunion näher. Nervös nahm ich an der Eucharistie und den folgenden Feierlichkeiten teil. Zwei Tage später standen auf einmal zwei schwarz gekleidete Männer vor unserer Tür. Es waren Boten des Papstes, die gekommen waren, um mich abzuholen. Meine Mutter packte mir ein paar Kleidungsstücke zusammen. Eine Stoffpuppe steckte sie auch mit hinein, das Lieblingsspielzeug meiner Kindheit. Es erschien mir irgendwie unpassend, diese Erinnerung an meine Kindheit mitzunehmen, aber ich widersprach ihr nicht. Dann sah ich, dass meine Mutter weinte, aber offenbar versuchte sie, es vor mir zu verbergen. Laut sagte sie zu meinem Vater:
»Was hat Gott nur mit meinem Kind vor? Das macht mich ganz beklommen.«
Dann übergab sie mit niedergeschlagenen Augen wortlos meinem Vater, was sie für mich zusammengepackt hatte. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als mein Vater den beiden Männern in Schwarz meine Habseligkeiten übergab. Mit einer kühlen Geste verabschiedete er sich von mir. Meine Mutter konnte nun ihre Tränen nicht mehr verbergen. Sie umarmte mich und winkte mir noch lange nach.
Kapitel 3
Der Heilige Vater
Man gab mir nicht nur ein eigenes Zimmer, sondern sogar zwei Zimmer, direkt im Apostolischen Palast, ganz in der Nähe der päpstlichen Privatgemächer. Die beiden Räume lagen hintereinander; das Schlafzimmer war nur durch das andere Zimmer erreichbar. Es waren hohe, schlicht weiß gestrichene Räume, jedoch sehr hübsch möbliert und hell. Die Möbel sahen genauso aus wie die, die mein Vater in seiner Werkstatt herstellte, und kamen mir daher vertraut vor: ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Toilettentisch mit Spiegel, Waschschüssel und Wasserkrug, ein Sofa, ein Tisch und ein Sekretär. Die Mahagonioberflächen, die Intarsienarbeiten zierten, glänzten so, wie ich es schon als Kind so oft bewundert hatte. An den Decken hingen zwei aufwendige Kristallleuchter, an den Wänden herrlich ziselierte Kerzenhalter und vor den Fenstern befanden sich schwere Vorhänge. Ein teurer Teppich lag auf dem Boden. Beheizen konnte man die Räume im Winter durch einen Kachelofen. Ich staunte und war mehr als zufrieden.
In der ersten Zeit gab sich der Heilige Vater nur als mein Gönner, mein Ziehvater. Wie versprochen nahm er sich meiner Ausbildung an. Ich erhielt einen Privatlehrer und lernte das Lesen, Schreiben und Rechnen, wurde aber auch in den sieben freien Künsten unterwiesen, zumindest in Grammatik, Dialektik und Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Philosophie und Musik. Latein sollte ich lernen, Französisch und Griechisch, mich in Geschichte auskennen und Orgel spielen. Mein Hauslehrer war ein ordinierter Priester mit strengem Blick und schmalen Lippen. Er sprach fließend Latein und Griechisch und war ein exzellenter Bibelkenner. Trotz seiner Strenge mochte ich ihn gern, war er doch nie ungerecht, sondern immer höflich zu mir. Meine Wissbegierde war groß, lesen und schreiben zu können eröffnete mir eine ganz neue, spannende Welt, die mir zuvor verschlossen gewesen war. Ich bekam Einblick in Neues, Unbekanntes, in vergangene Zeiten, wie die Welt der Antike, lernte etwas über fremde Länder und Kontinente. Endlich hatte ich Zugang zu Wissen, und Wissen, so ahnte ich, war unendlich kostbar. Später erhielt ich Unterricht in Philosophie, vor allem Logik, von einem Professor des Studium Urbis, im Palazzo della Sapienza, jenseits des Tibers, zwischen Pantheon und Piazza Navona gelegen. Der Heilige Vater, der aus einer alten, aber unbegüterten Adelsfamilie stammte, hatte selbst eine ausgezeichnete Bildung genossen und schätzte den Umgang mit gebildeten Menschen sehr. Er kannte den Professor persönlich und achtete ihn sehr. Dieser war ein zu Fülle neigender, kleiner Mann mit trockenem Humor. Gern erzählte er Anekdoten oder witzige Geschichten, in denen er mir Besprochenes aus meinem Lernstoff plastisch veranschaulichte. Eitelkeit kannte er nicht, seine Welt waren die Bücher. Die Kleidung, die er trug, war schlicht, und trotz seines schütteren Haares trug er keine Perücke.
Aber nicht nur Wissen und Bildung waren neu in meinem Leben, es wurde auch sehr viel komfortabler. Ich bekam eine eigene Kammerfrau. Sie hieß Maria und half mir beim An- und Auskleiden und bei der Morgentoilette. Außer Maria lebten noch weitere Frauen im Apostolischen Palast, wie ich verwundert feststellte. Ich hatte immer geglaubt, dort würden nur Männer wohnen; jetzt lernte ich, dass ihn sehr wohl auch Frauen bevölkerten. Abgesehen von mir war Pius VI. auch Wohltäter für eine weitere, eine ältere Frau, die er aus Dankbarkeit aufgenommen hatte: Sie hatte in früheren Jahren, als er noch kein Papst gewesen war, seiner Familie treu gedient. Daneben gab es viele Frauen, die in der Küche oder als Haushaltshilfen arbeiteten. Mich betraute man mit der Aufgabe, den Innenhof der Bibliothek zu pflegen. Ich mochte diese Arbeit gern und widmete ihr viel Zeit. Voller Liebe und Hingabe legte ich Beete neu an, pflanzte Blumen und Kräuter. Besonders gerne mochte ich Lavendel, Salbei, duftenden Thymian und Rosen. Bald schon hatte ich aus dem etwas vernachlässigten Innenhof einen wunderschönen Kräuter- und Blumengarten geschaffen. Dafür erntete ich Lob und Anerkennung; besonders die Frauen erfreuten sich an meinem kleinen Garten.
Das machte mich glücklich und zufrieden, und ich genoss das gute Leben, das ich im Palast hatte. Der Heilige Vater ließ mir kostbare Kleider von seinem Privatschneider nähen. Die Stoffe waren edel, die Schnitte schlicht und bequem. Außerdem erhielt ich meine erste Schnürbrust und feine Unterwäsche: Chemisen aus feinem Batist und mit Spitzenbesatz, Unterröcke aus Taft. Einer der beiden Kammerdiener des Papstes, den ich Giovanni nennen durfte, wurde damit betraut, für meine Annehmlichkeit zu sorgen und nach mir zu schauen. Nur selten verließ ich den Palast, niemals aber ohne Begleitung. Der Heilige Vater wünschte es so; er sagte, es schicke sich nicht und sei obendrein für ein junges Mädchen zu gefährlich, allein durch Roms Straßen zu streifen. Noch ahnte ich nicht, was meine eigentliche Bestimmung war, mit welchen verborgenen Gedanken der Heilige Vater sich meiner angenommen hatte. Vielleicht war ich dazu damals viel zu jung und unerfahren gewesen, doch schon bald sollte ich eines Besseren belehrt werden.
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich, so jung wie ich war, den Tagesablauf im Palast verstand. Aus Wochen wurden Monate, aus Monaten gar Jahre, ehe ich alle Mosaiksteinchen zusammengesammelt hatte und ein Bild entstand. Der Papst verrichtete seine täglichen Aufgaben beharrlich und mit Sorgfalt, das war nicht schwer herauszufinden. Täglich stand er früh am Morgen auf, um sich noch einige Zeit geistigen Übungen zu widmen, Exerzitien, wie er sie nannte. Auch mich hielt er dazu an, morgens den Rosenkranz zu beten. Nach dem Frühstück, zu dem er gern Brot und Wein zu sich nahm, betete er in einer der päpstlichen Privatkapellen, zu der nur ein kleiner Kreis anderer Bewohner des Palastes Zutritt hatte. Anschließend besprach er mit seinem persönlichen Sekretär und dem Kardinalstaatssekretär, der für alles politische und diplomatische Handeln des Heiligen Stuhls verantwortlich zeichnet, Regierungsangelegenheiten und gab Audienzen. Nach dem Mittagessen gehörte es für ihn zum Tagesablauf, sich mit hohen Würdenträgern der Kurie zu treffen, Predigten zu schreiben oder administrative Arbeiten zu erledigen, bis es Abend wurde. An manchen Tagen hielt er die Messe und entsprechend die Predigt oder er besuchte Wallfahrtsorte und am Abend Sühneandachten und, zu besonderen liturgischen Gelegenheiten, andere Kirchen der Stadt, um dort zu beten. Gern ging er in den vatikanischen Gärten spazieren, dabei durfte ich ihn gelegentlich begleiten. Im Oktober gab er keine Audienzen mehr, sondern vertiefte sich in Exerzitien und hielt auch auf langen Spaziergängen Zwiesprache mit Gott. Ab und zu bat mich der Papst in seine Privatgemächer, um sich nach meinem Wohlbefinden und den Fortschritten meiner Studien zu erkundigen. Ich bewunderte die Pracht dieser Gemächer, alles in einem altrosa Farbton gehalten, den herrlichen Schwung der Stuckaturen an Wänden und Decken. Der Papst bat mich dann, auf einem Sofa an einem kleinen runden Tisch Platz zu nehmen. Das zierliche Sofa hatte Geißfüße, die mich von Anfang an in ihren Bann schlugen, und war genau wie der Sessel mit edlem Brokat bespannt. Der Tisch war, wie der Tisch in meinen eigenen Gemächern, mit Intarsien verziert. So wunderschöne Möbel hatte nicht einmal mein Vater hergestellt. Ich strich gern mit den Fingern darüber, freute mich am Glanz und an der handwerklichen Meisterschaft, für die mein Auge in der Werkstatt meines Vaters geschult worden war. Manchmal hörte ich ihn förmlich mir mit Leidenschaft erklären, wie man dies herstellte, wie man das machte. Ich hatte aber nicht oft Gelegenheit, durch den Palast zu streifen, denn ich hatte viel zu lernen und war ständig beschäftigt. Wenn mich der Heilige Vater zu sich rief, dann, um mich nach meinen Fortschritten zu befragen. Dabei fand er stets väterliche Worte für mich und schmeichelte mir. Einmal reichte er mir ein kleines Päckchen und forderte mich auf, es zu öffnen. Darin befand sich ein Kartenspiel. Es war kein gewöhnliches Kartenspiel, sondern ein Rhetorik-Kartenspiel, wie er mir sogleich erklärte.
»Die Rhetorik ist eine wichtige Kunst, um in der gehobenen Gesellschaft zu bestehen, gerade für eine Frau. Jetzt können Sie diese Kunst leichter erlernen und dabei noch Spaß haben. Sie wissen doch sicher, dass mir Ihre Bildung am Herzen liegt.«
»Vielen Dank, Heiliger Vater«, sagte ich verlegen und senkte respektvoll den Kopf. Er sah diese Geste, legte mir den Finger unters Kinn und hob meinen Kopf.
»Schauen Sie einem Mann lieber in die Augen. Zuviel Demut vor einem Manne wird nur dazu führen, dass er Sie respektlos behandelt. Wenn Sie ihm in die Augen schauen, können Sie ihn verzaubern, und er wird Ihnen zu Füßen liegen.«
Er lachte herzlich.
»Aber, Eure Heiligkeit, Sie sind doch …«
Er ließ mich den Satz nicht vollenden.
»Ich weiß, Antonia, dass Sie mir Respekt entgegenbringen, so wie alle Gläubigen. Aber Sie … Sie sind etwas Besonderes für mich. Sie sollten selbstbewusster werden. Es braucht nur Gottes Segen, damit eine Frau von Ihrer Schönheit und Anmut mit Bildung und Selbstbewusstsein in der Welt alles erreichen kann.«
Nachdenklich schaute ich ihn an und versuchte den Blick nicht wieder schüchtern zu senken, sondern den Augenkontakt zu halten.
»So, nun gehen Sie! Ich habe noch zu tun.«
Mit der Kammerfrau Maria spielte ich von nun an oftmals das Kartenspiel. Aufgrund meiner Jugend erlaubte es mir der Heilige Vater, mit einer Bediensteten zu spielen und sah darüber hinweg. Vermutlich wusste er, dass ich oft einsam war. Zuerst wollte Maria nicht, dann aber ergab sie sich meinem Betteln und Flehen. Sie lachte laut und viel dabei, und das, obwohl sie nicht gut lesen konnte und sich ziemlich ungeschickt anstellte. Doch dann lernte sie mehr und fand Gefallen an dem Spiel mit mir. Wir taten dann so, als wären wir zwei vornehme Damen der römischen Gesellschaft, die Konversation betrieben und dabei Schokolade tranken Letzteres stellten wir uns natürlich nur vor; Schokolade getrunken hatten wir bis dahin beide noch nicht. Unser Lachen hörte man die Flure des Palastes hinauf und hinunter, und nicht nur einmal steckte Giovanni neugierig den Kopf zur Tür herein, einmal sogar der Heilige Vater selbst. Er ließ uns an diesem Nachmittag tatsächlich heiße Schokolade bringen. Noch nie in meinem Leben hatte ich etwas Köstlicheres gekostet, es war himmlisch. Ja, manchmal, und nicht nur wegen der himmlischen Schokolade, schien es mir tatsächlich, als wäre der Apostolische Palast dem Himmel ein Stück näher als der Rest der Welt. Für mich stand fest: Das Böse würde sich hierher in diese heile Welt nicht trauen. Es war, so erklärte ich es mir später und erwachsener geworden, als würde von der Verehrung der Menschen, von den vielen Gebeten eine große Kraft ausgehen. Ich spürte sie förmlich, diese spirituelle Kraft, die der heilige Ort auszustrahlen schien. Die Ruhe hier ließ die hohen, hellen Räume mit den kunstvollen Deckengemälden und dem goldenen Stuck noch majestätischer erscheinen. Der Heilige Vater mit seiner würdevollen, ruhigen und bedachten Art tat ein Übriges dazu. Er schien der von Gott Auserwählte zu sein, gewappnet, um alle Probleme dieser Welt zu lösen.
An Ostern erteilte der Papst den Segen urbi et orbi, der Stadt Rom und dem Erdkreis. Er stand dabei auf der Benediktionsloggia der Peterskirche. Auf dem großen Platz davor drängten sich die Menschen dicht an dicht, ein Meer an Köpfen, eine Masse, in der der Einzelne nicht mehr zu erkennen war. Es berührte mich zutiefst, welche Verehrung und Hingabe ihm das Volk entgegenbrachte, ja, es erstaunte mich jetzt, wo ich den Menschen in ihm sah, meinen Ziehvater, nicht nur den Papst und Stellvertreter Christi auf Erden. Ich behielt die Menge im Blick, und irgendwann ging mir auf, dass ich Ausschau nach meinen Eltern und meinen Geschwistern hielt. Würde ich sie vielleicht doch zufällig irgendwo entdecken können? Nein, es war nicht möglich in dieser Menschenmenge, so sehr ich mich auch anstrengte.
»Ich möchte meine Mutter besuchen«, sagte ich zu Giovanni, der neben mir stand. Wie immer wirkte er, schlank und rank, wie er war, zugleich würdevoll und seltsam unscheinbar in seiner schwarzen Kleidung. Giovanni schaute mich mitleidig an und berührte fast zärtlich meine Haare.
»Das geht leider nicht, Antonia. Der Heilige Vater wünscht es so. Er sagt, Sie könnten sich besser auf Ihre spätere Aufgabe vorbereiten, wenn Sie keinen Kontakt mehr mit Ihrer Familie haben. Es würde Ihren Geist vielleicht zu sehr ablenken und verwirren.«
Ich verstand nicht, was er mir damit bedeuten wollte, aber ich wiederholte meine Bitte auch nicht mehr. Den Stich im Herzen, den ich damals verspürte, vergaß ich schnell, oder bildete es mir zumindest ein, indem ich das Gepränge der Osterfeierlichkeiten verfolgte, die Pracht der geistlichen Gewänder, Fahnen und goldglitzernden Kreuze, die festlich gekleidete Menge, die Weihrauchschwaden, die gen Himmel stiegen.
Eines Tages bat mich der Heilige Vater zu sich in seine Privatgemächer und bedeutete mir wieder, auf dem Sofa an dem runden Tisch Platz zu nehmen. Er setzte sich zu mir und erkundigte sich, wie so oft, nach meinem Wohlergehen und nach meinen Fortschritten beim Lernen. Eine gute Bildung, sagte er zum wiederholten Male, sei ihm sehr wichtig. Höflich und schüchtern antwortete ich auf seine Fragen. Da legte er seine Hand auf mein Knie und berührte sanft meine Wange und, für mich völlig überraschend, griff er nach meiner Brust, was mich sehr in Verlegenheit brachte. Mit leiser Stimme begann er zu sprechen:
»Ich bin zu schwach, Antonia, um Ihrer Schönheit zu widerstehen.«
Mir war unbehaglich zumute, ich wusste nicht, was nun zu tun sei, also blieb ich wie angewurzelt sitzen. Vielleicht bemerkte er meinen Schrecken, denn, ebenso unerwartet, ließ er in diesem Moment auch schon wieder von mir ab und schickte mich zu meinem Hauslehrer. Doch der Vorfall wiederholte sich einige Wochen später. Dieses Mal bot mir der Heilige Vater Gebäck und welch ein Luxus! heiße Schokolade an und erkundigte sich nach den Fortschritten meines Studiums. Wie immer antwortete ich ihm ausgesucht höflich, und er verwickelte mich in ein Gespräch über Belanglosigkeiten. Sein Gesicht erhellte ein Lächeln. Auf einmal glitt seine Hand auf mein Knie, dann unter meine Röcke. Vielleicht, weil ich es geschehen ließ, erschrocken wie ich war, packte er mich und versuchte ungeschickt mein Kleid zu öffnen. Schließlich verlor er die Geduld, schob einfach meine Röcke nach oben und nahm mir die Unschuld. Obwohl es schmerzte, wollte mir kein Laut über die Lippen kommen. Sie blieben mir alle in der Kehle stecken. Es ging alles sehr schnell. Ich wusste nicht so recht, wie mir geschah.
Als alles vorbei war, sagte er zu mir:
»Sie werden in Zukunft noch öfter dem Heiligen Vater die verbotenen Früchte der Lust schenken. Aber Sie dürfen mit niemandem darüber sprechen, hören Sie? Mit niemandem, es soll ein Geheimnis bleiben!«
Völlig verstört lief ich in meine Gemächer, überwältigt von Scham- und Schuldgefühlen. Was er getan hatte, schmerzte mich körperlich und seelisch. Obendrein machte es mir große Angst. In der folgenden Nacht lag ich wach, weinte und rief leise nach meiner Mutter. Ich hatte sie nie wieder gesehen, seitdem mich die päpstlichen Boten abgeholt hatten. Ich war einsam, so schrecklich einsam und völlig verängstigt. Aber meine Mutter, sie hatte mich ja hierher gegeben! Sie hatte dem allen also zugestimmt. Sie musste es doch gewusst haben, sie war nicht so unerfahren, wie ich es gewesen war. Warum kam sie mich nie besuchen? Hatte sie mich vergessen? Hatte sie mich loswerden wollen? Ich weinte die ganze Nacht, bis ich vor Erschöpfung einschlief.
Bald nannte man mich im Apostolischen Palast seine >Gesellschafterin<. Es war meine Aufgabe, den Heiligen Vater angenehm zu unterhalten und kleinere Arbeiten für ihn zu erledigen. Selbst Schreibarbeiten teilte er mir manchmal zu. Er ließ mich nun öfter zu sich rufen. Offiziell speiste der Papst immer allein, so war es Brauch. Aber in Wahrheit leistete ich ihm bei vielen Gelegenheiten Gesellschaft, während er seine Mahlzeiten einnahm und durfte mit ihm essen. Es gab Rebhuhn, Meeresfrüchte, Wein und andere Köstlichkeiten, und von allem immer mehr als genug. Manchmal, wenn er nach mir rufen ließ, lag er im Bett. Das Bett des Heiligen Vaters war breit und besaß einen Baldachin aus schwerem Stoff, der von gedrechselten Säulen aus dunklem Holz getragen wurde. Weil Baldachin und Vorhänge in der gleichen Farbe wie die Wände waren, verschmolz das Bett mit diesen, als wäre alles eins, und so fühlte es sich für mich auch an: Gemächer und Bett eins. Auch im Bett blieb der Heilige Vater würdevoll und ernst, auch wenn er nur mit einem weißen Nachthemd aus Leinen bekleidet war. Er war nett zu mir. Jedes Mal, wenn ich zu ihm ins Bett steigen musste, machte er mir Komplimente und liebkoste mich. Ich fand bald, dass es doch gar nicht so schlimm war, zu ihm gerufen zu werden. Ich nahm mir jedenfalls vor, es nicht mehr schlimm zu finden. Der Heilige Vater freute sich doch immer so sehr, wenn ich zu ihm kam. Hätte ich sonst all die ausgesucht hübschen Dinge und die Aufmerksamkeit bekommen, mit denen er mir doch zeigte, dass ich etwas ganz Besonderes für ihn war?
Kapitel 4
Die Flucht
Es gab Augenblicke, da fühlte ich mich unglaublich einsam. Ich lebte in Prunk und Luxus, aber ich lebte in einem Elfenbeinturm. Diese Metapher hatte ich zuvor gelesen. Gemeint waren Dichter, Philosophen oder Künstler, die sich selbst von der Welt zurückzogen. Auf Anhieb hatte ich mich darin wiedererkannt. Mein Lebensmittelpunkt war Papst Pius, meine einzige Aufgabe, für ihn begehrenswert zu sein, ihn angenehm zu unterhalten. Besonders hart traf mich, dass ich gezwungen war, im Verborgenen zu leben. Niemand durfte von mir, vom Verhältnis des Papstes zu mir erfahren. Niemand durfte wissen, dass ich etwas Besonderes war. Ich lebte in einer beklemmenden Welt der Männer und der Scheinheiligkeit, die mich damals irritierte, die ich aber nicht zu benennen wusste. Es gab keine anderen Menschen außer dem Papst, meinen Lehrern und den Bediensteten, mit denen ich Kontakt hatte. Manchmal dachte ich, ich würde nicht wirklich etwas da draußen in der kalten, rauen Welt verpassen, die mich ohnehin nicht besonders reizte. In solchen Momenten war ich froh über die Geborgenheit, die mir mein Elfenbeinturm schenkte. Manchmal aber packte mich der Durst nach Leben, nach Abenteuern, nach Reisen in fremde Länder, nach neuen Erfahrungen. In mir brannte die Sehnsucht nach einem eigenen Leben, das weiß ich heute.
Im Sommer residierte der Papst im Quirinalspalast. Dieses Jahr sollte ich ihn dorthin begleiten und freute mich über die willkommene Abwechslung. Nachdem er aufgebrochen war, sollte ich zusammen mit Maria und einer anderen Frau in einer Kutsche unauffällig folgen. Zwei Kutschentruhen hatte ich gepackt, darin waren Kleidung und viele Bücher. Der Kutscher lud sie uns auf. Dann ging es zügig durch die vor Leben pulsierende Stadt. Ich hörte Kinder schreien, sah Frauen mit ihren Einkäufen nach Hause gehen und Händler ihre Ware feilbieten. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel, als wir uns der Sommerresidenz näherten. Von weitem sah ich zwei monumentale Standbilder vor dem Palast stehen, die ihre scheuenden Pferde im Zaum hielten. Später erklärte man mir, dass sie die mythologischen Zwillinge Castor und Pollux darstellten und ursprünglich aus einem alten römischen Tempel stammten. Man wies mir ein schönes, sonniges Zimmer in einem ruhigen Winkel des Palastes an. Wenn ich aus dem Fenster schaute, sah ich hinaus auf die Gartenanlage. Wie in einem Märchen erschien mir diese, wunderbar, verlockend und geheimnisvoll zugleich. Ich erkundete den Palast, lief durch Gänge und Flure, gelangte in den großen Innenhof des Quirinale. Auf einem der Flure begegnete mir eine Dame in ausgefallen vornehmer Kleidung. Sie trug eine Robe à la Polonaise, die Raffungen der Röcke, die dafür üblich waren, waren auffallend verziert mit Blumen aus Seide. Besonders fiel mir der riesige Hut ins Auge. Noch auffallender aber als Kleidung und Hut war ihr Betragen, als ziele alles nur darauf ab, möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie schien genau zu wissen, wohin sie wollte, als sei sie nicht zum ersten Mal hier. Sie betrat einen großen, hellen Raum, in dem der Heilige Vater sich gerade aufhielt, ohne sich anmelden zu lassen, und schloss hinter sich die Tür. Drinnen hörte man Stimmen. Aus dem Schatten einer Nische trat jemand auf mich zu, an den langen Beinen und Armen unschwer als Giovanni zu erkennen. Es war, als hätte er sich rasch und diskret vor der Dame zurückgezogen, war jetzt aber bereit, Diskretion Diskretion sein zu lassen.
»Wissen Sie, wer das ist?«
Verschwörerisch senkte er die Stimme, war aber eindeutig mitteilsam am heutigen Tag.
»Das ist die Donna Giulia Falconieri. Sie ist eine geborene Melini und Alleinerbin des gesamten Familienvermögens, da es keinen männlichen Erben gab. Sie besitzt neben der Villa ihrer Familie also auch noch viel Geld. Regelmäßig gibt sie Gesellschaften, zu denen Prälaten, Kardinäle und Gelehrte sich ein Stelldichein geben. Der Heilige Vater besuchte sie schon bei seinen früheren Aufenthalten in Rom, als er selber noch Prälat war.«
In diesem Moment ging die Tür auf, und der Heilige Vater winkte mir lächelnd zu.
»Antonia, kommen Sie, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen.«
Verwundert und dementsprechend schüchtern betrat ich den Raum. Es war mir so sehr zur Natur geworden, mich vor fremden Augen verborgen zu halten, dass ich überhaupt nicht damit umgehen konnte, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, nun, wo ich einer Fremden vorgestellt würde.
Der Papst lächelte.
»Dies ist Giulia Falconieri, die Mutter meiner zukünftigen Nichte und eine sehr gute Freundin von mir. Giulia, dies ist Antonia. Ich habe sie bei mir aufgenommen und möchte sie in ganz besonderer Art und Weise fördern.«
Die Dame musterte mich eingehend und antwortete dann: »Außergewöhnlich hübsch ist sie, aber noch sehr jung.«
Der Heilige Vater lächelte sie vielsagend an. Mir erschien das Ganze sonderbar. Ich war allerdings noch viel zu jung und unbedarft, um mir über solche Dinge lange Gedanken zu machen. Mich lockte momentan der schöne Garten mehr, der mir wie ein verwunschener Ort aus einem Märchen erschien, und die Sonne und die Weite des Horizonts. Ich lebte gern in meiner eigenen Welt, eine verborgene, geheimnisvoll-mystische Welt zum Greifen nah was kümmerten mich da die Damen der römischen Gesellschaft?
Der Heilige Vater fing meinen Blick hinaus zum Fenster auf und lächelte.
»Möchten Sie in den Garten, Antonia?«
»Ja, das würde ich gern.«
»Na, dann laufen Sie!«
Ich verabschiedete mich mit einem höflichen Knicks und lief hinaus. Unter einer Palme ließ ich mich ins Gras sinken und blinzelte in das Sonnenlicht. Ich spürte die Sonne auf meiner Haut. War das Leben nicht wundervoll?
Doch die Gärten des Quirinalspalasts waren längst nicht der einzige wunderbare Ort. Die Stadt Rom war voller Mystik, voller Geheimnisse. Übers ganze Jahr verteilten sich religiöse Feste und Feiertage, immer wieder konnte man einer Prozession beiwohnen. Ein Fest aber sollte mir ein Leben lang in besonderer Erinnerung bleiben, ich liebte es bald mehr als Ostern und Weihnachten. Es war das Fest Mariä Schnee, das am fünften August gefeiert wurde. Zur Muttergottes betete ich besonders gern, und die Feste ihr zu Ehren waren mir wichtig, dieses aber mochte ich mehr als alle anderen. Vom Quirinalspalast aus war es nicht weit zur Basilika Santa Maria Maggiore, man konnte den Weg dorthin bequem zu Fuß zurücklegen. Sie war die größte und älteste von den der Gottesmutter geweihten Kirchen Roms. Das Fest erinnerte an das Schneewunder, das die heilige Jungfrau einst in Rom gewirkt hatte. Sie war, so die Legende, im Traum gleichzeitig einem reichen Ehepaar, das sich nicht entscheiden konnte, sein Vermögen der Kirche oder den Armen zu stiften, und dem damaligen Papst Liberius erschienen. Sie hatte ihnen bedeutet, an der Stelle eine Kirche zu bauen, an der am folgenden Tage im August Schnee fallen würde. Wie gebannt saß ich während der Heiligen Messe in der Basilika auf der Kirchenbank, links neben mir Giovanni und rechts neben mir Maria. Dann passierte es: Von der Decke, direkt vor dem Altar der Papstbasilika, fielen weiße Rosenblätter hernieder, die an Schnee erinnerten. Es war ein fantastisches Schauspiel, während von draußen durch die hohen Fenster Sonnenlicht von der satten Wärme des Sommers in die Kirche fiel. Ich seufzte vor Rührung, und auch Maria schien ähnlich zu empfinden: Sie konnte die Tränen kaum zurückhalten. Wir sahen uns an und verstanden: Es gab Dinge, die konnte der Verstand nicht fassen, nur das Herz konnte sie begreifen. Gemeinsam kehrten wir zur päpstlichen Sommerresidenz zurück.
In diesem ersten Sommer im Quirinal beachtete mich der Heilige Vater kaum. Er empfing Damen und Herren aus der adeligen römischen Gesellschaft und ging auf die Vogeljagd. Als Kirchenfürst liebte auch er herrschaftliche Hofhaltung und aristokratisches Gebaren. Er präsentierte sich seinen adeligen Gästen obendrein gern als ihresgleichen und als gebildeter und weltgewandter Kunstmäzen. Besonders liebte er die Kunst der Renaissance, für die er große Summen ausgab. Die Mitglieder der Kurie, all die Männer, die tragende Positionen in der Kirche innehatten, hielten sich nicht im Quirinalspalast auf. Schließlich diente dieser dem Papst als Residenz in seiner Eigenschaft als Oberhaupt des Kirchenstaates, während der Apostolische Palast die Residenz des Papstes als Oberhaupt der Heiligen römischen Kirche war. Im Quirinale gab es nur Dienerschaft und päpstliche Leibgarde. Die Atmosphäre war anders hier, freier als im Apostolischen Palast. Ohne viel darüber nachzudenken, begann ich auf einem meiner Spaziergänge durch die Gärten zu laufen. Ich wollte endlich frei sein, frei von all den Zwängen und Einschränkungen, die mir auferlegt wurden. Ich lief und lief, ohne nachzudenken, von Neugier getrieben. Ich lief durch den Garten, der mich so magisch anzog, aber auch er war begrenzt. Ich lief weiter, lief einfach drauf los, ohne zu wissen wohin, die Straße entlang. Kutschen rumpelten mir entgegen; in der Gasse, der ersten, die mich vom Palast wegführte, roch es unangenehm. Frauen in einfachen grauen Kleidern, noch schlichter als die, die meine Mutter immer getragen hatte, begegneten mir, auf dem Kopf ein weißes Häubchen, in den Händen leere Körbe. Sie wirkten gehetzt und redeten laut aufeinander ein. Dann sah ich zwei Männer, die versuchten, einen mit Weinfässern beladenen Eselkarren durch die enge Gasse zu treiben. Der eine Mann schrie laut und schlug dabei auf den unwilligen armen Esel ein. Am Ende der Gasse gelangte ich auf einen Platz. Hilfe suchend schaute ich mich um, ich wusste nicht genau, wo ich mich befand. Macht nichts, dachte ich mir und entschied mich, dem rechten Weg zu folgen. Ich schaute in einen dunklen Hausflur, hörte lautes Stimmengewirr auf der Straße. Alle schienen in Eile zu sein, die ganze Stadt schien rastlos.
»Wohin des Wegs, meine Kleine?«
Ein Mann stand vor mir und grinste mich an. Ich schaute ihn an und wollte an ihm vorbei, doch er vertrat mir den Weg.
»Bleib doch stehen, meine Schöne!«
Der Mann lachte laut, und ich sah, wie nun drei andere Männer sich ebenfalls zu mir umwandten. Ihre Gesichter waren von der Sonne gebräunt, sie trugen schmutzige Kleidung und verschlissene Mützen auf dem Kopf. Sie kamen näher, was ich sofort als bedrohlich empfand, und lachten ebenfalls. Mit einem Mal war ich von Männern umringt und wusste instinktiv, dass sie es genossen, mir Angst einzujagen.
»Schöne, gibt mir einen Kuss!«, rief der eine Mann und spitzte in einer unmissverständlichen Geste die Lippen. Eine dicke Frau, eine echte Matrone, kam vorbei und rief den Männern zu: »Lasst doch die Kleine in Ruhe, ihr unnützes Pack!«
»Halt’s Maul, du Kuh, sonst bist Du als Erste dran!«, raunte einer der Männer ihr zu, die anderen lachten. Die Frau schimpfte laut vor sich hin, lamentierte, dass die Zustände immer schlimmer würden und die Polizei gar nichts dagegen unternehme, man könne sie getrost vergessen, diese Polizei von Rom. Dann ging sie davon. Ich hatte gehofft, den Moment nutzen und fliehen zu können, aber einer der Männer hatte wohl meine Absicht erraten und vertrat mir wieder den Weg.
»Halt, nicht so schnell. Wir haben noch etwas vor mit dir.«
Wieder lachten die Männer in widerwärtiger Art. Einer trat vor und griff nach mir. Energisch stieß ich ihn weg und verschränkte die Arme vor der Brust. Als wollten sie ihn anfeuern, drängten nun auch die anderen drei Männer auf mich zu. Sie rochen stechend nach Schweiß. Ich schaute mich um, aber niemand kam mir zur Hilfe. Niemand nahm Notiz von mir. Gleich würden sie sich auf mich stürzen. Wieder dieses furchtbare Gelächter. Angst schnürte mir die Kehle zu. Einer der Männer kam jetzt so nahe, dass ich seinen üblen Atem riechen konnte, in der Hand hielt er ein Messer. Er stellte einen Fuß direkt zwischen meine Füße. Jeden Augenblick würden sie über mich herfallen, mich vergewaltigen oder sogar töten. Ich schloss die Augen und betete innerlich zur Jungfrau Maria. Mein ganzes Herz rief nach ihr.
»Oh Muttergottes, hilf mir!«, kam es dann auch laut über meine Lippen. In dem Moment hörte ich das Klirren einer Klinge, starke Hände packten mich an den Armen. Ich riss die Augen auf, aber die Hände, die mich hielten, steckten nicht in schmutzigen Ärmeln, sondern in den blau-gelb-rot gestreiften Uniformen der Schweizer Garde, der päpstlichen Leibgarde. Drei der Angreifer hatten wohl, als die beiden Gardisten eingriffen, das Weite gesucht, der letzte schwang noch einmal drohend sein Messer, bevor auch er flüchtete. Meine beiden Retter in den bunten Uniformen trugen einen breiten Ledergürtel und einen Degen; auf ihren Köpfen saßen blaue, flache Mützen. Schweigend geleiteten sie mich zum Papstpalast zurück, hinauf bis vor das Arbeitszimmer Seiner Heiligkeit. Ich wusste, was mir bevorstand. Der Heilige Vater würde sehr böse auf mich sein. Schuldbewusst und voller Angst betrat ich den Raum. Mein Hals war wieder wie zugeschnürt. Pius ging aufgebracht im Raum auf und ab. Ohne abzuwarten, dass er das Wort an mich richtete, sank ich vor ihm auf die Knie.
»Verzeihen Sie mir, Heiliger Vater! Ich wollte Sie nicht erzürnen. Es ist nur … ich wollte einfach die Stadt kennenlernen. Ich verstehe es selber nicht.«
Der Heilige Vater sah mich unverwandt an, reagierte mit einer Kälte, die mir an ihm neu war.
»Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte nicht, dass Sie allein umherstreifen wie jemand aus dem Gesinde. Rom ist gefährlich. Hier gibt es viele Halunken und Männer mit Waffen. Ich weiß, wovon ich spreche!«
Niedergeschlagen verließ ich den Papst und ging hinauf auf mein Zimmer.
Giovanni betrat den Raum, kaum dass ich dort angekommen war.
»Tun Sie das bitte nicht wieder, Signorina. Wo wollten Sie denn nur hin? Jetzt packen Sie bitte Ihre Sachen, Maria wird gleich kommen und Ihnen helfen. Denn ich soll Sie zurück in den Apostolischen Palast bringen.«
Ich war erschrocken, so bestraft zu werden, und wütend darüber, dass Giovanni mit mir sprach wie mit einem dummen Kind, aber ich biss mir auf die Lippen und sagte keinen Ton. Gemeinsam mit Giovanni bestieg ich die Kutsche, die mich zurück in den Apostolischen Palast brachte. Nie wieder nahm der Heilige Vater mich mit in seine Sommerresidenz. Ich musste fortan im Sommer, unter Aufsicht des Personals, im Apostolischen Palast bleiben. Die unerfreuliche Begegnung in der Gasse war mir eine Lehre: Niemals wieder versuchte ich fortzulaufen. Ich hatte mein Schicksal angenommen.
Kapitel 5
Dunkle Prophezeiung
Auf Sommer folgte Winter, auf Winter Frühling, drei Jahre vergingen, vier. Der März dieses vierten Jahres brachte eine große Veränderung, die ich in ihrer Tragweite erst nicht begriff, vielleicht damals 1779 da war ich gerade einmal fünfzehn, kein Kind mehr und trotzdem noch lange keine erwachsene Frau – auch nicht begreifen konnte. Der Heilige Vater erkrankte. Ich erschrak über die Maßen, obwohl ich, so jung wie ich war, in ihm einen alten Mann sah; er war damals einundsechzig Jahre alt. Ich erschrak vor allem, das weiß ich heute besser als damals, weil ich mir nicht eingestehen wollte, wie abhängig ich von ihm war, dem alten Mann, der nun krank, sterben könnte. Und seine Erkrankung schien mir dramatisch. Seine Fingergelenke schwollen an und röteten sich, alles das Zeichen einer Entzündung. Vor allem morgens nach dem Aufstehen konnte er sich kaum bewegen. Es machte ihn wütend und ungehalten, denn er fühlte sich eingeschränkt in seiner Arbeit und seinem Tagesablauf, und anders als zuvor ließ er seine Ungeduld auch an anderen aus. Seine Stimmungen wechselten, er schien nicht ein Mann, sondern zwei, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Anfangs waren wir noch zuversichtlich, seine Gesundheit würde sich bald wiederherstellen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























