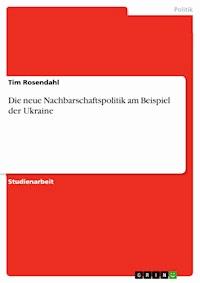Die Mediatisierung im Jugendalter. Konsequenzen für Schule und Unterricht durch die neue Mediennutzung Jugendlicher E-Book
Tim Rosendahl
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pädagogik - Medienpädagogik, Note: 1,1, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: „Die mit dem Schlagwort Globalisierung oder dem Wandel von der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft erfassten Veränderungen lassen Kinder und Jugendliche heute in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft aufwachsen“ (Busse 2002, S. 7). Eine bedeutende Stellung nehmen hierbei die Medien, vor allem aber die neuen Medien, ein, die einen enormen Wandel in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bewirkt haben und immer noch bewirken. So wurden, zum Beispiel durch die Einführung des Computers, Berufe verändert, zum Teil entfielen sie einfach, viele andere wurden dafür aber neu erschaffen. Doch nicht nur die Arbeitswelt wird durch die neuen Informationstechnologien verändert, auch alle andere Lebensbereiche werden beeinflusst. Der richtige Umgang mit neuen Medien ist somit eine wichtige Schlüsselqualifikation für die Zukunft, wodurch vor allem die Jugendlichen in den Vordergrund gerückt werden. Die Medien gehören heute bereits zum Alltag der Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund kommt der Institution Schule eine zentrale Aufgabe zu, indem sie die Vermittlung der Schlüsselqualifikationen sicherstellt und die neuen Medien in das Bildungssystem integriert. Die Schule bleibt auch in der Zeit der Informations- und Wissensgesellschaft der zentrale Ort des Lernens. Medienverwendung, Medienerziehung und Medienbildung müssen sich somit an dem allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule orientieren (Tulodziecki 2005, S. 368), das heißt die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, ihr Leben selbst bestimmend zu gestalten, sich ihrer Mitbestimmung in der Gesellschaft und der Politik bewusst zu sein und sozialverträgliches Handeln ermöglichen. Dies alles schließt jedoch einen kritischen Umgang mit den Medien mit ein. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Schule Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt bekommen, die es ihnen erlauben mit Medien sachgerecht, selbst bestimmt, kreativ und sozial verantwortlich umzugehen. In diesem Rahmen kommen auf Schule und Unterricht folgende Anforderungen zu (Tulodziecki/ Herzig 2002, S. 8): • Nutzung von Medien für Lernen und Lehren, • Wahrnehmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienbereich, • Gestaltung medienpädagogischer Konzepte in der Schule. Auf Grund dieser Anforderungen stellt sich die Frage, wie die Schule diesen gerecht werden kann. Doch bevor man darauf näher eingehen kann, müssen noch einige Vorüberlegungen getätigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Der Medienbegriff
2.1 Die traditionellen Medien in Gesellschaft und Schule
2.2 Die neuen Medien in Gesellschaft und Schule
2.3 Die Medientheorien
3. Jugend und Medien
4. Die Medien - Möglichkeiten und Gefahren
4.1 Möglichkeiten der neuen Medien
4.2 Gefahren der neuen Medien
4.2.1 Abhängigkeit
4.2.2 Verlust von sozialer Kompetenz und sozialem Verhalten
4.2.3 Wirklichkeitsverlust
4.2.4 Die offenen Gefahren der neuen Medien
5. Medienpädagogik
5.1 Medienerziehung
5.1.1 Konzepte der Medienerziehung
5.1.2 Aufgaben der Medienerziehung
5.1.2.1 Medienkunde
5.1.2.2 Mediennutzung
5.1.2.3 Mediengestaltung
5.1.2.4 Medienliteralität, Medienanalyse und Medienkritik
5.2 Mediendidaktik
5.2.1 Tendenzen innerhalb der Mediendidaktik
5.2.2 Mediendidaktische Ansätze
5.2.3 Konzepte der Mediendidaktik
6. Medienkompetenz als Grundvoraussetzung zur Mediennutzung
6.1 Definitorische Abgrenzung und Theorie der Medienkompetenz
6.2 Kompetenzen des Lesens, Schreibens und der Kommunikation
6.3 Unterschiedliche Ansätze zur Medienkompetenz
6.3.1 Medienkompetenz nach Bernd Schorb
6.3.2 Medienkompetenz nach Dieter Baacke
6.3.3 Medienkompetenz nach Ida Pöttinger
6.4 Medienkompetenz als Bildungsziel
6.5 Vermittlung von Medienkompetenz
7. Die Medien - Konsequenzen für Schule und Unterricht
7.1 Medien als Lerninstrumente
7.2 Die Rahmenbedingungen
7.3 Anforderungen an Schule und Unterricht
7.3.1 Nutzung von Medien für das Lernen und Lehren
7.3.2 Wahrnehmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben
7.3.3 Gestaltung medienpädagogischer Konzepte
7.4 Konsequenzen für die Lehrerbildung
7.5 Chancen und Grenzen der schulischen Medienerziehung
7.5.1 Chancen des Medieneinsatzes
7.5.2 Risiken und Grenzen des Medieneinsatzes
7.6 Ausblick und Forderungen
8. Fazit und Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
10. Anhang
1. Einführung
„Die mit dem Schlagwort Globalisierung oder dem Wandel von der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft erfassten Veränderungen lassen Kinder und Jugendliche heute in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft aufwachsen“ (Busse 2002, S. 7). Eine bedeutende Stellung nehmen hierbei die Medien, vor allem aber die neuen Medien, ein, die einen enormen Wandel in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bewirkt haben und immer noch bewirken. So wurden, zum Beispiel durch die Einführung des Computers, Berufe verändert, zum Teil entfielen sie einfach, viele andere wurden dafür aber neu erschaffen. Doch nicht nur die Arbeitswelt wird durch die neuen Informationstechnologien verändert, auch alle andere Lebensbereiche werden beeinflusst. Der richtige Umgang mit neuen Medien ist somit eine wichtige Schlüsselqualifikation für die Zukunft, wodurch vor allem die Jugendlichen in den Vordergrund gerückt werden.
Die Medien gehören heute bereits zum Alltag der Jugendlichen. Deutlich wird dies zum Beispiel durch die stetig steigenden Nutzerzahlen des Internets. So haben in Deutschland 1997 nur 4,11 Mio. (Eimeren 2001, S. 383) Menschen das Internet für sich genutzt. Innerhalb von vier Jahren hat sich diese Zahl der Nutzer versechsfacht. 2001 nutzten somit 24,77 Mio. (Eimeren 2001, S. 383) Bundesbürger das Internet. Im ersten Quartal 2004 (Statistisches Bundesamt 2005a) waren es bereits etwa 42 Mio. Menschen, die das Internet für private oder berufliche Zwecke nutzten. Dies bedeutet fast eine Verzehnfachung der Internetnutzung im Vergleich zu 1997. Dabei ist die Internetnutzung aber immer noch stark altersabhängig. So waren 2004 86% der 10- bis 24-Jährigen online, dem gegenüber aber nur 22% der über 54-Jährigen. Betrachtet man im ersten Quartal 2004[1] (Statistisches Bundesamt 2006) die Internetnutzung der Schülerinnen und Schüler, so nutzten 93% der ab 15-Jährigen das Internet. 70% gaben an, das Internet für Bildungszwecke zu nutzen. Bei den Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 14 Jahren lag die Internetnutzung insgesamt bei 75%, wobei 48% das Internet für Bildungszwecke nutzten (Statistisches Bundesamt 2005b, S. 36-37). Die Nutzung des Internets bei den 10- bis 49-Jährigen ist nicht mehr geschlechtsspezifisch bzw. spielt nur noch eine untergeordnete Rolle[2]. So nutzten Männer und Frauen in diesem Altersbereich das Internet in gleichem Maße. Erst im höheren Alter wird die Nutzung geschlechtsspezifisch. Ab 54 Jahren nutzen etwa 30% der Männer das Internet, aber nur 15% der Frauen (Statistisches Bundesamt 2005a). In unserem Zusammenhang sind vor allem die Zahlen der 10- bis 24-Jährigen von Bedeutung. Sie zeigen deutlich, dass das Medium Internet einen wichtigen Bezugspunkt für diese Altersgruppe darstellt. Am Beispiel der Internetnutzerzahlen wird damit deutlich, in welchem besonderem Maße die Jugendlichen von den Medien Gebrauch machen.
Vor diesem Hintergrund kommt der Institution Schule eine zentrale Aufgabe zu, indem sie die Vermittlung der Schlüsselqualifikationen sicherstellt und die neuen Medien in das Bildungssystem integriert. Die Schule bleibt auch in der Zeit der Informations- und Wissensgesellschaft der zentrale Ort des Lernens. Medienverwendung, Medienerziehung und Medienbildung müssen sich somit an dem allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule orientieren (Tulodziecki 2005, S. 368), das heißt die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, ihr Leben selbst bestimmend zu gestalten, sich ihrer Mitbestimmung in der Gesellschaft und der Politik bewusst zu sein und sozialverträgliches Handeln ermöglichen. Dies alles schließt jedoch einen kritischen Umgang mit den Medien mit ein. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Schule Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt bekommen, die es ihnen erlauben mit Medien sachgerecht, selbst bestimmt, kreativ und sozial verantwortlich umzugehen. In diesem Rahmen kommen auf Schule und Unterricht folgende Anforderungen zu (Tulodziecki/ Herzig 2002, S. 8):
· Nutzung von Medien für Lernen und Lehren,
· Wahrnehmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Medienbereich,
· Gestaltung medienpädagogischer Konzepte in der Schule.
Auf Grund dieser Anforderungen stellt sich die Frage, wie die Schule diesen gerecht werden kann. Doch bevor man darauf näher eingehen kann, müssen noch einige Vorüberlegungen getätigt werden.
Der Begriff Medien ist ein sehr schwammiger Begriff und bedarf für die nachfolgenden Überlegungen einer genaueren Abgrenzung und Definition (Kapitel 2).
Die Bestimmung der Jugend und die Bedeutung der Medien werden in Kapitel 3 näher betrachtet und was man unter dem Begriff der Mediatisierung zu verstehen hat.
Viele Jugendliche verwenden die Medien schon heute sehr selbstverständig und haben dadurch Möglichkeiten für sich entdeckt, diese für sich zu nutzen, allerdings setzen sie sich damit auch gewissen Gefahren aus, die ihnen vielleicht auf den ersten Blick nicht einleuchtend erscheinen (Kapitel 4).
Auch die Institution Schule muss sich dieser Gefahren und Möglichkeiten bewusst werden, denn nur vor diesem Hintergrund kann man mit Hilfe der Medienpädagogik und ihrer Teildisziplinen, die in Kapitel 5 näher betrachtet werden, Konzepte für Schule und Unterricht entwickeln, die auch vor diesen Gefahren schützen sollen.
Einer der wohl wichtigsten Begriffe, der im Zusammenhang mit der Medienpädagogik und deren Teildisziplin Mediendidaktik einhergeht und ein wichtiges Konzept für Schule und Unterricht darstellt, ist die Medienkompetenz. Doch auf Grund der vielseitigen Verwendung des Begriffs ist es auch hier, wie bei dem allgemeinen Begriff der Medien, nötig, die Theorie der Medienkompetenz genau zu beleuchten und abzugrenzen (Kapitel 6).
Nach diesen Vorbetrachtungen und Grundlegungen ist es nun möglich die Anforderungen und Konsequenzen für Schule und Unterricht genauer zu untersuchen (Kapitel 7).
2. Der Medienbegriff
Der Medienbegriff ist ein sehr schwer zu fassender Begriff. Im Laufe der Zeit kamen immer neue Innovationen hinzu, die den Medienbegriff immer größer und undurchsichtiger werden ließen. Die Gesellschaft betrachtet den Begriff Medien häufig als Synonym für die Massenmedien Printmedien, Rundfunk und Fernsehen. Doch aus wissenschaftlicher Sicht werden andere Trennlinien geschaffen, obwohl auch innerhalb der Wissenschaft die Medien auf unterschiedlichste Weise differenziert werden. So unterscheiden Kommunikationswissenschaftler die Medien in primäre (ohne Nutzung von Medien), sekundäre (eine Person benutzt ein Medium) und tertiäre (beide Kommunikationspartner verwenden die Medien) Medien, während eher technische basisierte Wissenschaften eine Einteilung in Speicher-, Übertragungs- und Bearbeitungsmedien vornehmen (Barsch/ Erlinger 2002, S. 10). Alle Disziplinen haben jedoch gemeinsam, dass sie die Medien nur als Hilfsmittel bzw. Mittler oder Vermittler (medium, lat.: das Mittlere, Vermittelnde) sehen. Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen ist eine genau Abgrenzung des Begriffs Medien nicht nur wichtig, um sagen zu können, worum es bei dem Begriff überhaupt geht, sondern man legt auch fest, inwieweit der Begriff untersucht werden soll. Indem man die wichtigsten Merkmale festlegt, können dann auch zum Beispiel pädagogische Konsequenzen daraus gezogen werden. In den letzten Jahren hat sich die Funktion der Medien von einem reinem technischen Verständnis „zu einer Bestimmung als soziale Institution verschoben, womit auch Fragen der politischen und ökonomischen Herrschaft thematisiert werden können“ (Stiehler 2005, S. 305-306). Dies verdeutlicht die höchstbedeutende Relevanz der Medien für alle gesellschaftlichen Bereiche.
Allgemein soll hier ein Medienbegriff verwendet werden, der alle Mittel zur Informationsgewinnung und Kommunikation einschließt. Dies bezieht sowohl vermittelnde als auch technische Aspekte mit ein. Das heißt, es gehören traditionelle Massenmedien genauso wie die neuen Medien Computer, Spielkonsolen oder Mobiltelefone dazu. Geht man von diesem Standpunkt aus, ist es möglich eine Abgrenzung zwischen den traditionellen und neuen Medien herzustellen, auch wenn die Trennlinien mit der Zeit immer mehr ineinander laufen.
2.1 Die traditionellen Medien in Gesellschaft und Schule
Unter traditionellen Medien sollen vor allem die Massenmedien, Printmedien, Fernsehen und Rundfunk gefasst werden. Auch wenn „traditionell“ möglicherweise etwas irreführend ist, so zeugt es nur davon, dass diese schön völlig in der Gesellschaft integriert sind. Sie werden somit nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt, sondern sind ein Teil unseres Lebens mit dem wir uns täglich beschäftigen. Einer der größten Unterschiede liegt zwischen den traditionellen und neuen Medien in der interaktiven Struktur. Während man bei den traditionellen Medien nur selten in deren Struktur und Inhalte eingreifen kann, sind die neuen Medien durch Interaktivität geprägt, das bedeutet, der Nutzer kann den Inhalt der neuen Medien mitbestimmen.
Betrachtet man die traditionellen Medien im Kontext der Schule so sind hier vor allem die Tafel, Hefte und Folien[3] zu nennen. Ein „Merkmal ist die meist analoge Form der Medien, die eine Integration in andere Träger häufig unmöglich macht“ (Busse 2002, S. 14), das heißt, es ist nicht möglich direkt in Kommunikation mit diesen Medien und damit mit anderen Menschen zu treten, sondern es ist nur möglich über sie selbst oder deren Inhalt zu sprechen, was der Aufgabe der Vermittlung und der Informationsgewinnung entspricht.
2.2 Die neuen Medien in Gesellschaft und Schule