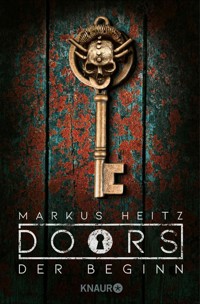12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Meisterin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Artefakt, ein tödliches Bündnis und eine Freundschaft auf dem Prüfstand: Teil 2 der spektakulären Fantasy-Reihe um die Scharfrichter-Dynastien Bugatti und Cornelius von Bestseller-Autor Markus Heitz Die Heilerin Geneve ist die letzte Nachfahrin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius. Als in ihrer Wahlheimat Leipzig eine junge Frau ermordet wird, führt die Spur direkt zu Geneve. Die Ermordete war Mitglied des Londoner Wicca-Covens und extra nach Leipzig gereist, um Geneves Rat einzuholen – offenbar wollte sie die Heilerin zu einer antiken Spiegel-Scherbe befragen. Geneve kontaktiert ihren Freund, den Vatikan-Polizisten Alessandro Bugatti. Gemeinsam versuchen sie, den Mord an der jungen Wicca aufzuklären und Licht in die Hintergründe des Verbrechens zu bringen. Schnell sehen Geneve und Alessandro sich schier übermächtigen Gegnern gegenüber. Um gegen dieses tödliche Bündnis anzukommen, müssen sie einander bedingungslos vertrauen – doch ihrem Feind ist es längst gelungen, in Geneve Zweifel an Alessandros Aufrichtigkeit zu säen. Auch vor hunderten Jahren stand Geneve einst einer mörderischen Kreatur gegenüber, die bis dahin keinen Fuß auf das Festland gesetzt hatte. Hängen Gegenwart und Historie einmal mehr zusammen? »Die Meisterin – Spiegel & Schatten« ist der zweite Roman zum Hörspiel-Erfolg bei Audible – ein rasanter Mix aus düsterer Fantasy mit historischen und Thriller-Elementen. Ihr erstes actiongeladenes Abenteuer bestreiten Geneve Cornelius und Alessandro Bugatti im Dark-Fantasy-Roman »Die Meisterin – Der Beginn«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
MarkusHeitz
Die Meisterin
Spiegel & Schatten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Heilerin Geneve ist die letzte Nachfahrin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius. Als in ihrer Wahlheimat Leipzig eine junge Frau ermordet wird, führt die Spur direkt zu Geneve. Die Ermordete war Mitglied des Londoner Wicca-Covens und extra nach Leipzig gereist, um Geneves Rat einzuholen – offenbar wollte sie die Heilerin zu einer antiken Spiegel-Scherbe befragen.
Geneve kontaktiert ihren Freund, den Vatikan-Polizisten Alessandro Bugatti. Gemeinsam versuchen sie, den Mord an der jungen Wicca aufzuklären und Licht in die Hintergründe des Verbrechens zu bringen.
Schnell sehen Geneve und Alessandro sich schier übermächtigen Gegnern gegenüber. Um gegen dieses tödliche Bündnis anzukommen, müssen sie einander bedingungslos vertrauen – doch ihrem Feind ist es längst gelungen, in Geneve Zweifel an Alessandros Aufrichtigkeit zu säen.
Auch vor hunderten Jahren stand Geneve einst einer mörderischen Kreatur gegenüber, die bis dahin keinen Fuß auf das Festland gesetzt hatte. Hängen Gegenwart und Historie einmal mehr zusammen?
Inhaltsübersicht
Vorwort
DRAMATIS PERSONAE
Fiktionshinweis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Nachwort
Vorwort
Reflexionen im Glas.
Schatten, die dunkler werden, umso heller die Sonne scheint.
Beides sind Abbilder des Menschen, und beide können sehr, sehr unheimlich sein.
Das Thema der Spiegel und Schatten beschäftigt mich schon einige Zeit, und dieses Mal tritt es ins Zentrum. Es ist einfach zu faszinierend, um es nicht aufzugreifen! Für mich ist es die perfekte Kombination.
Außerdem stehen wieder ein paar interessante Details und Historisches rund um das Amt der Scharfrichterinnen und -richter an. Dieses Mal kamen noch einige Anekdoten hinzu, um die Besonderheit dieser Männer und Frauen zu untermauern. Ich gebe zu, dass manche ins Reich des Erdachten gehören, aber auch das macht den Ruf und den Mythos der Zunft aus.
So wünsche ich beste Unterhaltung mit den neusten Abenteuern von Geneve Cornelius durch die Jahrhunderte. In der Vergangenheit der Meisterin lauert eine Gefahr, wie sie sich noch keiner zuvor stellen musste. Eine wahre Herausforderung für eine Wissende wie sie.
Markus Heitz
im Frühjahr 2020
DRAMATIS PERSONAE
Geneve Cornelius: Heilkunde-Expertin
Alessandro Bugatti: Vatikan-Polizist
Giovanni Bugatti: Alessandros Sohn
Giovanna Battista Bugatti: Anführerin der Bugatti-Dynastie
Monsignore Ignatius: Geistlicher & Exorzist
Marian Grey: Wicca des Tamesis-Covens
Willow Tree: Wicca des Tamesis-Covens
Eva Maryam Nives: Willows Zwillingsschwester
Dara Oschatz: Gestaltwandlerin (Wölfin)
William: Gestaltwandler (Wolf)
Archibald Christopher Cavendish: Leftenant des SAS
Prof. Gundel Zastrow: Wissenschaftlerin
Francesco Marco Dal Farra: Spiegelmeister
E. Anders: Rezeptionist
Frau Schätzle: Fremdenführerin in Spiegelberg
Geneve Cornelius: Heilerin
Catharina Cornelius: Geneves Mutter & Meisterin, Anführerin der Cornelius-Dynastie
Jacob Christian Heinrich Cornelius: Geneves Bruder Meister
Amalia: Gestaltwandlerin (Füchsin)
Jonathan Berg: Patrizier
Bhàs: Wesen der Anderswelt
Ferenz Sedra: Vagantenehepaar
Georg Philomena: Liebespaar
Jurko: alter Vagant, auch Bey genannt
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Es gibt keinerlei Ähnlichkeiten zu lebenden oder toten Menschen, und sollte es welche geben, basieren sie auf reinem Zufall und sind nicht beabsichtigt.
Kapitel I
Ich sagte Ihnen einst, dass ich Ihnen eine Geschichte erzählen werde.
Das habe ich getan. Und ich hätte noch eine weitere Episode auf Lager, die ich mit Ihnen teilen würde.
Sollten wir bisher nicht das Vergnügen miteinander gehabt haben: Mein Name ist Catharina Cornelius, und ich bin tot. Mehr brauchen Sie für den Moment nicht zu wissen.
Trafen wir bereits aufeinander, weiß ich nicht, wie viel Zeit genau seit unserer letzten Begegnung vergangen ist. Vielleicht haben Sie sich inzwischen kundig gemacht? Jenseits dessen, was ich Ihnen berichtete.
Über die Wesen der Dunkelheit und jenen Kreaturen, die im Verborgenen lauern.
Über das Gute und das Böse in all seinen Formen und wie sie unter den Menschen wandeln, um ihnen das Leben einmal schwer und einmal leichter zu machen.
Und doch wäre ich fast bereit zu wetten, dass Sie gleich etwas Neues hören werden … über einen alltäglichen Gegenstand.
Beinahe niemand kommt ohne ihn aus – und genau das ist das Perfide.
Oh, machen Sie mir danach bitte keine Vorwürfe, dass Sie nicht mehr ruhig zu Bett gehen könnten! Sie sind gewarnt, und es dient in gewisser Weise auch Ihrem Schutz. Was man kennt, kann man bekämpfen. Eine alte Weisheit, die ihre Gültigkeit im Laufe der Jahrhunderte nicht verloren hat.
Nun denn.
Beginnen wir mit meiner zweiten Geschichte dort, wo auch die erste begann: in Deutschland, in der heutigen Stadt Leipzig.
Sollten sie Klein-Paris, wie Goethe es im Faust nannte, noch nicht kennen, mache ich Ihnen die Orientierung etwas einfacher: Wir verlassen den wunderschönen Hauptbahnhof aus der Gründerzeit, schlendern am über hundert Jahre alten Hotel Astoria vorbei und bewegen uns auf eines der höchsten modernen Gebäude zu, mit dem allenfalls der sogenannte Weisheitszahn im Zentrum mithalten kann.
Ach ja, und eine weitere Sache hat sich nicht geändert, seit Sie mir das letzte Mal lauschten. Meine Empfehlung an Sie.
Wissen Sie noch?
Sie lautet: Nehmen Sie sich ein gutes Getränk Ihrer Wahl, suchen Sie sich einen gemütlichen Platz, mit dem Rücken zur Wand und dem Blick auf Türen und Fenster, und folgen Sie meinen Worten.
Danach wird Ihre Welt nicht mehr dieselbe sein …
Willow Tree hieß wirklich so.
Das amüsierte ihr Gegenüber beim Einchecken im Hotel, wie immer, denn jeder stutzte bei ihrem Namen, zumal man eine eher zierliche Frau Anfang zwanzig vor sich sah, die weder mit einer Trauerweide noch mit einem Baum im Generellen etwas gemein hatte: Die unauffällige Straßenkleidung hing nicht an ihr herab, sie war nicht grün und roch nicht nach Wald.
Normalerweise reagierte Willow stets mit einem Lächeln, einem Scherz oder auf andere charmante Weise. Aber nicht dieses Mal. Dafür fehlten ihr die Nerven und die gute Laune.
»Es wäre schön, wenn es etwas schneller ginge«, erwiderte sie stattdessen auf die nett gemeinte Anspielung des Angestellten auf ihren Namen und klammerte nebenbei ihre halblangen dunkelblonden Haare mit einer Spange am Hinterkopf fest. »Ernsthaft.«
Das Westin hatte als einziges Hotel noch Kapazitäten zur Messezeit. Mit mehr als vierhundert Zimmern auf etlichen Stockwerken und fast hundert Metern Höhe war es bestens auf den Ansturm der Besucher aus nah und fern vorbereitet. Um Willow herum herrschten rege Betriebsamkeit und Sprachengewirr, wobei es für sie als Britin einfacher war, die englischen Unterhaltungen zu verstehen.
Der errötete Angestellte steckte sich langsam sein Namensschildchen an das Jackett und wurde zu einem E. Anders. Ein Friedensangebot und die gut gemeinte Vorlage für sie, Wortspiele auf seine Kosten zu machen. »Es tut mir leid, aber das Zimmer ist noch nicht für Sie vorbereitet, Miss Tree. Wir haben gerade einen Engpass beim Housekeeping. Entschuldigen Sie bitte vielmals.«
Willow ersparte sich Witze zu seinem Nachnamen und bedauerte ihren schroffen Tonfall bereits. »Verzeihen Sie«, sagte sie und rückte dabei die schwarze Hornbrille auf der Nase zurecht. »War keine einfache Anreise. Sie können nichts dafür, Herr Anders.«
»Geschenkt, Miss Tree. Ich wollte Ihnen auch nicht zu nahe treten.« Anders lächelte mit mehr als üblicher Höflichkeit. Nonchalant legte er einen Gutschein für die Bar auf den Tresen. »Wegen meines Fauxpas und gegen Ihren Stress.«
»Vielen Dank.« Willow strich das Papier ein, das ihr einen leckeren Gin Tonic bescheren würde. Der kam ihr mehr als gelegen. »Wie lange dauert es noch?«
Anders’ roter Kopf, der seine blonden Haare und die hellen Augenbrauen unvorteilhaft betonte, nahm langsam eine normale Färbung an. Er klickte und scrollte sich durch die Listen. »Keine halbe Stunde mehr.« Er deutete auf die Lounge gegenüber der Rezeption. »Wenn Sie da warten möchten, bringe ich Ihnen eine kleine Erfrischung. Oder Sie fahren hoch in die Bar und genießen die phänomenale Aussicht, und wir sagen Ihnen Bescheid, sobald das Zimmer bereit ist.«
Willow haderte mit sich. Sie zog ihr Smartphone hervor und ließ es eine eingespeicherte Nummer wählen.
»Hier ist die automatische Ansage von Geneve Cornelius. Leider rufen Sie außerhalb der Bereitschaftszeiten meiner Praxis an. Schreiben Sie mir gern eine …«
Mist. Willow legte auf. Das machte ihr Unterfangen nicht einfacher und den Drink notwendiger. Sie stellte eine To-do-Reihenfolge auf: E-Mail an Cornelius verfassen, Drink genießen, auf die Stadt schauen und danach zur Praxis fahren, wenn binnen einer oder zwei Stunden keine Reaktion erfolgte. Zeit war ein wichtiges Gut. Und Geneve Cornelius die einzige Person, die ihr helfen konnte.
»Miss Tree?«
Die Stimme des Angestellten riss Willow aus ihren Gedanken. Sie raffte ihre dunkelblaue Handtasche an sich, um Platz am Tresen für die wartenden Gäste zu machen. »Verzeihung. Ich fahre –«
»Nein, wegen der Nachricht«, sagte Anders und streckte ihr den einfachen Umschlag offensiver entgegen.
»Für mich?« Willow sah irritiert auf das Kuvert. Handelsüblich, ohne Fenster, keine Marke und mit ihrem Namen darauf. Der Überbringer musste persönlich im Hotel gewesen sein. Sie rückte überrascht an ihrer Brille herum, als würden ihr die Gläser einen Blick ins Innere erlauben. »Wann wurde das abgegeben?«
»Tut mir leid, das weiß ich nicht, Miss Tree.«
Willow nahm den Umschlag entgegen. Leicht, mit nur einem Blatt, das konnte sie fühlen. Und etwas knirschte und rieb darin wie feiner Sand. Sehr ungewöhnlich. »Danke.«
»Selbstverständlich.« Anders kam um den Tresen und ergriff ihren kleinen altmodischen Koffer, um ihn mit einem Aufklebervermerk zu versehen und einem Gepäckmann zu überlassen.
»Ich warte da drüben, Herr Anders. Danke.« Willow ging nachdenklich zur Lounge, drehte und wendete den Umschlag, ohne weitere Auffälligkeiten zu bemerken; er roch wie harmloses Papier.
Sie setzte sich an einen freien Tisch und öffnete das Kuvert behutsam. Dabei überlegte sie, wer ihr die Nachricht übermittelt haben mochte. Sie war zum ersten Mal in Leipzig, niemand wusste, dass sie sich in Deutschland aufhielt.
Willow korrigierte erneut den Sitz der Brille. Dann zog sie das Kuvert mit spitzen Fingern auseinander.
Darin lag ein harmloser, gefalteter Brief.
Behutsam nahm sie ihn heraus, wobei glitzerndes, silbriges Pulver auf dem Tisch und ihrer Jeans landete. Daher das Knirschen. Willow kannte Spaßvögel, die Briefe mit extra viel Glitter versendeten, um dem Empfänger die Putzhölle zu bescheren.
Bei genauerem Hinsehen erwies es sich als gemahlenes, farbloses Glas, das im Licht der Lampen wie kleine Kristalle funkelte; der leichte Schmutzfilm auf ihrer Brille verstärkte den Effekt.
Willow faltete mit schlechtem Gefühl die Nachricht auf.
Bin,
wo Du bist.
Sehe,
was Du tust.
Hasse,
dass es Dich gibt.
Legion
heiße ich.
Denn wir
sind
unser viele.
Willows Puls schoss in die Höhe, ihr wurde heiß. Die Zeilen waren handgeschrieben, die Tinte schimmerte quecksilberartig. Leichter Schwindel erfasste sie, die Lounge wankte und kippelte.
Ihr Blick fiel auf das gemahlene Glaspulver auf dem Tisch. Es hatte die Züge einer unbekannten Frau angenommen, deren Mund zu einem lautlosen Lachen geöffnet war, wie um sie zu verhöhnen.
Willow ließ sich nichts anmerken, atmete tief und langsam durch. Trugbilder. Einbildung. Ihre überdrehte Vorstellungskraft und ihr Talent machten ihr zu schaffen, ausgelöst durch die handschriftliche Drohung.
Als ihr Smartphone klingelte, schreckte Willow zusammen. Unbekannte Nummer.
Es konnte der Verfasser oder die Verfasserin der bedrohlichen Zeilen sein.
Es konnte Geneve Cornelius sein, die von einem anderen Apparat aus anrief – und sie käme genau rechtzeitig.
Schnell atmend nahm Willow den Anruf entgegen. »Tree?«
»Wir hatten eine Verabredung.« Vorwurf und Verwunderung in einem einzigen Satz. »Wo steckst du?«
Willow hatte die Stimme ihrer Freundin bei der ersten Silbe erkannt. Immer mehr sehnte sie sich nach einem Gin Tonic. »Ich erkläre dir das alles, wenn ich zurück bin, Marian.«
»Zurück?« Die Verwunderung im Tonfall der Gesprächspartnerin stieg deutlich. »Heißt das, du bist nicht in London?«
Willow sah sich in der Lobby um, in der nach wie vor reges Treiben herrschte. Niemand schien sich für sie zu interessieren. Was sprach dagegen, dass sie verriet, wo sie steckte? Und doch wollte ihr das Wort Leipzig nicht über die Lippen kommen. Sie brachte Marian womöglich schon mit dieser vermeintlich harmlosen Information in Gefahr. »Ich … ich melde mich.«
»Bist du in Schwierigkeiten?«
»Ich melde mich«, beharrte Willow. »Morgen früh.«
»Gut. Morgen früh. Sonst suche ich nach dir. Wir alle suchen dann nach dir.« Marian legte auf.
Willow steckte den Zettel zurück in den Umschlag und wischte den Glasstaub damit vom Tisch. Sie wollte ihn nicht berühren. Glitzernd und flirrend fiel er auf den Teppich und funkelte in den kurzen Fasern weiter.
Auch wenn sie die Nachricht zurück in das Kuvert gesperrt hatte, die Worte blieben in ihrem Verstand.
Und ängstigten sie.
Bin,
wo Du bist.
Sehe,
was Du tust.
Hasse,
dass es Dich gibt.
Legion
heiße ich.
Denn wir
sind
unser viele.
Willow erhob sich. Um sich der vergifteten Zeilen zu entledigen, warf sie den Umschlag hastig zum Mülleimer. Er landete daneben und blieb hochkant stehen, als begehrte die Nachricht gegen die Entsorgung auf. Das Malheur bekam die junge Frau nicht mit. Sie eilte bereits durch die Lobby zu den Toiletten.
Dort angekommen, legte Willow die Brille ab und wusch sich das heiße, glühende Gesicht mit kaltem Wasser; ließ es sich über die Pulsadern laufen. Ihr Herz pochte viel zu schnell. Wie gerne hätte sie eine Dusche genommen, aber solange ihr Zimmer nicht bereit war, musste es auf diese Weise gehen.
Das permanente Rauschen aus dem Hahn beruhigte sie. Ihre Augen waren auf das fließende Wasser gerichtet, das sprudelte und blubberte. Ohne die Sehhilfe war die Umgebung undeutlich und weichgezeichnet. Konzentration, Meditation, Fokussierung.
Willow war die Einzige im Waschraum. Sie atmete langsam ein und aus, genoss die Stille im Gegensatz zur hektischen Lobby.
Ihr Blick fiel auf ihre dunkelblaue Handtasche, die seitlich auf dem Waschbecken stand. Darin bewahrte Willow ihren Fund auf, dieses rätselhafte Fragment, mit dem sie nichts anzufangen wusste und über das sie zufällig gestolpert war. Schon beim ersten Blick darauf war sie neugierig geworden, beim zweiten waren die Bedenken gekommen. Und beim dritten hatte sie auch ohne Nachforschungen gewusst: Sie brauchte eine Spezialistin.
Natürlich hatte Willow Recherche betrieben, aber nichts gefunden. Diese Erkenntnis hatte sie in ihrem Entschluss gestärkt, nach Leipzig zu reisen.
»Geht es Ihnen nicht gut?« Wie aus dem Nichts wurde Willow von einer Frau angesprochen.
»Danke, das ist gleich vorbei.« Weil es einfacher war, als den Kopf zur Seite zu drehen, während sie das Wasser über ihre Handgelenke rinnen ließ, kommunizierte sie über den Spiegel mit der hilfsbereiten Schwarzhaarigen, die Anfang dreißig sein mochte und leicht asiatische Züge hatte. So genau sah Willow die Unbekannte ohne ihre Brille nicht. »Kleine Kreislaufschwäche.«
Die Frau im schneidigen dunkelroten Dress einer Airline und mit einem bunten Schal um den Hals stand neben dem Eingang und lächelte sie an. Das Namensschild war aufgrund der Entfernung unleserlich. »Das kenne ich.«
»Wollen Sie ans Waschbecken?« Willow nahm die Brille und setzte sie auf. Die Umgebung erhielt etwas mehr Schärfe.
»Ach, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.« Die Frau sah sich im Vorraum um. »Schön gemacht. Da kenne ich ganz andere Waschraumeinrichtungen.«
Willow grinste. »Sie kommen in Ihrem Job ordentlich rum? Beneidenswert.«
Die Halbasiatin nickte und kam langsam näher. Ihre Bewegungen waren geschmeidig, wie die einer Bodenturnerin mit ausgeprägtem Körperbewusstsein. »Auf der ganzen Welt. Heute hier, morgen dort.«
»Welche Fluggesellschaft ist das? Ihre Uniform hat eine schöne Farbe.« Willow stellte das Wasser ab.
»Air China.« Die Unbekannte kam noch näher, sodass das Namensschild im Spiegel lesbar wurde, auch dank der geschliffenen Gläser vor Willows Pupillen: Jade-Aileen. »Ich hätte es schlimmer treffen können. Man glaubt ja kaum, was einem da von manchen Betreibern zugemutet wird.«
Willow wusste nicht, weshalb, doch sie fühlte sich abrupt unwohl. Etwas stimmte nicht.
Langsam langte sie nach den Handtüchern und trocknete sich die Finger ab; das Papier raschelte überlaut in der plötzlichen Stille des Vorraumes. Es wurde dringend Zeit zu gehen.
Jade-Aileen kramte in ihrer winzigen schwarz-weißen Handtasche. »Oje. Hätten Sie leihweise wohl einen Eyeliner? Ich fürchte, ich habe meinen verloren.«
Willows feine Nackenhärchen richteten sich warnend auf. Sie wollte gehen, aber ihre Höflichkeit verhinderte es.
»Klar.« Sie langte nach ihrer Handtasche – und bekam die Erleuchtung: Das Namensschild. Es war im Spiegel zu lesen wie direkt daraufgeschrieben. Die Buchstaben waren nicht falsch herum, wie es sich für eine Reflexion gehörte.
Willow gefror in der Bewegung, ihr Puls schoss in die Höhe.
»Der Kreislauf?«, erkundigte sich Jade-Aileen vorgetäuscht besorgt und klimperte mit den langen Wimpern.
Die Stimme der Stewardess erklang nicht von hinten, wie es sein müsste.
Sondern von vorne. Aus der reflektierenden Oberfläche.
Das kann nicht sein! Langsam wandte Willow den Kopf weg vom Spiegel zum Eingang, drehte dabei leicht den Oberkörper.
Dort stand niemand.
Ansatzlos bekam Willow einen Stoß in den Rücken, der sie gegen den Papiertuchspender beförderte. Ihr Kopf knallte an die Plastikabdeckung, es rumpelte dumpf, und der Bewegungssensor spuckte gehorsam ein frisches Blatt aus. Die Hornbrille zerbrach und landete auf dem Boden.
»Oder ist es doch mehr die Erkenntnis, Miss Tree?« Jade-Aileens Arm schoss aus dem Spiegel, mit eiskalten Fingern packte sie Willow im Nacken und presste sie gegen die Wand. Mit der anderen Hand drehte sie die dunkelblaue Handtasche um und schüttelte den Inhalt ins Waschbecken. Klimpernd und klirrend ergoss sich die Flut aus persönlichen Gegenständen in die Keramik. »Wollen Sie mir verraten, was Sie herausfanden?«
Willow vermochte sich gegen die zwingende Kraft nicht zu wehren. Es fühlte sich an, als könnte die Gegnerin mit einer Bewegung ihre Wirbel zerquetschen. »Was meinen Sie?«
»Sich dumm zu stellen, wird Ihnen nichts nützen.« Jade-Aileen fluchte laut. »Wo ist er?« Brutal drosch sie die leere Handtasche an Willows Gesicht. Die Metallhalterungen des Schulterriemens hinterließen blutige Kratzer in der Haut. »Ich weiß, dass Sie ihn mitgenommen haben!«
Im ersten Moment wusste es Willow wirklich nicht.
Sie schielte schräg zur Seite, weil sie den Kopf nicht drehen konnte, und sah auf Smartphone, Geldbeutel, Taschentücher, Schminkutensilien, Schlüssel, Stift, Notizblock, Powerbank für das Telefon. Aber jener Gegenstand, weswegen sie nach Leipzig gekommen war, war nicht darunter.
Dann fiel ihr unvermittelt ein, wo er sich befand.
»Er ist mir gestohlen worden«, behauptete Willow.
»Schwachsinn!«, zischte die Halbasiatin, und es klang, als würde sich Glas in ihrem Hals befinden, das bei dem Wort schwang und klirrte.
Jade-Aileens Gesicht schob sich langsam durch die glatte Oberfläche des Spiegels, tauchte wie aus einem ruhigen See auf; ihr Oberkörper folgte. Sie lehnte sich aus dem Rahmen und brachte ihre Lippen dicht an Willows Ohr. »Du hast ihn mitgenommen. Nach Leipzig. Was willst du hier? Wer soll dir helfen?« Der Druck im Nacken verstärkte sich. »Wenn du nicht in diesem Waschraum enden willst, gib mir das, was nicht dir gehört, kleine Diebin. Oder ich töte dich und suche selbst.«
Willow zitterte – und wusste, dass sie so oder so hier sterben würde. Die Spiegelfrau hatte kein Interesse daran, dass über sie gesprochen wurde. Oder über das, wonach sie suchte.
Da sie nicht genug Kraft besaß, die eiskalten, kräftigen Finger abzuschütteln, tat sie das, was ihr als das einzig Sinnvolle erschien: Willow schnappte sich ihr Smartphone – und warf es gegen den Spiegel.
Das klackende Geräusch des Einschlags mischte sich mit einem vernehmbaren Knistern und Knacken. Das Telefon prallte ab, scheppernd hüpfte es im Becken hin und her.
»Verdammt!« Die todeskalten Finger wichen aus Willows Genick, die Gegnerin glitt zurück in die Zweidimensionalität.
Sofort sprang Willow in Richtung Ausgang. Nur raus! Handtasche und Inhalt gab sie verloren.
»Denkst du, dass du mir entkommst?«, wisperte die Halbasiatin klirrend. »Eine reflektierende Oberfläche genügt mir. Eine Pfütze, ein Stück Metall, Glas, Spiegel, ganz gleich.«
Willow erreichte die Tür. »Lass mich in Frieden!«
»Du hättest ihn nicht mitnehmen dürfen, Willow«, verfolgte sie die drohende Stimme. »Du bist eine Diebin. Eine Todgeweihte.«
Willows Hand legte sich auf die Klinke. Jetzt benötigte sie erst recht Beistand, um das ganze Ausmaß ihrer Entdeckung zu erfassen. »Was immer du bist, ich halte dich auf.« Erleichtert beobachtete sie die sich ausbreitenden Sprünge und kriechenden Risse in der Spiegeloberfläche, die sie auch ohne Brille erkannte. Fortschreitendes Knacken und Knistern erklang.
»Große Worte. Dabei weißt du nicht einmal, was du gefunden hast.« Jade-Aileen wich zurück. Ihr Gesicht war eine Grimasse aus Wut und Besorgnis. Sie fürchtete sich offenkundig vor der Zerstörung, solange sie im Spiegel verweilte. »Welcher Sache du im Weg stehst.« Das unregelmäßige Netz zuckte voran und trieb die Angreiferin mehr und mehr in den Hintergrund, bis sie zu einem verschwommenen Umriss wurde.
»Fürchte reflektierende Oberflächen. Legion heiße ich. Denn wir sind unser viele«, erklang es schneidend. »Und ich bin überall. Überall!«
Mit einem unterdrückten Angstschrei rannte Willow los, quer durch die Lobby und hinaus ins Freie. Sie brauchte einen Ort, an dem es nichts gab, was Reflexionen erzeugte. Sonst bin ich verloren.
Hatte ich Ihnen zu viel versprochen, als ich Sie vor einem Alltagsgegenstand warnte?
Geben Sie es ruhig zu, Sie haben sich schon umgeschaut und die Bewegungen Ihrer eigenen Reflexion überprüft.
Haben Sie je darüber nachgedacht, wie oft man sich tagtäglich in etwas spiegelt?
Ab diesem Moment achten Sie öfter darauf, vermute ich.
Ich hörte, dass der durchschnittliche Westeuropäer täglich etwas weniger als eine Stunde bewusst vor Spiegeln verbringt.
Bei der Morgentoilette.
Beim raschen Blick an der Garderobe, bevor man aus dem Haus geht.
Beim kurzen Prüfen in den Waschräumen eines Restaurants.
Beim sekundenlangen Innehalten vor Schaufenstern.
Meinetwegen sogar beim Trinken aus einem reinen, klaren Bach. Auch wenn dies kein Spiegel im eigentlichen Sinne ist, war dies in grauer Vorzeit für die Menschen die einzige Möglichkeit, sich selbst zu betrachten.
Heute jedoch sind Glas, Metall, glanzlackierte Oberflächen und Wasser überall, und ebenso allgegenwärtig sind unsere Spiegelbilder.
Ja, Sie werden von nun an aufmerksamer sein.
Meine Tochter, die im beschaulichen Leipziger Stadtteil Schleußig abseits des Touristentrubels als … nennen wir es »Heilpraktikerin« lebt und sich bestens mit der Anderswelt auskennt, befand sich an diesem Punkt meiner Geschichte noch weit entfernt von dieser Erkenntnis.
Sie freute sich auf einen ruhigen Abend und eine Unterhaltung mit ihrem guten Freund, diesem Alexander Bugatti. Via Internet.
Aber lesen Sie selbst …
»Ist die Verbindung gut? Verstehst du mich?« Geneve Cornelius sah auf das Display des Tabletcomputers, den sie beim Hinsetzen schwungvoll auf den angewinkelten Oberschenkeln abstellte.
Sie hatte es sich auf der begrünten Dachterrasse ihrer kleinen Villa gemütlich gemacht, die ganz in der Nähe der Weißen Elster stand. Dara, ihre Schülerin in Sachen Heilkunde und Altem Wissen, war bereits heimgegangen.
Geneve platzierte sich in bequemer Jogginghose und Hoody im Sessel an der frischen Luft unter einer milden Nachmittagssonne. Vor sich hatte sie einen Aufguss aus verschiedenen Kräutern stehen, dessen Wirkung und Zusammensetzung nicht unbedingt mit dem deutschen Betäubungsmittelgesetz im Einklang standen.
»Sí. Klar und deutlich.«
Via Internet unterhielt sie sich mit Alessandro Bugatti, den sie vor einigen Monaten kennen- und schätzen gelernt hatte. Geneve mochte den sympathischen Mann Anfang vierzig. Er hatte kurze schwarze Haare, wache braune Augen und sprach Deutsch mit leichtem italienischen Akzent.
»Ist alles klar bei dir?«
»Sehr.« Sie langte nach der Tasse und prostete ihm zu, nahm einen Schluck. Und nicht mal geflunkert.
Der Tee diente medizinischen Zwecken. Er half gegen ihre chronischen Schmerzen, die schubweise auftraten, besonders in der Übergangsphase von Wärme auf Kälte. Den primären Grund für ihre wiederkehrenden Leiden und weswegen die üblichen Therapieformen für Rheuma oder Ähnliches versagten, konnte sie wiederum keinem Standardmediziner erläutern. Entweder wäre sie für verrückt erklärt worden oder im Labor eines Forschungskomplexes gelandet.
Geneve versuchte, am Hintergrund zu erkennen, wo sich Alessandro aufhielt, aber hinter ihm befand sich lediglich eine vertäfelte Wand. Er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte, die Lederriemen des Schulterhalfters waren andeutungsweise zu sehen. »Wo treibst du dich herum?«
»Besprechungszimmer im Vatikan.« Er drehte die Kamera im schlichten Büro, sodass an den vertäfelten dunklen Wänden etliche Papstbilder und ein Kruzifix erkennbar wurden. »Wir hatten mit einer organisierten Diebesbande zu tun, die sich im Petersdom an den Gläubigen bereicherte.«
»Die legale Bereicherung bleibt halt der Kirche vorbehalten«, entschlüpfte es Geneve, und sie musste kichern. Der Sud entspannte sie. Das Stechen in den Gelenken war bereits verschwunden.
»Dazu sage ich besser nichts. Als Commissario des Heiligen Vaters wäre derlei Kritik bestimmt ein Kündigungsgrund.« Alessandro grinste trotzdem. »Deine Pupillen sind ziemlich groß, kann das sein?«
»Das muss am Kamerawinkel liegen.« Geneve hob den Kopf in die Sonne und blinzelte. Der Sommer war gegangen, der Herbst lockte mit schönem Wetter bei geringeren Temperaturen. Das Laub ihrer Pflanzen hatte sich überwiegend gefärbt und machte die Terrasse bunt.
Auf der Staffelei stand ein angefangenes Gemälde, das den Garten abbildete: surrealistisch und in perfekter Punkttechnik. Wer so lange lebte wie Geneve, hatte genug Zeit zum Üben. Sie beherrschte inzwischen jede Stilform, von Caspar David Friedrich bis van Gogh, Dix, Chagall, einfach alles, wonach ihr war. Fehlerfrei.
Geneve suchte derzeit nach einem neuen Stil, um Bewegung in die Kunst zu bringen. Dafür arbeitete sie an einem Gemälde im Gemälde – mit phosphoreszierenden Farben, sodass bei Dunkelheit das zweite Bild sichtbar wurde, um das erste zu ergänzen, zu verfremden und je nach Leuchtintensität mit unvorhersehbaren Nuancen zu versehen. »Habt ihr die Diebe geschnappt?«
»Sí. Ich spielte den Köder und war ziemlich erstaunt, als mir eine falsche Nonne den Geldbeutel aufschnitt.« Alessandro lachte sein herrliches Lachen.
Geneve nahm noch einen Schluck und stellte die Tasse auf das Beistelltischchen. Auch auf die Gefahr hin, die Stimmung zu ruinieren, musste sie die nächste Frage stellen. Sie öffnete ihre braunen Haare, die schulterlang herabfielen. »Hattest du Zeit für die Nachforschungen, um die ich dich bat?«
Schlagartig wurde der Italiener ernst. »Ich habe eine Anfrage bei den Kollegen in England gestellt, aber es kam keine Antwort.«
Geneve atmete langsam aus. Damit hatte sie fast gerechnet.
Kennengelernt hatte sie Alessandro nach den Morden an ihrem Bruder und ihrer Mutter, da der Täter versucht hatte, dem Italiener die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Bugatti-Dynastie verband eine alte Fehde mit der Familie Cornelius, deren Auslöser weit in der Vergangenheit lag. Bei ihrem einst ausgeübten Handwerk der Henkerei war es zu einem Zwischenfall gekommen, der über Generationen nicht verziehen worden war.
Geneves und Alessandros gemeinsame Ermittlungen hatten ergeben, dass die Dinge anders lagen und die Fehde keineswegs der Grund für die Morde an den Cornelius gewesen war. Als Schuldige hatten sie Samantha Fry ausgemacht. Die Geschäftsfrau hatte einem dämonischen Kult angehört, mit dem Jacob Cornelius aneinandergeraten war. Fry hatte allerdings nur den Mord an Geneves Mutter, Catharina Cornelius, gestanden. Im Angesicht ihres eigenen Todes.
Seitdem beschäftigte Geneve der Verdacht, dass ihr Bruder einem anderen Täter zum Opfer gefallen war. Lügt man wirklich kurz vor seinem Ende?
»Sie hat dich angelogen.« Alessandro erriet Geneves Gedanken und hob ein Espressotässchen ins Bild, dessen Inhalt er schwungvoll in sich kippte. »Fry wollte, dass du im Zweifel bleibst. Sie wusste, dass es dich quälen und verfolgen wird.«
Geneve nickte abwesend, und das kleine Kontrollbildchen am unteren Displayrand folgte mit leichter Verzögerung. Die beruhigende Wirkung des Aufgusses würde sie bald zum Einschlafen bringen.
Sie hatte dieses uralte Wissen über Pflanzen, Extrakte und was man daraus an Salben, Tinkturen und Mittel herstellen konnte, jahrhundertelang angesammelt. Niemand außer ihr kannte das Geheimnis der unsterblichen Familie Cornelius, auch wenn in gewissen Kreisen der Anderswelt darüber gemunkelt und gemutmaßt wurde.
Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Familie war Geneve mit dieser Besonderheit alleine.
In gewissem Sinne war Geneve immer allein gewesen. Ihre Mutter und ihr Bruder hatten die Handgriffe der Henkerszunft beherrscht und über viele Dekaden ausgeführt, doch Geneve hatte sich dessen stets verweigert und sich ganz auf die Pflege der Gefangenen, Verhörten und Bedürftigen verlegt. Es war ihre passive Art der Rebellion gegen das grausame Gerichtsgebaren gewesen, das unter der Folter jeden zu einem Geständnis zwang. Damals. In der frühen Neuzeit.
Als diese Form der Strafe und des Verhörs endlich abgeschafft worden war, verlegte sich Geneve gänzlich auf ihre Berufung: die Heilkunst mit natürlichen Mitteln. Es erfüllte sie, für Menschen und Kreaturen der Anderswelt da zu sein und ihre Leiden zu lindern.
»Ich bin mir nicht sicher, was Fry angeht.« Geneve suchte Alessandros Blick. »Mir fehlt die Gewissheit, dass sie mich anlog. Verstehst du das?« Auch wenn sie ihren Bruder Jacob nie gemocht und vor langer Zeit mit ihm gebrochen hatte wie auch mit ihrer Mutter, wollte sie die Schuldigen gefasst wissen. »Vielleicht läuft der Mörder noch umher?«
Er nickte verständnisvoll. »Ich frage nach, ob sich neue Erkenntnisse bei den Ermittlungen rund um Fry und deinen Bruder ergaben.« Alessandro stellte das Tässchen ab, das winzig in seinen kräftigen Fingern wirkte; der Siegelring mit dem Zeichen der Bugattis blitzte auf. »Ich soll dich übrigens von meiner Mutter grüßen.«
Geneve horchte auf. »Grüßen?« Das hatte Seltenheitswert.
Die Fehde zwischen den Cornelius und den Bugattis hatte Alessandro zwar für beendet erklärt, weil er sie als unsinnig ansah, aber letztlich musste das Oberhaupt der Familie den Zwist begraben. Buchstäblich. Und das war Donna Giovanna Battista Bugatti. Sie führte eine Handvoll überaus erfolgreicher Bestattungsunternehmen und behauptete sich sogar gegen die Mafia. Fast alle Nachfahren der Henkerdynastien, die in Europa und den Staaten lebten, hatten Berufe ergriffen, die im Einklang mit ihren alten Aufgaben standen.
Bis auf Geneve.
»Was genau bedeutet denn grüßen?« Sie zog die Kapuze des grauen Hoodys hoch, um es kuschliger zu haben. Der laue Wind wisperte in ihren Ohren.
Alessandro machte eine bedeutungsschwangere Miene. »Ich habe ein bisschen auf sie eingewirkt und von dir erzählt. Und mein Sohn auch. Giovanni ist begeistert von dir.«
Geneve lachte auf. »Er kennt mich doch nur von unseren Gesprächen über das Internet.«
»Sí, sí. Du imponierst ihm. Seit der Geschichte über dein Elixier der Unsterblichkeit mehr als zuvor.« Er sah zur Seite und wechselte einige kurze Sätze auf Italienisch mit jemandem, der den Geräuschen nach außerhalb des Kamerawinkels den Kopf zur Tür hereinstreckte. »Scusi. Es ging um die Anzeige gegen die Diebe.«
»Sagt man bei einem Dom auch Hausfriedensbruch, oder ist das zu klein?« Geneve kicherte wieder. Die Geschichte um das Serum war nicht erfunden gewesen. Aber woher hätte Giovanni das wissen sollen? Der Schlaf rollte heran wie eine schöne Wolke und hüllte ihr Denken mehr und mehr ein. »Du, ich lege mich gleich ein bisschen hin.« Geneve unterdrückte ein Gähnen. »Aber vorher: Was hat es mit dem Gruß deiner Mutter auf sich?«
»Ich denke, sie will sich früher oder später mit dir treffen. Und in einem zweiten Schritt die Fehde aufkündigen«, verkündete Alessandro mit ein bisschen Stolz in der Stimme. »Offiziell und im Beisein aller Dynastien.«
»Das ist toll.« Geneve tat ihm den Gefallen und freute sich deutlich. Insgeheim war es ihr egal, auch wenn das Ende des Zwistes weniger Unruhe in Alessandros Leben bedeuten mochte. Damit wären ihre regelmäßigen Gespräche nicht vom Druck der Jahrhunderte um Schuld und Vergeltung durch die Bugatti-Famiglia belastet. »Ich komme gerne.«
»Un momento! So schnell geht es nicht. Meine Mutter wird die Aufkündigung von eurem Treffen abhängig machen wollen. Aber es ist ein Anfang.« Alessandro erhob sich und das Gerät mit der eingebauten Kamera, und die Wand schnellte hinter ihm in die Höhe. Geneve wurde davon ebenso schlecht wie schwindlig. »Va bene. Ich muss los. Ciao, ciao, bella!«
»Ciao, ciao, ragazzo.« Sie hob die Hand zur Verabschiedung und lächelte, dann erlosch das Bild. Ja, ich mag Alessandro. Ein offizielles Aus der Fehde wäre nicht das Schlechteste.
Geneves unterschiedlich farbige Augen richteten sich auf den Garten, dessen Blätter, letzte Blüten und Stauden im Wind wogten. Bambus rauschte und raschelte friedlich, Windspiele erzeugten ein chaotisch-harmonisches Konzert, in das sich das entfernte Gluckern der Weißen Elster mischte.
Geneve zog die Kapuze bis über die Augen. Ihr fielen die Lider zu, und sie driftete in einen angenehmen, schmerzfreien Schlummer, der jäh vom Fiepen und Vibrieren ihres Smartphones unterbrochen wurde. Das Gerät schien darauf gewartet zu haben, dass sie einschlafen wollte.
Das sekundenlange Ignorieren half nichts, zumal ihr Tabletcomputer das Geräusch einer eingehenden E-Mail von sich gab.
Und noch einer.
Und noch einer.
Jemand versuchte dringend, sie zu erreichen.
Ihr Verantwortungsgefühl und die Hilfsbereitschaft revoltierten gegen die weich-warme Lethargie, die sie sich eigentlich nach dem Tag in ihrer Praxis verdient hatte. Also tastete Geneve umher, bis sie das nervende Telefon zu greifen bekommen hatte, und nahm den Anruf mit gedämpftem Geist entgegen. »Cornelius?«
»Grey hier«, sagte eine Frauenstimme auf Englisch. »Gut, dass ich Sie erreiche. Sie können sich …«
»Grey?« Geneves benebelter Verstand arbeitete langsam, die Augen ließ sie zu. »Ach ja, Miss Grey vom …« Sie überlegte, welchen Vornamen die Wicca trug, aber er fiel ihr partout nicht ein.
»Tamesis-Coven in London. Exakt.« Grey war deutlich angespannt. »Verzeihen Sie die Störung. Haben Sie schon geschlafen?«
»So ähnlich, ja. Anstrengender Tag.«
Die moderne Hexe hatte Geneve und Alessandro bei der Lösung des letzten Falles geholfen. Entscheidende Tipps waren von ihr gekommen, nicht zuletzt auch, weil sie Jacob gekannt hatte.
»Oh, das … tut mir leid, aber ich brauche Ihre Hilfe. Dringend.«
»Ist etwas mit Ihrer Schwesternschaft?«
»Ich … ich bin mir nicht sicher. Es ist enorm wichtig. Können Sie bitte gleich kommen?«
Geneve fühlte sich kaum in der Lage, sich aus dem Sessel zu erheben, geschweige denn einen Koffer zu packen, einen Flug zu buchen und, und, und. »Ich bin … zurzeit unpässlich. Aber ich setze mich gleich morgen in den Flieger.«
»Das müssen Sie nicht. Ein Flieger hätte um diese Zeit ohnehin nicht mehr abgehoben. Ich bin in Leipzig.«
Das änderte nichts an Geneves Unpässlichkeit. Aber was meinte die Wicca mit ›um diese Zeit‹?
Sie hob mit einiger Anstrengung die Lider und sah zu ihrer Verwunderung zu einem Nachthimmel hinauf. Sie musste länger geschlafen haben, als es sich angefühlt hatte. Es war still auf der Terrasse, der Wind hatte sich gelegt.
Es sind Stunden vergangen? Geneve fröstelte und zog die Kapuze noch weiter über den Kopf, sodass sie nichts mehr sah. Der Trank hatte stärker gewirkt als gedacht, oder ihr erschöpfter Körper hatte die Gelegenheit genutzt, sich zu regenerieren.
»Treffen wir uns doch zum Frühstück, Miss Grey.« Sie richtete sich langsam auf.
»Es ist wirklich wichtig. Ich würde nicht drängen, wäre es nicht von Bedeutung.« Grey holte tief Luft. »Eine unserer Schwestern wurde in Leipzig ermordet. Ich habe Ihnen eine Mail geschickt, in dem der Unfall beschrieben ist.«
Die verschiedenen Formulierungen verwirrten Geneves langsam arbeitenden Verstand. »Unfall oder Mord?«
»Mord. Aber alle anderen werden und sollen es für einen Unfall halten.«
Geneve erhob sich und sog die Nachtluft ein, betrachtete den glitzernden Fluss. In Gedanken sortierte sie bereits die Bestandteile für ein Gegenmittel, um die Wirkungen des beruhigenden Suds zu beseitigen. Leicht berauscht konnte sie nicht zu einem Treffen fahren. Sie musste klar denken können. »Und wieso sind Sie in der Stadt, Miss Grey?«
»Ihr Name war Willow Tree. Sie ist in Leipzig umgebracht worden«, erklärte Grey im gleichen Moment.
Geneve streifte die Kapuze des Hoodys zurück und ließ die Kühle an ihren Kopf, um wacher zu werden. Langsam ging sie die Stufen nach unten zu ihrer Kräuterkammer. Es hatte keinen Zweck, sich mit Details des Falles zu beschäftigen, solange das Schmerzmittel durch ihre Rezeptoren jagte und sie im Denken beeinträchtigte.
»Miss Grey, ich bin in einer knappen Stunde bei Ihnen. Wo finde ich Sie?«
»Im Westin. Ich sitze in der Lobby und warte auf Sie.«
Geneve hatte nach mehreren Stufen und zwei Stockwerken ihre tresorgleich gesicherte Kammer erreicht und wählte die Gläser aus, deren Inhalt sie benötigte.
»Wissen Sie, was Willow in Leipzig wollte?«
»Zu Ihnen, Miss Cornelius.« Die Wicca legte auf.
Diese Neuigkeit steigerte die Wachheit. Geneve legte das Telefon zur Seite, steckte die Hände in die Hoodytaschen und sah nachdenklich über die Zutaten. Der Gegentrank würde die Schmerzen in den Gelenken und Muskeln zurückbringen, aber es musste sein. Sie hatte sich nach dem Tod ihrer Familie dafür entschieden, nicht länger neutral zu agieren und als bloße Beobachterin den Verlauf von Geschehnissen abzuwarten. Tatkraft. Sich einbringen und einmischen, für das Gute aktiv werden.
Einige kleine Dinge hatte sie in den letzten Monaten in Leipzig bereits bewegt. Auch in der Anderswelt. In diesem Fall wurde sie um Hilfe gebeten. Eine neuerliche Bewährungsprobe stand an, zumal Grey und ihr Tamesis-Coven etwas bei ihr gut hatten.
Sie würde den Tee stärker dosieren, um fokussiert zu sein. Offenbar befand sie sich bereits mitten in einem Mordfall, der mit der Anderswelt verknüpft war. Damit war sie zweifach involviert.
So schnell ist man in eine Sache verwickelt.
Und dabei hatte Geneve noch keine Ahnung, was sie alles erwartete.
Kapitel II
Ja, die Unsterblichkeit der Familie Cornelius.
Zumindest die relative, denn wie Sie wissen und sich vielleicht erinnern: Gegen weltliche Waffen sind und waren wir nicht gefeit. Ohne Kopf lebt es sich schlecht, und ich als einstige Scharfrichterin, die Jahrhunderte leben durfte, weiß es nun wirklich am besten.
Nur vor der Sanduhr des Gevatters blieben wir verschont.
Die Begebenheit, von der ich nun erzähle, trug sich zeitlich nach den Geschehnissen zu, die ich Ihnen letztes Mal schilderte. Sollten Sie zum ersten Mal davon hören, seien Sie unbesorgt. Sie werden alles verstehen und begreifen.
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Es gibt die Gestalten und Wesen, die gerne als Aberglaube und Fabeln und Märchen abgetan werden. Ich werde Ihnen davon berichten, und ich halte Sie nicht davon ab, die moderne Technik und alte Bücher zur eigenen Nachforschung zu nutzen.
Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen seltsam erscheint, von Verhör und Folter, Pranger, Stockhieben und verschiedensten Hinrichtungsformen samt weitergehender Strafen am Leichnam des Verurteilten zu erfahren. Es waren andere Zeiten. Aber die Todesstrafe ist so alt wie die menschliche Zivilisation, auch wenn sie mittlerweile in etwas mehr als 140 Staaten nicht mehr angewandt wird. Mehr als fünfzig haben sie noch. Wie viele Menschen heute noch in der Gegenwart des Staates gerichtet werden, ist schwer zu sagen. Manche Länder haben keine offizielle Statistik. Ich würde von einigen Tausend pro Jahr ausgehen.
Da ich vorhin von Goethe sprach: In Wilhelm Meisters theatralischer Sendung lässt er sagen:
»Wie viel Tausende werden unwiderstehlich nach einer Exekution, die sie verabscheuen, hingerissen, wie ängstet sich die Brust der Menge für den Übeltäter, und wie viele würden unbefriedigt nach Hause gehen, wenn er begnadigt würde und ihm der Kopf sitzen bliebe? Das sprudelnde Blut, das den bleichen Nacken des Schuldigen färbt, sprengt die Einbildungskraft der Zuschauer mit unauslöschlichen Flecken.«
So war es damals.
Später erzähle ich Ihnen noch ein bisschen mehr über die Anfänge dieses alten Berufs, den ich mit Freude und Überzeugung ausführte. Wie es das Amt verlangt.
Jetzt aber führe ich Sie in die Vergangenheit, ins frühe 17. Jahrhundert, in eine Stadt in Deutschland, deren Namen ich Ihnen nach wie vor nicht nenne. Es soll niemand wegen der Geschichten aus der Vergangenheit in Verruf geraten. In dieser Stadt gingen mein Sohn Jacob und ich dem Handwerk der Scharfrichterei nach, während Geneve sich auf die Behandlung von Wunden verlegte, welche die Befragung unter der Folter regelmäßig nach sich zog.
Und natürlich setzte meine Tochter ihre Hilfsbereitschaft nicht nur in den Kerkern ein, sondern auch für jene, die sonst ihre heilenden Hände benötigten. Sowohl Menschen, die heimlich oder offen zu ihr kamen, als auch sonstige Wesenheiten …
»Und wer brachte dir diese Wunde bei?« Geneve spreizte die Ränder der vierten Fleischwunde ihrer Besucherin mit einem selbst ersonnenen chirurgischen Instrument, das sie aus zwei verbogenen Forken gebaut hatte, und ließ die Arretierung mit einer Fingerbewegung einrasten. Damit war es ihr möglich, mit beiden Händen die Verletzungen an der hinteren Schulter zu sondieren und sie zu behandeln. Die weniger schlimmen Wunden am Arm und Rücken hatte sie bereits versorgt.
Die junge Frau in dem schlichten weißen Kleid, über dem sie eine Schnürung trug, jammerte leise und wandte den Blick ab. Sie hatte das Oberteil zur Behandlung herabgestreift, ihre Haut war bis auf die Wunden weiß und makellos, die Brüste klein und fest. Mehr als vierzehn, fünfzehn konnte sie nicht sein, und viel Zeit unter der Sonne verbrachte sie nicht. Sie war keine Bäuerin. »Ich sah ihn nicht.«
Vorgestellt hatte sich die Bittstellerin mit dem rötlich kastanienfarbenen Haar nicht. Aber dem orientalischen Schmuck und dem Geruch von billigem Ginster- und Nadelräucherwerk nach vermutete Geneve, jemanden aus dem Vergnügungshaus vor sich zu haben. Bezahlt hatte sie bereits. Mit einer kleinen Goldmünze. Eine weitere Ungewöhnlichkeit.
»Eine Lüge.« Geneve suchte in dem leicht verbrannten Fleisch nach den Resten des Geschosses. Es war in diesem Fall einfach, weil sie lediglich der schwarzen Spur im Gewebe zu folgen brauchte. »Also, wer attackierte dich und wusste um deine Besonderheit?« Sie hatte sich eine Schürze über ihr graues, weiß besticktes Kleid gelegt und die Ärmel in die Höhe gekrempelt. Ihre langen braunen Haare lagen geflochten unter einer Leinenhaube.
In dieser frostigen Herbstnacht saßen sie im Erdgeschoss ihres Hauses, das ganz am Rand stadtauswärts lag. Unehrenhafte und Unehrliche wie die Henkersfamilie hatten mitten unter den Bewohnern nichts verloren. Dieses Schicksal teilten mit Geneve ihr Bruder Jacob und ihre Mutter Catharina, die gemeinsam die Pflichten und Aufgaben des Scharfrichteramtes übernahmen.
Geneve hingegen war die Heilerin, die sich weder an Folter noch an Hinrichtungen beteiligte.
Sie widersetzte sich indirekt der Familientradition, indem sie mit ihrem heilkundigen Wissen Unschuldige und zu Unrecht Verhaftete pflegte, sodass sie Kraft genug fanden, kein Geständnis abzulegen. Ohne Geständnis gab es keine Verurteilung, und somit kamen sie frei.
Geneve kümmerte sich auch um jene, die grausame und weniger schlimme Taten begangen hatten. Linderung hatten alle verdient. Manchen verabreichte sie auf eigenes Bitten ein berauschendes Mittel, um ohne Angst die körperliche Strafe zu erdulden, ebenso versorgte sie die Wunden nach Auspeitschungen und Prügelstrafen.
Einen Vorteil hatte es, als Ausgestoßene abseits zu leben: Es erleichterte jenen den Besuch, die heimlich Rat und Tat bei Geneve suchten. Mit etwas Vorsicht konnte man sich beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit ungesehen in die Bleibe der Cornelius begeben und sein Anliegen vortragen. Vorausgesetzt, man besaß die Mittel, den verlangten Lohn aufzubringen.
Catharina tolerierte es, Jacob missfiel es. Aber solange die Mutter ihre Stimme nicht dagegen erhob, konnte er nichts tun.
»Was meinst du mit Besonderheit?« Die junge Frau stellte sich dumm.
»Silber ist’s.« Geneve baute die zwei aufgestellten Lampen mit Blendspiegeln um, sodass sie beste Sicht in die klaffende Wunde hatte. Sie stocherte mit zwei langen Nadeln geschickt im verbrannten Kanal, den das Projektil gezogen hatte, und bekam den Splitter zu fassen. Hab ich dich! »Außerdem wär’s eine ungewöhnliche Art für einen Freier, dir die Bezahlung für deine Liebesdienste mit Pfeilen unter die Haut zu stechen.«
Die Verletzte begehrte gegen die Unterstellung nicht auf.
Behutsam zog Geneve das Fragment heraus, das sich als abgebrochenes Stück eines Blasrohrpfeiles entpuppte. Das Blut daran kochte und blubberte, bis es eintrocknete und in kleinen Plättchen auf die Dielen rieselte. Der unwiderlegbare Beweis: Vor ihr saß eine Wer-Kreatur.
Die namenlose Hure atmete erleichtert auf. »Danke.«
»Es müsste nichts mehr drin sein.« Geneve legte die Spitze zu den anderen in ein Glas mit Branntwein, spülte die Wunde mit einer Kräuterlösung, welche die Wirkung des Silbers reduzierte, und tupfte sie trocken, um danach eine Tinktur hineinzutröpfeln. »Das wird deine Selbstheilungskräfte unterstützen«, erklärte sie und entfernte den Spreizer.
Schweigend vernähte Geneve die Stelle mit drei Stichen und legte ihrer Kundin einen Verband an. Erst dann strich sie die Münze ein. So hielt sie es immer. »Du bist frisch ins Hurenhaus. Stimmt’s?«
Die junge Frau nickte vorsichtig.
Sie ahnt, dass es vor mir wenig Geheimnisse gibt. »Du weißt, dass mein Bruder im Auftrag des Rates die Aufsicht dort führt? Du hättest dich bei ihm vorstellen müssen.«
Sie zog schüchtern das Kleid hoch und schloss es. »Ich hätt’s noch getan.«
Ihre Scham, sich vor der Heilerin zu entblößen, war nicht vorgespielt. Die Wandlerin konnte noch nicht lange zu den Liebesdienerinnen gehören. Vermutlich hatte Geneve eine Ausreißerin vor sich, die sich ihrem Rudel nicht unterordnen wollte und sich im Hurenhaus versteckte.
»Solche winzigen Pfeilchen nutzt man nicht, um Wandler zu töten.« Geneve nahm das Glas und ließ die Spitze im Alkohol kreisen. So etwas tut man, um sie zu ärgern. Entweder um sie in ihre Tiergestalt zu zwingen oder sie zu vertreiben. Als Warnung, sich nicht wieder blicken zu lassen.
Die Eingangstür tat sich mit Schwung auf, und Jacob trat ein. Er hatte einen dunkelbraunen Ledermantel angelegt, dessen Kragen bis zum Hinterkopf reichte. Unter dem ausladenden Hut, dessen Krempe seitlich in die Höhe gebogen war, wurde sein Gesicht im Schatten unkenntlich und gab ihm etwas von einer grimmigen Spukgestalt.
»Alle Wetter«, fluchte er. »Wieso ist’s bereits im Oktober so kalt?«
Prompt wich die junge Frau mit einem leisen Schrei vor ihm zurück.
»Erschrick unseren Gast nicht so«, mahnte Geneve. »Sie hält dich gewiss für den Gevatter.«
»Bin nur sein irdischer Bruder, der Henker.« Jacob lachte unter dem Kragen und zog zuerst den Hut, dann den Mantel aus; beides hängte er an den Haken hinter der Tür. »Wo ich bin, ist der andere nicht weit.«
»Gute Laune brachtest du von draußen. Trotz der Kälte. Wie kommt’s?«
»Den Ratsherrn Mahler traf ich, und der ließ mich wissen, dass ich Wölfe in den Wäldern jagen soll.« Jacob, gekleidet in exquisites Wildleder und mit einem bestickten Wams über seinem teuren Hemd, setzte sich und streckte die Hand nach dem Glas mit dem Branntwein aus. »Ein weiteres Mal. Die Hatz im Sommer war wohl nicht genug. Es fällt ein Stück Vieh nach dem anderen an den nimmersatten Reißzahn.«
Geneve hielt seine Finger fest und deutete auf den Silbersplitter darin. »Trink’s nicht. Es würd dir auf den Magen schlagen.«
»Oh, meiner Treu! Ich seh’s.« Er nahm sich den geöffneten Krug und trank einen Schluck daraus. »Diese Wolfsplage ist besonders arg. Ich denk, ich such mir Leute, die es besser können als Hinz und Kunz, die mir der Rat aufschwatzen wollt. Und Mühlmann, der städtische Jäger, taugt nichts. Der trifft nicht mal auf zehn Schritte einen mümmelnden Hasen.« Seine hellen Augen richteten sich auf die junge Unbekannte mit dem rötlich kastanienfarbenen Haar. »Wer ist dies schöne Kind?«
»Amalia ist mein Name, Meister Cornelius.« Sie deutete eine Verbeugung an.
Jacob nickte auf die Silberreste. »Und eine Wandlerin.«
»Ja.«
Geneve begann mit dem Aufräumen. Die Gläser mit den Tinkturen, Lösungen und Kräuteressenzen wanderten zurück in das Kästchen, das sie als Gestellrucksack tragen konnte, um auch durch unwegsames Gelände zu ihren Kunden zu gehen. Verbandsleinen kam in die Schubfächer, die Instrumente wusch sie mit Branntwein ab.
Sie hatte ihren Teil getan, jetzt musste sich die Hure mit ihrem Bruder einigen. Wie so oft überließ man den Henkern den unschönen Teil des Lebens. Oder besser gesagt den anrüchigen, lästigen und anstößigen.
»Ich rieche bekanntes Räucherwerk an dir.« Jacob lehnte sich nach vorne. »Du bist ein Freudenmädchen? Wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet?« In seiner Stimme lag Unmut. Das bedeutete Schläge für Amalia. »Die anderen Huren werden dir gesagt haben, wohin du dich zu wenden hast.«
»Sie kam just deswegen zu uns«, griff Geneve ein. Wenigstens die Hiebe will ich ihr ersparen. »Auf dem Weg hierher geschah der Angriff.«
»Dann muss sie am Lager der Manouches-Herumtreiber vorbeigekommen sein.« Mit einem Griff hatte er den Arm des Mädchens geschnappt und verdrehte ihn, sodass er ihr Armband besser sehen konnte. »Orientalisch. Wie’s Vaganten gerne tragen. Sag, hast du’s dir geborgt und wolltest es bei Gelegenheit retournieren?«
Aber natürlich! Nun wusste Geneve, wer Amalia mit Silberpfeilen beschossen hatten. Die Vaganten, für die es ein Dutzend Namen und Begriffe gab, mal abfällige, mal redliche, von Cinti über Cigani bis Roma und Manouches, hatten die Wandlerin vertrieben, nachdem sie sie beim Stehlen erwischt hatten. Da niemand der Stadtoberen auf die Anzeige eines Vaganten reagierte, halfen sie sich selbst.
»Nein. Gefunden hab ich’s. Und was man findet, das darf man behalten«, widersprach Amalia. »Im Hurenhaus putz, koch und wasch ich. Mehr nicht, Meister Cornelius.«
»Werd bald erfahren, was es mit deinem Fundstück auf sich hat.« Jacob bedachte sie mit einem gierigen Blick. Ein Finger seiner Hand, die ihren Arm bannte, fuhr zärtlich über die ungewöhnlich weiße Haut. »Sag, wer hat dich eingestellt?«
»Die werte Frau Gut, Meister Cornelius.«
»Dann mag sie dich auch bezahlen. Ich seh keine Notwendigkeit für ein Waschweib und leg dir nicht einen Groschen hin.« Seine sinkende Laune verlangte nach einem weiteren Schluck vom Branntwein. »Wenn du mir Ärger im Hurenhaus machst, Wandlerin, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Das mein ich, wie ich’s dir sage. Und gefundene Sachen«, er ließ ihre Hand los, »hast du bei mir zurückzugeben.«
»Ja, Meister Cornelius.«
Wie beiläufig legte sich Jacobs Rechte auf den Griff seines Dolches. »Treibt sich dein Rudel in den Wäldern herum?«
»Ich hab keins und bin eine freie Seele.«
»Umso besser. Dann müssen sie sich nicht zum Teufel scheren, wenn ich die Wölfe jage. Sollt ich einen von deinen erwischen, ist er fällig wie der Isegrim. Sag es jedem, den du triffst, Amalia.« Er erhob sich und zog das luxuriöse Wams glatt. Jacob scherte sich nicht um die vom Rat vorgegebene Kleiderordnung. »Ich denk bei mir, dass es einer von den Eurigen war, der den Bauern das Vieh zerfetzt. Das wird beendet. Die Manouches-Vaganten verstehen sich aufs Zur-Strecke-Bringen.« Warnend klopfte er gegen das Glas mit den Silberpfeilen. »Hast du mich verstanden?«
»Ja, Meister Cornelius.«
Geneve hatte das Aufräumen beendet. Sie mochte die Angeberei und Wichtigmacherei ihres Bruders nicht, vor allem nicht gegenüber jenen, die sich kaum zu wehren wussten. Zu gern hätte er die junge Frau eingeritten, aber da sie vorgab, nur häusliche Tätigkeiten zu verrichten, blieb sie von ihm verschont.
»So, nun ist’s genug mit deiner Predigt. Sie weiß jetzt, dass du böse und gefährlich bist«, fuhr Geneve ihm dazwischen, als Jacob erneut Luft für das Finale seines Monologs schöpfte. »Geh zu Bette.«
»Mein gütiges Schwesterherz. Warne du die Wandlerbrut auch. Nicht, dass sie später heulend angekrochen kommen und du sie flicken musst, weil ihnen der Pelz brennt.« Jacob stapfte die Stufen hinauf, wo sein Zimmer lag. »Morgen geht es los.« Dann war er verschwunden.
»Ein Arsch, ich weiß.« Geneve setzte sich erneut zu Amalia. »Du bist keine Wölfin. Was dann? Füchsin?«
Die junge Frau machte große Augen. »Wie hast du’s erraten?«
»Mit Raten hat’s nichts zu tun.« Geneve lächelte und löschte eine der Lampen, die anderen drehte sie herab. »Auf deinem Rückgrat sah ich einen schwachen rötlichen Flaum, zart und weich. Das hat kein Wolf. Und du bist zu zierlich. Selbst die schlanksten Wölfinnen, die ich kenne, sind muskulöser gebaut.«
»Wir Füchse brauchen selten Kraft.« Amalia lächelte. »Meinen Dank für deine Geduld und deinen Beistand. Eben.«
»Ach, wegen meines Bruders? Das kenn ich schon. Er macht sich gerne wichtig, und obendrein hätt er dich gern gepflügt.«
»Das wird nicht geschehen.« Amalia stand vom Stuhl auf und ging langsam zur Tür, wo ihr zerrissener Mantel hing. Ihre Schritte verzögerten sich. »Dürft ich dich um einen Gefallen bitten?« Sie blieb stehen und wandte sich um. »Ich weiß, du nimmst für jeden Handschlag Geld. Und für jeden Rat.«
»Was mein Recht ist.« Geneve sah Amalia an, dass sie sich fürchtete. Sie will nicht alleine gehen. »Sind die Manouches noch draußen? Warten sie auf dich?«
Das Haus der Familie Cornelius war neutraler Boden. Denn hier gingen Ausgestoßene und Kriminelle, gute Bürger und Bettler, aber vor allem die Wesen der Dunkelheit ebenso ein und aus wie alle anderen. Was sie außerhalb dieser vier Wände trieben, ob sie sich bekämpften und zerfetzten, ging Geneve nichts an. Sie hielt sich aus den Händeln raus. Sie half als Heilerin allen gegen das passende Entgelt und verstand sich als Ausgleich.
»Möchtest du, dass ich dich begleite?«
Zu ihrer Verwunderung schüttelte Amalia den Kopf. »Ich würde dich bitten, dass du den Manouches ausrichtest, sie sollen kein Silber bei der Wolfsjagd benutzen. Auch wenn’s dein Bruder befiehlt«, sprach sie mit gesenkter Stimme.
»Vaganten müssen ihr Geld verdienen wie du und ich. Wenn mein Bruder es ihnen zur Auflage macht, wissen sie zudem, dass sie mit Wandlern rechnen müssten.«
Amalia langte in ihr Kleid und zauberte eine weitere goldene Münze hervor. »Das sollte reichen, dass sie so tun, als würden sie Argentumkugeln und -pfeile einsetzen. Mehr können sie bei deinem Bruder nicht verdienen, auch nicht mit den Pelzen.«
Mit hochgezogener rechter Braue nahm Geneve die Münze. »Das ist sehr viel Lohn.«
»Denkst du, sie lassen mit sich reden?« Amalia wirkte angespannt und tief besorgt.
»Ich kann es versuchen.« Ein kleines Rätsel steckte hinter der Bitte. Warum wollte die Fuchswandlerin, dass niemand in Gefahr geriet, auch wenn sie weder von hier stammte noch eine Wölfin war? Geneve sah Amalia an, dass sie auf diese unmittelbare Frage ausweichen würde.
»Ich begleite dich«, entschied sie spontan und warf sich ihren Mantel um. Vielleicht ergibt sich unterwegs eine klärende Unterhaltung.
»Sehr freundlich von dir.« Amalia war erleichtert.
Die schwarze Seite von Geneves Umhangs deutete nach außen, die feuerrote trug sie nach innen. Sie zeigte sie, wenn sie sich durch die Gassen und Straßen der Stadt bewegte, damit man ihr ausweichen konnte, um nicht mit ihr in Berührung zu kommen. Zudem trug sie dabei eine Schelle am Fuß, damit ein jeder Mann und eine jede Frau sie kommen hörte. Als Henkerstochter war sie unehrlich wie Mutter und Bruder. Und wer sie anfasste oder touchierte, übernahm diese Unehrlichkeit, bis sie durch geistliche Segnung aufgehoben wurde. Bei diesem Gang durch die Nacht jedoch war Schwarz die bessere Wahl.
Gemeinsam traten sie hinaus in die sternenklare Herbstnacht. Bodennebel stemmte sich aus den Wiesen und zauberte einen schimmernden Schleier über das Gras. Eulen streiften auf der Suche nach Beute als geräuschlose Schatten durch die Luft, ein Käuzchen schrie von weiter her.
Als ein Fuchs bellte, musste Amalia lachen. »Nein, das ist keiner, den ich kenne!«
Geneve lächelte. Ein halbes Kind ist sie noch. »Seit wann bist du in dieser Gegend?«
»Im Wald seit einem halben Jahr. In der Stadt erst diese Woche.« Sie zupfte am Mantel herum. »Es wurde mir zu kalt, und wenn ich die Annehmlichkeiten eines warmen Bettes und eines Feuers nutzen kann …«
»Ausgerechnet in einem Hurenhaus?« Geneve überlegte, wie unerfahren die Fuchswandlerin war. »Bist du sicher, dass du dort überwintern willst?«
»Es ist nicht meine erste Arbeit.« Amalia sah sich die ganze Zeit um, während sie sich vom Stadtrand auf das Tor zubewegten. »Ich verdingte mich schon als Marketenderin. Das war weitaus schlimmer.«
»Wie kommt es, dass –«
Unvermittelt sprangen zwei Maskierte in einfachen Gewändern aus dem Unterholz und reckten ihre gezogenen Dolche gegen die Wanderinnen. Ringe und Bänder blinkten im Mondlicht auf, die dunklen Haare lagen größtenteils unter bestickten Kappen.
»Das ist sie«, sprach eine Frau mit rauer Stimme durch das dunkelrote Tuch vor Mund und Nase. »Sieh! Das Armband! Ich habe es nicht verloren. Sie stahl es!«
»Ich fand es!«, rief Amalia sofort kämpferisch. »Ohne Gravur könnt es gar jedem gehören. Warum nicht mir?«
»Und wenn ich dich absteche, dann ist’s mein. Ohne Gravur«, schnarrte die Räuberin streitlustig. »Ihr haltet Euch raus, Meisterin Cornelius, darum bitt ich. Mit Euch habe ich keinen Ärger.«
»Ich bin keine Meisterin.« Geneve schob sich vor Amalia. Und ich lasse kein Leid zu. Es wird sich anders lösen lassen. »Die Maskerade kannst du sein lassen. Ihr gehört zu den Manouches, die mein Bruder anheuerte. Zur Wolfsjagd.«
Der Mann und die Frau zogen die Tücher herab und zeigten ihre sonnengebräunten Gesichter. Sie waren beide um die dreißig, die Ohrläppchen voller Creolen und Perlenanhänger. Ihm stand ein stattlicher Bart um die Wangen, der sich um das Kinn verjüngte.
»So lässt sich’s doch gleich besser reden.« Geneve blieb bewusst freundlich. »Hast du Beweise, dass das Armband dir gehört?«
»Habt Ihr den Verstand verloren? Es ist meins!« Die Manouche zog den Ärmel zurück und wies auf eine umlaufende helle Stelle zwischen dem sonstigen Schmuck an ihrem Handgelenk. »Hier saß es, Jahr um Jahr, Tag um Tag. Versucht es! Ihr werdet sehen, es passt haargenau. Auch die durchbrochenen Stellen. Mein Mann wird’s bezeugen, und ich schwör’s auf Isis.«
Geneve wandte sich zu Amalia. »Würde dir das als Beweis genügen?« Sie senkte die Stimme leicht, damit nur Amalia sie hörte. »Bedenke: Es könnt gute Auswirkungen auf dein Anliegen haben, zeigtest du dich einsichtig. Die Sache mit den Silbergeschossen.«
Seufzend zog die Wandlerin das Armband ab und warf es der Manouche zu, die es sogleich anlegte.
Geneve prüfte den Sitz und die Abdrücke, die sich durch die Sonne gebildet hatten. »Es stimmt.« Sie richtete den Blick vorwurfsvoll auf die beiden Angreifer, die ihre Messer verstaut hatten. »Was sollten die Silberpfeile, mit denen ihr nach Amalia geschossen habt?«
»Eine Lektion. Die kleine Diebin sollte lernen, dass man uns nicht bestiehlt. Zwei Dutzend weit’re hab ich noch. Die hätt sie gleich zu spüren bekommen. Gespickt, von oben bis unten.« Die Manouche machte noch immer ein grimmiges Gesicht. »Beim nächsten Mal rückst du heraus, was nicht dein ist.«
»Sagt eine Vagantin«, erwiderte Amalia giftig und bleckte die Zähne. »Wo ihr seid, fehlt die Wäsche auf der Leine. Kinder stehlt ihr aus der Wiege!«
»Dich hätten wir darin erschlagen«, gab die Manouche mit einem bösen Lachen zurück. »Diebische Wandlerin!«
So schnell verfliegt die gute Stimmung. »Wo wir gerade dabei sind, innige Freundschaft unter Ausgestoßenen zu schließen«, warf sich Geneve in den verbalen Schlagabtausch. »Ein Anliegen hätt ich.«
»Welches, Meisterin Cornelius?« Der Manouche hatte hörbar keine Lust auf die Streiterei um ein Armband. Vermutlich war er als Gemahl zum Mitmachen verdonnert worden. »Und wie trefflich, dass wir Euch begegnet sind, mag ich noch erwähnen. Wir bräuchten Eure Kunst. Da wir gegenseitig etwas voneinander möchten, ließe sich ein Tauschgeschäft machen.«
»Erst bedroht ihr mich mit euren Klingen, dann hofft ihr, dass ich euch beispringe?« Geneve lächelte, um zu zeigen, dass sie es den Vaganten nicht krummnahm.
Leider hatte sie nicht herausfinden können, weswegen die Wandlerin auf den Silberverzicht drängte. Der Angriff der Manouches hatte das Nachhaken verhindert. Vielleicht ein Liebhaber in den Reihen der Werwölfe, von dem keiner erfahren darf? Die Rudelanführer sahen solche gemischten Liaisons nicht gerne. Die Fuchswandler hatten die Wölfe in der Vergangenheit oft genarrt und für eigene Ziele eingespannt, um sie danach leer ausgehen zu lassen.
»Es war nur Theater.« Der Manouche deutete eine Verbeugung an. »Ich bin Ferenz, das ist mein Weib Sedra. Und um ehrlich zu sein, waren wir auf dem Weg zu Euch. Wir hörten eure Stimmen und versteckten uns, um zu sehen, wer sich nähert.«
»Mein Einfall war’s«, gestand Sedra. »Der Überfall. Um diese Elster einzuschüchtern und mein Eigentum zurückzubekommen.«
»Das ist nun geschehen.« Geneve zog verdeckt die Goldmünze, die Amalia ihr überlassen hatte. »Zum einen lasst ihr mir Amalia in Ruhe. Ihr habt das Band zurück.«
»Selbstverständlich.« Ferenz legte einen Finger auf ein kreuzförmiges, bemaltes Holzamulett, das er um den Hals trug. »Ich schwör’s auf die Schwarze Madonna.«
Er rempelte seine Frau an, die es ihm widerwillig nachtat.