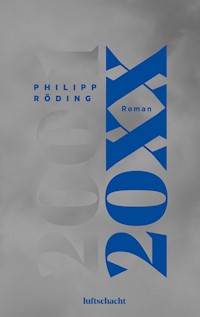Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Filmemacherin, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Eine Telefonseelsorgerin, die in ihren Nachtschichten um das Überleben ihrer Anrufer kämpft. Ein Unbekannter, der im Internet einer Pornodarstellerin seine Liebe gesteht. Und ein junges Liebespaar, deren gemeinsame Zeit wohl kürzer ist, als es einer der beiden vermuten würde. All das hängt mit allem zusammen, aber wie? In seinem Romandebüt "Die Möglichkeit eines Gesprächs” beschreibt Philipp Röding die innere Zerrissenheit junger Menschen, erzählt uns von ihren Hoffnungen und Ängsten, ihrer Liebe und ihrem Sex. Dabei ist er stets ganz nah an seinen Charakteren, zeigt sie uns ungeschminkt in all ihrer Zerbrechlichkeit und erörtert über sie den einzigen Ort wahrer Begegnung: das Gespräch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eine Filmemacherin, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Eine Telefonseelsorgerin, die in ihren Nachtschichten um das Überleben ihrer Anrufer kämpft. Ein Unbekannter, der im Internet einer Pornodarstellerin seine Liebe gesteht. Und ein junges Liebespaar, deren gemeinsame Zeit wohl kürzer ist, als es einer der beiden vermuten würde. All das hängt mit allem zusammen, aber wie?
In seinem Romandebüt Die Möglichkeit eines Gesprächs beschreibt Philipp Röding die innere Zerrissenheit junger Menschen, erzählt uns von ihren Hoffnungen und Ängsten, ihrer Liebe und ihrem Sex. Dabei ist er stets ganz nah an seinen Charakteren, zeigt sie uns ungeschminkt in all ihrer Zerbrechlichkeit und erörtert über sie den einzigen Ort wahrer Begegnung: das Gespräch.
PHILIPP RÖDING, * 1990 in Stuttgart, wuchs in Süddeutschland auf. Studium der Filmtheorie in Wien, Frankfurt am Main und an der University of Illinois. Er ist Guest Lecturer am Van-Gurp Institut Berlin-Weißensee und lebt in Wien.
Titel bei Luftschacht:
Die Stille am Ende des Flurs (Erzählungen, 2013)
Die Möglichkeit eines Gesprächs (Roman, 2017)
Philipp Röding
Die Möglichkeit einesGesprächs
Roman
© Luftschacht Verlag – Wien
Alle Rechte an der deutschsprachigen Ausgabe vorbehalten
1. Auflage 2017
www.luftschacht.com
Umschlaggestaltung: Matthias Kronfuß – www.matthiaskronfuss.at
Satz: Luftschacht
ISBN: 978-3-902844-97-2eISBN: 978-3-903081-55-0
My symptoms control the discourse.
Geschrieben mit schwarzem Filzstift,
an die Kabinentür einer Damentoilette,
am Flughafen Kopenhagen.
Inhalt
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Epilog
Prolog
Werner Herzog, der wohl berühmteste Vertreter des Neuen Deutschen Films, trägt Shorts, Flip-Flops, ein ziemlich abgetragenes Hawaiihemd und fragt Maya, ob sie eigentlich gern einen Eistee hätte. Eine ganze Weile sagt keiner von beiden etwas und die Frage dreht sich um sich selbst wie eine Ananas in der Schwerelosigkeit.
„Er liegt jetzt seit zwei Wochen im Kühlschrank und wird genau die richtige Temperatur haben.“
Maya schüttelt den Kopf und antwortet „Nein. Nein danke, ich hasse dieses Gefühl, dass einem … wenn einem das Gehirn so weh tut.“
„Der Brainfreeze? Wirklich? Ich liebe das.“
Dieser fast durchsichtig gewordene bayerische Dialekt, in dem Herzog sich ausdrückt. Der Breynfries. Maya schüttelt den Kopf. Dass dieser sehr alte Mann in die Höhlen von Chavet eingestiegen ist, um dort Das Erwachen der Seele des modernen Menschen zu filmen, dass er dreißigtausend Ratten auf eine niederländische Kleinstadt losgelassen hat und jetzt im Freizeitoutfit in seiner Kitchenette steht und die Farbreflexe des Eistees im Gegenlicht prüft, als sei auch darin ein Mythos enthalten, dem es bei Gelegenheit gilt, auf den Grund zu gehen …
Es ist mild, die Fenster stehen offen, die Vorhänge wehen herein. Hügel, rotbraune Felsen, die Kiefernwälder von Kalifornien. Das Orange County im Bernsteinlicht des US-amerikanischen Nachmittages und ein Wind, der sich anfühlt, als hätte man ihn mit Weichspüler gewaschen.
Es gibt keine befestigte Straße hierher. Man muss das Auto weiter unten abstellen und geht dann einen Feldweg entlang, bis das Haus irgendwann zwischen den Baumwipfeln auftaucht wie eine brauchbare Idee. Die Südseite ist komplett verglast. Das sei jetzt sein Kino, hat Herzog ihr zu verstehen gegeben, als man auf einem Sofa aus sandfarbenem Wildleder Platz nahm.
Auf einem Glastisch vor ihnen steht ein Schachbrett, auf dem kunstvoll geschnitzte Figürchen ihren Einsatz erwarten. Maya greift sich den weißen Springer und betrachtet ihn eingehend. Ein kleiner, hölzerner Ritter, der sie wiederum ernst und ein bisschen beleidigt ansieht.
„Spielen Sie?“
Maya verneint und stellt den Springer zurück in die Lücke zwischen Läufer und Turm.
„Ich eigentlich auch nicht. Ich finde, Schach ist ein reichlich dummes Spiel. Warum nur gilt es als intellektuell, sich damit zu befassen? Mir ist das ein Rätsel. Ich finde das Brett einfach schön. Die Figuren, sie wirken, als ob sie lebendig wären, nicht?“
Die Eiswürfel in Herzogs Glas klimpern. Ein gefrorenes, kleines Glockenspiel. Er schaut aus dem Fenster.
„In dieser Gegend hier haben früher Indianerstämme gesiedelt, Muwekma Ohlones, Chemehuevis, ein paar aus den Great Plains abgewanderte Shoshonen. Immer wieder entdecken Wanderer bemalte Scherben oder Reste von Werkzeug. Die Indianer jagten Wild in den Kiefernwäldern oder fischten in den zahlreichen kleineren Gewässern. Wie überall betreiben ihre Nachfahren inzwischen Casinos, trotzdem habe ich das Gefühl, ihre Geister leben noch immer hier. Ich spürte gleich, dass ich mich hier niederlassen will. Die Abgeschiedenheit erinnert mich an meine Kindheit im Chiemgau, nur das Klima ist freilich angenehmer. Ich bin nicht einmal einsam, hin und wieder machen ein paar Studenten aus Stanford einen Ausflug hierher und ich bewirte sie dann. Ein paar hundert Meter weiter hat Jack Nicholson sein Haus. Jack. Manchmal kommt er rüber, dann reden wir oder grillen uns ein paar Koteletts. Ich mariniere sie mit gehacktem Basilikum und Zitrone. Das schmeckt schön frisch.“
Herzog betrachtet gedankenverloren sein Glas.
„Ich hätte nie gedacht, dass aus mir einmal ein sogenannter gastfreundlicher Mensch werden würde. Fast mein ganzes Leben lang habe ich menschlicher Gesellschaft misstraut und sie nach Kräften gemieden. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht ein Fehler war. Na ja.“
Dann geschieht eine Weile lang nichts, Werner Herzog und Maya schauen einem Greifvogel zu, der die nachmittägliche Thermik ausnutzt und hoch über den Hügeln seine Kreise zieht.
„Ich habe mich von den Menschen immer nur angegriffen und verletzt gefühlt. Immer hatte ich das Gefühl, mich zur Wehr setzen zu müssen. Erst jetzt beginne ich zu begreifen, wie anstrengend das gewesen ist, und wie sehr es an meinen Kräften gezehrt hat. Dennoch, wenn man recht darüber nachdenkt, kommt einem diese Haltung doch durchaus gerechtfertigt vor, finden Sie nicht?“
„Ich weiß nicht, ob ich Ihnen zustimmen möchte.“
„Sie haben einen Film gemacht? Ich meine, davon gelesen zu haben. Gesehen habe ich ihn natürlich nicht, ich gehe ungern ins Kino und zu Festivals schon gar nicht. Man hat ihn beim Telluride-Festival gezeigt, wenn ich richtig informiert bin.“
Maya nickt. Der Greifvogel hat sich mit einem Mal fallengelassen, er sinkt so schnell, dass man das Gefühl hat, das Tier sei in der Lage, die Gesetze der Erdanziehung zu seinen Gunsten zu manipulieren. Dann fängt er sich kurz vor dem Boden ab. Wahrscheinlich kam ihm sein Anflug noch nicht perfekt genug vor.
„Ich war nicht in Telluride. Entgegen anderslautender Gerüchte. Ich finde Festivals einfach nur entsetzlich. Es hat mir immer Spaß gemacht, Geschichten zu erzählen, aber das ganze Bohei ist unerträglich. Haben Sie denn was gewonnen?“
„Es wurden keine Preise vergeben, es gab nur diese Medaillen aus Papier für … es war unsinnig.“
„Wie? Na ja, machen Sie sich nichts draus. Es ist wirklich ganz gleichgültig, ob man etwas gewinnt oder nicht. Fälschlicherweise wird angenommen, diese Preise seien ein Zeichen dafür, dass die Leute das eigene Schaffen aufrichtig bewundern und dieser Bewunderung Ausdruck verleihen wollen. In Wahrheit jedoch ist man den Leuten einfach nur egal, wie ihnen eigentlich alles egal ist. Sicher, man geht schon mal ins Kino, aber das hat schlicht und einfach den Grund, dass es unerträglich wäre, sich permanent der eigenen Langeweile auszusetzen. Ein Film gaukelt dem Publikum das Gefühl vor, bedeutsame Momente zu bezeugen. Es geht darum, einen Mangel an Erfahrung auszugleichen. Damit beginnt und endet diese Kunstgattung. Ich halte das für wenig zielführend.
Wenn ich Ihnen einen Rat geben kann: Stellen Sie niemals etwas her, sei es ein Film oder irgendwas anderes, von dem nicht nach zwanzig Sekunden klar ist, wie es funktioniert. Sie sollten das vermeiden. Um Ihretwillen.“
Herzog spricht, als halte er ein Plädoyer in einem schon Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte lang andauernden Gerichtsverfahren, in dem eine Entscheidung nicht mehr erreicht, sondern nur mehr erzwungen werden konnte.
„Nein, nein. Das einzig wirklich Wichtige ist, regelmäßig Wasser zu trinken und vielleicht mal ein Stück Obst zu essen. Das genügt. Ich musste über achtzig Jahre alt werden, um zu begreifen, dass es nicht nötig ist, sich darüber hinaus mit irgendetwas zu beschäftigen.“
Er sieht sie an wie jemand, der feststellt, eine Schraube zu fest angezogen zu haben.
„Ach. Wie dem auch sei. Der Wunsch, komplexe und teils sogar merkwürdige Geschichten zu erzählen, der mich ja selbst durch mein ganzes Leben hindurch getragen hat, war im Grunde genommen von einer tiefen Aussichtlosigkeit geprägt, inzwischen ist mir das klar geworden. Es hat sich doch nie jemand wirklich für mich oder meine Arbeiten interessiert.“
Maya fragt sich, ob der Regisseur von Auch Zwerge haben klein angefangen und Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner auf seine alten Tage nicht vielleicht von einer handfesten Depression heimgesucht wird, ein Verdacht, der sich erhärtet, als sie im Badezimmerschränkchen verschiedener Psychopharmaka ansichtig wird: Pillen, Tropfen, sogar Zäpfchen. Hauptsächlich hoch dosierte Anxiolytika. Angstlöser.
Als sie aus dem Bad zurückkommt, hockt Herzog noch immer auf dem Sofa, er hat die Schultern angezogen und stützt sich mit beiden Handflächen ab, so als fürchte er, jeden Moment im Sitzen umzufallen. Am Horizont verglüht die Sonne, als hätte man die Tür eines Ofens geöffnet. Die langen Schatten der Bäume, der Menschen und Gegenstände. Herzog wirkt mit einem Mal wie eine zerbrechliche alte Blumenvase.
„Was wollen Sie eigentlich hier?“, sagt er, ohne sie anzuschauen.
„Warum sind Sie überhaupt hergekommen?“
Die Stille ist wie ein Schwitzkasten. Als der Körper des Regisseurs beginnt, nach vorne wegzukippen, schiebt Maya sich den Lauf der Waffe in den Mund, schließt die Augen und denkt an die Sterne.
Erster Teil
Like Someone in Love oder Die Arbeit am Menschen.
Communication is health; communication is happiness.
früher Werbeclaim der International Bell Telephone Company, jetzt Warteschleifenjingle des Telefonnotdienstes Recibo
1
Die Wahrheit ist, dass sich niemand wirklich für dich interessiert.
Zum Beispiel die junge Frau, die Jana anruft und erzählt, wie ihr ganzes Dasein von einer amerikanischen Dichterin bestimmt werde, deren Gedichte die Frau, eine Englisch-Tutorin wie sich auf Nachfrage herausstellt, allesamt wieder und wieder gelesen hatte, und nicht nur die Gedichte, sondern auch die Essays und die Interviews mit ihr (der Dichterin), und die Interviews mit denen, die die Dichterin interviewt hatten – denn ihr Ruhm strahlte auf alle ab, die ihr irgendwann einmal nahegekommen waren, und außerdem alle Kritiken und alle Preis- und Würdigungsreden auf die Dichterin, und das Tagebuch des Ehemanns der Dichterin, und Bibliotheken mit Sekundärliteratur, und sogar den schauerlichen autobiographischen Roman des Sohnes der Dichterin, und TV-Dokumentationen, und unzählige Internettagebücher von jungen Frauen und Männern, die sich auf ebenso krankhafte Weise mit der amerikanischen Dichterin zu identifizieren suchten, und mittlerweile habe ihre Verehrung ein derart perverses Ausmaß angenommen, so die junge Frau, dass sie im Gespräch mit ihren Freunden und Freundinnen eigentlich nur noch die Ansichten und Redewendungen der Dichterin wiedergebe, teils sogar wortwörtlich, also die Dichterin quasi durch sie sprechen ließe, dass sie auf eine Frage so antworte, wie die Dichterin auf ähnliche Weise in einem Interview geantwortet hatte, et cetera, und das wahrhaft Irritierende an der Sache sei, dass ihre Freunde und Freundinnen das anscheinend total gut fänden und ihr lobend konstatierten, plötzlich ein ganz neuer Mensch zu sein, eigentlich ganz sympathisch und zeitweise sogar witzig und spritzig und geistreich zu sein und nicht mehr diese unerträgliche, depressive Person. Und so bestärkt ihr ganzes Umfeld die junge Frau in ihrer sowieso schon gefassten Ansicht, dass es in jeder Hinsicht besser wäre, nicht sie selbst, sondern die amerikanische Dichterin zu sein, in jeder Hinsicht, dass diese Dichterin ein Maß an Würde und Menschenfreundlichkeit und literarischem Talent und Genie und allseits anerkanntem Charisma erreicht habe und im direkten Vergleich dazu die Persönlichkeit der Tutorin blass und unedel und einfach nur erbärmlich sei, und jetzt habe sich besagte Dichterin also umgebracht, indem sie sich in den kaltfrühen Morgenstunden eine letale Dosis Insektenspray direkt in den Mund gesprüht habe, so als sei es ihr darum gegangen, einen endgültigen Kommentar zu Kafkas Verwandlung auszusprechen, und es wäre jetzt doch also ganz klar und eindeutig, was unter diesen Umständen zu tun sei, oder etwa nicht?
Und Jana, sie schließt diese Frau kurz, indem sie sie fragt: Ob es nicht möglich wäre, dass sich die von ihr verehrte Dichterin nur deshalb umgebracht habe, weil es ihr wiederum nicht möglich gewesen sei, ein ganz normaler, nicht-großartiger Mensch zu sein, also so zu sein wie zum Beispiel die Englischtutorin usw.
Um diese Uhrzeit ist wenig los. Vorabend: Die Leute sind am Weg nach Hause, warten an der Kasse im Supermarkt oder versuchen, in der überfüllten U-Bahn so wenig Raum wie möglich in Anspruch zu nehmen. Erst gegen zehn, halb elf, greifen sie zum Hörer. Jana nutzt die Zeit und absolviert im Sitzen einige gymnastische Übungen, schließt die Augen, legt den Kopf in den Nacken, rollt ihn hin und her.
Hierher gelangt man, wenn man R für Recibo wählt: sechzig Quadratmeter Teppichboden, angemietet in der Nekropole der Dienstleistung, Frankfurt-Fechenheim. Gegenüber einer FKKOase, wo Angestellte der mittleren Führungsebene versuchen, das Träumen wieder zu erlernen, vor einer schäbigen Südseeszenerie aus Schaumstoff und Plastik und einer geil rasierten Möse im Gesicht, die ihnen den Atem nimmt und den Zweifel. Hier hatte die Gemeinde Frankfurt sich entschlossen, den Telefonseelsorgedienst R für Recibo unterzubringen, ein von der öffentlichen Hand finanziertes Projekt, um der seit Jahren steigenden Selbstmordrate etwas entgegenzusetzen.
Jetzt teilen sich Nacht für Nacht zwei Mitarbeiter das dritte Geschoß eines ansonsten mieterlosen Zweckbaus aus den späten Achtziger Jahren, mit sepiaglänzenden Spiegelfenstern, die so schwarz sind, dass Jana einmal nachgesehen hat, ob es überhaupt Fenster sind. Sowohl Jana als auch Markus sind sich sicher, dass es im Gebäude Gespenster gibt und dass man deshalb zwischen drei und vier Uhr morgens nicht in den Spiegel der Damentoilette sehen sollte. Daran, dass die Heizung ständig ausfällt, gewöhnt man sich irgendwann. Das Gebäude entlädt sich, pflegt Markus dann zu sagen und zieht seine Kapuze enger. Die Kälte komme vom Ektoplasma.
Jana bleibt ruhig und sagt erstmal nichts, als ihr von 22:39 Uhr bis 23:20 ein Anrufer erzählt, dass seine unerfüllbare sexuelle Wunschvorstellung darin bestehe, mit einem kleinen Auto auf dem Körper einer Frau herumzufahren. Ein Auto, in etwa so groß wie eine Maus, und man selber darin so groß wie ein Käfer, und damit fahre man herum und verursache bei der Frau die wildesten sinnlichen Genüsse. Jana schweigt und hört zu, als der Anrufer fortfährt ihr zu erzählen, wie diese Phantasie ihn bei lebendigem Leib auffresse, weil er wisse, es sei unmöglich, sie wahr zu machen, weil es einfach nicht geht (er sagt das fast ein bisschen schrill, aber nur fast) und es sei auch nicht so wie bei anderen Phantasien, dass es irgendwie schön sei, wenn sie nicht einlösbar sind, es sei einfach nur eine unaufhörliche Quälerei und darüber hinaus gebe es niemanden, dem er das jemals wirklich verständlich machen könne, weil er sei sich ziemlich sicher, dass er der einzige Mensch auf der Welt mit dieser spezifischen Phantasie sei. Ob sie sich das vorstellen könne, wie das sei, auf diese lächerliche Weise von allen anderen Menschen auf dem Planeten getrennt zu sein. Entsetzlich sei das.
Sie könne sich vorstellen, sagt Jana dann, dass diese Phantasie ein Gegenstück habe, sie glaube an die grundsätzliche Dualität von Phantasien, es gibt diese Frau, die befahren werden will, die davon träumt, eine Straße zu sein, ziemlich sicher, und dann schweigt sie und sieht Markus zu, der wieder mal aufgestanden ist und mit seinem drahtlosen Headset um den Schreibtisch herumgeht, beidhändig gestikulierend wie Cicero. Hallo, sagt Jana, noch dran?
Markus, der in der Nachtschicht ihr Flügelmann ist, studiert tagsüber Informatik auf Master und macht über Fernstudium seinen BA in Filmtheorie. Er ist ein Fettleibiger des Apfeltyps, sein Torso ist eine einzige Wölbung. Ein Inselbewohner, der dir breit lächelnd sirupsüße Lieder auf der Ukulele vorspielt. Es ist scheißkalt wie immer und Markus trägt deswegen Sweatshirts in TripleXL, auf denen eisblaue Airbrushdrachen sich um vollbusige Frauen mit bronzener Haut winden, und ein kabelloses Pro-Gamer-Headset und lehnt sich weit in den Sessel zurück, wobei er die Arme hinter dem Kopf verschränkt wie jemand, der alles gesehen hat und alles gehört und alles als gleichwertig anerkennt.
Er ist schon lange dabei und kennt sich aus. Markus rettet die Leute, indem er ihren psychischen Kathodenstrahl woandershin ablenkt, irgendwohin, Hauptsache weg vom eigenen Bauchnabel. Er fragt sie, welchen Film sie zuletzt gesehen haben und welche Szene sie darin am meisten berührt hat.
Jana hat Markus gern, aber auch nicht mehr, als man eine Zimmerpflanze gern hat oder einen besonders nützlichen Gegenstand. Als sie ihm erzählt, wie sie mit sechzehn ihre Alice-im-Wunderland™-Zahnbürste geschluckt hat, weils ihr so scheiße ging, hat er laut gelacht und gesagt: Klassiker.