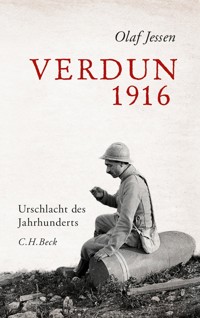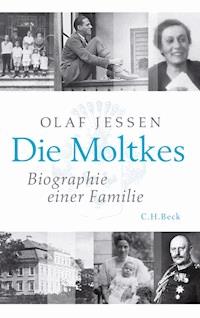
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Sprache: Deutsch
Olaf Jessen erzählt in seinem glänzend geschriebenen Buch aus dem Leben der Familie von Moltke, die wie keine andere in Militär und Politik die deutsche Geschichte geprägt hat. Zur Sprache kommen dabei auch die Frauen, von der Hofdame Königin Luises bis zu der kürzlich verstorbenen Widerstandskämpferin Freya von Moltke. Die Moltkes haben über sieben Generationen, vom Zeitalter Napoleons bis in unsere Gegenwart, eine führende Rolle gespielt: als Schlachtensieger und gescheiterte Weltkriegsstrategen, demokratische Regierungschefs und Innenminister des Kaisers, homosexuelle Komponisten und patriarchalische Gutsbesitzer, Botschafter des NS-Regimes und Widerstandskämpfer gegen Hitler, Investmentbanker in New York und Visionäre eines geeinten Europa. Helmuth von Moltke, der Sieger von Königgrätz und Sedan, wurde zur Ikone des Kaiserreichs, der Widerstandskämpfer Helmuth James von Moltke zur Identifikationsfigur einer demokratischen und weltoffenen Bundesrepublik. Olaf Jessens meisterhaftes Porträt des Adelsgeschlechts ist daher mehr als eine spannende Familiengeschichte: In den Moltkes spiegelt sich die preußische und deutsche Geschichte und das sich wandelnde Selbstverständnis einer Nation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Olaf Jessen
Die Moltkes
Biographie einer Familie
Verlag C. H.Beck
Inhalt
Einleitung
Erstes Kapitel:Am Anfang war Napoleon – Die Erfindung der Nation
Idee der Nation
Schill und die Moltkes
Merkmale der Adeligkeit
Strietfeld und Toitenwinkel
Die dänischen Moltkes
Die Moltkes in Mecklenburg
Friedrich Philipp von Moltke
Armee und Aufklärung
Henriette Paschen
Güterspekulation
Wechsel in dänische Dienste
Zweites Kapitel:Bildungshunger – Jenseits der Nationen
Krater «Moltke»
Moltke und Preußen
Kopenhagen
Im Dienst der Hohenzollern
«Demokratische» Wehrpflicht?
Ursprünge des Generalstabs
Jurist wider Willen
Geschwisterliebe
John Burt: «landed gentleman»
Hofdame in der Provinz
Drittes Kapitel:Unter dem Halbmond – Nation im Spiegel
Sekbān-ï-ğedīd
In den Gassen von Stambul
«Volkskrieg» in Kurdistan
Schlacht bei Nizib
«Briefe aus der Türkei»
Viertes Kapitel:Familienkongress – Zwischen den Nationen
Vormärz
Romantisches
Schleswig und Kiel
«Hotel Burt» Mary Burt
Louis und Mie von Moltke
Heirat in Itzehoe
Fünftes Kapitel:Revolution – Aufbruch der Nationen
«Offener Brief»
Deutsche Kanzlei
Aufruhr und Erhebung
Familie zwischen den Fronten
Landesversammlung
Gemeinsame Regierung
Berliner Mission
Sechstes Kapitel:Reaktion – Scheitern der Nation
Administrator in Rantzau
Fritz von Moltke
Nachkriegszeit
Helmuth und die Revolution
Siebentes Kapitel:Alsen – Verunsicherung der Nation
Helmuth und Marie von Moltke
Adjutant des Prinzen von Preußen
Tod des Squires
Chef des Generalstabs
Wandel des Kriegsbilds
Verfassungskonflikt
Krieg von 1864
Waffenstillstand
Eroberung von Alsen
Frieden von Wien
Achtes Kapitel:Zwei Kriege – Gründung des Nationalstaats
Schlacht bei Königgrätz
Landrat von Pinneberg
Tod Marie von Moltkes
«Kriegsrat» 1870
Industrialisierter Volkskrieg
Neuntes Kapitel:Moltke-Kult – Selbstbild der Nation
Olympische Höhen
Via triumphalis
Moltke als Erinnerungsort
Anton von Werner
«Generalstabs-Familie»
Nichten und Neffen
Tod des Feldmarschalls
Zehntes Kapitel:Wilhelminisches – Licht und Schatten der Nation
Wandel des Nationalismus
Kreisau: ein Wallfahrtsort
Kampf um das Erbe
Der nervöse Neffe
Im Umkreis Rudolf Steiners «paying guests»
Ernennung zum Chef des Generalstabs
Die Wende: Dorothy von Moltke
Elftes Kapitel:In den Abgrund – Katastrophe der Nation
Moltke-Harden-Prozess
Fin-de-siècle-Stimmung
«Germanentum und Slawentum»
Innenminister von Moltke
Expedition in die Antarktis
Scheitern der Wahlrechtsreform
Zwölftes Kapitel:Marne – Niederlage der Nation
«Kriegsrat» 1912
Moltke in der Julikrise
Oberpräsident von Schleswig-Holstein
Entlassung Helmuth von Moltkes
Kreisau im Krieg
Deutsche Gesellschaft 1914
Revolution in Kiel
Dreizehntes Kapitel:Kreisau und Wernersdorf – Krise der Nation
Familienärger
Moltke-Marne-Debatte
Gemischte Kommission
Davida von Moltke
Helmuth James von Moltke
Krise in Kreisau
Freya von Moltke
«In einem Irrenhaus»
Vierzehntes Kapitel:Widerstand – Verbrechen im Zeichen der Nation
Nichtangriffspakt
Tod Dorothy von Moltkes
Auf dem Obersalzberg
Polens «Schuld» am Krieg
Am Quai d’Orsay
Helmuth James versus Hans-Adolf von Moltke
Botschafter in Madrid
Volksgerichtshof
Fünfzehntes Kapitel:Weltfamilie – Wandlung der Nation
Stunde der Frauen
«Entnazifizierung»
Wahrnehmung des Widerstands
«Moltke macht Schule»
Das neue Kreisau
«Auferstehung»
Schluss
Anhang
Stammtafel
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Candide et CauteWahlspruch der Moltkes
Einleitung
Der Bitte seines Müsteschars mag Hafiz Pascha nicht entsprechen. Jeder Rückzug wäre schimpflich. Es sei ein strategischer Rückzug, beharrt der Müsteschar, oberster Ratgeber des Paschas, von den Türken «Baron Bey» genannt. Der Feind unternehme einen Flankenmarsch. Weiche man nicht aus, werde Hafiz Pascha seine Armee verlieren. Weiter östlich, im Lager von Biredschik, könne man auf eigene Verstärkungen und den Angriff der Ägypter warten. Doch der Feldherr hält den jungen Müsteschar für einen klugen, aber allzu vorsichtigen Krieger. Drängen nicht Sterndeuter und Wahrsager zum Kampf? Die Sache von Sultan Mahmût sei gerecht. Allah werde deshalb ihm, Hafiz Pascha, zum Sieg verhelfen, das Heer der Ägypter vernichten und Syrien für das Osmanische Reich zurückgewinnen; das verkünden Mollas wie Hodschas. Hafiz Pascha will die Stellung halten. Sein Ratgeber schickt sich ins Unvermeidliche. Ruhrkrank und zu Tode erschöpft, richtet er noch in der Nacht die Front neu aus, mutlos freilich, Schlimmes ahnend. Denn die Mängel des Heeres kennt der Müsteschar genau. Schließlich hat er selbst versucht, die Sekbān-ï-ğedīd, eine «neue Armee», nach westlichem Vorbild aufzubauen – vergebens. Der Islam, klagt er vor Vertrauten, halte den Orient stationär, mache aus dem Osmanischen Reich eine «Nation in Pantoffeln».[1] Jetzt verfügt das Korps von Hafiz Pascha, knapp dreißigtausend Mann, über russische Jacken, belgische Gewehre, ungarische Sättel, türkische Mützen, englische Säbel und arabische Kamele, nicht aber über preußische Disziplin.
Am 24. Juni 1839 beginnt der Kampf. Die «Schlacht» bei Nizib ist vor allem eine Kanonade. Hundertzwanzig ägyptische Geschütze feuern aus großer Entfernung Steilschüsse. Zahllose Kugeln stürzen langsam, in hohem Bogen, auf die Soldaten des Sultans herab. Munitionswagen explodieren, Menschen spritzen auseinander, Reiterei überrennt die eigenen Linien. Nach zwei Stunden ist die Kampfmoral gebrochen. Ganze Bataillone werfen die Gewehre fort, sprechen mit erhobenen Händen Gebete. Als zum Dienst gepresste Kurden auf die eigenen Anführer schießen, löst sich das Heer endgültig auf.
Fiebergeschüttelt, ohne Lebensmittel und seiner Karten beraubt, flüchtet Baron Bey in die Berge von Rumkaleh. Er gelangt nach Malatya und geht in Samsun an Bord eines österreichischen Dampfers. Über Konstantinopel will er die Heimreise nach Europa antreten. In zerlumpter Türkenkleidung, mit langem Bart, mager und abgezehrt, wird ihm der Zutritt in die Erste Klasse nur gewährt, weil er sich dem Kapitän auf Französisch vorstellt: Helmuth von Moltke, Militärberater des Sultans, Hauptmann im preußischen Generalstab.
Mehr als fünfzig Jahre später, an seinem neunzigsten Geburtstag, ist der Verlierer von Nizib neben Napoleon und Wellington der gefeiertste Feldherr des Jahrhunderts. Als Sieger von Königgrätz und Sedan, Geburtshelfer des Deutschen Reiches, Vollender des modernen Generalstabs, aber auch als erster Stratege des industrialisierten Volkskrieges begründet «Baron Bey» den Mythos einer Familie, die wie kaum eine andere die Geschicke der Nation mitbestimmt hat.
Als Schlachtensieger und gescheiterte Weltkriegsstrategen, demokratische Regierungschefs und Innenminister des Kaisers, Diplomaten des NS-Regimes und Widerstandskämpfer gegen Hitler, Botschafter der Bundesrepublik und Visionäre eines geeinten Europa haben die Moltkes über sieben Generationen, vom Zeitalter Napoleons bis in unsere Gegenwart, wichtige Rollen gespielt. Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke wurde zur Ikone des Kaiserreichs, der jüngere Moltke zum Symbol deutschen Scheiterns im Ersten Weltkrieg, der Widerstandskämpfer Helmuth James von Moltke zur Identifikationsfigur einer demokratischen und weltoffenen Bundesrepublik.
Bestimmt die familiäre Herkunft das Schicksal? Kein Zweifel: Noch immer werden Macht und Ansehen auch über den Einfluss von Familien errungen. Und die alte Vorstellung, besonders des Adels, dass sich Begabung vererbe, ist niemals untergegangen.[2] Während Pädagogen die prägende Kraft des Lernumfelds beschwören, gewinnt der Glaube an die Macht der Gene an Boden. Auch deshalb ist Ahnenforschung zum verbreiteten Hobby geworden.[3] Die Weitergabe familiärer Rituale, Aufträge und Werte, kurzum: die «Familienkultur», entfaltet eine hemmende oder auch eine treibende Wirkung. Wie sind den Moltkes der Aufstieg und das Obenbleiben gelungen? Und welche Rolle spielte ihre Familienkultur?
Das sind klassische Fragen der Elitenforschung. Aber die Geschichte der Moltkes führt auf weitere Felder. Denn wohl kaum eine andere Familie hat die Wechselbeziehung zwischen Krieg und Nation selbst so deutlich geprägt oder gespiegelt. Wer solchen Beziehungen nachspüren will, der sollte wissen: Nationen sind keine Ureinheiten der Geschichte. Jede Nation ist Idee. Und auf Ideen muss man kommen. Die nationale Idee entstand vor etwa 250 Jahren in den Schreibstuben europäischer Gelehrter. Massentauglich wurde sie erst auf dem Schlachtfeld. «Nationalstaaten sind», erkannte Norbert Elias, «in Kriegen und für Kriege geboren.»[4] Die Formen des Krieges und die Idee der Nation – beide beeinflussen einander und unterliegen geschichtlichem Wandel.
Den Chamäleon-Charakter nationaler Ideen haben Historiker vielfach nachgewiesen. Schwerer tut sich die Nationalismus-Forschung bisweilen damit, langfristige Bedingungen des Nationalen zu erhellen, vor allem die Erfahrung von Krieg, Bürgerkrieg und Revolution.[5] Wie haben die Moltkes den Wandel des Kriegsbilds und der Nationsidee über mehrere Generationen hinweg beeinflusst? Wie sind sie ihrerseits durch Umbrüche in der Geschichte des Krieges und durch wechselnde nationale Ideen geprägt worden?
Die Moltke-Familie, die aus mecklenburgischem Uradel stammt, hat Spuren in vielen Archiven hinterlassen, in der Bundesrepublik vor allem in Mecklenburg, Berlin, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Umso verblüffender ist es, dass eine deutschsprachige Familiengeschichte bisher aussteht. Das gilt auch für den Samower Zweig des Feldmarschalls, genauer: für die Nachfahren von Friedrich Philipp und Henriette von Moltke. Sie rückten besonders auffällig in das Spannungsfeld zwischen Krieg und Nation. Es liegt nahe, vor allem ihren Spuren zu folgen. Die brillante Studie Blood and Iron des amerikanischen Historikers Otto Friedrich beschränkt sich im Kern auf eine Dreifach-Biographie der «großen» Moltkes und schöpft überwiegend aus englischer Sekundärliteratur.[6]
Dabei sprudeln die Quellen nicht nur in öffentlichen Archiven. Ein Berliner Privatarchiv zum Beispiel verwahrt den unerschlossenen Nachlass Adolph von Moltkes, eines Bruders des Feldmarschalls, wie auch die bisher unbekannten Erinnerungen Davida von Moltkes, einer Schwester von Peter Yorck von Wartenburg.[7] Peter Yorck gilt neben Helmuth James von Moltke als Kopf der Widerstandsgruppe «Kreisauer Kreis». Im Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg schlummerten «Feldzugs-Erinnerungen» des jüngeren Moltke. Wer darüber hinaus Familien-Papiere aus dem Nachlass des älteren Moltke mit der häufig genutzten Druckfassung dieser Quellen vergleicht, stößt auf Verblüffendes. Wie so oft halten Archive auch mit Blick auf die Moltkes Überraschungen bereit.
Um historische Erfahrungen tatsächlich verstehen und sich aneignen zu können, müsse man «viel mehr ins Menschliche gehen, wenn man die Geschichte» befrage, forderte Freya von Moltke, Witwe von Helmuth James, denn: «Zukunft und Vergangenheit gehören zusammen.»[8]
ERSTES KAPITELAm Anfang war NapoleonDie Erfindung der Nation
Inmitten hinterpommerscher Weite rollt ein Zweispänner auf den Hof des Rittergutes Haseleu. Ein Herbststurm ist aufgezogen. Am Fuße der großen Freitreppe zügelt der Kutscher die Pferde. Unruhig tänzeln die Tiere. Zwei Offiziere springen aus dem Wagen. Während der eine, in seinen Mantel gehüllt, sich durch Auf- und Abgehen zu wärmen versucht, fliegt der andere die Stufen hinauf. Endlich kann er die Verlobte, siebzehn Jahre jung, umarmen. Sein Bild ziert landauf, landab Teller, Tassen, Tabakspfeifen und sogar Torten. Über seine Husarenstreiche redet man in Bauernstuben, Wachlokalen und Schenken. Hundertfach wandern Anekdotensammlungen von Hand zu Hand. Schuljungen ahmen seinen Haarschnitt nach. Mädchen sind stolz darauf, mit ihm zu tanzen. Wo er auftritt, läuft das Volk zusammen. Vor zwei Tagen ist er an der Spitze seines Husarenregiments in Treptow aufgebrochen. Nach dem Willen des dankbaren Herrschers soll er mit den Husaren die Hauptstadt als Erster wieder besetzen. Weil König Friedrich Wilhelm, der Besiegte, Wohlverhalten zeigt, hat Napoleon, der Sieger, ein Jahr nach dem Diktat von Tilsit seine Truppen aus Berlin abgezogen. Der Husarenmarsch wird zum Triumphzug. Kommen die Reiter in Dörfer oder Städte, läuten allerorts die Kirchenglocken. Der Besucher in Haseleu ist Preußens berühmtester Soldat: Ferdinand Baptista von Schill, zweiunddreißig Jahre alt, mehr Haudegen denn Stratege, «ein kleiner, untersetzter Kerl mit prächtigem Schnurrbart».[1]
Im Salon des kleinen Herrenhauses sagen die Verlobten einander Lebewohl. Die Hochzeit muss warten. Schill plant Unerhörtes: Er will einen Aufstand gegen Napoleon entfesseln; ein letzter Blick, dann fährt er ab, die Verlobte am offenen Fenster winkt mit dem Taschentuch. Da betritt ihre Mutter den Raum. Wind greift ins Zimmer, schlägt das Fenster zu, ein Säbel fällt von der Wand und stürzt klirrend zu Boden. «‹Oh, Mutter, sieh›, Schills Säbel, den er mit dem Vater tauschte, er fiel von der Wand, im Augenblick, als ich ihn unter den Bäumen verschwinden sah. Ach, er wird fallen in diesem Kampf, den er so glühend heraufbeschwört, ich werde ihn nimmer wieder sehen.›»[2]
So jedenfalls berichtet es ein Zeitgenosse achtundsechzig Jahre nach dem Abschied der Verlobten. 1876, fünf Jahre nach der Gründung des Kaiserreiches, steht der Schill-Kult immer noch in voller Blüte. Mit dem Schicksal der Moltkes ist der lange Ritt des Ferdinand von Schill über das Grab hinaus verwoben: Ein Moltke kämpft für Schill, ein anderer steht auf Seiten von Schills Feinden. Und ähnlich wie bei der Ikone des Kaiserreiches, Feldmarschall Moltke, oder einer Hauptfigur bundesdeutscher Tradition, Helmuth James Graf Moltke, hat die Verklärung Schills vor allem mit Überpersönlichem zu tun: mit Preußen, mit Frankreich – und mit der Idee einer deutschen Nation.
Nationen sind nichts Selbstverständliches. Sie beruhen weder auf Rasse, Sprache und Religion noch auf Interessen oder angeblich «natürlichen» Grenzen. Jede Nation ist Idee. Wird diese Idee nicht mehr gedacht oder gewollt, erlischt die Nation.[3] Auf Ideen muss man kommen. Vorbedingung für die Erfindung der Nationen in Europa waren handfeste Umwälzungen: die Bevölkerungsexplosion seit Mitte des 18. Jahrhunderts, die Anfänge der Industriellen Revolution, der Sieg über Zeit und Raum – etwa die Verdichtung des Straßennetzes oder der Durchbruch neuer Medien wie Zeitungen und Zeitschriften. Im Gefolge dieser Veränderungen entwickelten sich als Grundursache für die Erfindung der Nation drei Wertekrisen. Eine Krise des politischen Systems: Die Umwälzungen zwangen zur Straffung und Erweiterung von Durchgriffsmöglichkeiten staatlicher Gefüge. Eine Krise der Machtteilhabe: Der Aufstieg des Bürgertums bedrohte alte Führungsschichten. Eine Krise der Machtbegründung: Entchristianisierung und Aufklärung schwächten die Bindekraft von Gottesgnadentum und Traditionen. Anfangs bestimmte lediglich eine Handvoll Gelehrter den Ideenhaushalt der Nationen – Professoren, Theologen, Schriftsteller, Offiziere –, einflussreiche Männer der Feder wie Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schiller, Johann Gottlieb Fichte und Ernst Moritz Arndt, Gerhard Scharnhorst und August Neidhardt von Gneisenau. Ihr Schreibtisch-Nationalismus antwortete vor allem auf die Krise der Machtbegründung, denn er bot ersatzweise eine Art Säkularreligion. Deren Vaterunser umfasste Denkfiguren wie die «historische Mission», das «auserwählte Volk», die «Todfeinde», das «heilige Vaterland».[4] Den Weg der Nationsidee aus den Studierstuben in die Herzen der Massen bahnte in Deutschland Napoleon – ungewollt freilich; denn Krieg, Invasion und Ausplünderung weckten vielerorts den Willen zur Selbstbehauptung. Das entschärfte vorläufig die Krise der Machtteilhabe. Unter französischer Besatzung verlegte das bürgerliche Denken den Schwerpunkt von der inneren auf die äußere Freiheit.[5] Zugleich suchten reformfreudige Beamte in Preußen und in den Staaten des «Rheinbundes», einer Schöpfung Napoleons, die Krise des politischen Systems zu überwinden. Sie setzten auf Vereinheitlichung, Straffung und Verrechtlichung von Regierungen und Behörden. Ihre Reformen beschleunigten den Weg vom monarchischen zum bürokratischen Absolutismus, die Entwicklung von der Selbstherrschaft des Monarchen zur Herrschaft der Beamten im Namen des Königs.
Vor dieser Kulisse begann die Suche nach jenem wabernd Wechselhaften, das unsere Gegenwart «deutsche Identität» zu nennen pflegt. Man sammelte – oder erdichtete – Märchen, Mythen und Volkslieder, entdeckte das Mittelalter, beschwor Volksgeister und Walhall, Minne und Walküren. Des Knaben Wunderhorn erschien. Fouqué, nicht Goethe war der meistgelesene Autor in Deutschland. Kurzum: Die politische Romantik dämmerte herauf. Sie besang das große Miteinander von Oben und Unten, den Heiligen Krieg des Völkerhasses, liebte das Gefühl, misstraute dem bloßen Verstand. Was Preußen betraf, kamen Bürgertum und Monarchie sich sozusagen romantisch näher. Im Zeitalter der Aufklärung hatte preußischer Absolutismus noch bedeutet: Offiziersadel und Königsheer. Die Kluft zwischen Zivil und Militär entsprach dem geistigen Abstand zwischen Bürger und Krone. Im Zeitalter der Romantik, so hofften manche, würde preußisches Königtum bedeuten: Leistungsadel und Volksheer. Fortan würde jeder Soldat ein Bürger und jeder Bürger auch Soldat sein. Nicht die Nation findet ihre Nationalisten; Nationalisten erschaffen sich ihre Nation.
Einer wie Schill passte bestens in die sich wandelnde Epoche, in die Zeit der Frühromantik und der Wertekrisen. Er war adeliger Offizier des Königs, galt aber als volksnah ohne eine Spur von Standesstolz. Und nur Schill konnte offenbar dem «Todfeind» wenigstens ein Schnippchen schlagen. Unzählige Flugschriften überhöhten seine Taten: Er allein hatte 1807 während des Kleinkriegs um die Festungsstadt Kolberg sechs Franzosen getötet, war über einen unfassbar breiten Graben geritten, hatte dutzende Verwundungen erlitten. Schill entschwebte schon zu Lebzeiten in mythische Gefilde. Von Ferne erinnert sein Ruf an den Mythos des Retters, der in Frankreich den Aufstieg Bonapartes beflügelt hatte. Nicht zufällig galt er als Gegenbild des hochmütigen, bürgerfeindlichen Junkers. Schill «verschwendete kein Geld, machte keine Schulden, spielte nicht und sah nicht Alles, was keinen Federbusch trug, über die Achsel an».[6] Außerdem soll er in Kolberg, während ringsherum alle Festungen die Waffen streckten, gemeinsam mit Nettelbeck und Gneisenau das erste Bündnis zwischen Bürger und Soldat geschmiedet haben, ein Stern in Wetterwolken, der den Weg in eine bessere, sprich: nationale Zukunft wies – eine Legende, von Gneisenau gezielt verbreitet, der im preußischen Offizierskorps vielleicht am glühendsten die Nationalidee vertrat.[7] Mit seinem Gespür für Menschenführung und Massenpropaganda befeuerte Gneisenau den Kult um Schill. Dadurch könne man die Bevölkerung leichter für eine Erhebung gegen Napoleon gewinnen.
Und tatsächlich: 1809 wagt Schill ohne Befehl des Königs, lediglich im Namen der «Nation», den Versuch zum Aufstand – ein bis dahin unerhörter Vorfall! Schill aber ist kein Einzelgänger. Er handelt als Teil einer Verschwörung, in die hohe Offiziere ebenso verwickelt sind wie leitende Beamte. Sie wollen den Monarchen in einen Krieg gegen Napoleon drängen.[8] Am 28. April 1809 verlässt Major Ferdinand Baptista von Schill an der Spitze seines Husarenregiments die Garnison Berlin, angeblich für ein Manöver. Seine Vorhut befehligt Leutnant Friedrich Franz Graf von Moltke. Die Familie des Leutnants leistet dem preußischen Königspaar Hofdienste. Der Hofdienst, in Europa schon seit Jahrhunderten dem Adel vorbehalten, umfasst zeremonielle, wirtschaftliche oder gesellige Aufgaben, ist an Ehrenämter und Tätigkeiten in der Hofverwaltung geknüpft. So bekleidet der Vater des Schill-Leutnants, Friedrich Detlof Graf von Moltke, das Ehrenamt eines Königlichen Oberjägermeisters.[9] Seine Einkünfte erwirtschaftet er als Gutsherr auf Wolde bei Stavenhagen. Charlotte, die Schwester des Leutnants, war jahrelang Hofdame und Freundin der Königin Luise, bevor sie Friedrich von der Marwitz heiratete, den wohl klügsten und schillerndsten Gegner der Staatsreformer um Stein und Hardenberg.
In Dessau lässt Schill die Maske fallen, verbreitet den Aufruf An die Deutschen! Moltke fordert eine Erklärung. Zur Rede gestellt, verpfändet Schill sein Ehrenwort: Er handele auf geheimen Befehl des Königs, dürfe den Monarchen aber nicht bloßstellen.[10] Moltke und viele andere Offiziere schenken ihm Glauben. Schill setzt das Unternehmen fort. Unterwegs hält Moltke seinen Vater in Wolde brieflich auf dem Laufenden, der seinerseits alle Angaben nach Berlin weiterleitet.[11] Schnell spitzen sich die Dinge zu. Schill zieht nach Norden, behält bei Dodendorf in einem Gefecht gegen französische Truppen die Oberhand, plündert Staatskassen im Königreich Westphalen, das Napoleons jüngster Bruder, Jérôme Bonaparte, regiert, hält wortgewaltige Reden –Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! –, durchquert Mecklenburg und überschreitet die Grenze zu Schwedisch-Pommern. «Schill ist also jetzt Meister von Pommern», berichtet Oberjägermeister Moltke nach Berlin. «Er hat viel Zulauf und an Waffen fehlt es ihm nicht. Nach gestern eingegangener Nachricht verfolgen ihn jetzt 3000 Holländer und 2000 Dänen. Was daraus wird, muss die Zeit lehren.»[12]
In Wahrheit findet Schill nur wenig Unterstützung. Ein Volksaufstand oder ein Guerillakrieg kommt nirgendwo zustande. Die meisten Menschen denken nicht in nationalen Mustern. Für Napoleon bedeutet das Ganze lediglich ein Ärgernis; der Imperator betrachtet Schill als Straßendieb. Nicht Einheiten der Grande Armée, sondern dänischholländische Hilfstruppen übernehmen die Verfolgung.
Mit den Verbänden des dänischen Königs, an ihrer Spitze General Johann von Ewald, marschiert auch das Dritte Bataillon Holstein. Die Soldaten des Bataillons gehörten vor wenigen Wochen noch zur Landwehr. Um das Feldheer aufzustocken, hat man sie den Linientruppen zugeschlagen. Unersättlich scheint der Bedarf des Imperators an Soldaten. An der Spitze des Bataillons steht Major Friedrich Philipp Victor von Moltke, vierzig Jahre alt, Gutsherr auf Augustenhof in Holstein und mit dem Schill-Leutnant weitläufig verwandt. An der Grenze zu Mecklenburg reden sich die Soldaten in Hitze. Der König, murren sie, habe versprochen, die Landwehr nur in Dänemark einzusetzen; ins Mecklenburgische werde man nicht weiterziehen. Moltke befiehlt eine Mittagsrast. Satte Soldaten rebellieren selten. Geschickt lässt er nach dem Essen die fünf Kompanien des Bataillons in großem Abstand voneinander Aufstellung nehmen. So kann er jede vor der Front getrennt ansprechen. Moltke beginnt mit seiner Leibkompanie, denn diese Männer sieht er täglich, auf sie hat er den größten Einfluss: «‹Soldaten! Ich höre, dass einige von Euch geneigt sind, nicht über die Grenze des Vaterlandes zu marschieren, obgleich es der Wille Seiner Majestät des Königs ist. Ihr stützt diesen Ungehorsam darauf, dass der Landwehr versprochen ist, nicht über die Grenze des Vaterlandes zu marschieren. Ihr gehört aber nicht mehr zu der Landwehr, sondern zu den Linientruppen – und wäre dies auch nicht der Fall, der König kann befehlen und widerrufen, was er will. Der Ungehorsam des Soldaten gegen seinen König wird mit dem Tode bestraft. Wer aber aus Feighaftigkeit ungehorsam ist,verliert noch mehr – die Ehre! Nur über meine Leiche geht der Rückweg, denn ich mag meine Ehre nicht verlieren, und – nicht wahr – Ihr auch nicht? Also treu und gehorsam unserem allergnädigsten König! Eins, zwei, drei: Hurra!›. Alles stimmte mit ein.»[13] In den vier anderen Kompanien setzen Einzelne zur Widerrede an. Sofort droht Moltke mit Erschießung. Die Geschütze des Bataillons hat er auf seine eigenen Soldaten richten lassen. «Noch nach 30 Jahren danke ich Gott, dass ich nicht in die unglückliche Lage kam, Blut vergießen zu lassen.»[14] Die Männer setzen die Verfolgung fort. Mit der Disziplin seiner Truppe hat Moltke künftig keine Schwierigkeiten mehr.
Schill hat die Küsten- und Festungsstadt Stralsund handstreichartig überrumpelt. Nun will er von dort aus einen Kleinkrieg führen. In Wolde wachsen die Sorgen des Oberjägermeisters: «Schill rechnet auf die Landung der Engländer, die in großer Menge in der See zu sehen, aber nicht gelandet sind», meldet er nach Berlin. «Bis jetzt täuscht er auch nur sein Korps, dass er zu seiner Expedition höhere Befehle habe. Ich gehe aber heute selbst zu ihm und werde Licht verbreiten, wenigstens meinen Sohn von dem Gegenteil überzeugen und ihn dann zurücknehmen.»[15] Doch in Stralsund kann der Oberjägermeister nichts erreichen; sein Sohn jedenfalls bleibt in der Stadt. Schon am 31. Mai erscheinen die Verfolger. Schill hat kaum Maßnahmen zur Verteidigung getroffen. Sofort beginnt der Angriff. Gut möglich, dass auch die Moltkes bei den Straßenkämpfen aufeinandertreffen. «An diesem Tag», berichtet der Dänen-Moltke, «war auch ich in großer Lebensgefahr. Mehrere Kanonen- und Flintenkugeln sausten an meinem Kopf vorbei – ich ward nicht verwundet.»[16] Viele Verteidiger fechten bis in den Tod. Schill sprengt ziellos durch die Gassen. In der Fährstraße treffen den Major drei Kugeln; tödlich ist ein Bajonettstich in den Unterleib. Seine Leute werden zerstreut, niedergemacht oder gefangen genommen. Danach trennt Stabsarzt Genoux Schills Kopf vom Rumpf der Leiche. König Jérôme hat auf die Trophäe ein Preisgeld ausgesetzt.
Elf Offiziere, die in Gefangenschaft geraten, lässt Napoleon in Wesel erschießen. Zweiundsiebzig Offiziere entkommen, darunter auch der Schill-Moltke: Er rettet sich nach Hinterpommern, wird in Kolberg von Blücher verhört, vor ein Kriegsgericht gestellt und freigesprochen.[17] Der Dänen-Moltke soll nach dem Sturm auf Stralsund die Stadt mit seinem Bataillon vor Plünderungen schützen und bekommt Gelegenheit, «mehreren Menschen das Leben zu retten und oft mit eigener Gefahr».[18] Ausschreitungen gibt es trotzdem. Es sei bedauerlich, klagt Ewald, der Oberkommandierende, dass die Truppen «unter den Augen ihrer Offiziere so schreckliche Exzesse haben begehen können .… Das 3te Bataillon Holstein unter dem Herrn Major v. Moltke nebst dem Husarenkommando … sind von diesem Vorwurfe frei und ist in keinem Fall die geringste Klage über sie eingegangen.»[19] Prinz Friedrich von Hessen, Moltkes Regimentschef, überschüttet das Bataillon mit Lob und Ehren. Der König höchstpersönlich ernennt Moltke in Kiel zum Ritter des Dannebrog. «Sie haben», lobt Friedrich VI., «durch Ihr gutes Betragen mir und meinem ganzen königlichen Haus Freude bereitet. Ich werde es Ihnen nicht vergessen.»[20] Napoleon verleiht Moltke das Kreuz der französischen Ehrenlegion.[21]
Ferdinand Baptista von Schills Tod in Stralsund am 31. Mai 1809. Holzstich, um 1870
Fast ähnelt der Schill-Zug einer Familienfehde. Doch an der Epochenschwelle zwischen Früher Neuzeit und Moderne ist der Militärdienst des Adels über Grenzen hinweg nicht ungewöhnlich. Dass Angehörige weit zerstreuter uralter Geschlechter verschiedenen Fürsten dienen, hat keinen Zeitgenossen je verblüfft. Als die Streitkräfte Napoleons das Erbe der Französischen Revolution über den Kontinent verbreiten, ist der Adel noch immer keine nationale, sondern eine europäische Schicht. Kraft schöpft er nicht aus der Hoffnung auf die Zukunft der Nation, sondern aus dem Stolz auf die Vergangenheit seiner Familien.
«Adel» stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet «vornehmes Geschlecht», «Herkunft», «edler Stand». Die Ablautform «Odal» bezeichnet Sippeneigentum an Grund und Boden.[22] Adel ist also mit Vornehmheit, Abstammung und Grundbesitz verbunden. Vornehm ist, wer sich dafür hält – und wen andere dafür halten; ohne Anerkennung kein Adel. Ansehen genießt ein Vornehmer in erster Linie nicht als Person; seinen Rang bestimmt vor allem das Alter der Familie, die Summe aller Ahnen. Das «Haus» steht dabei für die Einheit des Geschlechts, für seinen Ursprung, seine Stetigkeit. In der Welt des Adels haben Einzelne sich nicht am persönlichen Vorteil auszurichten, sondern am Nutzen für ihr Haus. Abstammung meint Biologisches: Der Glauben, kriegerische Tugenden und die Fähigkeit zur Führung vererbten sich im Kreise der Familie. Mittelbar schwingt eine europäische Einheit mit, vor allem beim Kriegeradel. Diese Einheit gründet auf gemeinsamen Ehrbegriffen, die ihren Ursprung im Rittertum finden, von Generation zu Generation weiterwirken und allein dem Adel zugehören, meint Ehre doch besonders die kriegerische Tapferkeit. Adelige leben in einer Gemeinschaft der Ehre. Solche Verflechtungen sind nicht nur geistiger, sondern – wie bei den Moltkes – auch verwandtschaftlicher Natur; sie prägen den Adel als «horizontale Nation».[23] Die Ehre seines Hauses zwingt den Einzelnen zu Opfern und zur Versöhnlichkeit, denn öffentlicher Streit zwischen Mitgliedern einer Familie beschädigt das Ansehen des Geschlechts. Umgekehrt darf der Adelige bei persönlichen Schwierigkeiten auf die Unterstützung seiner Familie zählen.
Eine besondere Bedeutung hat der Grundbesitz: Der europäische Adel fußt nicht auf Geldvermögen, sondern auf der Herrschaft über Land und Leute. Diese Rechtsmacht hat seit dem Mittelalter verwickelte Ausprägungen erfahren. Vereinfacht könnte man sagen: Grundherrschaft im Westen, Gutsherrschaft im Osten. In der Grundherrschaft, wie sie am Ausgang des 18. Jahrhunderts besteht, sind Bauern von ihrem Grundherrn finanziell abhängig; Geldzahlungen haben die Abgabe von Naturalien ersetzt. In der Gutsherrschaft hingegen leben Bauern nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in persönlicher Abhängigkeit von ihren Herren. Lebenslang bindet sie die Schollenpflicht. Den eigenen Wohnsitz dürfen sie ohne Erlaubnis nicht verlegen. Der Gutsherr – oder ein rechtskundiger Vertreter – sitzt über sie zu Gericht, ist ihr Kirchenpatron, gewährt oder verweigert die Erlaubnis zur Heirat und nimmt Frondienste in Anspruch, kann also jeden Untertanen einige Tage lang ohne Bezahlung auf seinem Gut arbeiten lassen. Der «Gesindezwangdienst» verpflichtet sogar die Kinder des Untertanen, der Herrschaft auf Verlangen als Gesinde zu dienen. Andererseits obliegen auch dem Gutsherrn Pflichten. Er muss den Pfarrer, gelegentlich den Lehrer bezahlen, Kirchen- und Schulbauten im Gutsbezirk unterhalten und seinen Untertanen im Alter oder bei einer Erkrankung Hilfe gewähren. Der Adel ist in sich eine Art von Staat. Und der Gutsherr waltet wie ein Patriarch – so jedenfalls sieht es die Aristokratie auf dem Lande. Fest steht: Landsässigkeit gehört zu den wichtigsten Merkmalen einer Lebenswelt, in der man nicht nur Eigentum, sondern auch Vorrechte vererbt, ein besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit pflegt, in Netzwerken fester Familienverbände lebt, innerhalb der eigenen Schicht heiratet, kriegerischen Tugenden verpflichtet ist, zum Landesherrn, dem Ersten unter Gleichen, ein persönliches Treueverhältnis unterhält, allseits hohes Ansehen genießt, aber sein Prestige stets aufs Neue zu vermitteln sucht.[24] Adel – das ist ein sozialer Stand und eine Denkart.
Die Moltkes entstammen mecklenburgischem, nicht preußischem Adel. Im Wappen führen sie drei Hühner, die gewöhnlich zu Birkhühnern erklärt werden, alten Siegeln zufolge aber wohl eher gewöhnliche Hennen darstellen. Die Wappenkrone zeigt an, dass die Familie spätestens seit dem 14. Jahrhundert zu den einflussreichsten Geschlechtern Mecklenburgs gehörte.[25] Sage und schreibe sechzehn Kirchenpatronate waren im Lande mit den Moltkes verbunden. Der Familienname leitet sich angeblich aus dem slawischen «Moltek» ab, eine Verkleinerungsform von «mlatu», der «Hammer». Mit eiserner Faust, so scheint es, haben die Moltkes über slawische Bauern geherrscht, seit ein Urahn als Vasall Heinrichs des Löwen mithalf, die Abodriten zu unterwerfen, und dafür offenbar Grundbesitz in Mecklenburg erhielt. Die Moltkes, erklären Heraldiker, führten ein «redendes» Wappen: Familienname und Wappenbild entsprächen einander, denn «Moltke» bedeute möglicherweise gar nicht «Hammer», sondern tatsächlich «Birkhuhn». Jedenfalls spricht vieles für eine slawische Herkunft.[26]
Spätestens im Hochmittelalter saß die Familie auf vier Stammsitzen. Der wohl wichtigste war mehr als fünfhundert Jahre lang und über sechzehn Generationen hinweg die Burg Strietfeld westlich von Gnoien unweit der Stadt Güstrow. Ihr neunter Besitzer, Gebhard von Moltke, ist der Stammvater aller noch lebenden Moltkes. Strietfeld, eine der größten Burganlagen in Mecklenburg, besaß solche Bedeutung, dass Tilemann Stella sie 1552 auf der ersten Karte des Landes als einen der wenigen tatsächlich genannten Orte verzeichnete.[27] Das Gut Toitenwinkel, auch Moltkewinkel genannt, gilt als weiterer Hauptsitz des Geschlechts. Es umfasste zwölf Dörfer und Gebiete östlich der Unterwarnow. Teile des Gutsbezirks bilden nunmehr einen Stadtteil von Rostock.[28] Das Gutshaus selbst ließ die SED-Führung 1973 sprengen.
Burgen, Schlösser und befestigte Gutshöfe bildeten erstens den Mittelpunkt im Leben adeliger Familien, sicherten zweitens ihren Anspruch auf Herrschaft und offenbarten drittens den Machtanspruch nach außen. Burg-, Schloss- und Gutsherren, lautete die steingewordene Botschaft, sind so reich und mächtig, dass sie dergleichen bauen können.[29] Die Moltkes traten nicht zufällig 1254 mit Ritter Fridericus Moltiko ins Licht der Überlieferung. Mitte des 13. Jahrhunderts lagen die vier mecklenburgischen Fürstentümer fast ununterbrochen in Fehde. Das schwächte die Herrscher und stärkte die Stände. Hart rang der Adel mit seinen Lehnsherrn um Reichtum und Macht. So führte Truchsess Johann Moltke um 1280 den Vormundschaftsrat der Herrschaft Rostock. Johann wandte sich gegen sein Mündel, Nikolaus das Kind, den Chronisten auch als Nikolaus den Kindischen beschreiben, und betrieb die Unterwerfung Rostocks unter dänische Lehnshoheit. Johann und sein Bruder, Ritter Friedrich Moltke, überredeten den Wendenfürsten Niklot, die Herrschaft Rostock unter den Schutz des Dänenkönigs Menved, nicht des Markgrafen von Brandenburg, zu stellen. König Menved schien erfreut, Rostock aber beförderte der Wechsel vom Regen in die Traufe, und der Markgraf von Brandenburg bedrängte Niklot übel. Vor dessen Anfeindungen retteten sich die Moltke-Brüder in die Arme Erik Menveds. Mit ihrer Flucht begann die Geschichte der dänischen Moltkes.[30]
Adam Gottlob von Moltke.Gemälde von Jens Juel,1780
Ein grenzübergreifendes Geflecht von Verwandtschaft und Freundschaft kennzeichnete nicht nur den mecklenburgischen Adel – ihn aber besonders. Klein war das Land, gering der Bedarf an Beamten und Offizieren, groß aber die Zahl der Adelsfamilien.[31] Und so gelangten im Kielwasser von Johann und Friedrich Moltke bald weitere Mitglieder des Geschlechts nach Dänemark. Ihre Nachfahren wurden Bischöfe, Reichsräte, Diplomaten und Söldnerführer. Begütert waren sie oft nicht nur in Inseldänemark, sondern auch in Mecklenburg, dem Land ihrer Herkunft.
Sogar der einflussreichste Spross der Dänenlinie kam noch in Mecklenburg zur Welt, 1710 auf Gut Walkendorf bei Strietfeld. Durch einen Onkel als Page an den Kopenhagener Hof vermittelt, schloss Adam Gottlob von Moltke mit Kronprinz Friedrich eine lebenslange Freundschaft. 1745 bestieg der Prinz als König Friedrich V. den Thron. Seinen Freund ernannte er zum Oberhofmarschall. Als Günstling des Königs spielte Moltke zwanzig Jahre lang die Rolle einer grauen Eminenz.[32] Adam Gottlob korrespondierte mit Fürsten und Kaisern, unterstützte Handel, Industrie und Seefahrt, gründete die Akademie der Künste, stieg auf zu einem der reichsten Grundbesitzer des Landes, erhielt die Grafenwürde und führte zwei Ehen, denen fünfzehn Kinder entsprossen.
Der König schenkte ihm Schloss Bregentved auf Seeland. Auch über Moltkes Bauvorhaben hielt Friedrich seine Hand. Das war ein Glück, denn nur selten haben harmonische Verbindungen zwischen Bauherr und Baumeister das Entstehen ungewöhnlicher Kunstwerke begünstigt; eine solche Verbindung aber glückte zwischen Adam Gottlob von Moltke und Baumeister Nicolai Eigtved. Das Moltke-Haus in Kopenhagen, von Eigtved für Adam Gottlob errichtet, gilt zu Recht als Meisterwerk der Weltarchitektur.[33] Das Palais ist Teil der Schlossanlage Amalienborg und zugleich ein Denkmal für die Macht des Adels, aber auch für das Selbstverständnis der absoluten Monarchie. Adam Gottlob von Moltke, der Grand Seigneur des dänischen Absolutismus, fiel nach dem Tode Friedrichs V. in Ungnade und starb 1792 auf Bregentved. Das Schloss verblieb in den Händen der Familie. Gegenwärtig besitzen die Bregentveder Moltkes 6338 Hektar Wald- und Ackerland sowie 163 Gebäude, beschäftigen vierzig Angestellte und erzielen einen jährlichen Umsatz von rund acht Millionen Euro.[34]
Das Palais Moltke in Kopenhagen
Von großer Adelsmacht in Mecklenburg zeugt nicht zuletzt die Reihe uralter Geschlechter; im Nordwesten die Plessen und Bülow, für den Südwesten Lützow und Pentz, im Südosten Maltzahn, Dewitz, Flotow und Voß, für den Nordosten Bassewitz, Lühe und Moltke. Sie alle traten als Marschälle, Vögte und Amthauptmänner in Erscheinung, suchten und fanden die Nähe der Herzöge von Mecklenburg. In Toitenwinkel, einem Geschenk des Dänenkönigs Erik Menved, errangen die Moltkes schon im 14. Jahrhundert die Hochgerichtsbarkeit; das Recht, über Kapitalverbrechen zu richten, besaßen andernorts nur Fürsten. Dergleichen hatte soziale Folgen. Beim Übergang von der mittelalterlichen Grund- zur neuzeitlichen Gutsherrschaft, im Zuge der Ablösung bäuerlicher Abgaben durch Frondienste also, entwickelte Mecklenburg sich zur klassischen Landschaft des feudalen Großgrundbesitzes – mehr noch als Pommern oder Brandenburg. Am Glanz und Elend des spätmittelalterlichen Herzogtums nahmen die Moltkes daher fortlaufend Anteil. Herzog Albrecht II., nur von ortsansässigen Geschichtsschreibern «der Große» genannt, brach um 1360 einen kostspieligen Seekrieg gegen die dänische Krone vom Zaun. Bei neun Adelsfamilien des Landes musste er eine Art Kriegsanleihe aufnehmen. Johann, Vicke und Henneke Moltke verpfändete er die Vogtei Boizenburg sowie Schloss, Stadt und Vogtei Tessin. Noch 1423 gehörten die Moltkes einem vormundschaftlichen Ritterrat an, als ein erwachsener Landesherr nicht zur Verfügung stand.
Ende des 16. Jahrhunderts blühte das Geschlecht in zwei Hauptlinien: Strietfeld und Samow. Der Toitenwinkeler Zweig geriet durch Streitigkeiten mit den Landesherren und der Hansestadt Rostock Zug um Zug ins Hintertreffen. Mit einem Axthieb nahm das Ende seinen Anfang. Thideke Noitinck, Müller in Toitenwinkel, erschlug am 17. Mai 1564, drei Uhr nachmittags, Carin Moltke, seinen Gutsherrn. Der Mörder büßte auf dem Rad. Doch die Untat hatte böse Folgen. Carins Witwe, verschuldet und in einen langwierigen Prozess um Besitzrechte verstrickt, mit drei minderjährigen Söhnen und zwei unverheirateten Töchtern am Rocksaum, stiftete Wilm Ulenoge, ihren Notar, zur größten Urkundenfälschung der mecklenburgischen Geschichte an – ein Kriminalstück, an Bewegtheit kaum zu überbieten, das mit der Flucht, Ergreifung, Folterung und Hinrichtung Ulenoges und dem Landesverweis der Moltke-Witwe endete.[35] Davon hat sich der Toitenwinkeler Zweig auch in den nächsten Generationen nicht mehr erholt. Die Strietfelder Linie hingegen schlug sogar in Schweden Wurzeln; eine Moltke, Margaretha, zählt zu den Stammmüttern der Wasas. Alle «deutschen» Moltkes entsprossen der Samower Linie, benannt nach Gut Samow, von Strietfeld nur eine Stunde Fußweg entfernt.
Für Strietfelder wie Samower, für ihre Macht, für ihren Reichtum und für Mecklenburg bedeutete der Dreißigjährige Krieg eine Erzkatastrophe. 1627 besetzten Wallensteins Truppen das Land. Der Feldherr des Kaisers entmachtete die Herzöge von Mecklenburg-Güstrow und Mecklenburg-Schwerin, erhielt ganz Mecklenburg als Lehen, zog ins Güstrower Schloss und reformierte Regierung wie Verwaltung. Mecklenburgs Adel rief er zur Mitwirkung auf. Zögernd, misstrauisch zuerst, stellte der Adel sich zur Verfügung. Mecklenburger bildeten in Wallensteins oberster Regierungsbehörde das Direktorium: Gregorius von Bevernest, Volrath von der Lühe und Gebhard von Moltke. Drei Jahre später lag Wallensteins Herrschaft in Scherben. Die Schweden landeten auf Usedom, beide Herzöge kehrten nach Mecklenburg zurück. Lühe und Moltke traf die Rache der Sieger. Ihre Güter wurden erst geplündert, dann auf Befehl des schwedischen Königs an schwedische Offiziere verschenkt. Bei den Herzögen fielen sie in Ungnade. Die Kämpfe zwischen Elbe und Oder tobten noch achtzehn lange Jahre. Im Heiligen Römischen Reich gehörte Mecklenburg neben Württemberg und der Pfalz zu den am schwersten heimgesuchten Ländern. Von ehemals rund 300.000 Bewohnern soll nur ein Sechstel den Krieg überstanden haben. In manchen Gegenden, so auf den Gütern der Moltkes, waren die Verluste höher.
Viele Adelsfamilien zogen aus dem Unheil Nutzen, als nach Friedensschluss verlassene Höfe an Rittergüter fielen und vormals freie, nun heillos verarmte Bauern zu Leibeigenen herabsanken. Nicht so die Moltkes; mit der Samower Linie ging es stetig bergab. Hatte die Soldateska ihre Güter allzu gründlich verwüstet? Lag es an der Ungnade des Fürstenhauses? Oder gab es eine Flucht ins dänische Exil, zu den begüterten Verwandten? Genaues weiß man nicht. Aber eine wichtige Rolle spielte das Erbrecht. In Mecklenburg wie auch im Reich wurde es von Familie zu Familie unterschiedlich gehandhabt. Eine verbindliche Manneserbfolge kannten die Moltkes nicht. Ende des 18. Jahrhunderts waren Toitenwinkel und Strietfeld ihren Händen bereits entglitten. Friedrich Philipp von Moltke, der Gegner des Majors von Schill, war 1768 der letzte männliche Moltke, der auf Samow das Licht der Welt erblickte. Dass Kaiser Joseph II. acht Jahre später Friedrich Detlof von Moltke, den Vater des Schill-Leutnants, in den Reichsgrafenstand erhob – diesen Rang erreichten in Mecklenburg nur alte, angesehene Geschlechter[36] –, half den Samowern wenig. 1785 ging ihr Stammsitz für immer verloren, weil nach dem Tod des Gutsherrn Kasimir von Moltke neun Söhne und drei Töchter Anteile hielten.
Die jahrhundertealte Verbindung ins Mecklenburgische zerbricht. Am Vorabend der Französischen Revolution sind die Samower Moltkes heimatlos geworden. Doch eine Zuflucht gibt es immer: die ruhmreiche Armee des Königs von Preußen. Ihr Bedarf an Offizieren eröffnet dem bitterarmen Landadel die Möglichkeit standesgemäßer Versorgung. Sechs Söhne Kasimirs treten in den Dienst der Hohenzollern, darunter auch sein jüngster, Friedrich Philipp, der Verfolger Schills. Friedrich Philipp Victor von Moltke ist manches Unglück widerfahren. Viel Unglück aber hat er selbst verursacht. Als das Lebensende naht, drängt es den alten Mann zur Beichte. Und so schreibt Friedrich Philipp eine Lebenschronik, die nach dem Tode nur seine Kinder lesen sollen, damit sie alle Klippen umschiffen, «auf denen ich so oft leichtsinnigerweise gestrandet bin».[37] In schonungsloser, auch peinlich anmutender Offenheit spiegeln die Erinnerungen das Bildnis eines eitlen, ruhelosen Mitgiftjägers und Verschwenders. Mehr als einmal wünscht Friedrich Philipp, sein Leben zu beenden; ein fähiger, mutiger Offizier, aber wohl mit dem Hang zum Manisch-Depressiven, voller Selbstmitleid und Egozentrik, höchst empfindlich und tief misstrauisch; in so viele Duelle verstrickt, dass seine Ehrenhändel wie getarnte Versuche der Selbsttötung erscheinen. So fordert er aus nichtigem Anlass einen alten General, seinen Vorgesetzten, zum Zweikampf heraus. Anfangs verweigert Friedrich Philipp gegen alle Bitten eine Versöhnung; seine Hartnäckigkeit wendet das Todernste ins Komödiantische: «Er: ‹Ja, wenn Sie es verlangen, so muss ich mich noch auf meine alten Tage mit Ihnen herum hauen.› Ich: ‹Das würde wohl nach unserem Range nicht passend sein, wir müssen ernsthaftere Waffen, also ein Paar Pistolen, wählen.› Er: ‹Aber lieber Moltke, wenn ich Ihnen nun die Versicherung erteile, dass Sie nie wieder von mir beleidigt werden sollen, und dass es mir leid tut, Sie beleidigt zu haben, wollen Sie dann die Hand der Versöhnung nicht von mir annehmen?› – wobei er mir die Hand reichte. Ohne diese noch anzunehmen, erinnerte ich ihn an manche andere Sache, wo er offenbar mein Ehrgefühl gereizt habe, an sein geringschätziges Betragen gegen meinen verstorbenen Freund, den Major von Qualen, und alle seine Stabsoffiziere. Er rief Gott zum Zeugen, dass er niemand mit Vorsatz beleidigen wolle. Er bat mich nochmals um Verzeihung, küsste mich und reichte mir abermals die Hand. Ich war versöhnt.»[38]
Auch von homosexuellen oder homoerotischen Erfahrungen des Dreizehnjährigen ist die Rede. Immer noch stehe ihm lebhaft vor Augen, klagt der Pensionär, dass er sich im Pagenkorps des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin «sehr unglücklich unter diesen Knaben befand, dass ich das Heimweh hatte und manche Stunde im dunkeln Winkel saß und bitterlich weinte. Aber, ach, nach einigen Monaten war ich schon verführt und ebenso lasterhaft wie meine Verführer, nur mit dem Unterschied, dass ich nie Einen oder Eine verführt habe.» Solche «sehr geheimen Laster»[39] sind übrigens auch im preußischen Pagenkorps verbreitet; in Berlin führt das zu dessen Auflösung.
Der Vater, Kasimir von Moltke, hatte im Streit einen Totschlag begangen, den württembergischen Pagendienst verlassen und sich nach Wien begeben müssen. Dort schlüpfte er unter die Fittiche eines katholischen Verwandten, des Feldmarschalls Philipp Ludwig Freiherr von Moltke, und brachte es schnell bis zum Hauptmann.[40] Die Erinnerungen schildern Kasimir als gichtkranken Choleriker, der Frau und Kinder tyrannisiert. Nicht nur das Vaterbild hängt Friedrich Philipp nach: «Meine acht älteren Geschwister waren, soviel ich weiß, von der Mutter selbst gestillt worden, ich aber nicht, welches mir immer ein trauriger Gedanke gewesen ist.» Von Seiten der älteren Geschwister fühlt er sich am wenigsten geliebt, «und zwar deshalb diese Zurücksendung, weil ich ungehorsam und unreinlich war».
Wie in Gutshäusern üblich, hat auch Kasimir die Erziehung seiner Kinder Hauslehrern übertragen. Sie wechseln allerdings ständig, «welches nicht zu unserem Vorteil war». Anna, die Mutter, kommt aus einer Hugenottenfamilie. Sie erscheint als Muster weiblicher Tugend, nicht zuletzt, weil sie ihren Gatten scheinbar geduldig erträgt: «O, teure, verehrte Mutter, die Du nun verklärt bist, bete für uns, dass wir alle, die Du geboren hast, dort oben mit Dir vereinigt bleiben mögen, schließ in Dein Gebet auch meine Kinder und Kindeskinder ein.»[41] 1785 stirbt Kasimir als Verwalter des Damenstiftsklosters in Ribnitz. Über Klosterpfründe verfügen nur altadelige Familien, wenige Geschlechter also, die schon seit 1572 im Lande ansässig sind.[42] Friedrich Philipp erhält einen Vormund, einen Herrn von Raben, der für seinen Zögling Merksätze verfasst – Friedrich Philipp Victor von Moltke beliebe, folgende Grundsätze zu beobachten:[43] Als wichtigsten Punkt nennt Raben die Gottesfurcht. Dann folgt – kaum zufällig – das Zügeln geschlechtlicher Triebe. Friedrich Philipp müsse außerdem alle «Religions-Spötter» meiden, jene Aufklärer und Kirchengegner, die im Nachbarland Preußen nicht nur den Schutz, sondern auch die Achtung Friedrichs des Großen genießen. Denn dass Friedrich Philipp preußischer Offizier werden soll, haben Raben und die Brüder längst beschlossen.
1785 bringt Anna den Sohn zu ihrer Schwester nach Berlin, der Majorin von Holtzmann; die Tante umsorgt den Sechzehnjährigen wie eine Mutter. Auch in der preußischen Hauptstadt kann Friedrich Philipp auf die Familie zählen. Schwester Marianne hat den Kammergerichtsrat Carl Ballhorn, Schwester Louise einen Oberst von Knebel geheiratet. Wohl auf Vermittlung von Holtzmann oder Knebel kommt Friedrich Philipp als Fahnenjunker in das Berliner Infanterieregiment «von Möllendorff». Ein Unteroffizier, Bender mit Namen, nimmt sich des jungen Mannes an. «Ich aß Kommissbrot, lag auf Matratzen oder harten Pritschen, jede Woche kam ich auf Wache und war täglich im Dienst. … So reifte ich zum schönen Jüngling, aber auch mit dem Leichtsinn der Jugend.»[44] Moltke sieht Friedrich den Großen, schon zu Lebzeiten eine Legende, «von dem ich als Fahnenjunker zweimal angeredet worden bin mit den Worten: ‹Wie heißt Er?›»[45]
Der König sucht zu möglichst vielen Offizieren eine persönliche Verbindung. Hoffähigkeit besitzt in Preußen jeder Leutnant. Friedrichs Kriege haben dem Adel einen ungeheuren Blutzoll abgefordert. So sind in den Schlachten des Königs zweiundsiebzig Wedels und achtundfünfzig Kleists gestorben. Von vierzig pommerschen Hertzbergs, die zwischen 1740 und 1763 dienten, fielen siebzehn; die übrigen dreiundzwanzig blieben alle nicht unverwundet. Solche Opfer haben das Bündnis des Adels mit der Krone gefestigt, denn nun glaubt Friedrich sich in einer Treueschuld. Anders als in Mecklenburg hat der preußische Adel spätestens seit den Tagen des «Soldatenkönigs» die Allonge- mit der Dienstperücke vertauscht. Der Offiziersrock führte Junker und König zusammen. Das hat den Grundstein für Preußens Aufstieg zur Großmacht gelegt.
Als Friedrich Philipp in das Offizierskorps der Königlich Preußischen Armee eintritt, ist das Heer eine vom Adel beherrschte Streitmacht, der Staat ein bäuerlich geprägtes Gemeinwesen. Doch den kulturellen und wirtschaftlichen Schwung tragen nicht zuletzt die Bürger. Zaghaft noch, aber immerhin spürbar, untergraben sie die Vorherrschaft der Aristokratie. Professoren, Ärzte und Pastoren üben ihre Berufe nicht aufgrund der Standeszugehörigkeit, sondern kraft eigener Befähigung aus, deren Nachweis in einem akademischen Abschluss besteht. Immer mehr Menschen verdanken Ansehen und Stellung ihrem Wissen. Weil der Dreißigjährige Krieg die Städte langfristig ruiniert hat, bietet der Bedarf des Staates an Beamten die beste, fast einzige Möglichkeit zum Aufstieg. Daher drängt das Bürgertum in die Verwaltung. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so genießt Bildung eine seltene Wertschätzung in Preußen. Darüber hinaus entspricht Auslese durch Leistung dem Geist der Zeit. Aufklärung soll den Menschen aus Bindungen, Vorurteilen und Gewohnheiten befreien, die einer Prüfung am Maßstab der Vernunft nicht standhalten.
Preußens Armee gilt nach dem Siebenjährigen Krieg als die beste Europas. Und Feldmarschall Wichard von Möllendorff, Moltkes Regimentschef, ist seit der Schlacht bei Leuthen ein Held dieses Krieges. Doch das Zeitalter der Vernunft zwingt das Offizierskorps in die Verteidigung. Der Glaube, Edelleute seien schon durch Geburt und familiäre Tradition zur Führung bestimmt, verblasst. Kriegerische Gewalt weckt zudem den Argwohn vieler Aufklärer. Sie bezweifeln den Sinn stehender Heere und nähren Hoffnungen auf einen ewigen Frieden. Frankreichs Revolution verschärft den Druck. «Ich stamme nur von mir ab!»,[46] kann der Vicomte de Pelleport, vom einfachen Soldaten zum General aufgestiegen, nun erklären. Politisch scheint eine Bürgergesellschaft fortan grundsätzlich möglich; militärisch wecken die französischen Siege Zweifel an der Schlagkraft des Schwertadels. Das Heer kommt dem Drängen der Epoche auf halbem Weg entgegen. Schon nach dem Siebenjährigen Krieg hatte die Offiziersbildung einen lebhaften Aufschwung erfahren. Nun wird sie zum Mittel, das aufgeklärtes Gedankengut ins Heer überträgt. Krieg wandelt sich vom Handwerk zur Wissenschaft. Eine verwickelte Mechanik von Märschen und Gegenmärschen, Manövern und Scheinmanövern entsteht, die blutige Schlachten vermeiden soll. Mittels methodischer Defensivstrategien, deren Handhabung gebildete Offiziere erfordert, will man den Gegner ermatten, die Bevölkerung schonen, Verluste begrenzen, Siege kampflos ausmarschieren. Kurzum: Das Zeitalter der Vernunft hofft auf eine «chirurgische» Kriegführung.
Doch im Offizierskorps stößt mancher Bücherfreund auf Widerstand. Ein innerer Wettstreit durch Bildung und Leistung widerspricht seinem Charakter als Bruderschaft. Dass Bildung verweichliche, ist ohnehin die Ansicht der schweigenden Mehrheit. Ihre Ablehnung fußt auf geistiger Trägheit und Überlieferungen des Rittertums, aber auch auf sozialer Verunsicherung. Denn wird Fachkunde zur Bedingung soldatischer Leistung, schwinden alle Vorzüge der Geburt. An ihre Stelle tritt überprüfbares Wissen, das sich auch jeder Bürger aneignen kann. Prüfungen gelten als Todfeind der Anciennität, dem Grundsatz der Beförderung nach Dienstalter. Friedrich Philipp gehört zur schweigenden Mehrheit. Wenig deutet auf geistige Neigungen. Dabei entwickeln viele Offiziere in Potsdam und Berlin ungewohnten Bildungshunger.
In der Armee flackert der Widerschein des Zeitalters. Allerorts bricht eine nie gekannte Fülle geistiger Begabungen hervor, wirken Fichte, Schleiermacher und Hegel, Görres, Arndt, Gentz und die Humboldts, Novalis, Brentano und Arnim, die Schlegels, Jean Paul und E. T. A. Hoffmann. Kaum ist die Geniezeit des «Sturm und Drang» verflogen, entwickelt sich in der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller die literarische Klassik. Doch schon beginnt das romantische Berlin, das klassische Weimar als Musenhof zu überflügeln. In den Salons der Rahel Levin, Dorothea Schlegel und Henriette Herz mischen sich literarische und politische Welten, verkehren Bürgertum und Adel. Im Palais der Herzogin von Kurland, einer der reichsten Frauen Europas, sind Künstler und Verleger, Bürger und Diplomaten, Politiker und Aristokraten zu Gast. Und mittendrin die Offiziere: Scharnhorst etwa, Gneisenau, Clausewitz und Marwitz. Geist und Gesprächskunst, nicht Stand und Besitz öffnen die Salontür. Das alles verbessert das Verhältnis zwischen Zivil und Militär, ohne alle Gräben zuzuschütten. Zur gemeinsamen Plattform wird nicht zuletzt die Freimaurerei. In den Logen sollen Weltbürgertum, Duldsamkeit, Nächstenliebe und Vernunft alle Grenzen von Herkunft, Glauben, Stand und Besitz überwinden. Dabei gedenkt man, weniger die Mitwelt als vielmehr sich selbst sittlich zu veredeln. In den Logen, hofft man, werden die Maurer gleiche Rechte genießen. In den Logen wird allein die Vernunft regieren. In den Logen werden sich Menschen brüderlich begegnen. Kurzum: In den Logen wird eine bessere Welt entstehen. Tatsächlich ähnelt die Freimaurerei einem Schmelztiegel, der die Stände zu durchmischen beginnt. Auch Friedrich Philipp wird zum Logenbruder; der Freimaurerei bleibt er ein Leben lang verpflichtet.[47] Was aber das Veredeln der eigenen Sittlichkeit betrifft, hat Moltke Schwierigkeiten.
Der junge, ziemlich windige Leutnant, der sich selbst unter die schönen Männer zählt, sucht eine gute Partie. «Ein paar tausend Taler, die ich von meinen Eltern geerbt hatte, waren bald verschleudert, denn nur zu früh ward ich mündig erklärt, ich musste also daran denken, eine reiche Heirat zu machen, denn sich einschränken hatte ich nicht gelernt.»[48] Liebschaften und gebrochene Heiratsversprechen markieren den Weg. In Ribnitz lässt er eine Witwe von Zanthier sitzen; in Berlin muss ihn Oberst von Knebel, sein Schwager, «von einem übereilten Eheversprechen» befreien; in Bückeburg macht er der Gräfin Juliane von Schaumburg-Lippe schöne Augen, einer Regentin, die viel Gutes in ihrem Herrgottswinkel leistet und für das Werben des Offiziers empfänglich scheint –«die Trennung ward uns beiderseits schwer»; in Berlin bricht er Caroline von Grolman das Herz, Schwester des späteren Heeresreformers und engste Freundin von Marianne Ballhorn, Moltkes Schwester: «Insgeheim ward ich von diesem, in jeder Hinsicht ausgezeichneten Mädchen geliebt, welches ich aber erst erfuhr, als es zu spät war.»[49] In Oberschlesien beginnt er ein langjähriges, heimliches Verhältnis mit Auguste von Rothkirch. «Als ich bei ihr ankam, ward ich aufgefordert, eine Reise mit ihr zu machen. Solange wir in der Gegend ihrer Bekannten waren, musste ich als ihr Jäger auf dem Bock des Wagens sitzen, danach aber nahm ich den ersten Platz im Wagen ein.» Auguste, Witwe eines Generals, ist fünfzehn Jahre älter, hält Moltke aus, begleicht seine Schulden, überhäuft ihn mit Geschenken, verbringt jede freie Minute in seiner Nähe, will ihn schließlich heiraten, erwirkt das Einverständnis ihrer Tochter –«da aber brach ich auf eine unedle Art diese Bekanntschaft ab …».[50]
Die Liebeshändel führen schließlich zum Ziel. 1796 besucht Friedrich Philipp in Parchim seinen Bruder Helmuth, Lange Straße 28, Stadtkommandant und Hauptmann des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin. Die Brüder reisen zu Helmuths Schwägerin, Regina Paschen, auf das Landgut Rakow nahe der Insel Poel. Reginas Ehemann ist Millionär. Und der Millionär hat eine noch ledige Tochter: Sophie Henriette, zwanzig Jahre jung. «Mamsell Henriette war schön, feurig und lechzte nach Genuß.»[51] Bernhard Johann Paschen, ihr Vater, herzoglich mecklenburgischer Finanzrat, zählt zu den einhundert höchstbesteuerten Bürgern Hamburgs. «Von jeher», urteilt ein Bekannter, «steckte eine mächtige Grandezza in diesem Mann, wozu denn seine beträchtliche Länge viel Imposantes hergab, er hat über sechs Fuß. Verstand und Bildung kann man ihm nicht absprechen.»[52] Der Sohn eines Lübecker Kaufmanns, zweiundsechzig Jahre alt, führt in Hamburg mit seinem Schwiegersohn, einem Herrn Möller, das Handelshaus J. B. Paschen & Company, besitzt dort mehrere Häuser und Speicher, gehört zum Direktorat zahlreicher Versicherungen, hat für die Hansestadt mit Vertretern des Königreichs Hannover über Zollfragen verhandelt, ist «Meister vom Stuhl» zweier Logen und Mitbegründer der Patriotischen Gesellschaft.[53] Als Ruhesitz hat er die Güter Rakow und Buschmühlen erworben. In Rakow ist Friedrich Philipp erst ein paar Tage zu Gast, als er sich schon unter vier Augen mit Paschens Tochter verlobt. Doch der Kaufmann erkennt den Offizier als Mitgiftjäger; seine Zustimmung verweigert er. «Ich verließ», so Friedrich Philipp, «Rakow augenblicklich und war so vergnügt auf meiner Rückreise mit meinem Bruder …, als ich hingereist war.»[54]
Henriette von Moltke, geb. Paschen
Von Liebeskummer scheint Moltke also nicht geplagt. Doch Henriette legt sich krank ins Bett. Mit reitendem Boten sendet Mutter Paschen ein Schreiben nach Parchim. Sie berichtet, ihre Tochter habe erklärt, nie mehr heiraten zu wollen. Der Vater würde nun seine Einwilligung geben, wenn Friedrich Philipp zurückkehrte. «Einen Entschluss nun zu fassen, dies war der wichtigste Augenblick meines ganzen Lebens, welches einzusehen ich damals weit entfernt war!»[55] Am Abend sind Henriette und Friedrich Philipp verlobt. Moltke muss versprechen, das Leutnantsdasein aufzugeben und sich als Gutsherr zu verdingen. In Berlin nimmt er nach fast dreizehn Jahren Militärdienst seinen Abschied. «Ach, hätte ich gewusst, wie viel Kummer und Sorgen mir bevorstanden, ich würde für keinen Preis den Dienst verlassen haben![56]» 1797, im Mai, heiratet das Paar auf dem Landgut Horst bei Ratzeburg im Herzogtum Lauenburg, das der Familie Pauly gehört; sie ist mit Henriette befreundet und weitläufig verwandt. Als Mitgift erhält die Braut das Gut Liebenthal in der östlichen Prignitz im Wert von rund 14 500 Talern, dazu Gold, Juwelen und Silberbesteck, in das Paschen ein «P» eingravieren lässt.[57] Der Ehevertrag verbietet dem Bräutigam, Liebenthal mit Hypotheken zu belasten oder ohne Einwilligung von Henriette und ihrem Vater zu verkaufen. Paragraf 6 schreibt Moltke vor, nach dem Tod Henriettes und im Falle einer Wiederheirat für alle Kinder aus erster Ehe Vormünder zu bestellen; offenbar möchte Paschen eine Veruntreuung des Erbes durch Moltke verhindern. So enthält der Ehevertrag eine zweifache Botschaft: Bernhard Johann Paschen will weder die Tochter noch ein Vermögen verlieren. Ihm wird jedoch beides misslingen.
Friedrich Philipp von Moltke
Als die Eheleute nach Liebenthal ziehen, sind sie bereits zerstritten.[58] 1798 und 1799 kommen die ersten Kinder, Wilhelm und Friedrich, zur Welt. Wenige Monate nach der Geburt des zweiten Sohnes verkauft Moltke das Gut mit Gewinn – Paschen und Henriette müssen zugestimmt haben. Die Familie zieht zu Bruder Helmuth nach Parchim. In der Langen Straße wird am 26. Oktober der dritte Sohn geboren; zu Ehren ihres Gastgebers nennen die Eltern ihn Helmuth. «Damals ahndete ich nicht, dass ich es noch nach 40 Jahren erleben würde, dass dieser Sohn meine Freude, mein Stolz und mein Wohltäter werden würde – und dass diesem Kind ein so seltsamer Lebenslauf bestimmt war, in welchem ihm so viele Gefahren gedroht haben.»[59] Moltke beginnt ein Wanderleben ohne Rücksicht auf seine Familie. Zur Landwirtschaft besitzt er wenig Neigung. «Ich glaubte, durch den Handel mit Gütern ein reicher Mann zu werden.»[60] Das Spekulieren mit Landgütern trägt um die Jahrhundertwende das Gepräge allgemeiner Raserei. Der König erlässt dagegen Gesetze, die aber kaum greifen. Jahrhundertelanger Familienbesitz wechselt binnen Jahresfrist drei- bis sechsmal den Besitzer. Bindungen zwischen Untertanen und Gutsherrschaft zerreißen; der Landwirtschaft selbst bringt das Handeln keinerlei Nutzen. Das stetige Wachstum der Bevölkerung, die große Getreidenachfrage in Westeuropa, ein ständiger Preisanstieg für Weizen und Roggen, der blühende Binnenmarkt, angeregt durch den Ausbau der gewerblichen Wirtschaft, die Fortschritte wissenschaftlicher Anbaumethoden, das Überführen lehnsgebundener Rittergüter in privates Eigentum, die Gründung von «Landschaften» als ritterschaftliche Kreditinstitute – das alles führt zu einem Agrarboom, der das Treiben der Spekulanten beflügelt. Nur sehr große und ertragreiche Güter kommen nicht auf den Markt.[61] So kauft Moltke 1801 das Gut Gnewitz in der Nähe von Samow. Seine Familie folgt ihm dorthin. Aber bereits zwei Jahre später stößt er das Gut wieder ab. «Wir beschlossen, nun nach Lübeck zu ziehen. Da aber zu der Zeit mein eheliches Glück ganz zerstört war, so dachte ich ernstlich daran, mich scheiden zu lassen». Moltke hat durch Spekulationen mit dem Vermögen der Paschens so viel Kapital gewonnen, «dass ich ohne das von meiner Frau leben konnte».[62]
Friedrich Philipp reist allein in die Schweiz, kehrt nicht nach Lübeck zurück, sondern betreibt von Berlin aus die Scheidung. Doch eine Trennung wollen Henriette und Paschen vermeiden. Über ihre Gründe kann man nur Vermutungen anstellen; alle betreffenden Briefe, in Moltkes Nachlass überliefert, sind mittlerweile verschwunden – wohl auf Betreiben der Kinder. Fest steht, dass Paschen Zugeständnisse macht. Aus dem Ehevertrag streicht er den Paragrafen Nummer Sechs: Stürbe Henriette, bliebe es nun Friedrich Philipp überlassen, ob er «seinen Kindern Vormünder setzen oder deren natürlicher Vormund selbst sein wolle».[63] Moltke lenkt ein. «Da mir aber sowohl von Seiten meines Schwiegervaters als seiner Tochter die heiligsten Versicherungen gegeben wurden, dass in Zukunft alles geschehen würde, um mich glücklich zu machen, so gab ich meinen Vorsatz auf. Ich reiste also wieder zu meiner Frau nach Lübeck, um noch 30 Jahre ein unglücklicher Ehemann zu sein. Mehrere Male hatte ich den sündhaften Gedanken, durch einen Pistolenschuss mein Leben zu enden, welches vielleicht geschehen wäre, wenn mich der Gedanke an meine drei Söhne, die mir lieb geworden waren, nicht davon abgehalten hätte.»[64]
1804 und 1805 werden in Lübeck Adolph und Ludwig geboren. Als «Louis» zur Welt kommt, hat Moltke das Rittergut Augustenhof mitsamt dem Dorf Klenau nahe Oldenburg im Herzogtum Holstein für 93.000 Taler gekauft. Friedrich Philipp setzt sein gesamtes Vermögen ein, große Teile der Mitgift und Geld des Schwiegervaters Paschen. Weil das Gut über kein Wohnhaus verfügt, bleibt Henriette mit den Kindern in Lübeck, während Moltke in Augustenhof die Bauaufsicht führt, heilfroh, von seiner Frau länger getrennt sein zu können. Wohl auch deshalb lässt er – man könnte hinzufügen: natürlich –«ein viel zu schönes und zu kostspieliges Gebäude»[65] errichten, das ihm Schulden von 80.000 Talern einträgt. Moltke ahnt offenbar Schlimmes. Schon jetzt will er ins Militär, betreibt seinen Eintritt in die Landwehr und erhält im Juni 1806 seine dänische Einbürgerung mitsamt dem Patent zum Landwehrmajor. Mit dem Kauf von Augustenhof ist Moltke Untertan des Königs von Dänemark geworden. Das Herzogtum Holstein gehört zum «Heiligen Römischen Reich deutscher Nation», ist aber mit der dänischen Krone in Personalunion verbunden. Die Familiengeschichte verlagert sich für 61 Jahre in eine Lebenswelt zwischen Dänischem und Deutschem.
Vier Monate später ist die Mehrheit von Moltkes Kameraden aus der Berliner Militärzeit verwundet, gefangen oder tot. Das Regiment «von Möllendorff» gibt es nicht mehr. Am 14. Oktober 1806 hat Napoleon die preußische Armee bei Jena und Auerstedt vernichtet. Der letzte halbwegs kampfbereite Großverband, zwanzigtausend Preußen unter Blücher, hetzt Richtung Ostsee, hart verfolgt von überlegenen französischen Streitkräften. Die Neutralität der Stadt missachtend, flüchtet Blücher überraschend hinter die Wälle von Lübeck.[66] Dort aber lebt Henriette mit ihren fünf Söhnen: Wilhelm ist acht, Fritz sieben, Helmuth sechs, Adolph zwei und Louis ein Jahr alt. Blücher kann sich in Lübeck nicht halten. Durch eine Ungeschicklichkeit fällt das Burgtor in feindliche Hände. Während die Franzosen plündern, morden und vergewaltigen, flieht der Husarengeneral kämpfend nach Ratekau. «Ich kapithullire, weil ich kein Brot und keine Muhnitsion nicht mehr habe.»[67]
Die dreitägigen Ausschreitungen kosten mehr als hundert Lübeckern das Leben. Familienväter sind vor den Augen ihrer Angehörigen umgebracht, Frauen zu Tode vergewaltigt worden.[68] Scharnhorst, Blüchers Stabschef, graust es vor «Schreckensszenen, die selbst dem größten Theile der erfahrenen Krieger zum Glück für die Menschheit unbekannt bleiben».[69] Auch Henriettes Haus wird geplündert. Mit Stillschweigen übergeht Friedrich Philipp das Schicksal der Familie. Irgendwelche Bemerkungen zum Albtraum von Lübeck werden die Moltkes nicht überliefern.
Zu allem Unglück bricht auf Augustenhof ein Feuer aus, das zwei Tage andauert und fast alle Gebäude schwer beschädigt. Sein kostspieliges Gutshaus hat Moltke nicht versichert. «Jetzt war ich ein Bettler und ein höchst unglücklicher Mann in jeder Rücksicht. Auch das Vertrauen meines Schwiegervaters hatte ich verloren – so wie er viel durch mein Unglück.»[70] Augustenhof wird notdürftig instandgesetzt, ist aber so überschuldet, dass nur jahrelange harte Arbeit dem Ganzen vielleicht aufhelfen könnte. Dazu aber scheint Moltke weder willens noch in der Lage. «Candide et Caute», aufrichtig und vorsichtig, so lautet der Wahlspruch des Geschlechts. Vorsichtig ist Friedrich Philipp nie, aufrichtig wenigstens gegenüber sich selbst nur halb gewesen. Andernfalls hätte er geahnt, dass nicht das Äußere des eigenen Lebens, sondern sein Blick auf die Welt das wahre Unglück seines Schicksals war.
ZWEITES KAPITELBildungshungerJenseits der Nationen
Am 20. Juli 1969 verfolgen mehr als eine halbe Milliarde Menschen die Live-Berichte der Fernsehanstalten. Drei Amerikaner sollen den Mond erobern: Edwin Aldrin, Mike Collins und Neil Armstrong, die Astronauten der Apollo-11-Mission. Präsident Nixon ist vorbereitet; eine Trauerrede liegt schon in seiner Schublade. Zweiundneunzig Stunden sind vergangen, seit tausende Tonnen Treibstoff unter ihnen in Flammen aufgegangen sind und die kathedralenhohe Saturn-5-Rakete sie in den Himmel über Cape Canaveral geschraubt hat. Jetzt, im Mondorbit, bleibt Collins im Mutterschiff zurück. Aldrin und Armstrong wechseln in die Raumfähre Eagle. Durch die Luke der Kommandokapsel sieht Collins zu, wie seine Kameraden sich von der Columbia lösen. Die automatische Steuerung der Eagle beginnt den Sinkflug. Die Sonne steht recht tief. Der Mondtag – er dauert siebenundzwanzig Erdentage – hat eben erst begonnen. Als Aldrin und Armstrong über dem Rand des Mare Tranquillitatis schweben, gerät ein Einschlagkrater in ihr Blickfeld. Das beckenförmige Gebilde im Meer der Ruhe hat einen Durchmesser von nur sechs Kilometern. Verglichen mit dem Aiken-Becken am Südpol des Mondes und seinen 2200 Kilometern Durchmesser erscheint er winzig. Scherzbolde der NASA nennen ihn Chuck hole; das «Schlagloch» liegt auf dem Sinkflugweg der Eagle.[1] Um einen sicheren Landeplatz auszuspähen, haben vor zwei Monaten die Astronauten von Apollo 10 den Krater fotografiert. Nun macht auch Apollo 11 Aufnahmen des kilometerbreiten Schlaglochs. Sekunden später entdecken Armstrong und Aldrin einen anderen, kleineren Krater eben dort, wo ihre Fähre landen soll. Mit der Handsteuerung gelingt Kommandant Armstrong ein Ausweichmanöver. Doch dann, während die Eagle weiter an Höhe verliert, schlagen die Rechner Alarm. Der Treibstoff geht zur Neige. Das Zeitfenster für einen Notstart schmilzt auf wenige Sekunden. In Houston, im Kontrollzentrum, ist die Spannung fast mit Händen greifbar. Es folgt ein Augenblick der Stille. Endlich, um 21 Uhr 17 mitteleuropäischer Zeit, meldet Armstrong die erhoffte Botschaft: «Tranquility Base here. The Eagle has landed.» Die Adler steht auf dem Boden des Mondes. Ein Menschheitstraum hat sich erfüllt. Und nur etwa fünfzig Kilometer entfernt gähnt jenes Schlagloch, das die Astronomische Union in ihren Listen mit seinem offiziellen Namen führt: Krater Moltke.
Die Astronomen Johann Krieger und Rudolf König haben den Krater nach Moltke dem Älteren benannt.[2] Krieger und König arbeiteten an einem Mondatlas. Sie wollten nicht den Feldherrn verewigen, sondern an Moltkes Verdienste um die Selenografie erinnern. Mit der Drucklegung der «Schmidt-Karte», durch Moltke unterstützt, hatte die Geografie des Mondes Riesenfortschritte erzielt.[3] Und so bezeugt sogar ein Krater auf dem Erdtrabanten, dass Generalfeldmarschall Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke seinen Zeitgenossen als ein Gelehrter in Uniform erschien.