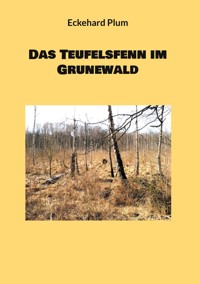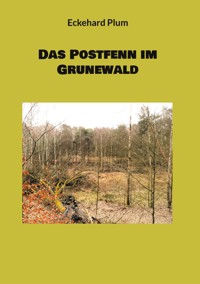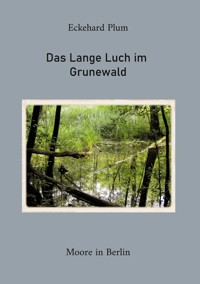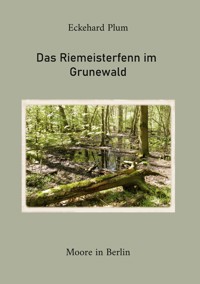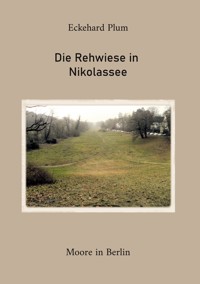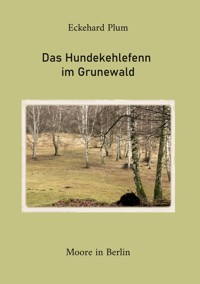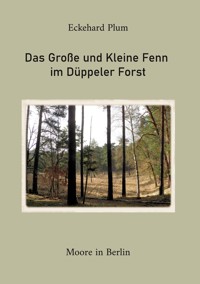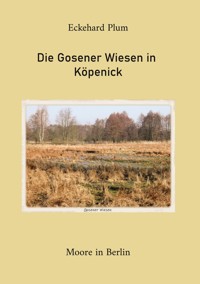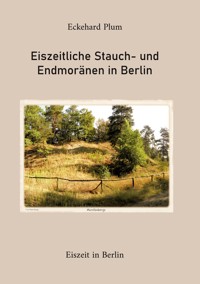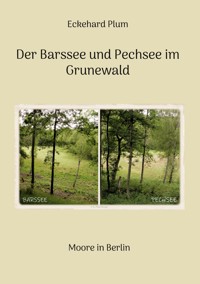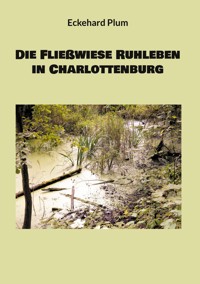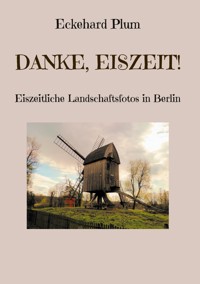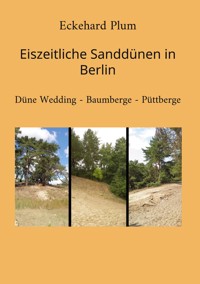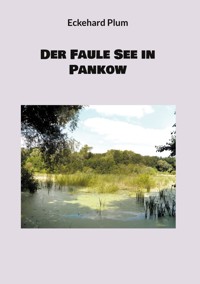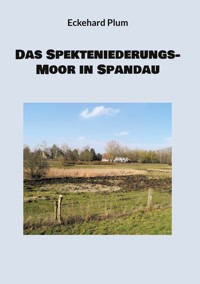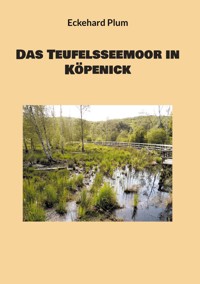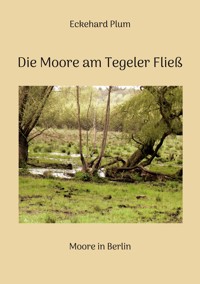
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Moore am Tegeler Fließ und die Szenerie drumherum gehören mit zum Schönsten, was Berlin landschaftlich zu bieten hat. Zu verdanken haben wir all das der Weichseleiszeit, die die Berliner Landschaft zu dem gemacht hat, was sie ist: einzigartig! Wie sie das vollbracht hat, erfahren Sie in diesem Buch. Abseits der Geologie lädt es natürlich auch dazu ein, die beschriebenen und reichlich bebilderten Orte selbst einmal aufzusuchen. Sie können dieses Buch deshalb auch als Reiseführer in die Natur von Berlin verwenden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 37
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ein Graureiher am Tegeler Fließ (nordöstlich der „Eisenbahnbrücke Dianastraße“)
Eine Bisamratte am Egidysteg (sie gehört zoologisch zu den Wühlmäusen, nicht zu den Ratten!)
Ein Buntspecht östlich des Egidystegs (Südseite des Tegeler Fließes)
Eine typische Moorlandschaft am Tegeler Fließ (Lübarser Felder)
Das Tegeler Fließ in Blankenfelde (NSG Kalktuffgelände)
Das in Brandenburg entspringende Tegeler Fließ übertritt nordwestlich des Mönchmühler Teiches die Grenze zu Berlin und durchfließt dabei manchmal stark mäandrierend von Ost nach West den Norden der Hauptstadt (hauptsächlich Reinickendorf), um nach etwa 14,5 Kilometern durch Berlin letztendlich unter der Tegeler Hafenbrücke – auch bekannt als Sechserbrücke – in den Tegeler See zu münden.
Verlauf des Tegeler Fließes in Berlin (diagonal von rechts oben bis links unten)1
Die Gesamtlänge des Baches (denn das ist die Beschreibung des Duden über ein Fließ) beträgt ca. 30 Kilometer. Seine Entwässerung erfolgt schlussendlich über den Tegeler See in die Havel. Wie bei den meisten Berliner Flüssen oder Bächen bildete sich auch beim Tegeler Fließ während der Weichseleiszeit unter einem ausgeprägten Gletscher eine Schmelzwasserrinne. Durch die relativ geringe Fließgeschwindigkeit konnten sich an den Uferbereichen etliche Niedermoore ausbil den, die mit zu den schönsten Landschaften in Berlin zählen. Aber wie genau sind diese Moore eigentlich entstanden? Dazu muss ich ein wenig in der Zeit zurückgehen – bis zur letzten Eiszeit – der sogenannten Weichseleiszeit.
Mit der Elster, Saale- und der Weichseleiszeit, allesamt benannt nach europäischen Flüssen, lassen sich in Berlin drei Kaltzeiten sicher nachweisen. Ausschlaggebend für diese Stadt war aber letztendlich die letzte, nämlich die Weichseleis - zeit. Sie hat der Stadt ihr morphologisches Aussehen gegeben. Ohne diese Eiszeit wäre Berlin platt wie ein Pfannkuchen! Ohne sie gäbe es auch nicht die vielen Seen und Flüsse, die den ganz besonderen Charme dieser Metropole ausmachen. Und ohne sie gäbe es deshalb auch nicht die Tegeler-Fließ-Moore! Verweilen wir doch noch ein wenig bei der Weichseleiszeit, die vor etwa 115.000 Jahren begann und vor ca. 11.700 Jahren endete. Ihre gewaltigen Eismassen und Gletscher – die bis etwa 45 Kilometer südlich von Berlin vordrangen – kamen aus dem hohen Norden, aus Skandinavien zu uns. Nach dem Abschmelzen der riesigen Eismassen blieben die mitgeführten Geschiebe einfach liegen. Ebenfalls zurück blieben Sand, Kies, Schluff und Ton. Daraus bildete sich unter dem Eis die Grundmoränenlandschaft mit ihren sanften Hügeln. Das charakteristische Sediment der Grundmoräne ist der fruchtbare Geschiebemergel, auch Till genannt. Wie Sie anhand der geologischen Skizze2 sehen können, zeigen sich mit der Barnim-Hochfläche im Nordosten, der Teltow-Hochfläche im Süden und der Nauener Platte im Südwesten Berlins drei ausgebildete Grundmoränenlandschaften.
Weitere sichtbare Hinterlassenschaften der Eiszeiten sind sicherlich auch die vielen Seen (Wannsee, Müggelsee) und Flüsse (Spree, Havel). Ich sprach eben von Geschieben, die in der Landschaft liegen geblieben sind. Ab einer Größe von 1 Kubikmeter spricht man nicht mehr von Geschieben, sondern von Findlingen.
Findling in der Nähe der „Eisenbahnbrücke Dianastraße“ am Tegeler Fließ
Und von diesen gibt es in Berlin unzählige.3 Wollen wir die Tegeler Fließ-Moore besser verstehen, müssen wir über subglaziale Abflussrinnen unter einem Gletscher sprechen, der durch seinen enormen hydrostatischen Druck und die mitgeführten Geschiebe auch subglaziale Tunneltäler bilden kann.
Besagte subglaziale Rinnen entstehen unter dem Gletschereis durch die Kraft der Schmelzwasser des abtauenden Eises, wobei sie letztendlich Bestandteil der Grundmoränenlandschaft sind, besonders auch im Bereich des Warschau-Berliner Urstromtals. Glaziale Rinnen sind lang gestreckte, bis zu 50 km lange Hohlformen, die in der Breite mehrere 100 Meter erreichen können. Je nach Grundwasserstand ist der Boden einer Rinne trocken, vermoort oder mit Flüssen und Seen gefüllt. Weil das Eis in der Regel aus nördlicher Richtung kam, sind die meisten glazialen Rinnen auch von Nord nach Süd ausgerichtet. Auf den nun folgenden Abbildungen sehen Sie, wie sich in und an eiszeitlichen Abflussrinnen Moore entwickeln konnten – so wie es bei den Tegeler Fließ-Mooren der Fall war.
Wenn eine Eiszeit ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die Landschaft (in unserem Fall die Gegend um das spätere Berlin) mit einem mehrere Hundert Meter dicken Gletscher bedeckt.
Noch während der Eiszeit entstehen durch Tauprozesse im „Sommer“ unter dem Eispanzer (subglazial) sich in den Untergrund einschneidende Abflussrinnen des abfließenden Wassers, die im „Winter“ wieder gefrieren oder von nachbrechendem Eis verfüllt werden können. Dadurch können sie nicht vom Sand zugeschüttet werden und bleiben deshalb auch nach dem Rückzug der Gletscher als Hohlform erhalten.