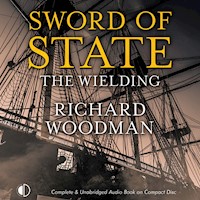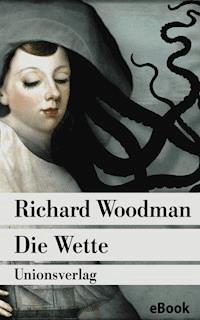Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Nathaniel Drinkwater Roman
- Sprache: Deutsch
Sturm, Eis und feindliches Feuer England, 1800: Kapitän Nathaniel Drinkwater erhält das Kommando über die »Virago«, ein altes Mörserschiff. Zum Kampfschiff hergerichtet, soll es nun in die Ostsee geschickt werden, um die britische Navy im Öresund vor Frankreichs Flotten zu schützen. Doch Drinkwaters Pläne werden durchkreuzt, als sein verzweifelter Bruder ihn um Hilfe bittet – es geht um Leben oder Tod … Hin- und hergerissen zwischen seiner Verantwortung als Kapitän und Familienloyalitäten muss Drinkwater inmitten von Stürmen und Eis nicht nur um die Rettung seines Schiffes, sondern auch das Leben seines Bruders kämpfen. Wird es Drinkwater trotz allem gelingen, in der blutigen Schlacht von Kopenhagen zu bestehen – und zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein junger Kapitän? »Ein großartiger Roman! Woodman ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler.« Goodreads-LeserEin packender und exzellent recherchierter Abenteuerroman vor den Hintergründen der napoleonischen Kriege – für Fans von C.S. Forester und Bernard Cornwell.Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Augen der Flotte – Feuertaufe auf der Fregatte Cyclops Band 2: »Kutterkorsaren – In geheimer Mission vor Frankreichs Küsten« Band 3: »Kurier zum Kap der Stürme – Auf Vorposten im Roten Meer« Band 4: »Die Mörser-Flottille – Die Schlacht von Kopenhagen« Band 5: »Die Korvette – Die Walfänger von Grönland«Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1800: Kapitän Nathaniel Drinkwater erhält das Kommando über die »Virago«, ein altes Mörserschiff. Zum Kampfschiff hergerichtet, soll es nun in die Ostsee geschickt werden, um die britische Navy im Öresund vor Frankreichs Flotten zu schützen. Doch Drinkwaters Pläne werden durchkreuzt, als sein verzweifelter Bruder ihn um Hilfe bittet – es geht um Leben oder Tod … Hin- und hergerissen zwischen seiner Verantwortung als Kapitän und Familienloyalitäten muss Drinkwater inmitten von Stürmen und Eis nicht nur um die Rettung seines Schiffes, sondern auch das Leben seines Bruders kämpfen. Wird es Drinkwater trotz allem gelingen, in der blutigen Schlacht von Kopenhagen zu bestehen – und zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein junger Kapitän?
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1984 unter dem Originaltitel »The Bomb Vessel« bei John Murray Publishers Ltd, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1986 unter dem Titel »Die Mörser-Flottille. Leutnant Drinkwater in der Schlacht von Kopenhagen« bei Ullstein, Frankfurt/M –Berlin.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1984 Richard Woodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1986 Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M –Berlin.
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/4Zevar, paseven, MoreVector und AdobeStock/manapaund
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-068-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Richard Woodman
Die Mörser-Flottille – Die Schlacht von Kopenhagen
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Uwe D. Minge
dotbooks.
Widmung
Für OSYTH LEESTON in Dankbarkeit
TEIL EINS ZAR PAUL I.
Wenn ich einen Mann kennenlerne, der zu herrschen versteht, schließe ich ihn in mein Herz. Ich möchte Ihnen meine Ansichten über England mitteilen, jenes Land, das (...) von Habgier und Selbstsucht beherrscht wird. Mein Wunsch ist es, daß wir uns verbünden mit dem Ziel, der Willkür dieses Regimes ein Ende zu setzen.
Zar Paul I. an Napoleon, 1800
ERSTES KAPITEL Wie ein Fisch auf dem Trockenen
September 1801
Nathaniel Drinkwater sah die Kutsche nicht. Er stand, freudlos seinen Gedanken nachhängend, vor der Fensterfront eines Kleiderladens, als der Wagen, von Portsmouth kommend, nach Petersfield hereindonnerte. Kurz vor dem »Roten Löwen« hieb der Kutscher noch einmal auf die Gäule ein.
Das plötzliche Knarren und Quietschen des Zaumzeugs, der Geruch nach Pferdeschweiß, die wirbelnden Räder überraschten Drinkwater; eine wappengeschmückte Tür glitt vorbei, dann ergoß sich eine Ladung Straßenschmutz über ihn. Einen Augenblick starrte er sprachlos seinen pflaumenblauen Gehrock und die ruinierte Hose an, dann ließ er seinen Gefühlen freien Lauf.
»He! Du verdammter Hurensohn, kannst du nicht in der Straßenmitte fahren?«
Der Kutscher blickte zurück und grinste unverschämt. Die Lautstärke des Anpfiffs hatte ihn überrascht, so etwas hatte er auf der Hauptstraße von Petersfield nicht erwartet.
Das Gesicht, das durch das hintere Fenster der Kutsche nach ihm ausschaute, sah Drinkwater nicht.
»Bei allen Heiligen, so ein Spitzbube«, murmelte er, die Feuchtigkeit verfluchend, die bis zu seinen Hüften reichte. Er warf einen schnellen Blick durchs Schaufenster, denn er hatte das vage Gefühl, daß der Zwischenfall die Strafe dafür war, daß er seine Frau und Louise Quilhampton im Laden sich selbst überlassen hatte, weil er lieber draußen die Frische nach dem Regenschauer genießen wollte. Das Kopfsteinpflaster glänzte im Sonnenlicht, kleine Bäche strömten in die Gossen und gurgelten in den Regenrinnen – und tropften auch von den Schößen seines neuen Gehrocks, zum Teufel noch mal! Ohne großen Erfolg versuchte er, die beschmutzte Hose zu säubern, und verspürte dabei wieder den sehnlichen Wunsch, den hohen steifen Vatermörder mit dem angenehm weichen Kragen einer Marineoffiziersuniform zu vertauschen. Mit Abscheu blickte er auf seine verschmierten Hände nieder.
»Nathaniel!« Er sah auf. Vierzig Meter weiter hatte die Kutsche angehalten. Der Passagier war ausgestiegen, hatte die Kutsche weiterfahren lassen und schritt nun auf ihn zu. Drinkwater zog überlegend die Augenbrauen zusammen. Der Mann war älter als er, trug einen flaschengrünen Samtrock über seiner Hose und eine cremefarbene Krawatte. Solche Eleganz verdoppelte Drinkwaters Wut über seinen verdorbenen Anzug. Zum zweiten Mal an diesem Morgen war er drauf und dran, seinem Temperament freien Lauf zu lassen. Aber da erkannte er das gewinnende Lächeln und die durchdringenden Augen Lord Dungarths, seines vormaligen Ersten Offiziers auf der Fregatte Cyclops, der jetzt im Geheimdienst der Regierung arbeitete. Der Earl näherte sich mit ausgestreckten Händen.
»Mein lieber Freund, es tut mir entsetzlich leid ...« Er deutete auf Drinkwaters Anzug.
Drinkwater errötete und ergriff die ausgestreckte Hand.
»Das macht doch nichts, Milord.«
Dungarth lachte. »Ha! Sie lügen miserabel. Kommen Sie mit in den ›Roten Löwen‹ und erlauben Sie mir, ein paar Drinks als Wiedergutmachung auszugeben, während die Pferde gewechselt werden.«
Drinkwater warf einen letzten Blick auf die Frauen im Laden. Anscheinend hatten sie nichts von den Ereignissen draußen gemerkt, oder sie ignorierten einfach seinen unbeherrschten Ausbruch. Erleichtert fiel er neben dem Earl in Gleichschritt.
»Fahren Sie nach London, Milord?«
Dungarth nickte. »Aye, ich habe eine Verabredung mit Spencer in der Admiralität. Aber was ist mit Ihnen? Ich habe von Griffiths’ Tod gehört. Ihr Bericht ist über meinen Schreibtisch gewandert, zusammen mit dem von Wrinch aus Mocha. Es hat mich gefreut zu hören, daß die Antigone in die Kriegsmarine übernommen worden ist, allerdings hat es mich tief betrübt, daß Ihnen Santhonax entwischt ist. Haben Sie endlich Ihre Epaulette bekommen?«
Drinkwater schüttelte den Kopf. »Nein, die Beförderung ging an unseren alten Freund Morris, Milord. Er tauchte im Roten Meer so unerwartet auf wie Falschgeld – und war auch so beliebt ...« Er unterbrach sich, dann setzte er resignierend hinzu: »Commander Morris blieb zwar im Hospital in Kapstadt 1 zurück, aber seine Briefe scheinen Gift versprüht zu haben. Seitdem hat die Admiralität keine Verwendung mehr für mich.«
»Ach ja, die Briefe an seine Schwester. Diese Giftschlange verfügt dank Jemmy Twitchers Geist noch immer über einigen Einfluß.«
Schweigend gingen sie weiter und schwenkten in die Einfahrt zum »Roten Löwen« ein, wo sie der Wirt bereits erwartete und in ein Hinterzimmer führte.
»Einen Krug Rum, und mit Beeilung, wenn ich bitten darf! Nun zu Ihnen, Nathaniel. Die arabische Sonne hat Sie gebräunt, aber sonst sind Sie unverändert. Es wird Sie sicher interessieren, daß Santhonax inzwischen wieder in Paris ist. Mir wurde berichtet, daß er zum Oberstleutnant der Marineinfanterie befördert worden ist. Bonaparte ist schnell bei der Hand mit Beförderungen, wenn sie helfen, das Fiasko seines orientalischen Abenteuers zu vertuschen.«
Drinkwater lachte bitter auf. »Er hat also das Glück, wieder eingesetzt zu werden ...« Er brach ab und blickte den Earl scharf an, denn er war nicht sicher, daß seine Bemerkung angebracht gewesen war. Verlegen fügte er hinzu: »Um die Wahrheit zu sagen, Milord, ich fühle mich ohne Schiff verteufelt elend. Ich wohne hier an der Postroute nach Portsmouth und sehe den Blauen Jungs nach, die jeden Tag auf dem Weg zu ihren Fregatten vorbeikommen. Verdammt, Milord, Sie wissen, es ist nicht meine Art, um Vergünstigungen zu bitten, aber einen kleinen Kutter muß es doch irgendwo für mich geben ...«
Dungarth lächelte. »Auf einer Fregatte oder einem Linienschiff würden Sie nicht so gerne dienen?«
Drinkwater grinste erleichtert. »Ich würde auch auf einer Badewanne anheuern, wenn eine Karronade draufstünde. Für eine Fregatte fehlt mir das jugendliche Ungestüm und für ein Linienschiff der vornehme Schliff. Auf einem kleineren Schiff könnte ich meine Fähigkeiten am besten unter Beweis stellen.«
Dungarth musterte Drinkwater nachdenklich. Es war eine Schande, daß ein so vielversprechender Offizier noch immer nicht zum Commander befördert worden war. Drinkwaters Wunsch nach einem kleinen Schiff war ein Symptom dieses Dilemmas, denn es bot ihm die einzig erreichbare Gelegenheit, sich zu bewähren. Trotzdem, es gab einfach zu viele Leutnants, die bei den Beförderungen vergessen worden waren und nun auf Transportern, Kuttern oder Kanonenbooten alt wurden. Sie verbrachten ihr Leben mit der nervtötenden Routine des Geleitschutzdienstes und mit mörderischen kleinen Scharmützeln, die von der Öffentlichkeit gar nicht zur Kenntnis genommen wurden. Drinkwater schien für so eine Laufbahn bestimmt zu sein. In seinem dichten braunen Haarschopf zeigten sich an den Schläfen schon die ersten grauen Haare. Sein linkes Auge war wie mit Tintenspritzern umgeben – Pulverspuren –, und eine alte Narbe entstellte seine linke Wange: das Gesicht eines Mannes, der an harten Dienst und Enttäuschungen gewöhnt war. Dungarth, dessen Aufgabe es war, einen täglich unpopulärer werdenden Krieg führen zu müssen, erkannte, daß Drinkwaters Talente in Petersfield vergeudet wurden.
Der Rum kam und wärmte sie.
»Sie fühlen sich hier wohl wie ein Fisch auf dem Trockenen. Was würden Sie zu einer Kanonenbrigg sagen?«
Der Earl beobachtete die Reaktion in den grauen Augen des Jüngeren. Sie leuchteten freudig auf, was sofort die Strenge aus den Gesichtszügen vertrieb. Dungarth fühlte sich an den eifrigen Fähnrich erinnert, der Drinkwater einmal gewesen war.
»Ich stünde für immer in Ihrer Schuld, Milord.«
Dungarth kippte seinen Rum und winkte lässig ab.
»Ich kann nichts versprechen. Sie haben doch von der Freya-Affäre gehört? Die Dänen haben sich zwar inzwischen wieder beruhigt, aber dem Zar hat es gar nicht gefallen, mit welchem Nachdruck unser Botschafter Lord Whitworth die Sache niedergeschlagen hat. Den Zaren hat das Einlaufen britischer Kriegsschiffe in die Ostsee verärgert. Das alles erzähle ich Ihnen im Vertrauen, Nathaniel, und erinnere Sie an Ihre Schweigepflicht von damals, als Sie noch auf Kestrel ...«
Drinkwater nickte, sein Pulsschlag beschleunigte sich. »Ich verstehe, Milord.«
»Malta ist uns von Vaubois übergeben worden. Zwar ist Pitt der Auffassung, daß uns Port Mahon als Stützpunkt für das Mittelmeer völlig genügt. Aber viele von uns sind da anderer Meinung. Wir werden Malta halten!« Dungarth hob bedeutungsvoll die Augenbrauen. »Der Zar schielt lüstern auf diese Insel, Ferdinand von Sizilien steht ihm dabei nicht nach, aber der Zar ist Großmeister des Malteserordens, und das verleiht seinen Ansprüchen besonderes Gewicht. Die Koalition gegen Frankreich kann jeden Augenblick wie eine überreife Frucht platzen. Österreich hat seit der Niederlage bei Marengo im April keinen Schuß mehr abgefeuert. Der Zar hat es also in der Hand, die ganze Allianz zu sprengen, und er ist verrückt genug, verletzten Stolz vor politische Interessen zu stellen.«
Er schwieg und kippte wieder ein Glas Rum. Dann fuhr er fort: »Bestimmt erinnern Sie sich an den unglücklichen Zwischenfall mit Seiner Kaiserlichen Majestät, als er die Streitigkeiten zwischen unseren beiden Nationen durch ein Duell mit dem König klären wollte.« Dungarth lachte. »Diesmal hat er sich damit begnügt, alles britische Eigentum in Rußland beschlagnahmen zu lassen.«
Drinkwaters Augen weiteten sich, als er das Gehörte in vollem Umfang begriff.
»Wie ich sehe, verstehen wir uns«, fuhr Dungarth fort. »Ausnahmsweise sind wir diesmal gut über die Vorgänge in St. Petersburg und Kopenhagen informiert.« Er lächelte ironisch über das versteckte Eigenlob. »Trotz unserer enormen Subventionen heuchelt der Zar Besorgnis über das Wohlergehen der Dänen. Eine Besorgnis, bei der ihm lüstern das Wasser im Mund zusammenläuft, aber das ist ein Problem der Dänen. Kurz gesagt, mein Freund: Es ist die feste Absicht dieses Geistesgestörten, die alte bewaffnete Neutralität der Ostseeanlieger wieder aufleben zu lassen, die seit dem Krieg mit Amerika eingeschlafen war. Diese Machtkonstellation ist uns nicht neu, sie bedeutet, daß die sogenannten Neutralen über eine gewaltige Flotte verfügen, die sich in der Nordsee mit der Frankreichs und Hollands verbünden könnte. Nach Ihren Erfahrungen können Sie sicher ermessen, was es bedeutet, wenn so eine Flotte vor unserer Haustür operieren würde. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie der verrückte Paul und der Erste Konsul Bonaparte miteinander auskommen sollen, aber es heißt, daß sie ein Geheimabkommen geschlossen haben. Was dabei auch herauskommt ...«
Er wurde von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Der Wirt ließ ausrichten, daß die frischen Pferde angespannt seien. Dungarth griff nach seinem Hut.
»Auf Wiedersehen, Nathaniel. Sie können sich darauf verlassen, daß ich etwas für Sie finde.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Milord, auch für Ihr Vertrauen.«
Gedankenverloren stand Drinkwater auf dem Hof und sah der davonpolternden Kutsche nach. Weniger als eine halbe Stunde war vergangen, seit sie seine Kleider bespritzt hatte, aber das hatte alles verändert. Erregt überlegte er: Die Ostsee war ein vergleichsweise flaches Gewässer, ein idealer Tummelplatz für kleine Schiffe, ein Kriegschauplatz wie maßgeschneidert für Leutnants und Kanonenboote. Seine Gedanken überschlugen sich. Schuldbewußt dachte er an seine Frau, dann an Louise Quilhampton, die er beide in dem Kleiderladen zurückgelassen hatte. Louises Sohn James hatte er mit einem eisernen Haken anstelle der linken Hand aus dem Roten Meer zurückgebracht. Drinkwaters Gedanken wanderten zu dem jungen Quilhampton, der von den Offizieren der Brigg Hellebore nur »Mr. Q« genannt worden war. Auch er hatte keinen neuen Posten bekommen.
Drinkwater setzte seinen Hut auf. Dann war da auch noch Charlotte Amelia, seine fast zwei Jahre alte Tochter. Sie würde er entsetzlich vermissen, wenn er wieder zur See fuhr. Er sah sie vor sich, wie sie auf den Knien von Susan Tregembo herumgehüpft war, als er sie vor knapp einer Stunde verlassen hatte. Nicht vergessen durfte er auch Tregembo, der mit Hingabe über das Wohlbefinden seines Herrn wachte.
Das alte Leiden jedes Seefahrers packte ihn: Zwiespalt der Gefühle. Hier seine Frau Elizabeth und die vertrauensseligen braunen Augen seiner Tochter, dazu all der Komfort und die Annehmlichkeiten eines bürgerlichen Landlebens; dort der harte Dienst auf See, die Selbstbestätigung eines erfolgreichen Marineoffiziers. Wenn er das eine hatte, sehnte er sich nach dem anderen.
Elizabeth fing ihn ab, als er aus dem »Roten Löwen« trat. Mit einem Blick hatte sie seine beschmutzten Kleider und die Kutsche, die stetig Sheet Hill hinauf ächzte, in Zusammenhang gebracht.
»Nathaniel!«
»Wie? Ach ... Ja, mein Liebling?« Vor Schuldbewußtsein reagierte er übertrieben besorgt ... »Hast du alles bekommen, was du brauchst? Wo ist Louise?«
»Wahrscheinlich beleidigt heimgegangen. Nathaniel, du verheimlichst mir etwas! Was war mit dieser Kutsche?«
»Was für eine Kutsche, Liebling?«
»Die Kutsche mit dem eindrucksvollen Wappen am Schlag, Nathaniel. Wenn ich mich nicht irre, war es das Wappen von Lord Dungarth.«
Elizabeth hakte sich bei ihm unter, während er dümmlich auf sie hinabgrinste. Sie war noch genauso schön wie zu der Zeit, als er sie damals im Garten der Pfarrei in Falmouth zum erstenmal gesehen hatte. Ihr großen Augen neckten ihn.
»Ich rieche Pulver, Nathaniel.«
»Sie haben mich entwaffnet, Madam.«
»Das ist nicht schwer«, sie drückte seinen Arm, »da du ein miserabler Schauspieler bist.«
Er seufzte. »Ja, es war Dungarth. Und es könnte sein, daß wir uns in Kürze mit den Ostseestaaten im Krieg befinden.«
»Wegen Rußland?«
»Du bist sehr scharfsinnig.«
Er drückte sie an sich, und das Gespräch wurde in völliger Harmonie fortgeführt.
»Tja, ich bin eben nicht so seicht und flatterhaft wie viele meines Geschlechts.«
»Jedenfalls bist du schöner als die meisten.«
»Sie sind sehr galant, Sir. Aber ich war nicht darauf aus, mir Komplimente zu angeln, ich will Fakten hören. Denke nicht schlecht über Louise, weil sie es nicht so hält, sie ist eine treue Seele und eine wahre Freundin. Allerdings ziehst du wohl die Gesellschaft ihres Sohnes vor«, schloß Elizabeth trocken.
»Mr. Qs Unterhaltung sagt mir tatsächlich mehr zu, aber ...«
»Pfui Teufel!« unterbrach ihn Elizabeth. »Er spricht von nichts anderem als von eurem scheußlichen Beruf. Nathaniel, versuche nicht, mich abzulenken!« setzte sie warnend hinzu.
Er holte tief Luft und faßte die Neuigkeiten kurz zusammen, aber ohne Details zu verraten.
»So heißt es diesmal Britannien gegen den Rest der Welt«, stellte Elizabeth fest.
»Ja.«
Sie schwieg einen Augenblick.
»Unser Land ist kriegsmüde, Nathaniel.«
»Das brauchst du mir nicht zu sagen. Aber ...« Er biß sich auf die Zunge, das letzte Wort hätte ihm nicht entwischen dürfen.
»Aber, Nathaniel, aber? Aber wenn schon gekämpft werden muß, dann kann man ohne meinen Herrn Gemahl keinen Sieg erzielen, das ist es doch – nicht wahr?«
Er blickte sie an und wußte, daß sie mit ihrer Verbitterung im Recht war.
Elizabeth versuchte, ihr Gefühle so gut es ging zu verbergen.
»Lord Dungarth hat dir ein Schiff versprochen?«
»Wie gesagt, du bist sehr scharfsinnig.«
Er sah nicht die Tränen in ihren Augen, aber sie sah die Vorfreude in den seinen.
ZWEITES KAPITEL Kavaliersdienste
Oktober - November 1800
»Drinkwater!«
Drinkwater drehte sich um. Eine Hand packte ihn fest am Arm, gerade als er die Admiralität verlassen wollte. Er erkannte den anderen nicht gleich. Das lag zum einen an dem Gedränge, in dem die beiden Seeoffiziere standen, zum anderen hinderte das verhärmte Äußere des Ankömmlings Drinkwater an einem schnellen Wiedererkennen.
»Sam? Samuel Rogers, tatsächlich! Wo, in drei Teufels Namen, kommen Sie denn her?«
»Ich habe die letzte beiden Monate damit verbracht, mich in den elenden Warteräumen Ihrer Lordschaften herumzudrücken und ihre schmierigen Schreiberlinge zu bestechen, damit sie meinen Namen auf der Warteliste etwas höher rücken. Aber dieser Abschaum hält es kaum für nötig aufzublicken, wenn ich vorspreche.«
Rogers schlug die Augen nieder. Seine Kleidung war zerknittert und schmutzig, seine Halsbinde hing verwahrlost herunter; offensichtlich war diesmal der Fehler wohl mehr bei ihm selbst zu suchen als bei den Schreibern der Admiralität.
»Ich muß Sie verpaßt haben, als ich heute morgen kam.« Drinkwater stockte, die Misere seines ehemaligen Bordkameraden ging ihm nahe. Um sie herum herrschte rege Geschäftigkeit, dadurch wurde das Schweigen zwischen den beiden Männern noch auffälliger.
»Sie haben ein Schiff bekommen«, brach es schließlich aus Rogers heraus. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Er deutete auf den braunen Umschlag, den Drinkwater unter den Arm geklemmt hielt.
Drinkwater lächelte gequält.
»So kann man es kaum nennen. Man hat mir eine Kanonenbrigg in Aussicht gestellt, aber es ist was anderes daraus geworden: ein Mörserschiff. Der Name ist Virago.«
»Aber ein selbständiges Kommando, nicht wahr?« Rogers reckte eifrig den Kopf vor, so daß Drinkwater seinen Atem riechen konnte, und der ließ auf einen leeren Magen schließen. Rogers setzte wieder zum Sprechen an, preßte dann aber die Lippen zusammen. Drinkwater sah, daß er sein Temperament zügelte.
»Mein lieber Freund, kommen Sie mit.«
Er ergriff Rogers am Ellenbogen und steuerte ihn durch das Gewimmel in das nächstbeste Kaffeehaus am Strand. Nachdem er bestellt hatte, sah er zu, wie Rogers die Fleischpastete in sich hineinschlang, und brütete über der Idee, die ihm gekommen war. Sorgsam überlegte er die Konsequenzen, bevor er begann.
»Sie können kein Schiff finden?«
Rogers schüttelte den Kopf, schluckte gierig und spülte den Rest der Pastete mit Bier hinunter.
»Ich habe keine Verbindungen, und die Geschichte von Hellebores Strandung ist hier nur zu gut bekannt.«
Drinkwater war erstaunt. Der Verlust der Brigg hatte Rogers nur einen milden Verweis der Untersuchungskommission eingebracht, die sich in Mocha mit dem Vorfall beschäftigt hatte. Nur die unmittelbar Beteiligten wußten, daß die Strandung auch auf sein unbeherrschtes Temperament zurückzuführen war. Auch Drinkwater war nicht schuldlos gewesen, da er die abnorme Refraktion nicht berücksichtigt hatte und so zu einem falschen Standort gekommen war.
»Wieso ist dieser Vorfall ›nur zu gut‹ bekannt, Sam?«
Rogers zuckte mit den Schultern und blickte Drinkwater mißtrauisch an. Er war schon immer ein schwieriger Bordkamerad gewesen, der mit den meisten Offizieren im Streit lag, auch mit Drinkwater. Es war klar, daß er immer noch alte Vorurteile hegte, obwohl Drinkwater der Meinung gewesen war, daß sie sich während der langen Monate recht nahe gekommen waren, als sie Antigone zusammen zurückgebracht hatten.
»Üble Nachrede, Küstenklatsch, nennen Sie es wie Sie wollen. Einer erzählt es dem anderen, und schon breitet es sich aus wie ein Buschfeuer.«
»Augenblick, Sam. Appleby war ein Tratschmaul, aber der lebt jetzt in Australien. Und Griffiths ist tot. Ich setze ein Pfund gegen einen rostigen Penny, daß Morris dieses Gift verspritzt hat!«
Rogers blieb mißtrauisch. Verdächtigte er Drinkwater, er habe ihm die Pastete und das Bier nur gekauft, um sein schlechtes Gewissen zu beschwichtigen? Drinkwater schüttelte den Kopf.
»Nein, Sam, ich war es nicht.« Er blickte dem anderen fest in die Augen, bis jener schließlich den Blick senkte.
»Was halten Sie davon, bei mir als Erster Offizier einzusteigen?«
Rogers’ Mund blieb vor Erstaunen offenstehen; dann wandte er plötzlich das Gesicht ab und ergriff Drinkwaters Hand, sein Mund formte lautlos Worte. Drinkwater versuchte, seiner Ergriffenheit Herr zu werden, indem er ihm einige Fragen stellte.
»Beruhigen Sie sich. Sie können doch gar nicht so am Ende sein, da ist doch noch Ihr Prisengeld ... Wie kommt es, daß Sie so heruntergekommen aussehen?«
Rogers riß sich zusammen, sein Achselzucken ließ die alte Arroganz ahnen.
»Der Spieltisch, ein paar Frauengeschichten ...« Er beendete den Satz nicht, sondern blickte zu Boden. Drinkwater konnte sich ohne sonderliche Mühe vorstellen, wie Rogers nach zweijährigem Zölibat sein Prisengeld durchgebracht hatte. Er lächelte ihn an, während er sich seine Verdienste ins Gedächtnis rief, seinen großen persönlichen Mut und seine wilde Tapferkeit.
»Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber, Sam.«
Er betrachtete Rogers, der eifrig nickte, bestellte Kaffee und lehnte sich dann zurück. Der Dämpfer, den Rogers bekommen hatte, mochte sich ganz günstig auswirken, und in der Schlacht war sein hitziges Temperament nur von Vorteil.
»Um ehrlich zu sein, Samuel, es ist nicht gerade ein Traumjob, den ich Ihnen anbiete, aber in einem Punkt bin ich mir ganz sicher.«
»Worin?«
»Daß wir beide es sehr nötig haben, daraus das Beste zu machen!«
Drinkwater lieh Rogers zehn Pfund, damit er sich wieder präsentabel machen konnte. Ihr Schiff lag oberhalb von Chatham, und Rogers war angewiesen worden, Drinkwater am folgenden Morgen in dessen Unterkunft aufzusuchen. In der Zwischenzeit mußte Drinkwater ins Marineministerium, das er erst gegen Abend wieder verließ. Sein Kopf schwirrte vor Anweisungen, Ermahnungen und Kränkungen, die er klaglos hatte einstecken müssen: ein Leutnant mit eigenem Kommando, dem man die Gnade zuteil werden ließ, diesen Tempel der Intrige und Korruption betreten zu dürfen.
Dann hatte er sein zweites unerwartetes Zusammentreffen an diesem Tag.
Er ging den Strand in westlicher Richtung entlang und stieß auf einen kleinen, aber sehr erregten Menschenhaufen, der einen Kutscher vom Bock gezogen hatte. Es war schon fast dunkel. In die erregten Schreie des Mobs mischten sich die schrillen Hilferufe einer Frau. Er boxte sich durch die unbeteiligten Zuschauer, sah ein blasses Gesicht hinter dem Fenster der Kutsche und hörte, wie eine Frau in der Menge sagte: »Das geschieht ihm verdammt recht. Warum schlägt er auch mit seiner Peitsche um sich!«
Drinkwater hatte jetzt den Kreis der Zuschauer durchbrochen. Ein großer Mann in Arbeitskleidung hielt grinsend die Pferde am Zügel. Nervös warfen sie die Köpfe in die Luft, verdrehten angstvoll die Augen. Vor ihren stampfenden Hufen wand sich der glatzköpfige Kutscher in der Gosse. Drei Männer, von denen einer eine blutige Strieme an der Wange hatte, verprügelten ihn mit Stöcken. Die besagte Peitsche lag auf der Straße, sein Dreispitz war von einem zerlumpten Jungen aufgehoben worden, der ihn zum Amüsement der Umstehenden aufprobierte. Ein paar häßliche alte Weiber feuerten die Männer mit schrillen Stimmen an, und ein paar Huren beschimpften die Frau in der Kutsche.
Mit einem Blick erfaßte Drinkwater die Situation. Seine anfängliche Sympathie mit dem Mann, der mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen worden war, wich seiner starken Abneigung gegen Aufruhr. Er war ein Trauma für ihn, denn als Marineoffizier suchte er ständig mit allen Sinnen nach dem leisesten Anzeichen für Meuterei. London hatte ihn den ganzen Tag gebeutelt, nun setzte diese Szene seine unterdrückten Aggressionen frei. Er trug noch immer Ausgehuniform, deshalb schlug er seinen Umhang über die Schulter zurück, zog den Degen und trat dem nächststehenden Angreifer kräftig in den Hintern. Erstaunt stellte er fest, daß ihm das erhebliche Freude bereitete. Die Menge antwortete mit einem Aufschrei aus Ermunterung und Ärger. Der Mann fiel zwischen die stampfenden Hufe und rollte sich unter wilden Flüchen zur Seite. Die beiden anderen hielten schwer atmend inne und wandten sich dann drohend gegen den Angreifer. Drinkwater trat zu dem verzweifelt wimmernden Kutscher und zielte dabei mit der Degenspitze auf die Kehle des Mannes mit der Peitschenstrieme. Mit der Linken suchte er etwas in seiner Tasche.
»Das reicht jetzt!« sagte er scharf. »Ihr habt euren Spaß gehabt, nun laßt die Dame weiterfahren.«
Der Mann hob seinen Knüppel zum Schlag. Drinkwater ließ eine Münze auf den Rücken des Kutschers fallen. Das Glitzern der halben Krone lenkte die Augen des Mannes ab, er bückte sich rasch, um sie aufzuheben, da berührte ihn im Nacken Drinkwaters Degenspitze.
»Jetzt setzt ihr den Kutscher wieder auf den Bock!«
Er konnte den Widerstand des Mannes fast körperlich fühlen.
»Ich bin gerade damit beschäftigt, Männer für ein Schiff des Königs zu rekrutieren, mein Freund«, sagte er mild. »Du solltest also sehr schnell das Silberstück nehmen und den Kutscher wieder auf seinen Bock plazieren.«
Er fühlte, wie der Mann aufgab. Schnell trat er einen Schritt zurück und schob den Degen in die Scheide. Die Drohung mit der Zwangsrekrutierung hatte mehr gewirkt als das Silber, aber Drinkwater war es um das Geld nicht leid.
Der Mann richtete sich auf und gab seinen Kumpanen ein Zeichen. Der Kutscher wurde auf die Füße gestellt und schwungvoll auf seinen Bock geworfen. Sein Hut war verschwunden, so preßte er beide Hände gegen den kahlen Kopf, als die Menge ihn beschimpfte.
Drinkwater drehte sich zur Kutsche um.
»Wünschen Sie meine Begleitung, Madam?«
Das Gesicht leuchtete bleich im Dämmerlicht. Er konnte ihre geflüsterten Worte nicht verstehen, aber die Tür ging auf, und er stieg ein.
»Weiterfahren!« befahl er dem Kutscher, sobald er die Tür geschlossen hatte, und setzte sich der Dame gegenüber. Sie war kaum den Kinderschuhen entwachsen, sicherlich noch keine zwanzig. Das gelbe Lampenlicht beleuchtete ein offenes Gesicht, das ihm seltsam bekannt vorkam. Er zog seinen Hut.
»Ich hoffe, Sie sind nicht verletzt?«
Sie schüttelte den Kopf und räusperte sich.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir.«
»Nicht der Rede wert. Vielleicht sollten Sie Ihren Kutscher dazu erziehen, daß er etwas zurückhaltender mit dem Gebrauch der Peitsche wird, Madam.«
Sie nickte.
»Haben Sie es weit?« fuhr er fort.
»Ich muß zum Lothian Hotel in der Albemarle Street. Wenn das abseits Ihres Weges liegt, lasse ich Sie von dem armen Matthew bringen, wohin Sie wünschen.« Sie gewann allmählich ihre Sicherheit zurück.
Drinkwater grinste. »Das wird nicht nötig sein, mein Hotel liegt gleich um die Ecke. Ich kann es zu Fuß sehr gut erreichen, bemühen Sie sich also bitte nicht.«
»Sehr zuvorkommend, Sir. Wie ich sehe, sind Sie Marineoffizier. Darf ich Ihren Namen erfahren?«
»Drinkwater, Madam, Leutnant Nathaniel Drinkwater. Darf ich meinerseits erfahren, wem ich die Ehre hatte, zu Diensten zu sein?«
»Ich heiße Onslow, Leutnant, France Onslow.«
»Ihr ergebener Diener, Miss Onslow.«
Sie lächelten sich an, und Drinkwater wußte nun, woher die Ähnlichkeit kam.
»Vergeben Sie mir bitte meine Neugier, aber sind Sie mit Admiral Sir Richard Onslow verwandt?«
»Das ist mein Vater, Mr. Drinkwater. Sie kennen ihn?«
»Ich hatte die Ehre, unter ihm dienen zu dürfen, damals in der Schlacht bei Kampenduin 2 .«
Im Unterbewußtsein war es Drinkwater, als ob er noch mehr über Miss Onslow wüßte, etwas, das sie persönlich betraf, aber er konnte sich nicht daran erinnern. Ein oder zwei Minuten später verließ die Kutsche den Piccadilly Circus und kam in der Albemarle Street zum Stehen.
Nachdem er der jungen Dame beim Aussteigen behilflich gewesen war, lehnte er ihre Einladung ab, ihn mit dem Admiral bekannt zu machen.
»Ich fürchte, daß ich noch wichtige Geschäfte zu erledigen habe, Miss Onslow. Aber es war mir eine Ehre, Ihnen helfen zu dürfen.«
Galant beugte er sich über ihre Hand.
»Ich werde Ihnen das nicht vergessen, Mr. Drinkwater.«
Im Trubel der nächsten Tage dachte Drinkwater nicht mehr an den Zwischenfall. Die zahllosen Kleinigkeiten, die erledigt werden mußten, bevor sein Schiff auslaufen konnte, nahmen ihn voll in Anspruch. Er besuchte noch einmal das Marineministerium, bestach den Schreiber im Beschaffungsamt, schrieb an den Offizier der Preßgang in Chatham. Er legte eine Sammlung von Büchern und Ordnern an: die Musterrolle, das Krankentagebuch, Rechnungsbücher, Bücher mit Ständigen Befehlen, Anweisungen vom Marineministerium, Beschaffungsamt, des Hospitals zu Greenwich und sogar des Generalfeldzeugmeisters vom Arsenal in Woolwich. Gegen Ende November bezahlte er seine Rechnungen und fluchte über die enorme Gebühr für Kerzen, die er im Dienste Ihrer Lordschaften verbrauchte hatte. Mit einem nun ansehnlicheren Rogers nahm er um vier Uhr morgens vor dem »George« am Southwark die Postkutsche nach Dover und machte sich auf den Weg nach Chatham.
Als die Kutsche über die Brücke in Rochester rumpelte, blickte er auf den stahlgrauen Medway hinunter, der kalt unter dem tiefverhangenen Himmel lag, und rief sich noch einmal den Inhalt des Briefes von Lord Dungarth ins Gedächtnis, der ihn in seinem Hotel erreicht hatte.
»Ich kann mir vorstellen, mein lieber Nathaniel, daß das Schiff nicht ganz dem entspricht, was Sie sich von meinem Einfluß erhofft haben. Jedoch bietet die vor Ihnen liegende Aufgabe gute Beförderungschancen. Virago ist ein Mörserschiff, wenn auch nicht offiziell. Ich überlasse es Ihnen, diesen Zustand zu ändern ...«
Drinkwater runzelte die Stirn. Es mochte sich um eine beschönigende Floskel handeln, aber das sah dem Earl so gar nicht ähnlich. Was Drinkwaters Interesse fesselte, war der versteckte Hinweis, den diese Ermutigung enthielt. Virago war als Mörserschiff gebaut worden, obwohl sie zur Zeit nur als Tender fungierte und die anderen Mörserschiffe der Flottille versorgte. Aber erst diese Abstufung machte es möglich, daß sie von einem Leutnant kommandiert werden konnte, denn eigentlich sollte ein Commander auf ihrem Achterdeck stehen.
Eine Welle unguter Gefühle überfluteten Drinkwater, als die Kutsche vor dem Ziegeltor des Arsenals in Chatham hielt. Sie stiegen aus, und der Wachposten der Marineinfanterie betrachtete sie gelangweilt. Eine Wolke altbekannter Gerüche hüllte sie ein: nach Teer, Hanf, Segeltuch, Schmiedefeuer und – unverkennbar dominierend – nach dem salzigen, trockengefallenen Watt.
Er überließ es Rogers, sich um ihre Seekisten zu kümmern, der sie von einer Horde junger Bengel zur nächsten Wirtschaft schleppen ließ. Drinkwater war dazu verdammt, sich eine Stunde lang die Absätze im Wartezimmer des Commissioners schief zu laufen. Dafür waren sie nun so früh aufgestanden. Außerdem stellte Drinkwater fest, daß er Hunger hatte.
Schließlich gewährte ihm ein hochnäsiger Sekretär zehn Minuten seiner kostbaren Zeit, obwohl man ihm ansah, daß er es aufs schärfste verabscheute, mit einem einfachen Leutnant auf die gleiche Stufe gestellt zu werden, egal ob dieser ein Schiff kommandierte oder nicht.
»Die Virago ist einer von mehreren Tendern, die die Mörserschiffe versorgen sollen.« Er sprach mit dem schleppenden Tonfall der neuesten Mode. »Wie Sie sicher wissen, wurde Ihr Schiff im Jahr ’59 als Bombarde gebaut; bei den anderen handelt es sich um beschlagnahmte Kohlenfrachter. Ihre Spieren sind bewilligt, Material für den Zimmermann und den Stückmeister liegt bereit, der Zahlmeister im Magazin ist über Ihre Bedürfnisse informiert worden. So bleibt Ihnen, Leutnant, lediglich noch die Aufgabe, den Commissioner zu informieren, wenn Ihr Schiff bereit zum Auslaufen ist. Dann bekommen Sie die Ladepapiere für die Explosivstoffe, das Pulver, die Granaten usw. aus dem Arsenal ...« Er wedelte lässig mit einem Taschentuch, ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken und schlug die Beine übereinander.
Drinkwater zog sich zurück, um Rogers zu suchen. Wenn tatsächlich alles so gut vorbereitet war, wie es ihm der Sekretär geschildert hatte, dann war diese Werft ungewöhnlich effektiv.
Fünfzehn Minuten später saß er mit Rogers im Heck eines Versetzbootes des Arsenals, und die Pinne zuckte sachte unter seinem Ellenbogen. Der Wind war hier draußen recht frisch und warf steile graue Wellen auf. Die Tropfen zischten nur so von den Riemenblättern. Die Sonne stand bereits tief am Abendhimmel.
»Ihr Schiff liegt am Ende der westlichen Bojenkette«, bemerkte der Bootsmann kurz, während er stromaufwärts ruderte. Drinkwater und Rogers musterten die Schiffe, die in Zweier- und Dreierpäckchen zwischen den Bojen lagen. Die Flut umspülte gurgelnd ihre plumpen Steven. Zwei riesige Achtundneunziger ragten hoch aus dem Wasser, da sie noch keine Kanonen und Vorräte an Bord hatten. Lediglich die Untermasten waren den aufgelegten Schiffen verblieben. Hinter ihnen lagen vier Fregatten, die auf ihre Besatzungen warteten. Sie waren teilweise schon aufgeriggt, aber ihr Anstrich ließ sehr zu wünschen übrig. Die zur Belüftung geöffneten Stückpforten sahen seltsam aus, aus einigen ragten behelfsmäßige Schornsteine. Auf den Decks herrschte Unordnung, Wäscheleinen zeugten davon, daß die Ehefrauen der Unteroffiziere an Bord lebten. Drinkwater erkannte zwei zerschlagene und verrottete holländische Prisen aus der Schlacht von Kampenduin und erinnerte sich wehmütig daran, daß er 1783 hier die Fregatte Cyclops mit aufgeriggt hatte 3 . Damals lagen da wesentlich mehr Schiffe, eine ganze Flotte, die nach Beendigung des Krieges mit Amerika überflüssig geworden war. Der Bootsmann unterbrach seine Träumereien.
»Legen Sie jetzt bitte Ruder, Sir, da hinten ist sie.«
Drinkwater reckte den Hals. Sie drehten unter dem Heck einer mit Geschoßnarben übersäten Slup hindurch, die Tide erfaßte das Boot, und die Ruderer arbeiteten mit vereinten Kräften gegenan. Neugierig betrachtete Drinkwater das Heck seiner Virago.
DRITTES KAPITEL Die Virago
November – Dezember 1800
Die geschnitzten Verzierungen am Heck überraschten ihn. Sie waren zwar angebrochen und völlig ohne Farbe und Goldauflage, aber trotzdem reich und dekorativ. Durch die Heckfenster leuchtete flackernder Kerzenschein. Mit einem dumpfen Stoß schor das Boot längsseits. Drinkwater ergriff das Manntau und hievte sich an Deck. Es gab keine Masten, keine Kanonen. Die Farbe der Mörserluken blätterte in großen Fladen ab, ausgefranste Persenninglappen klatschten über den zwei Niedergängen. In der spätherbstlichen Dämmerung war es ein recht niederdrückender Anblick. Er hörte Rogers hinter sich tadelnd mit der Zunge schnalzen. Ein paar Sekunden standen die beiden Offiziere starr da und schauten sich um, ihre weiten Bootsmäntel schlugen im Wind.
»Hier gibt’s allerhand Arbeit, Mr. Rogers.«
»Jawohl, Sir.«
Drinkwater marschierte nach achtern, erklomm die niedrige Poop und warf die Persenning über dem Niedergang zur Seite. Ein Geruch nach Essen und ungewaschenen Menschen schlug ihm entgegen. Lustiges Stimmengewirr war zu hören. Er stieg die Leiter hinab, wandte sich im Dunkel des unbeleuchteten Vorraumes nach achtern und stieß die Tür der Achterkajüte auf. Rogers trat hinter ihm ein.
Die Wirkung ihres Erscheinens war grotesk. Die Anwesenden erstarrten zu Salzsäulen. Hatte sich Drinkwater vorher nur irritiert gefühlt, als er das Licht hinter den Heckfenstern sah, so erregte der Anblick, der sich ihm jetzt bot, seinen Ärger. Mit einem Blick erfaßte er das schmierige Tischtuch, die schmutzigen Teller und Töpfe, die Überreste eines Festmahls, die herumliegenden leeren Flaschen. Sein Blick glitt über die Teilnehmer des Gelages. In der Mitte thronte ein kleiner rundlicher Mann in gutgeschneidertem Anzug und zerknautschtem Hemd. Er hatte an einer sehr offenherzig gekleideten Frau herumgefummelt, die halb über ihm lag. Ihr Mund war zu einer Grimasse erstarrt, kein Lachen kam mehr über ihre Lippen. Zwei weitere Männer lungerten um den Tisch, ihre Bekleidung befand sich in den unterschiedlichsten Stadien der Auflösung. Jeder hatte ein kicherndes Mädchen mit nackten Schultern auf dem Schoß. Nackte Knöchel und Waden waren unter schmuddeligen Petticoats sichtbar.
Die älteste der Frauen, die auf den Knien des gut gekleideten Mannes, faßte sich zuerst. Sie richtete sich auf, zuckte mit einer oft geübten Bewegung die Schultern, und ihr fülliger Busen verschwand im Leibchen.
»Was können wir für die Gentlemen tun?«
Die anderen Frauen folgten ihrem Beispiel, Baumwolle raschelte.
»Leutnant Drinkwater und Leutnant Rogers, Madam, und wie ist Ihr Name, wenn ich bitten darf?« Drinkwaters Stimme war von eisiger Höflichkeit.
»Ich bin Mrs. Jex«, antwortete sie und brachte mit einer Handbewegung aufkeimendes Gekicher von der anderen Tischseite zum Verstummen. »Frisch mit Hektor Jex verheiratet. Hier, das ist mein Ehemann.« Wieder wurde gekichert. »Er ist Zahlmeister auf diesem Schiff.« Ein besitzergreifender Hochmut schwang in ihrer Stimme mit. Mr. Jex blieb stumm hinter dem ausladenden Körper seiner Frau versteckt.
»Wer sind die anderen?«
»Mr. Matchett, der Bootsmann, und Mr. Mason, Steuermannsgehilfe.«
»Und die Damen?« fragte Drinkwater ironisch, der ihren Beruf schon ausgemacht hatte.
»Freundinnen von mir«, erwiderte Mrs. Jex mit der scharfen Selbstsicherheit der Besitzenden.
»Ich verstehe. Mr. Matchett!«
Matchett riß sich zusammen. »Sir?«
»Wo sind die anderen Unteroffiziere?«
»Nun ja, wir haben keinen Stückmeister und auch keinen Segelmeister ...«
»Wie viele Männer haben wir?«
»Die Gehilfen der Unteroffiziere nicht mitgezählt, das wären nämlich vier Mann, haben wir achtzehn Seeleute. Alle sind älter als sechzig Jahre. Das wär’s ...«
»Gut, Gentlemen. Ich werde das Kommando über die Virago übernehmen, Mr. Rogers hier wird Erster Offizer. Morgen früh kehre ich an Bord zurück und erwarte, daß Sie dann an Ihrer Arbeit sind.«
Er blickte alle noch einmal fest an, drehte sich auf dem Absatz um und kletterte wieder die Leiter empor. Er hörte, daß Rogers noch etwas zu ihnen sagte.
Auf dem Weg zu ihrem Boot stellte sich ihnen ein Mann in den Weg. Er trug eine Schürze und war trotz des kalten Windes in Hemdsärmeln. Grüßend hob er die Hand an die Stirn.
»Verzeihung, Sir, ich bin Willerton, der Zimmermann. Haben Sie das Hurenpack achtern gesehen, Sir? Der Lohn der Sünde wird über sie kommen! Mit dem Schiff ist sonst alles in bester Ordnung, Sir, das ist so gesund wie zur Zeit, als es gebaut wurde. Wir können zwei dreizehnzöllige Mörser aufnehmen, und kein Unterzug wird dabei auch nur knarren ... Nein, es ist wirklich alles in bester Orndung mit dem Schiff!«
Drinkwater, leicht aus der Fassung gebracht, dankte dem Mann. Als er wieder im Boot saß, dachte er über das nach, was er soeben erlebt hatte, und kam zu dem Schluß, daß es auf Virago Cliquen gab, die er in den nächsten Tagen besser kennenlernen mußte.
»Hiermit werden Sie angewiesen, ohne Verzug das Kommando auf Seiner Majestät Mörsertender Virago zu übernehmen, das Schiff seeklar zu machen und baldmöglichst klar zu melden ...«
Er stand im beißenden Wind und las weiter vor, die Bestallung flatterte in seinen Händen. Nachdem er geendet hatte, musterte er den kleinen Halbkreis, den die Unteroffiziere um ihn bildeten. Sie hatten die Mützen abgenommen, ihre sauberen blauen Jacken bildeten einen scharfen Kontrast zur abblätternden Farbe und dem nackten Holz des Schiffes. Sie bemühten sich ganz offensichtlich, den ersten Eindruck, den ihr neuer Kommandant am Vorabend von ihnen bekommen hatte, zu korrigieren. Das sollte man ihnen zugutehalten, dachte Drinkwater.
»Guten Morgen, meine Herren. Ich sehe mit Genugtuung, daß die nächtlichen Abenteuer Sie nicht von Ihren Pflichten abhalten.«
Er blickte sich um. Matchetts achtzehn Seeleute standen barfuß da und zitterten in dünnen Baumwollhemden und Hosen. In der einen Hand hielten sie ihren Scheuerstein, in der anderen die Mütze. Drinkwater wandte sich mit einer uralten Phrase an sie. Er hoffte, daß es aufrichtig klang, obwohl heißer Ärger in ihm aufstieg.
»Tut eure Pflicht, Männer, dann habt ihr nichts zu befürchten!«
Er marschierte nach achtern. Die Achterkajüte war aufgeklart worden. An die letzte Nacht erinnerten nur noch der Tisch und die Stühle. Rogers war ihm gefolgt, Drinkwater hörte ihn seufzen.
»Es gibt eine Menge zu tun, Sam.«
»Jawohl«, erwiderte Rogers ausdruckslos.
Aus einer benachbarten Kammer war ein dumpfes Husten zu hören, das schnell unterdrückt wurde. Die Luft roch immer noch nach Schweiß und Lavendelwasser.
Drinkwater kehrte in den Vorraum zurück und riß die Tür zur angrenzenden Kammer auf. Sie war leer, obwohl eine Seekiste, Bettzeug und eine Hutschachtel bezeugten, daß sie belegt war. Er wandte sich der gegenüberliegenden Tür zu, die sich öffnen ließ. Mrs. Jex kleidete sich darin gerade an. Sie mimte verschämte Überraschung, dann winkte sie ihm einladend zu. Ihre Reize waren unübersehbar, und in der Stille hörte Drinkwater Rogers hinter sich heftig schlucken.