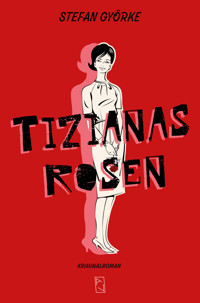Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im wohlsituierten Zürcher Bürgertum werden Jessy, Chloé und Clara von der chinesischen Nanny Atscho großgezogen. Atscho stammt vom Volk der Mosuo, bei dem die Mütter das Sagen haben, die Väter nicht der Rede wert sind und die Schwestern immer zusammenbleiben. Die Mutter der drei Töchter, die Ethnologin Sylvia Hofmann, hatte das kleine Matriarchat im chinesischen Himalaya erforscht und die junge Mosuo als Kindermädchen mit nach Zürich gebracht. Denn weder die häufig reisende Mutter noch der vielbeschäftigte Vater haben Zeit für die Kinder. Die Geschichten, die Atscho aus ihrer Heimat erzählt, und der unbedingte Zusammenhalt, der das Rückgrat der matriarchalen Familie der Mosuo bildet, faszinieren die Mädchen und sie beschließen, ihre eigene Schwestern-Familie zu gründen. Als aus den Töchtern Mütter werden, entspringen ihre sechs Kinder daher Gelegenheitsbekanntschaften nach dem Vorbild der Besuchsehe der Mosuo. Drei Mütter, eine Atscho, keine Väter – eine Oase der Frauen inmitten der Schweizer Bourgoisie. Als jedoch der wahre Grund für Atschos Emigration ans Licht kommt und der älteste Sohn Anton gegen die unkonventionelle Lebensform der Mütter immer stärker aufbegehrt, droht die Familie zu zerbrechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Györke
DIE MÜTTER
Roman Steidl
Inhalt
Teil 1
Nanny Atscho
Hakenhand
Klimapapier
Erwachsenengespräche
Ikarus
Antigone
Franziskaner
Bräute
Teil 2
Mütter
Brüder, Schwestern
Das Geschlecht der Geschichten
Väter
Schnitzer
Nuttenhaus
Jäger
Motorola
Grand Hotel
Teil 3
Desktop
Der Gu und das Mädchen
Wilhelm Hofmann
Ahtschalatscho Dabu
Ikarus II
Impressum
NANNY ATSCHO
Ohne Atscho wären die Mütter nicht die Mütter geworden, so viel steht fest. Vielleicht jede für sich eine Mutter, vielleicht auch nicht, wer weiß.
Jessy. Chloé. Clara.
Was habe ich euch alles zu verdanken! Was habt ihr mir alles angetan!
»Sag schon, Atscho!«, bettelte Chloé. Die drei Schwestern saßen um das Kindermädchen am Kamin. Atscho brauchte nicht auf das Nähzeug hinabzuschauen, ihre rauen Finger erledigten die Arbeit von allein, stachen zu, empfingen die Nadel, zogen den Faden, und wieder von vorn. Auch einen Fingerhut brauchte sie nicht, so verhornt waren die Kuppen. Wenn von ihren Fingern die Rede war, wurde sie rot. Am Kamin erzählte Atscho die wunderlichsten Geschichten, und Gutenachtlieder sang sie in der chinesischen Naxi-Sprache mit ihrer sanften Stimme. Am liebsten war es den Mädchen, wenn sie aus ihrer Heimat erzählte, vom Leben am Lugu-See, wo die Mütter das Sagen haben und die Schwestern für immer zusammenbleiben. Gerade hatte Chloé es herausgefunden, Atscho, das war gar nicht ihr richtiger Name.
»Ihr könntet ihn nicht aussprechen«, sagte Atscho, aber Clara sagte: »wie kannst du das wissen, wenn du ihn nicht verrätst?«, die kleine Clara richtete sich aus dem Schneidersitz auf, machte beim Sprechen mit dem Finger Zeichen in die Luft.
»Ah-tscha-la-tscho«, hörten die Mädchen die Stimme der Mutter, die auf einmal im Wohnzimmer stand.
»Ah-tscha-la-tscho«, versuchte sich Clara.
»Nicht schlecht«, meinte Sylvia Hofmann, die jetzt leiser sprach. »Ihr müsst es sagen, als wolltet ihr es gar nicht sagen. In Atschos Sprache wird geflüstert.«
Atscho lächelte wieder und machte ein schwirrendes Geräusch mit den Lippen. Jessy lachte laut auf, Chloé aber machte eine todernste Miene und säuselte genau wie Atscho irgendein Kauderwelsch. Atscho widersprach, ohne etwas zu sagen, bis alle durcheinanderzischelten, ein einziger geflüsterter Wortsalat, von Gelächter hier und da unterbrochen.
»So«, sagte schließlich das Kindermädchen, biss den Faden ab und legte das Nähzeug beiseite, »Schlafenszeit.«
»Moment«, rief Clara, »du hast die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt!«
»Wie ihr gereist seid«, sagte Jessy, »Mama und du, durch ganz China und um die halbe Welt!«
Eine lange Zeit ist es her, dass ich an die Mütter gedacht habe.
Jessy. Chloé. Clara.
Manchmal braucht es eine außergewöhnliche Begegnung, um uns an das Wesentliche im Leben zu erinnern – und sei es inzwischen verloren in der Vergangenheit. Manchmal braucht es die Unerschütterlichkeit eines uralten Katers, um uns auf die Sprünge zu helfen …
Ausgerechnet in Kaisers Reblaube habe ich Linda eingeladen, ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Für die Mütter war das Lokal etwas ganz Besonderes gewesen, ein Ort erotischer Verschwörung und Liebesidiotie. Es hieß, hier hätten sie ihre Heiratsanträge bekommen.
Alle drei.
Keine Frage, auf die Pflege ihrer Mythen verstanden sich die Mütter, darauf, sich zu verschwören, schon als kleine Mädchen waren sie darin geübt – Atscho hatte es ihnen leicht gemacht.
Als ich mich gegen sechs Uhr abends auf den Weg ins Restaurant mache, wird es dunkel und es ist kalt und neblig im herbstlichen Zürich, die Leute tragen Schals und Mützen.
»Sa-tans-bra-ten!«, hatte Atscho immer gesagt, wenn sie mir hinterrücks eine Kappe überzog, die ich mir sofort wieder vom Kopf riss, die Haare elektrisiert.
Von der Glockengasse kommt man rückseits zum Restaurant, bevor es links in die Robert-Walser-Gasse geht. Ich gehe langsamer, nähere mich einem der Fenster. In die Scheibe sind ein Mann und eine Frau eingraviert, umrankt von Reben, zwischen denen ich im Inneren der Gaststube Lindas Gesicht erkenne.
Fast ein Jahr kennen wir uns jetzt. Wir gehen zusammen ins Kino, im Wald spazieren, Kaffee trinken. Dass ich keine Anstalten mache, sie ins Bett zu kriegen, scheint sie nicht zu stören.
Linda ist Augenärztin, und als ich Blinda zu ihr sagte, hat sie die cremefarbenen Augen verdreht, aber als ich ihr sagte, sie sei eine Augenweideärztin, hat sie immerhin geschmunzelt. Humor verträgt sich bekanntlich nicht mit der Eitelkeit der Frauen. Ihr Whatsapp-Profilbild wechselt Blinda jede Woche, darauf ist immer nur sie zu sehen, in Szene gesetzt in einem Straßencafé, auf der Leiter eines Motorboots oder vor irgendwelchen Denkmälern, Blinda unterm Arc de Triomphe, Blinda vor dem Kolosseum, Blinda zu Füßen der Sagrada Familia.
Einer eitlen Frau wird es entweder langweilig oder unheimlich, wenn Humor ins Spiel kommt. Erst lässt sie sich nichts anmerken – und dann lässt sie nichts mehr von sich hören. Früher oder später werde ich jeder Frau unheimlich. Früher oder später verschwinden sie alle. Außer Blinda. Noch erscheint sie sogar zu früh zu unseren Verabredungen.
Ich hänge meinen Mantel auf, schiele an der Garderobe vorbei. Es ist der Tisch in der Nische, an den man Blinda gesetzt hat, der beste im Restaurant. Jener Tisch, an dem die Mütter ihre Anträge bekommen hatten.
Alle drei.
Atscho stammte vom Volk der Mosuo am Lugu-See, einer abgelegenen Provinz im chinesischen Himalaya, »dem äußeren Arsch der Welt«, wenn es nach Damian Hofmann ging, dem Vater der Mütter. Die Mutter der Mütter hatte Atscho von dort mit nach Hause genommen, weil sie ein Kindermädchen brauchte. Die Mutter der Mütter, Dr. Sylvia Hofmann, hatte keine Zeit, sich um die Mütter zu kümmern, als sie noch Töchter waren.
Manchmal waren Sylvia Hofmann und ihr Mann Damian für einen Gutenachtkuss zu Hause, manchmal nicht. Und wenn ihre kleinen Töchter frühmorgens erwachten, waren die Eltern schon wieder in der Kanzlei, oder im Taxi zum Flughafen.
Aber Atscho war da. Sie ging als Letzte zu Bett und stand als Erste auf. Um fünf in der Früh öffnete sie in ihrem Zimmerchen das Fenster zum Innenhof, setzte sich im Schneidersitz vor den Altar. Josef hatte von den Meistern gelernt. Der Altar, den er ihr geschnitzt hatte, war von jenen in ihrer Heimat nicht zu unterscheiden. Manch eine Mosuo hätte ihn ihr bestimmt missgönnt. »Der Neid ist die billigste aller Sünden«, hatte ihre Mutter manchmal gesagt.
Ein gefächerter Holzrahmen umfasste das Podest, da standen Messingschalen, zwei Blumenvasen, Buddha-Figuren. In der Mitte die Bilder der Ahninnen und die Talismane. Atscho zündete ein Stück Kohle in der Schale an, zupfte getrocknete Salbeiblätter drüber. Mit dem Zeigefinger berührte sie ihre Stirn, dann die Stirn der Buddhas, jene der Mutter, Großmutter, Tanten.
Nach dem morgendlichen Gebet ging Atscho in die Küche, bereitete Frühstück, kochte Buttertee. Der junge Kater Ikarus sprang hoch auf die Abzugshaube.
»Spring-Bock«, sagte Atscho und drehte das Gas am Herd auf. Wenn ihr ein deutsches Wort fremd vorkam – Schnürsen-kel, Kopf-stein-pflas-ter –, formte sie es Silbe für Silbe mit ihren breiten Lippen, Sa-tans-bra-ten.
In der Küche roch es nach Teeblättern und geräuchertem Fleisch. Atscho nahm die gedämpften Hirsebrote aus dem Bambus-Steamer. In der Vorratskammer packte sie eine der Würste, die von der Decke hingen, holte ein Messer aus den Falten ihrer Küchenkluft, trennte die Schnur.
»Die Katze gehört auf den Boden«, sagte Sylvia Hofmann, legte ihre Handtasche neben die Früchteschale. Atscho lächelte nur, wischte sich die Hände am Küchentuch ab, »erst mal Tee«, sagte sie, schenkte ein und stellte das Tablett auf den Frühstückstisch.
»Die Kinder haben am Nachmittag frei«, sagte Sylvia, tunkte ein Stück Brot in den Tee, »Lehrerfortbildung oder so. Sie kommen mittags schon nach Hause. Zusammen mit Chloé.«
»Chloé?«, fragte Atscho.
»Ihre Mutter hat gestern angerufen«, sagte Sylvia, »hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie wollten Chloé eigentlich fürs Wochenende abholen, aber jetzt ist etwas dazwischengekommen. Sie fliegen heute nach Asien.«
»Gut, gut«, sagte Atscho, und Sylvia sagte: »Manchmal vergesse ich, dass sie Eltern hat.«
»Sie hat uns«, sagte Atscho und schnitt Sylvia ein Stück Wurst ab.
Längst kümmerte es niemanden mehr, dass Chloé keine Tochter der Hofmanns war. Jessy und Clara hatten erst im Kindergarten erfahren, dass sie Sander mit Nachnamen hieß, und nicht Hofmann.
Chloés Eltern, Mike und Hedy Sander, handelten mit luxuriösen Terrarien, die sie für seltene Tiere entwarfen, Civetkatzen, Beutelratten, Skorpione. Die Terrarien verkauften sie auf der ganzen Welt, sie waren dauernd unterwegs. Das sei ja kein Leben für ein kleines Kind, fanden Hedy und Mike. Atscho fand das auch. Chloé erst recht. Und Sylvia Hofmann zuckte mit der Schulter.
Chloés Vater Mike hatte nur ein halbes Gesicht, die andere Hälfte war dunkelbraunes Narbengewebe, seit er als neugieriges Kind den Kopf in eine Gasheizung gesteckt hatte. Damian Hofmann und er hatten sich in der Rekrutenschule angefreundet, und als Damian von der Genfer Anwaltskanzlei Widmer & Fils zum Partner gemacht werden sollte, war Mike mit einem Darlehen zur Stelle. Hofmann hatte es längst zurückbezahlt und war mit seinem Partnersalär auf finanzielle Hilfe nicht mehr angewiesen, als Sander ihm die Eigentumswohnung an der Kirchgasse 33 vermittelte, eine der begehrtesten Immobilien Zürichs. Die Wohnung lag im zweiten Stockwerk des sogenannten Steinhauses aus dem 14. Jahrhundert, wo der Dichter Gottfried Keller als Stadtschreiber gelebt und gearbeitet hatte. Sie war sorgfältig renoviert und legte ein gesamtes Stockwerk der ehemaligen Staatskanzlei zusammen. Acht Zimmer zählte sie, und ein Drittel der Fläche entfiel auf das große Wohnzimmer, von dem aus man nach drei Seiten Ausblick hatte: bergwärts hinüber zur riesigen Buche an der Florhofgasse, gegenüber auf die mittelalterliche Häuserzeile und stadtabwärts bis zum See.
»Wie hat Mike das nur hingekriegt?«, fragte Sylvia, als sie sich in ihrem neuen Zuhause umschaute.
»Die Stadtregierung im Puff erwischt, nehme ich an«, meinte Damian, und Sylvia sagte: »Ich weiß nicht, ob das reicht.«
Wenn die Sanders zum Abendessen kamen, sagte Damian zu seinem Kumpan: »Jetzt pass mal auf«, und zeigte auf das Kindermädchen, »wie die wieder alles im Griff hat hier«, und Mike meinte: »Sehr fleißig, diese Chinesinnen.«
»Wart nur, das Hühnchen mit Ginseng, Sojasauce und Salbei«, sagte Damian, »da wirst du religiös.«
Atschos Kochkünste waren umso erstaunlicher, als dass sie aufgrund einer Krankheit in ihrer Jugend nichts mehr riechen konnte und kaum etwas schmeckte.
»Furchtbar«, sagte Hedy Sander, »also ich würde keinen Bissen mehr essen. Geschweige denn kochen!« Atscho aber meinte: »Auch die Nase hat ihr Gedächtnis.«
Sie hielt das Essen warm, servierte die angerichteten Teller, schenkte Wein nach und kümmerte sich um die kleine Chloé Sander, die ihr auf den Speckbeinchen nachstolperte, während die eifersüchtige Jessy sich an ihre Fersen heftete. Schließlich packte sich Atscho die beiden kurzerhand auf den breiten Rücken. Den Rest des Abends klammerten sich die Mädchen in den Jutestoff, ritten vom Esszimmer in die Küche und zurück und schlossen auf dem Kindermädchenbuckel Freundschaft.
Eines Abends verabschiedeten sich die Sanders und machten sich ohne Chloé auf den Heimweg. Die vierjährige Tochter hatte sich schon mit Jessy und Clara schlafen gelegt – und wurde vergessen.
»Jetzt bleibt sie hier«, sagte Atscho, und Sylvia sagte: »Klar«, und ihr betrunkener Gatte nickte schläfrig vor sich hin.
Damian wollte nicht, dass die Sanders für Chloés Unterhalt aufkamen, »du hast weiß Gott genug für uns getan«, doch Mike ließ sich nicht davon abbringen. Als seine monatlichen Beiträge postwendend auf sein Konto rücküberwiesen wurden, begann er, den Hofmann’schen Keller mit Bordeaux-Weinen auszustatten. »Alles andere ist Katzenpisse«, meinte Sander, und dann wies er in Richtung Atscho, »vom Reiswein ganz zu schweigen.«
Die kleine Clara fürchtete sich immer ein wenig vor Mike Sander wegen des Brandmals über seinem halben Gesicht, aber Chloé versicherte ihr, er sei ein Papa wie jeder andere. Chloé bekam ihr eigenes Zimmer ganz am Ende des Korridors, das sie aber kaum benutzte, denn die Mädchen schliefen immer alle zusammen in Jessys Zimmer.
»Unter einer Decke«, sagte Atscho mit ihrer sanften, heiseren Stimme, »die stecken unter einer Decke.«
Die Mutter der Mütter hatte damals keinen Aufwand gescheut, die junge Atscho mit allen nötigen Papieren auszustatten. Sie musste mit ihr nach Beijing reisen, um einen Pass zu beantragen. Erst einmal ging es auf lehmigen Pfaden vom Lugu-See zu Fuß die Berge hinab nach Hongqiao, von dort mit dem Jeep nach Xichang, der Hauptstadt des autonomen Kreises. Im Verwaltungsbüro musste Atscho ein kleines Büchlein voller Tabellen und Stempel vorweisen, das Hokuo, das sie ihrer Familie und ihrem Dorf zuordnete und zur Nutzung ihres Landes berechtigte. Der Ausweis wurde ausgiebig begutachtet und schließlich unterzeichnet, damit er in Beijing zugunsten eines Reisepasses annulliert werden konnte. Von Xichang reisten die beiden Frauen mit dem Zug über Chengdu in die Hauptstadt. Sylvia Hofmann wusste, ihnen würden noch mehr Steine in den Weg gelegt werden, als es in den Verwaltungsverfahren der Volksrepublik ohnehin vorgesehen war. Dem Volk der Mosuo begegnete die Zentralregierung seit jeher mit Argwohn, manchmal mit Schikanen. Einige Jahre lang war ihnen sogar ihre traditionelle Lebensweise und die Pflege ihres Brauchtums untersagt gewesen. Aber nebst Naxi sprach Sylvia damals schon gut Mandarin und wusste ihren fremden Zungenschlag, wenn nötig, charmant den Han-Dialekten aufzusetzen. Im Übrigen halfen ihre porzellanweiße Haut, die großen Augen und die roten Haare den chinesischen Beamten doch hier und da auf die Sprünge.
Auf dem Flug von Beijing nach Zürich wollte Atschos Herz nicht aufhören, wie wild zu klopfen. Ein ewiges Abendrot über der Erde weit dort unten begleitete sie von der Heimat fast über den gesamten Kontinent nach Westen. So traurig sie über den Abschied von ihrer Familie war, die Freude auf ihr neues Zuhause überwog, und es war ihr, als könne die Sonne niemals mehr untergehen über ihrem neuen Leben.
Sie löste die Schnalle ihres Gurts, kauerte im Korridor vor Sylvia nieder und wollte ihr auf den Knien danken. Diese aber packte Atscho am Ärmel und zerrte sie zurück auf den Sitz: »So etwas machst du nie wieder!«
Ja, unter einer Decke steckten sie, die Mütter, die noch kleine Mädchen waren, von Atscho geliebt und erzogen. Von Atscho bekamen sie die Geschichten ihres Volks erzählt, von Atscho waren sie Strenge gewohnt, kannten den harten Griff der hornigen Finger, wenn es galt, Ordnung und Gerechtigkeit einzuhalten – aber auch Atschos Nachsicht, wenn sie die Schwestern etwa weit nach Schlafenszeit im Licht einer Taschenlampe die halben Nächte miteinander flüstern ließ, das Betttuch über den Köpfen:
»Aber wisst ihr auch, wie die Mosuo leben?«
»Klar wissen wir das.«
»Mosuo-Mütter sind die Chefinnen.«
»Jawohl, sie haben das Sagen.«
»Und Mosuo-Schwestern bleiben immer zusammen.«
»Und wenn sie erwachsen sind?«
»Sie bleiben immer zusammen.«
»Und wenn sie verheiratet sind?«
»Oje! Glaubt ihr, eine Mosuo wäre jemals so dumm?«
»Kuckucks-Chloé«, sagte manchmal Damian, der Vater der Mütter, und Sylvia missbilligte das der Form halber, schnalzte nur mahnend mit der Zunge. Sein böser Humor, der hatte ihr immer gefallen.
Atscho formte noch ein paar Hirsefladen für die Mädchen, die sie eben aufgeweckt und ins Bad geschickt hatte.
»Montagabend nicht vergessen«, sagte Atscho zu Sylvia, »die Aufführung.«
»Schultheater«, erinnerte sich Sylvia und trank den letzten Schluck Buttertee, »das werde ich nicht schaffen.«
»Die Mädchen verstehen das schon.«
»Sag mal, dein Deutsch ist ja inzwischen fast perfekt.«
»Danke«, lächelte Atscho.
»Josef muss ein begabter Lehrer sein«, fügte Sylvia hinzu und schielte über den Rand der Tasse nach dem Kindermädchen, das rote Ohren bekam.
»Wieso kannst du nicht? Zum Schultheater?«
»Sitzung. Die Webstuhl-Firma.«
»Web-stuhl.«
»Eine Delegation aus Nanjing«, sagte Sylvia, »Zollfragen, Zahlungsmodus, Menschenrechte«, Sylvia verdrehte die Augen, »wird ewig dauern.«
»Du arbeitest zu viel«, sagte Atscho.
»Vielleicht kommt Damian rechtzeitig aus Basel. Schreib ihm einen Zettel.«
Zwischen den Falten ihrer Kluft fand Atscho ein Blatt Papier mit einer Bleistiftnotiz, die beiden Frauen tauschten ein kleines Lächeln.
»Der Auftrag in Basel«, Atscho runzelte die Stirn, »wie sagt man …?«
»Mandat.«
»Ein großes Mandat?«
»Das hoffe ich«, sagte Sylvia, »soll ich alles alleine verdienen?«
»Damian arbeitet auch zu viel.«
Sylvia stand auf, faltete die Serviette.
»Die Einzige, die zu viel arbeitet«, sagte sie, »bist du. Was machen die Knie?«
»Wet-ter-wech-sel«, meinte Atscho und hängte Sylvia die Handtasche um die Schulter. Da sprang Ikarus vom Dampfabzug in weitem Bogen über ihre Köpfe, landete direkt auf dem Brotkasten, so dass der Deckel zuschnappte. Sylvia warf Atscho einen Blick zu und sagte: »Komödiant.«
HAKENHAND
Bei unserem letzten Treffen habe ich Blinda zum ersten Mal aus dem Mantel geholfen. Es braucht schon ein wenig Fingerspitzengefühl, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Nicht wenige Frauen halten es für antiquiert, wenn man ihnen die Tür aufhält, als Erster ein Restaurant betritt oder sich vor der Garderobe an ihnen zu schaffen macht. Blinda ließ es sich gefallen, wie von selbst glitt sie aus den Ärmeln.
Der Tisch im Erker der Reblaube ist die Sorte Tisch, die etwas abseits steht, wo man seine Ruhe hat und doch von allen Gästen gesehen wird. Und Blinda ist die Sorte Frau, die den besten Tisch bekommt, ohne danach zu fragen.
»Die Sorte Frau, die man nicht allein warten lassen sollte«, sage ich und gebe ihr zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange.
»Sorte Frau?«, fragt Blinda, hebt eine ihrer herrlichen Brauen.
»Ich bin überrascht«, sage ich, »dass mein Platz nicht schon besetzt ist.«
»So?«, meint Blinda und ich sage, »Verehrer lauern überall.«
Im Kamin brannte nie auch nur eine Flamme. Damian hielt Feuer in der Stube für spießig, »das ist mir der brave Schweizer: im Kopf keinen Funken Verstand, aber im Haus brennt’s!«
Atscho hielt trotzdem stets Holz bereit, wie sie es von ihrer Mutter gelernt hatte, einen Kegel leicht brennbares Schnittholz, die dicken Buchenkloben rundherum. Manchmal, nicht oft, war es dieser Anblick, der Atscho einen kleinen Stich Heimweh versetzte, das Holz, das vergeblich darauf wartete, entzündet zu werden, während Atschos Schwestern zu Hause in der Feuerstelle die Flammen niemals ausgehen ließen, wie es sich gehörte. Hier stand das Holz kalt im Kamin bereit, jahrein, jahraus.
Die Mädchen und Atscho machten es sich trotzdem davor gemütlich, holten Sofakissen und setzten sich zusammen. Als die Mütter noch Töchter waren, konnten sie von jener einen Geschichte nie genug kriegen.
»Los Atscho, Das mutige Mädchen und der Gu!«
Sie hingen an Atschos Lippen, selbst Ikarus saß reglos zu ihren Füßen und hielt beim Schnurren inne – wenn aber der Vater nach Hause kam, hielt den jungen Kater nichts mehr. Er hatte es auf Damians Schnürsenkel abgesehen. Auch für die Wohnung hatte der Vater ein gutes Paar italienische Schuhe, »wer Pantoffeln trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren«, meinte er. Ikarus aber entwickelte eine beachtliche Meisterschaft, die Schnürsenkel zu lösen, während Damian am Tisch Zeitung las oder auf dem Sofa eine Zigarre rauchte.
»Blöder Kater!«, schimpfte der Vater und fuchtelte mit der Zeitung, »dich haben wir diesem schwulen Juden zu verdanken!«
»Sprache«, mahnte Sylvia und ihr Mann sagte: »Sprache benennt Sache, zum Teufel!«
»Genug jetzt«, sagte Sylvia, »lass Josef aus dem Spiel, mit Ikarus hat der nichts am Hut.«
Damian Hofmann war der Überzeugung, der Kater sei zusammen mit dem Journalisten und Edelholzhändler Josef Stein oben im dritten Stockwerk eingezogen, bevor er in die Hofmann’sche Wohnung übersiedelte. »Jetzt auch noch eine Kuckucks-Katz?«
Zwischendurch war der Kater gut und gerne eine Woche unterwegs, streunte über die Altstadtdächer. Wenn sie spätabends alles erledigt hatte, stand Atscho im Wohnzimmer am Fenster, hielt Ausschau, und wenn er endlich wieder auftauchte, urplötzlich von Josef Steins Dachterrasse angeflogen, ließen sich beide ihre Freude nicht anmerken. Im Trab folgte der Kater Atscho in die Küche, wo er einen besonders großen Zipfel Wurst von ihr spendiert bekam.
Wahrscheinlich lag Sylvia richtig, mit Josef Stein hatte Ikarus nichts am Hut. Er war wohl einfach ungefähr zu jener Zeit zugelaufen, als Stein die Wohnung in der oberen Etage bezogen hatte. Der neue Nachbar hatte sich mit einer Grußkarte vorgestellt, und Damian war von der schönen Handschrift angetan: »Das ist ja reine Kalligraphie«, sagte er ehrfürchtig. Für Kunstfertigkeit hatte er eine Schwäche.
Als der neue Nachbar dann an einem Samstagabend an der Tür klingelte, rief Sylvia ihre Töchter herbei und stellte sie vor, legte ihre Hand nacheinander auf die Köpfe der drei Mädchen.
Jessy weißblond. Chloé pechschwarz. Clara rostrot.
»Mein Mann nennt sie die Buntlinge«, erzählte Sylvia und lachte mit dem neuen Nachbarn. Sie hatte schon von ihm gehört, wusste, dass auch er wohl eine Weile in Asien gelebt und mehrere Reiseberichte und Reportagen veröffentlicht hatte. Sein Geld aber verdiente Stein inzwischen mit Zitan-Holz, das er aus China importierte. Einen kleinen Teil davon bearbeitete er in seiner Werkstatt, fertigte Schatullen, Bilderrahmen, Holzskulpturen, kleine geschnitzte Kunstwerke.
»Zitan?«, fragte Jessy, und Josef meinte: »Das schwerste Holz der Welt, das einzige, das nicht auf dem Wasser schwimmt.«
»Wofür soll das gut sein«, fragte Clara, »U-Boote?«
»Oh«, lachte Josef, »das könnte teuer werden. Im alten China war Zitan mehr wert als Gold.«
»Sie lassen das Holz hierherbringen und verkaufen es«, sagte Jessy, und Josef sagte zu Sylvia: »Ihren Töchtern kann man nichts vormachen«, und Sylvia gab einen Seufzer von sich: »Nicht das Geringste!«
»Das meiste davon verkaufe ich«, sagte Stein, »das eine oder andere Stück bearbeite ich selbst.«
»Sie sind ein Schreiner?«, fragte Chloé, und Josef sagte: »Ein Amateur«, und Clara fragte: »Ein schlechter Schreiner?«, und Josef musste wieder lachen, bevor er auf einmal innehielt und an sich hinabblickte. Ikarus hatte sich dazugesellt, strich dem neuen Nachbarn um die Füße.
»Ikarus?«, sagte Chloé ungläubig, »er mag keine fremden Menschen.«
»Wenn das so ist«, sagte Stein, »gehöre ich wohl ab jetzt zur Familie.«
Der Kater stellte sich auf die Hinterläufe, schnupperte am Ärmel.
»Neugierig?«, fragte Stein, und die drei Mädchen machten Augen, jetzt streckte er den Arm hervor, krempelte den Ärmel Stück für Stück zurück über den Stahlhaken, der anstelle einer Hand zum Vorschein kam. Der Kater beschnupperte vorsichtig das Metall, das unter seiner rosa Nase beschlug.
»Aber«, brachte Jessy endlich heraus, und Stein sagte: »Halb so wild. Tropische Gangrän. Musste amputiert werden.« Er wandte sich an Sylvia Hofmann: »Ich bin in jungen Jahren lange durch Asien gereist. Ich war seinerzeit sehr beeindruckt von Ihrem Werk über die Mosuo.«
»Sie haben meine Dissertation gelesen?«
»Nein, ich habe sie genau studiert.«
»Das freut mich wirklich«, strahlte Sylvia Hofmann, »leider muss ich gestehen, noch nichts von Ihnen gelesen zu haben.«
Als Stein gerade fragen wollte, ob er Sylvia einen Band mit Reiseberichten vorbeibringen dürfe, hielt Clara nicht mehr länger an sich und streckte die Hand nach dem Haken aus.
»Clara!«, rief Sylvia und packte die Tochter am Arm, »Herr Stein, entschuldigen Sie, unsere Kleinste ist noch neugieriger als der Kater.«
»Oh, es gibt sicher bessere Attrappen heutzutage«, sagte Stein und zeigte seinen Haken her, »aber ich sage immer: lieber eine wahre Fälschung als eine gefälschte Wahrheit.«
Sylvia lachte, und der Nachbar ging vor den Mädchen in die Knie, hielt ihnen den Haken zum Anfassen hin.
»Übrigens«, sagte er, »was sucht der Einarmige im Einkaufszentrum?«
Die Schwestern untersuchten eine nach der anderen mit ihren kleinen Fingern das Metall.
»Den Second-Hand-Shop!«
Aus der Küche ein Knall. Scherben.
»Alles in Ordnung?«, rief Sylvia. »Ja«, hörten sie Atscho aus der Küche, »alles in Ordnung.«
KLIMAPAPIER
Ich schiebe das Töpfchen mit der roten Amaryllis-Blume beiseite, die Blüte verliert eine Prise Staub. Ich tupfe das goldene Pulver vom Tischtuch auf, stemple damit sanft Blindas Ringfinger. Da fährt ihre zierliche Hand aus, patsch! … knapp entkommt ihrem Schlag eine Fliege, die gerade dabei war, mit ihrem Rüssel die winzigen Leinenmaschen der Serviette zu untersuchen.
»Was ist das?«, fragt Blinda und zeigt auf meine Handfläche, während ich der Fliege nachsehe.
»Ein Brandmal«, sage ich.
»Erzähl.«
»Später, lass uns bestellen.«
In der Vorlesung von Professorin Sabine Hammer habe ich gelernt, dass wir in Zeiten einer ausgenüchterten Erotik leben. Die blutjunge Akademikerin bekleidet an der philosophischen Fakultät die noch jüngere Position der Programmdirektorin Gender Studies. Jeder Mensch, vom Säugling bis zum Greis, habe ein polysexuelles Potential. Das Geschlecht bestehe aus einem Set von Merkmalen, die jeder Mensch nach Gutdünken empfinden oder verwerfen kann. Schluss mit der guten alten Fleischlichkeit und unzweideutiger Lust, Schluss mit der Klarheit auf dem Feld des Begehrens, mit Sexbomben und Machos.
Mag sein. Aber gilt nicht doch auch heute wie eh und je, wenn eine schöne Frau von einem Mann nicht begehrt wird, erwägt sie nur gerade zwei Optionen: schwul oder impotent. Ich weiß noch nicht, wie Blindas Urteil über mich ausfällt. Ich habe mich auch schon gefragt, ob mit ihr etwas nicht stimme, da sie scheinbar nicht der Ansicht ist, mit mir stimme etwas nicht.
Anfangs waren sie alle von meiner Zurückhaltung angetan, die Frauen, mit denen ich mich verabredete. Mein Interesse an ihnen hielten sie für etwas Besonderes, ein wahrhaftes Feingefühl, eine so abgründige Leidenschaft, dass sie dem ersten Blick verborgen blieb. Doch je länger meine Avancen ausblieben, desto misstrauischer wurden sie – bis sie dann verschwanden.
Beim Dessert erzählt Blinda von ihrem Forschungsprojekt. Sie will nachweisen, dass irgendwelche Grippeviren auch über die Augenschleimhaut aufgenommen werden. Ich verliere mich in Blindas crèmebraunen Augen, dem klassischen Schlafzimmerblick, ich tue mein Bestes, mich nicht in sie zu verlieben. Vor einer Woche habe ich ihr nicht nur zum ersten Mal aus dem Mantel geholfen, wir haben uns auch zum ersten Mal geküsst, wie aus Versehen.
Da ist irgendetwas an ihr, das mich zu verführen scheint, Geheimnisse zu offenbaren, meine Karten auf den Tisch zu legen. Soll ich ihr vom heutigen Ausflug auf den Dachboden erzählen?
Den ganzen Tag war ich auf der Flucht vor einem Text, an den ich mich längst hätte setzen sollen: Positionspapier Klimawandel. Schon vor einer Woche hatte Heinz Aerni meinen Entwurf erwartet, Nationalrat und Kommunikationschef der Volkspartei, Vorsitzender des Thinktanks zum CO2-Gesetz.
Vorläufig habe ich mich herausgelogen, Spaziergang im Wald mit Stolper-Stunt, Schlüsselbeinbruch. Aerni hasst es, Dinge zu verschieben, »Sankt Nimmerlein!« Bei mir drückt er schon mal ein Auge zu. Man kann sagen, wir seien uns freundschaftlich verbunden. Er sieht sich als mein Mentor, das bedeutet doch eine gewisse Pflicht zur Fürsorglichkeit. Damals, als ich aus der Wohnung an der Kirchgasse ausgezogen war, hatte er mir einen Bauernhof vermittelt, der günstig zu haben sei, »ein Spottpreis«, sagte Aerni. »Und nicht mal den ist er wert«, sagte ich, »die Ställe sind besser ausgebaut als das Haus.« Aerni hatte schließlich einräumen müssen, der Hof sei schlicht nicht bewohnbar, man würde viel investieren müssen, Küche, Bad, Heizung, Böden, Dach, die Auflagen zur Energieeffizienz machten die Geschichte nicht billiger. Es war mir damals nicht ganz klar, weshalb ich mich trotzdem zum Kauf überreden ließ. Oder vielmehr, weshalb ich gar nicht überredet werden musste. Die kleine Mietwohnung an der Turner-Strasse im Hochschul-Quartier, die ich immer noch bewohne, war damals als Übergangslösung gedacht.
Aerni reißt langsam der Geduldsfaden. Er hat mir Zeit bis Ende des Jahres gegeben. Somit bleibt ein guter Monat, die verbockte Umweltpolitik der Volkspartei auf ein akzeptables Fundament zu stellen.
Länger schon liegen die Nerven im Vorstand blank. Das Thema wird immer heißer, Kinder bestreiken ihre Schulen, Erdölkonzerne saugen sich »auf dem Weg zur CO2-Neutralität« die üblichen Phrasen aus den Fingern, die Klimafrage abonniert die Schlagzeilen – allmählich dämmert der Parteileitung, dass die Sache keine Treibhaus-Petarde ist. Die kreativen Organe wurden aufgescheucht, neben meinem rauchen ein gutes Dutzend weitere Köpfe. Aber mein Kopf bleibt auch rauchend ohne den Hauch einer Idee, wie die Sache aus konservativ-liberaler Sicht vernünftig angegangen werden soll.
Wie es aussieht, sind meine Tage in der Volkspartei ohnehin gezählt. Ich hatte ja von Anfang an meine liebe Mühe. Dass es dort fast nur Männer gibt, hat mich nicht gestört. Alle heißen Walter, Heiri, Heinz und Kurt, alle stehen für Recht und Ordnung mit ihren karierten Hemden, alle sprechen doppelt so laut wie nötig. Anfangs bin ich auf das fidele Miteinander hereingefallen, das jede Partei durchseucht, egal welcher Gesinnung. Man spendet Zuspruch, klopft Schultern, applaudiert – das macht die Runde wie im Ringelreihen, man bekommt Zuspruch, Schulterklopfen und Applaus.
Natürlich hatte mein Beitritt die Mütter in Rage gebracht. Damals, Sommer 2005, Abstimmungskampf zum Schengen-Abkommen. Die Schweiz sollte sich dem europäischen Sicherheitsraum anschließen. Gemäß dem Schengen-Abkommen kontrollieren die Länder ihre Grenzen nicht mehr selbst, das übernehmen die Kollegen im ehemaligen Ostblock.
Das polnische, ungarische und slowakische Grenzwachpersonal hat sicher eine solide Erfahrung, Landsleute an der Ausreise zu hindern. Aber können sie eine Grenze auch vor Eindringlingen schützen?, hieß es in einem meiner Entwürfe für die Rede eines Stadtrats, Walter, Heiri, Heinz oder Kurt.
Die Volkspartei hatte das Referendum ergriffen, und ich zog in den Kampf für die Unabhängigkeit der Schweiz, verteilte Flugblätter, stritt an Informationsständen, ließ mich wegen meiner Jugend und meiner Klugscheißerei anpöbeln, legte mir ein dickes Fell zu. Die Abstimmung ging verloren, die Vorlage wurde angenommen und ich war am Boden zerstört. Mit einer Mail wandte ich mich an die Wortführer meiner Volkspartei. Ich kritisierte die Strategie im Abstimmungskampf, die halbherzigen Auftritte, die schlechte Kommunikation, vor allem diese dämliche Plakatkampagne: ein Mann, eine Frau, Panik in den Gesichtern, schreiend, haareraufend, darunter: Schengen Nein! Dublin Nein!
Ich plädierte für konzise Inhalte, scharf auf den Punkt gebracht mit einer Prise Humor. Meine Vorschläge gelangten irgendwie in Heinz Aernis Finger, und der naseweise Gymnasiast, der ich war, erhielt von ihm einen handgeschriebenen Brief.
Er lud mich ein zum Kaffee, und wir unterhielten uns eine gute Stunde. Er machte Notizen in sein Heft, lachte über meine Sprüche und fragte mich, was ich aus meinem Leben machen wollte. Schon bei diesem ersten Treffen versuchte er, mich zum Landleben zu bekehren, schwärmte von den Apfelbäumen auf seinem Hof, die er, ohne sich um Zertifikate zu scheren, auf ganz eigene Faust »bio-dynamisch« bewirtschaftete. Schließlich schleppte er mich mit zu einer Sitzung des Ausschusses zur nächsten Volksabstimmung, da ging es um Personenfreizügigkeit.
Am Ende der Sitzung stand ich auf und ergriff das Wort, ich sprach so laut wie Walter und Heiri: »Die Plakate zu Schengen waren ein Reinfall«, sagte ich, »das Geld dafür hätte man direkt auf die Plakatwände kleistern können!«
Ich sah, wie Aerni sich ein Schmunzeln verkniff.
»So, so!«, rief schließlich jemand, und ein anderer: »Der Herr Professor hat sicher eine bessere Idee!«
»Aus dem Stegreif«, sagte ich zu Heiri, »wie wäre es damit: Die Schweiz als Karte mit dem Schweizer Kreuz, rundherum gierige Krähen, die mit den Schnäbeln in unser Land picken und von allen Seiten dran zerren.«
Die Herren überlegten einen Moment. Die Offenbarung im Gesicht des aufrechten Mannes. Einer knurrte noch: »Die frechen Sauviehcher …«
Ich gelangte in die Sitzungszimmer der Partei-Strategen, in den Kreis der Ideengeber. Formulierungsakrobat, nannte mich Aerni. Weil mir jede Ahnung fehlte, was einmal aus mir werden sollte, hatte ich mich an der Universität in Politologie eingeschrieben. Doch heckte ich lieber für die Volkspartei knackige Slogans aus, als in Professor Hammers Vorlesung zu gehen. Als ich zum ersten Mal in einem Fernseh-Interview einen Ständerat Wort für Wort eine Passage aus meiner Feder rezitieren hörte, surrte kurz darauf mein Telefon, SMS von Aerni:
Das ist erst der ANFANG, Kleiner …
Freudentränen meinerseits.
Die politischen Texte waren mir ein willkommener Vorwand, meine Romananfänge, Gedichtfetzen und unfertigen Short Stories liegen zu lassen, mein Schubladen-Fragmentarium, unter dem ich litt, seit ich den ersten Satz auf ein Blatt Papier gekritzelt hatte. Gegen die Marter zweifelhaften Talents hilft auch ein dickes Fell nicht. Wie hatte Clara immer gesagt: »Viele sind berufen, wenige sind auserwählt.«
Doch über die Jahre sind mir auch die politischen Texte zur Mühsal geworden. Das Klimapapier bereitet mir nichts als Kopfschmerzen. Ich plage mich mit Verbrennungsmotoren, Treibhaus-Steuern, CO2-Kontingenten. Noch bevor es Abend wird, steige ich vom Weißwein auf Kirsch um, während ich draußen auf meinem kleinen Balkon Zigaretten rauche und in die Ahornzweige hinabsehe, die gerade vergilben. In der Musikbox die Courante A-Dur von Händel, Endlosschleife.
Auf der Suche nach einem Vorwand, jene Arbeit liegen zu lassen, die mir einmal Vorwand war, meine Schreibarbeit liegen zu lassen, nahm ich an jenem späten Vormittag die Steuererklärung zur Hand. Da ich aber bald realisierte, dass ich mit Jessy hätte Kontakt aufnehmen müssen, räumte ich sie gleich wieder weg. Den ansehnlichen Betrag, damals von den Müttern als Erbvorbezug überwiesen, habe ich bislang immer als zinsloses Darlehen angegeben. Was den Bauernhof anbelangt, wäre bestimmt ein guter Teil des Werts in Form von Instandsetzungsarbeiten abzusetzen gewesen. Bisher habe ich mich nicht dazu entschließen können, einen Bauunternehmer durch das verwilderte Terrain zu führen, um eine Kostenschätzung einzuholen.
Schließlich erinnerte ich mich, dass ich schon länger die Tür meines Dachboden-Abteils hatte reparieren wollen. Das Zahlenschloss stand rechtwinklig von der Türe ab, die Holzlatten wölbten sich unter dem Gewicht von Krempel wie ein dicker Bauch. Als ich das Schloss vorsichtig aufschnappen ließ, sprang mir die Tür ins Gesicht. Ein Haufen Zeug krachte zu Boden, Flaschen zerbrachen, Ping-Pong-Bälle sprangen zwischen das Durcheinander. Fluchend bahnte ich mir eine Schneise ins Gerümpel, kehrte die Scherben zusammen. Beim Anblick der Bananenkartons überkam mich eine vernichtende Trostlosigkeit, die ich gleich wieder abschüttelte. Dann entdeckte ich unter einem Haufen Kleider Atschos Lehnstuhl. Der hatte an der Kirchgasse vor dem Kamin gestanden.
Wenn die Kinder im Bett waren, hatte Atscho ihren Knien einen Augenblick Ruhe gegönnt, sie schaute dann einfach ins kalte Holz. Vielleicht, wenn sie sich sicher sein konnte, dass niemand mehr zu ihr kam, nicht Sylvia oder Damian, nicht die Mädchen, nicht einmal Ikarus, dann suchte sie in den Falten ihres Gewands seinen neusten Brief, entfaltete ihn auf dem Schoß, fuhr mit den Fingern über die Zeilen. Sie brauchte nicht darin zu lesen, sie wusste um den Inhalt.
ERWACHSENENGESPRÄCHE
Blinda kommt nicht mehr auf das Brandmal auf meiner Hand zu sprechen. Den Hauptgang über halte ich die Plauderei über ihre Forschung in Gang. Ich beschließe, der Versuchung zu widerstehen und über den Dachstock und seine Schätze besser zu schweigen. Was hätte sie schon ein altes Familienalbum interessiert, oder der Zeitungsartikel über ein chinesisches Matriarchat?
Nachdem ich Atschos Sessel beiseitegeräumt hatte, fiel mein Blick auf den dunkelblauen Albumrücken, auf dem Etikett die strenge Handschrift Claras. Die Fotoalben sind nicht das Einzige, was damals fälschlicherweise in meinen Besitz gelangt war. Meine paar Kubik Habseligkeiten hatte ich unbesehen auf den Dachstock packen lassen, als ich die Wohnung an der Turner-Strasse bezog. Bestimmt wartete in diesem Gewühl noch die eine oder andere Überraschung, die mir hätte gestohlen bleiben können. Ich nahm das Album zur Hand, 1965/66 stand drauf. Ich ließ die Seiten durchlaufen, ein Daumenkino mit sinnloser Handlung, als einige Papiere herausfielen, ausgeschnittene Zeitungsartikel. 17.09.1964, Der Neuen Zürcher Zeitung 184. Jahrgang.
Mit aller Kraft stieß ich die Abteiltüre zu, hing das Schloss ein, nahm das vergilbte Zeitungspapier mit hinab in die Wohnung.
Im Reich der Mütter – wie eine kleine Ethnie in Südchina in matriarchalen Strukturen lebt
von Dr. Sylvia Hofmann
Nebelschwaden hängen tief über den schwach bewegten Wellen des Lugu-Sees. Wie jeden Herbst hört man denSchwarzhalskranich. Das Gurren der Zugvögel ist für die Mosuo-Frauen ein gutes Omen, sofern sie es frühmorgens hören, wenn ihr Auserwählter gerade aufsteht, nach Hause zu seiner Familie aufbricht. Dem Vogel wird eine mystische Fähigkeit nachgesagt, er spüre, so die Überlieferung, im Leib der Frauen das Schweigen ungeborenen Lebens.