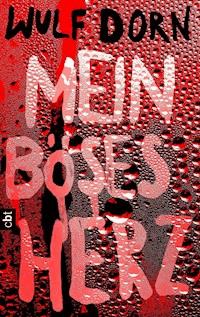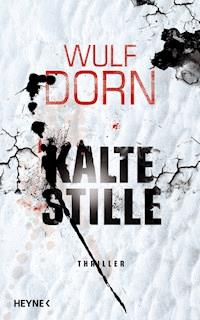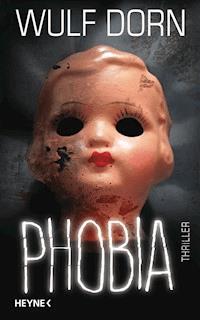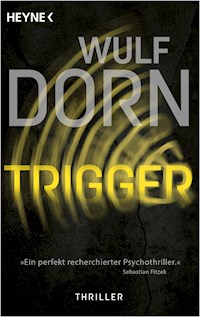9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Seit dem tödlichen Autounfall seiner Eltern, den er selbst miterlebt hat, leidet Simon unter Albträumen und Angstzuständen. Nach einem Psychiatrieaufenthalt zieht er zu seiner Tante und seinem Bruder, aber es fällt ihm schwer, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Vor allem, als er feststellen muss, dass seine schlimmen Träume Wirklichkeit werden: Etwas Böses scheint im Dunkel, das Simon umgibt, erwacht zu sein. Und das Verschwinden eines Mädchens ist erst der Anfang …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
WULF DORN
Roman
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage 2015
© 2015 cbt Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten
Ein Projekt der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München
Umschlaggestaltung: zeichenpool, München
unter Verwendung eines Bildes von © Shutterstock/Complot
SK · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-16197-2
www.cbt-buecher.de
Im Gedenken an Rod Serling.
Ich hoffe, wir begegnen uns
irgendwann in der Twilight Zone.
Und für Anita.
Immer wieder für dich!
»Der Wolf ist nicht immer ein Wolf.«
Italienische Redensart
ES WAR EINMAL …
… an einem sonnigen Tag im Juni. Ein Junge und ein Mädchen, beide fünf Jahre alt, standen am Gartenzaun und beobachteten die Nachbarskatze, die einen Vogel gefangen hatte. Die Katze hatte ihre Beute auf den Rasen gezerrt und eine Zeit lang mit ihr gespielt. Nun biss sie dem Vogel den Kopf ab.
Das Mädchen verzog angewidert das Gesicht und ergriff die Hand des Jungen. »Weißt du was?«, sagte es. »Sie haben uns angelogen.«
Der Junge sah sie fragend an. »Angelogen? Wer denn?«
»Na, die Erwachsenen. Sie lügen uns an. Sie erzählen uns Märchen, aber nichts davon stimmt.«
Das Mädchen zeigte auf die Katze, die ihre Beute mit ein paar Bissen verschlang und anschließend zufrieden davontrottete. Nur ein ausgerissener Flügel und ein Häufchen blutiger Federn waren übrig geblieben.
»Wenn wir der Katze jetzt den Bauch aufschneiden, würde der Vogel bestimmt nicht herausfliegen können. Geht ja auch gar nicht, weil er tot ist.«
Der Junge dachte an das Märchen, das ihnen seine Mutter am Abend zuvor vorgelesen hatte. »Stimmt. So hätten auch Rotkäppchen und die Großmutter ausgesehen, wenn sie wirklich vom Wolf gefressen worden wären.«
»Genau.« Das Mädchen nickte. »Der Wolf hat nämlich noch viel schärfere Zähne als die Katze eben. Also ist das Märchen eine Lüge und deine Mutter hat uns angelogen.«
»Oder sie hat etwas anderes gemeint«, warf der Junge ein. »Märchen erzählt man doch, weil man etwas daraus lernen soll.«
»Glaubst du?«
»Ja, das sagt mein Vater.«
Das Mädchen überlegte, ohne den Blick von dem traurigen Federhäufchen abzuwenden. »Dann ist der Wolf in Wirklichkeit vielleicht gar kein Wolf«, sagte es schließlich. »Vielleicht bedeutet er ja etwas anderes?«
Der Junge zuckte mit den Schultern. »Kann schon sein. Aber was?«
»Der Wolf ist böse«, sagte das Mädchen. »Vielleicht bedeutet es, dass Rotkäppchen etwas Böses getan hat. Und weil sie böse gewesen ist, wird sie dafür bestraft. Sie wird aufgefressen wie der Vogel.«
Das wollte dem Jungen nicht ganz einleuchten. »Aber die Großmutter hat doch nichts Böses gemacht. Warum wird sie dann auch bestraft und gefressen?«
»Sie konnte nichts dafür«, sagte das Mädchen. »Aber weil Rotkäppchen dem Wolf geglaubt hat und etwas Böses getan hat, ist auch der Großmutter etwas Schlimmes passiert.«
»Etwas Böses«, wiederholte der Junge.
»Das Böse ist überall«, sagte das Mädchen ernst. »Das sagt mein Papa. Und dass man sich davor in Acht nehmen muss.«
Der Junge runzelte die Stirn. »Aber was ist mit dem Jäger? Wenn der Wolf das Böse ist, was ist dann der Jäger?«
»Keine Ahnung«, sagte das Mädchen. Dann zog es an seiner Hand. »Komm, mir wird langweilig. Lass uns wieder spielen gehen.«
Sie liefen zurück auf die Terrasse und bald darauf waren die Katze, der Vogel und das Märchen vergessen.
Später wehte der Nachmittagswind die restlichen Federn davon. Nur wenn man genau hinsah, konnte man noch etwas Blut im Gras erkennen.
Teil 1
BÖSE TRÄUME
»Here in the black, it comes.
Here in the black, it comes for me.
Here in the black, I’m lost.«
GARY NUMAN
1.
Nichts währt für immer und Sicherheit ist eine Illusion. Diese bittere Erfahrung machte Simon Strode an einem Samstag im März.
Es dauerte nur einen Augenblick und sein Leben war nicht mehr wie zuvor. Alles, was ihm lieb und teuer war, wurde ihm genommen – ohne Vorwarnung.
Dabei hatte jener Samstag für Simon begonnen wie jeder andere Samstag auch. Nach dem Frühstück lernte er ein wenig für die Englischklausur am Montag, dann las er sich durch die neuesten Chats in einem Spieleforum und hörte Musik, bis ihn seine Mutter zum Mittagessen rief.
Alles war wie immer, doch noch vor Ende des Nachmittags sollte es der schlimmste Tag in seinem Leben werden.
Als er dann nachts in einem Bett des Fahlenberger Stadtklinikums lag und die Schatten an der Decke des Krankenzimmers beobachtete, hatte er nur noch einen Gedanken. Dieser Gedanke kreiste in seinem Kopf wie ein schwarzer Vogel und wollte nicht mehr verschwinden.
Warum habe ich überlebt?
2.
Gegen halb zwei waren sie endlich losgefahren. Simons Vater hatte noch den Geschenkkorb für Tante Tilia abholen müssen und wie immer hatte er den Samstagsverkehr in der Stuttgarter Innenstadt unterschätzt. Normalerweise fuhr Lars Strode die meisten Strecken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was deutlich schneller ging, aber der Korb war zu groß und zu schwer gewesen, um ihn durch die halbe Stadt zu schleppen.
Als sie sich dann mit reichlich Verspätung auf den Weg zu Tilias Geburtstagsfeier machten, stand der mit roten Schleifen verzierte Korb wie ein gewaltiges Monstrum im Kofferraum des Ford Kombi. Unter der raschelnden Zellophanhülle sah Simon Weinflaschen, Pralinen und allerlei Spezialitäten aus dem italienischen Feinkostladen, in dem sein Vater Stammkunde war, und eine große silberne 50 baumelte am Henkel.
Tilia würde für die nächsten Wochen keine Lebensmittel mehr kaufen müssen, so viel stand fest, dachte Simon. Dass sie sich zu ihrem fünfzigsten Geburtstag tatsächlich über einen Geschenkkorb freuen würde, bezweifelte er allerdings. So etwas schenkte man doch nur richtig alten Leuten und auch nur dann, wenn einem überhaupt nichts anderes einfiel. Aber so wirklich einfallsreich bei Geschenken war sein Vater noch nie gewesen. Und Mutter hatte sich bei diesem Thema herausgehalten, Tilia war schließlich seine Schwester.
Normalerweise drückte Simon sich vor Familienfesten, wann immer es möglich war, aber für Tilia machte er eine Ausnahme. Zum einen, weil er sie wirklich mochte, aber vor allem, weil seine Tante geniale Kuchen backen konnte. Dafür würde er die üblichen Unterhaltungen in der Art von »Bist du aber groß geworden!«, »Wie läuft’s denn in der Schule?«, »Weißt du schon, was du einmal werden willst?« oder »Na, hast du schon eine Freundin?« wohl oder übel über sich ergehen lassen.
Außerdem würde er seinen Bruder Mike wiedersehen. Darauf freute Simon sich ganz besonders.
Seit Mike vor zwei Jahren ins Fahlenberger Umland gezogen war, vermisste er ihn.
Einen großen Bruder zu haben, der sechs Jahre älter ist, war eine tolle Sache. Mike war mit Simon auf den Fußballplatz gegangen, hatte ihn mit ins Kino genommen und ihn hin und wieder auch in Filme geschmuggelt, für die Simon eigentlich noch zu jung war.
Vor allem aber hatte er Simon Respekt bei den Jungs an seiner Schule verschafft, die ihm sonst das Leben schwer machten, weil er … nun ja, anders als sie war.
Seit Mike nicht mehr zu Hause wohnte, hatte es wieder Schwierigkeiten mit den Jungs an seiner Schule gegeben. Beschimpfungen als »Spacko« oder »Missi« oder »Opfer« waren noch die harmloseren Dinge gewesen.
Viel schlimmer waren die Begegnungen mit Ronny, einem bulligen Kerl aus Simons Klasse, der ein Jahr älter als die anderen war, weil er eine Ehrenrunde drehte. Vor ihm musste Simon sich ganz besonders in Acht nehmen. Ronny schien an nichts mehr Spaß zu haben als daran, ihn zu demütigen. Ein Junge wie er, der in fast allen Fächern Klassenbester, aber mit seiner dürren Statur ein Loser in jedem Sport war, eignete sich für Typen wie Ronny offenbar als das ideale Opfer.
Einmal hatten ihn Ronny und zwei seiner Kumpels bis in die Schultoilette verfolgt. Dort hatten sie ihm den Rucksack von den Schultern gerissen, Simon zu Boden gedrückt und den Rucksack über ihm ausgeleert. Dann hatte Ronny Simons Pausenbrot in ein Urinal getaucht und ihn gezwungen, das Brot zu essen.
Natürlich hatte Simon sich gewehrt, doch Ronny hatte sich auf ihn gesetzt und ihm die Unterhose so weit nach oben gezogen, bis sie ihm die Hoden quetschte.
Simon hatte geschrien, aber niemand war ihm zu Hilfe gekommen. Die Jungs hatten erst dann aufgehört, als er einen großen Bissen des aufgeweichten und nach Klosteinen schmeckenden Brotes heruntergewürgt hatte. Als er sich dann auf den Boden zwischen seinen Büchern übergeben hatte, waren sie lachend davongelaufen.
Simon hatte nicht den Mut gehabt, mit einem Lehrer oder gar mit seinen Eltern darüber zu sprechen. Das hätte ohnehin alles nur noch schlimmer gemacht, da war er sich sicher. Stattdessen flüchtete er sich in die Welten seiner Bücher und Spiele und ging den Jungs so gut wie möglich aus dem Weg.
Auch Mike hatte er nichts davon erzählt. Simon wollte nicht, dass sein Bruder dachte, er käme nicht ohne ihn zurecht. Mike war sein Vorbild, Simon wollte, dass er stolz auf ihn war, und er konnte es kaum erwarten, Mike an diesem Tag wiederzusehen.
Ungeduldig saß er auf dem Rücksitz und spielte eine Runde Crossy Road nach der anderen. Es kostete ihn einige Nerven, bis es ihm gelang, das Huhn wenigstens ein Stück weit heil über die Straßen zu führen. Das blöde Vieh reagierte oft zu langsam und wurde immer wieder überfahren.
Eigentlich fand Simon Handyspiele ziemlich dämlich, aber wenigstens konnte er sich damit während der langen Fahrt ablenken.
Je länger sie unterwegs waren, desto häufiger sah er auf die Zeitanzeige seines Handys. Es kam ihm vor, als seien sie schon Ewigkeiten unterwegs. Auf der Autobahn hatte es einen Stau nach dem anderen gegeben, und gleich nachdem sie die Abfahrt nach Fahlenberg genommen hatten, meldete der Verkehrsfunk auch noch einen Lkw-Unfall. Der Sprecher empfahl, die Schnellstraße weitläufig zu umfahren, da der Rückstau bereits fünfzehn Kilometer lang war.
Lars Strode schlug vor, auf die Landstraße auszuweichen, und Simon dachte: Na prima, diese verdammten Lastwagen! Jetzt wird es noch länger dauern.
Heute, wo ihn dies alles wieder und wieder in seinen Träumen verfolgte, wünschte er, sie hätten die Schnellstraße nicht umfahren.
Wären sie doch in diesem verdammten Stau geblieben und hätte es doch länger gedauert – wenigstens wären sie angekommen.
Natürlich brachten solche Gedanken nichts, das wusste Simon. Man konnte die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber trotzdem …
Manchmal waren Wünsche alles, was einem blieb.
3.
Bald kamen sie durch eine Gegend, in der Simon noch nie zuvor gewesen war. Gelegentlich sah er aus dem Fenster, wo sich weite Getreidefelder und Waldstücke abwechselten. Dazwischen lagen einige kleine Orte, die kaum größer waren als ein paar Häuser, ein Gasthof und eine Kirche. Hin und wieder zog ein Supermarkt oder eine Tankstelle an ihnen vorüber.
Der Akku seines Handys war schon fast leer. Simon seufzte. Das veraltete Teil musste man dauernd aufladen. Er konnte es kaum erwarten, bis er zu seinem sechzehnten Geburtstag im Juni ein neues Smartphone bekam.
Da noch ein gutes Stück Fahrt vor ihnen lag, hoffte er, dass der Akku noch eine Weile halten würde. Im Augenblick lief es mal richtig gut, das Huhn bewährte sich, und Simon hatte schon beinahe vierhundert Punkte erreicht. Vielleicht konnte er endlich seinen persönlichen Rekord brechen und fünfhundert Punkte schaffen.
Genau in diesem Moment schrien seine Eltern auf.
Lars und Maria Strode schrien gleichzeitig, als hätten sie etwas Schreckliches gesehen. Etwas, das Simon nicht sehen konnte, weil alles viel zu schnell ging.
Von einer Sekunde auf die nächste brach die Hölle los.
Bremsen kreischten.
Der Wagen schleuderte.
Alles drehte sich.
Für einen Sekundenbruchteil erkannte Simon den Abhang neben der Waldstraße. Dann schoss der Wagen darüber hinaus und überschlug sich, wieder und wieder und wieder. Unten wurde zu oben, oben zu unten, dann wieder zu oben …
Dazu der ohrenbetäubende Lärm, als ob ein Riese mit der Faust auf den Wagen einschlagen würde.
Simon wurde herumgewirbelt wie ein Wäschestück in einer Waschmaschinentrommel. Panisch klammerte er sich an die Lehne des Vordersitzes, verlor aber schon bei der nächsten Umdrehung den Halt, während um ihn herum Metall knirschte und Glas barst.
Auch wenn alles nur wenige Sekunden dauerte, kam es ihm vor, als würde der Sturz kein Ende nehmen. Immer wieder riss ihn der Sicherheitsgurt schmerzhaft in den Sitz zurück.
Gegenstände flogen umher. Der Geschenkkorb, Weinflaschen, eine Pralinenschachtel, Konserven, eine Stange Salami, eine Jacke, ein Kugelschreiber, eine Sonnenbrille … Etwas schlug gegen Simons Wange, klein und hart, und für einen irrwitzigen Moment musste er an sein Handy denken.
Dann folgte der Aufprall, jäh und so heftig, dass er die Besinnung verlor.
4.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er bewusstlos gewesen war. Vielleicht nur für ein paar Sekunden oder Minuten, vielleicht auch länger.
Als er wieder zu sich kam, hatte er entsetzliche Kopfschmerzen. Er war völlig benommen, konnte kaum klar denken. Seine Augen ließen sich nicht richtig öffnen, weil die Lider geschwollen waren. Nein, sein ganzer Kopf war aufgeschwollen wie ein Ballon.
Dazu spürte er einen starken Druck auf den Ohren. Es kam ihm vor, als würde er das nicht enden wollende Heulen der Hupe wie durch eine dicke Watteschicht hören.
Er bekam kaum Luft, der Sicherheitsgurt drückte wie ein Stahlband gegen seine Brust. Der Gurt schnürte sich schmerzhaft in die rechte Seite seines Halses und aus irgendeinem Grund konnte sich Simon nicht rühren.
Ihm war schwindlig, weil sich sein Blut im Kopf staute. Als er versuchte, sich auf einen festen Punkt zu konzentrieren, um den Schwindel loszuwerden, fiel ihm etwas Seltsames auf: Seine Arme hingen nach oben und berührten den Himmel des Wagendachs. Zwischen seinen Händen lag ein Päckchen Vivil Bonbons, die ihm seine Mutter während der Fahrt nach hinten gereicht hatte.
Eigentlich müsste es doch auf der Fußmatte liegen, dachte er verwirrt. Es dauerte noch einen weiteren Augenblick, ehe sein Verstand vollends aufklarte und er begriff, dass er kopfüber hing.
Er roch Benzin und geriet in Panik.
Ich muss hier raus!
Ich muss hier sofort raus!
5.
»Dann werde ich wieder ohnmächtig. Ich weiß nicht, für wie lange.«
Wie immer, wenn er von dem Unfall erzählte, spürte Simon diese unbeschreibliche Beklemmung in der Brust. Es war, als hinge er wieder kopfüber im Auto und der Gurt schnürte ihm die Luft ab.
»Als Nächstes finde ich mich auf der Waldstraße wieder. Die Hupe heult noch immer. Sie hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich es aus dem Auto geschafft habe, aber ich krieche auf allen vieren über den Asphalt und mein ganzer Körper brennt vor Schmerz. Hinter mir höre ich das Feuer. Ich kann mich nicht umdrehen, das schaffe ich einfach nicht. Meine Mutter und mein Vater … sie sind … ich meine, sie waren doch noch im Auto!«
Er schluckte, konnte nicht weiterreden. Es war jedes Mal dasselbe. Jede Nacht träumte er davon und es wollte und wollte nicht aufhören. Noch schlimmer war jedoch, wenn er darüber reden sollte.
Wie bei jeder ihrer Unterhaltungen ließ ihm Dr. Forstner Zeit und schwieg und wie bei jedem Mal war Simon ihm dafür dankbar.
Er versuchte, sich wieder zu beruhigen, sah aus dem Fenster und kratzte an den Narben an seinen Handgelenken. Sie waren inzwischen verheilt und juckten schon lange nicht mehr, das Kratzen war nur zu einer dummen Angewohnheit geworden. Als ihm auffiel, dass er es wieder tat, hörte er sofort damit auf.
Das Sprechzimmer befand sich im zweiten Stock der Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie. An diesem schwülwarmen Augusttag bot es einen schönen Ausblick auf den Park der Waldklinik. Zwischen den Stationsgebäuden gab es viele Bäume, Blumenrondelle und Büsche, sodass man sich eher wie in einem Stadtpark als wie in einer Klinik vorkam. In den letzten fünf Monaten war Simon häufig in diesem Park spazieren gegangen.
Nicht weit dahinter erstreckte sich der Fahlenberger Forst – der Ort, der Simons Leben für immer verändert hatte.
Für eine Weile beobachtete er einen Hubschrauber, der wie eine Libelle über dem Wald stand, als hielte er dort nach etwas oder jemandem Ausschau. Die Sonne spiegelte sich auf dem Kabinengehäuse, aber Simon war sich trotzdem sicher, für einen kurzen Moment die grüne Lackierung und den Schriftzug POLIZEI darauf zu erkennen.
Er fragte sich, ob man bei ihrem Unfall ebenfalls einen Hubschrauber eingesetzt hatte, vielleicht einen Rettungshelikopter, konnte sich aber nicht daran erinnern.
Er konnte sich an einiges nicht erinnern. Zum Beispiel wusste er nicht mehr, wie er es aus dem Auto geschafft hatte.
»Diese Erinnerungslücken«, sagte er und sah Dr. Forstner wieder an. »Sie haben gesagt, das lag am Schock, nicht wahr?«
Dr. Forstner nickte. Er war ein schlanker, dunkelhaariger Mann mit freundlichen Augen, die Simon aufmerksam beobachteten. Simon mochte ihn, vor allem, weil er überhaupt nicht so aussah, wie er sich einen Psychiater vorgestellt hatte. In den Filmen, die Simon kannte, waren das meist ältere Männer im weißen Kittel mit dicker Brille und einer wirren Einstein-Frisur. Dagegen wirkte Dr. Jan Forstner eher wie ein verständnisvoller Freund. Er sah jünger aus, als er wahrscheinlich war, und irgendwie erinnerte er Simon an Mike. Nur dass Mike es sicherlich nicht hinbekommen hätte, so lange ruhig in einem Sessel zu sitzen, dachte er. Was ihr Wesen betraf, waren sein lebhafter Bruder und der Psychiater grundverschieden.
»Ja, es lag am Schock«, sagte Dr. Forstner, »und an der Gehirnerschütterung, die du dir zugezogen hattest. Diese Erinnerungsausfälle bezeichnet man auch als kongrade Amnesie. Aber wie schon gesagt, ist es bei dir nur eine sehr leichte Form. Du musst dir deshalb keine Sorgen machen. Du hast dich sehr gut erholt und bist wieder gesund.«
»Ja, vielleicht.« Simon seufzte. »Aber was ist mit diesen Träumen? Werden die denn nie aufhören?«
»Doch, das werden sie. Vielleicht nicht für immer, aber ihre Häufigkeit wird nachlassen. Bis dahin solltest du nie vergessen, was ich dir dazu gesagt habe: Schlimme Träume haben auch ihr Gutes, sie erfüllen einen Zweck. Sie sind wie ein Großputz in deinem Kopf, eine Art Seelenhygiene, die dir dabei hilft, das Geschehene zu verarbeiten. Deshalb solltest du Geduld damit haben, auch wenn es schwerfällt.«
Wieder schaute Simon aus dem Fenster. Nun war der Hubschrauber ein deutliches Stück kleiner geworden und schwebte an einer anderen Stelle über dem Wald.
»Und die Tür?«, fragte er und sprach damit jenen Teil seiner Träume an, der für ihn keinerlei Sinn ergab.
Dr. Forstner beugte sich zu ihm vor. »Träumst du immer noch von ihr?«
»Ja, ich sehe sie immer am Ende des Traums. Sie steht mitten auf der Waldstraße und lässt sich nicht öffnen. Das ist doch verrückt, oder?«
»Nein, ist es nicht«, versicherte ihm Dr. Forstner. »Nicht alles, was man im Traum sieht, muss einen Sinn ergeben. Auch dann nicht, wenn man zum Großteil von realen Ereignissen träumt wie du. Manchmal ist ein Traum nichts weiter als ein Traum. Selbstverständlich kann die Tür ein Symbol für deine verlorene Erinnerung sein, aber ebenso gut wäre es möglich, dass es einfach nur eine Tür ist, die mitten auf einem Waldweg steht.«
»Glauben Sie wirklich?«
Dr. Forstner zwinkerte ihm zu und deutete zu einem Kunstkalender, der am anderen Ende des Raums über seinem Schreibtisch hing. Diesen Monat zeigte er das Gemälde zweier spitzohriger Elefanten, die auf Storchenbeinen aufeinander zustelzten und turmartige Gebilde auf ihren Rücken trugen.
»Angeblich hat Salvador Dalí häufig von solchen Elefanten geträumt«, sagte er und hob lächelnd die Hände. »Und von brennenden Giraffen, Schubladen in menschlichen Körpern oder zerfließenden Uhren. Diese Träume haben ihn berühmt gemacht, trotzdem hat man ihn nicht für verrückt gehalten. Ich glaube, wenn man ihm überhaupt etwas in dieser Art nachsagen kann, dann höchstens, dass er provokativ und exzentrisch gewesen ist. Warum also solltest du nicht von einer Tür auf einer Waldstraße träumen dürfen, ohne dich gleich selbst für verrückt zu erklären?«
Dass ihn jemand mit diesem durchgeknallten Künstler verglich, brachte Simon zum Grinsen. Bisher hatte er nur Dalís Bild mit den zerfließenden Uhren gekannt. Sie hatten im Kunstunterricht darüber gesprochen. Auch wenn er gelernt hatte, dass dieses Bild beispielhaft für eine etablierte Kunstrichtung namens »Surrealismus« war, fand er, dass man schon ziemlich verrückt sein musste, um auf solche abgefahrenen Ideen zu kommen. Aber er verstand, auf was Dr. Forstner hinauswollte, und behielt diesen Kommentar für sich.
»Vielleicht solltest du es selbst einmal mit der Malerei versuchen?«, schlug Dr. Forstner vor, und nun konnte Simon nicht anders als lachen.
»Lieber nicht.« Er musste an seinen Kunsttherapeuten denken, der jedes seiner Werke mit Interesse betrachtet hatte, aber sein Mitleid mit Simons mangelndem Talent kaum verbergen konnte. »Dr. Grünberg bekäme dann definitiv noch viel mehr graue Haare.«
Nun lachte auch Dr. Forstner. »Du entdeckst deinen Humor wieder, das ist gut.« Er sah zur Wanduhr hoch. »Tja, und da unsere Sitzung jetzt zu Ende geht und wir deine Tante nicht noch länger warten lassen sollten, bleibt mir jetzt nichts anderes, als dir alles Gute für die Zukunft zu wünschen.«
Es gab eine kurze, aber herzliche Verabschiedung. Bis dahin hätte Simon es nie für möglich gehalten, dass er je so etwas denken würde, aber es fiel ihm nicht leicht, die Klinik zu verlassen.
Als hätte Dr. Forstner seine Gedanken gelesen, erinnerte er ihn noch einmal an die ambulanten Sprechstunden, von denen Simon jederzeit Gebrauch machen könne. Er selbst sei für die nächsten drei Wochen zwar im Urlaub, aber Dr. Grünberg sei jederzeit für ihn da, falls er Hilfe oder jemanden zum Reden brauchte.
Insgeheim beschloss Simon, notfalls lieber auf Dr. Forstner zu warten. Mit Dr. Grünberg war er nie besonders gut klargekommen. Der Psychotherapeut hatte Simon immer angesehen, als würde er ihm nicht trauen. In seiner Gegenwart kam sich Simon schlichtweg wie ein Irrer vor.
»Und was die schlimmen Träume betrifft«, sagte Dr. Forstner, als sie an der Tür des Sprechzimmers angekommen waren, »je weniger du dich gegen sie wehrst, desto schneller gehen sie vorüber. Lass die Putzkolonne in deinem Kopf ihren Job machen. Gib ihr ein bisschen Zeit, dann werden die Träume verschwinden.«
Das hätte Simon ihm nur zu gern geglaubt.
6.
Für das Packen brauchte er keine fünf Minuten. Seit dem Unfall besaß Simon nur noch Flüchtlingsgepäck. Zahnputzzeug, Duschgel, ein paar Jeans, T-Shirts und Unterwäsche, das war alles.
Er stopfte seine Habseligkeiten in eine Sporttasche, die ihm Tilia besorgt hatte, legte ein Taschenbuch mit dem Titel Sorge dich nicht, lebe! dazu, das ebenfalls ein Geschenk seiner Tante war, und schloss den Reißverschluss.
Bevor er das Zimmer verließ, das für fast fünf Monate eine Art Zuhause für ihn gewesen war, sah Simon noch einmal nach Lennard. Wie meistens saß sein Zimmergenosse auf seinem Bett, starrte vor sich ins Leere und hörte laute Musik aus riesigen Kopfhörern. Angeblich half das gegen die Stimmen in seinem Kopf.
Lennard war achtzehn, sah mit seinen langen Rastazöpfen und dem flaumigen Vollbart aber wie Mitte zwanzig aus. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte er seine Bäckerlehre abgebrochen, um in einer Rockband als Schlagzeuger zu spielen. Dazu war es jedoch nie gekommen. Stattdessen hatte Lennard irgendwann mit Drogen herumexperimentiert, die bei ihm eine Form von Schizophrenie auslösten. So war auch er ein Mitglied im »ehrenwerten Club der Durchgeknallten« geworden, wie er es nannte. Nun sah er Dinge, die nicht wirklich da waren, und hörte jede Menge Stimmen, die sonst keiner hörte.
Es seien nicht irgendwelche Stimmen, behauptete er, sondern die von verstorbenen Familienangehörigen. Sein Onkel, seine Großeltern und sein Vater, der bei Gerüstbauarbeiten ums Leben gekommen war, redeten unaufhörlich zu ihm. Lennard vertrat die Theorie, dass man nach dem Tod weder in den Himmel noch sonst wohin kam, sondern in den Köpfen der Menschen weiterlebte, denen man besonders viel bedeutet hatte. In gewisser Weise leuchtete Simon das ein, trotzdem hatte es ihn genervt, wenn Lennard mitten in der Nacht mit den Toten diskutiert hatte.
Simon wedelte mit der Hand vor Lennards Gesicht herum, und wie so oft dauerte es ein paar Sekunden, ehe ihn sein Zimmergenosse bemerkte.
»Hast es wohl geschafft«, sagte Lennard laut und nahm die Kopfhörer ab. »Lassen sie dich endlich raus?«
»Ja, jetzt hast du das Zimmer für dich allein.«
»Red keinen Quatsch, Mann«, sagte Lennard und tippte mit einem verschwörerischen Grinsen gegen seine Schläfe. »Ich bin nie allein, das weißt du doch. Die Quasselstrippen nerven zwar manchmal, aber irgendwie ist es auch ein gutes Gefühl. Da drin ist immer jemand da für mich, auch wenn es sonst niemanden gibt. Hat schon was, ein Freak zu sein.«
»Da ist was dran«, sagte Simon und dachte an all die Ungewissheiten, die nun auf ihn zukamen.
Zwar waren ihm Mike und Tilia geblieben, aber dennoch war da natürlich dieses Gefühl von Leere und Einsamkeit. Er konnte es noch immer nicht fassen, kein Zuhause und keine Eltern mehr zu haben, und anders als Lennard konnte er nicht mal mehr ihre Stimmen hören. Wo immer seine Eltern jetzt auch sein mochten, sie waren nicht bei ihm.
»Hey Mann, jetzt schau nicht so!« Lennard gab ihm mit dem Handballen einen freundschaftlichen Schubs an der Schulter. »Denk immer dran, dass du was besonderes bist. Du hast eine Ehrenmitgliedschaft im Club.« Sein Grinsen wurde breiter und er hielt Simon die Hand entgegen. »Na los, Alter, gib mir fünf!«
Simon erwiderte Lennards Grinsen und sie klatschten sich ab. Lennard wünschte ihm alles Gute, auch im Namen der anderen Bewohner seines Kopfes. Dann zog er die Kopfhörer wieder über und verschwand in einer imaginären Welt, um die ihn Simon jetzt beneidete.
Simon umklammerte den Trageriemen seiner Tasche fester, als er aus dem Zimmer trat und Tilia am Ende des Ganges sah. Sie stand neben dem Eingang zum Stationszimmer und unterhielt sich mit Schwester Marion. Neben der Schwester, die eine der dicksten Frauen war, die Simon je gesehen hatte, wirkte seine Tante wie eine Strichfigur. Sie war ebenso groß und hager wie Simons Vater und hatte auch dieselben kantigen Gesichtszüge. Als sie Simon sah, winkte sie ihm freudig zu und rief seinen Namen.
Nun gab es kein Zurück mehr. Dies war der Moment, in dem ihm vollends bewusst wurde, dass er jetzt in ein neues, anderes Leben hinausgehen musste.
Am liebsten wäre er zurück zu Lennard gelaufen und hätte sich mit ihm über Rockbands oder die neuesten Nachrichten aus der Totenwelt unterhalten. Die Vorstellung, den Schutz der Klinik zu verlassen und in eine ungewisse Zukunft zu gehen, machte ihn ziemlich nervös.
Nein, das stimmte nicht ganz. Wenn er ehrlich mit sich war, dann machte sie ihn nicht nur nervös. Sie machte ihm eine Heidenangst.
7.
»Du musst unbedingt mehr essen«, sagte Tilia, als sie das Klinikgebäude verließen. »Du bist ja bald nur noch Haut und Knochen. War das Krankenhausessen denn wirklich so übel?«
Und ob es das gewesen war. Aber noch ehe Simon antworten konnte, redete Tilia bereits weiter. Wie sehr sie sich freue, dass es ihm wieder gut gehe. Dass sie ihr Gästezimmer für ihn freigeräumt habe. Dass sein Bruder am Abend zum Essen käme, und so weiter.
Sie redete wie ein Wasserfall, und Simon konnte ihr anmerken, dass sie wieder einmal ihre Unsicherheit zu verbergen versuchte. Daran hatte sich in den letzten fünf Monaten nichts geändert. Tilia hatte sich bei jedem ihrer Besuche verhalten, als befürchte sie, sie könne irgendetwas falsch machen oder etwas Falsches sagen, und heute, am Tag seiner Entlassung, war sie ganz besonders unsicher.
Es ging ihr wie den meisten Leuten, die einen Angehörigen aus der Psychiatrie zu sich nach Hause holten. Während der Gruppensitzungen mit Dr. Forstner hatte Simon oft genug seine Mitpatienten darüber sprechen hören – diejenigen, die schon länger als er dem »ehrenwerten Club der Durchgeknallten« angehörten.
Für einen gebrochenen Arm oder eine Blinddarmentzündung hatte jeder Verständnis, weil man sich darunter etwas Konkretes vorstellen konnte. Aber wenn jemand versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, war das etwas ganz anderes. Es war verdammt schwer, wenn nicht gar unmöglich, anderen zu erklären, wie unerträglich Depressionen und böse Träume sein konnten. Das war, als wolle man Kopfschmerzen für jemanden begreiflich machen, der noch nie welche gehabt hatte.
Tilia verhielt sich wie die Angehörigen von fast allen Jugendlichen, die Simon auf seiner Station kennengelernt hatte. Sie tat so, als sei nichts gewesen, auch wenn das ungefähr so sinnvoll war, als wenn man den Fleck auf einem Tischtuch mit einer Blumenvase verdeckte. Man konnte zwar behaupten, das Tischtuch sei wieder sauber, aber trotzdem wusste jeder, dass sich der Fleck unter der Vase befand.
»Zuhause werde ich dir erst einmal etwas Ordentliches zu essen machen«, sagte sie und strahlte Simon an, während sie über den Klinikparkplatz gingen. »Und ich werde dir einen Kuchen backen. Magst du Zitronenkuchen?«
»Und wie«, entgegnete Simon und rang sich ein Lächeln ab, auch wenn ihm überhaupt nicht danach zumute war.
Er sah sich noch einmal zum Stationsgebäude um. Es lag nun weit entfernt, halb verborgen hinter den Ästen mehrerer bauchiger Kastanienbäume. Dann hörte er Tilias Schlüsselbund klimpern. Das Geräusch versetzte ihm einen Stich und ihn überlief trotz der sommerlichen Hitze des Nachmittags eine Gänsehaut.
Als sie bei Tilias Fiesta angekommen waren, schlug Simons Herz schneller. Seine Knie fühlten sich plötzlich weich an und er musste sich am Dach des Wagens abstützen.
Tilia schien das nicht zu bemerken. Sie legte seine Tasche in den Kofferraum und stieg ein.
Zögerlich öffnete Simon die Beifahrertür und schlagartig wurde sein Mund trocken. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte Tilia, und Simon schüttelte den Kopf.
»Nein, ich hatte nur überlegt, ob ich auch nichts vergessen habe«, log er, dann stieg er ein.
Es war das erste Mal seit dem Unfall, dass er wieder in einem Auto saß, und es war schrecklich. Es kostete ihn große Überwindung, die Tür zu schließen. Der Innenraum war von der Sommerhitze aufgeheizt und stickig, sodass ihm das Atmen schwerfiel – erst recht, als er sich den Gurt umlegte.
Da war es wieder, dieses Stahlbandgefühl aus seinen Träumen und Erinnerungen, nur dass es diesmal real war.
Sie fuhren los und Tilia schaltete die Klimaanlage ein. Der kühle Luftzug fühlte sich gut an, aber er verbreitete auch den typischen Autogeruch. Genauso hatte es im Wagen seiner Eltern gerochen. Simons Magen zog sich zusammen.
Während sie über das Klinikgelände zur Ausfahrt fuhren, erzählte ihm Tilia von Mike, und wie es auch Simons Eltern immer getan hatten, nannte sie seinen Bruder bei seinem richtigen Namen: Michael. Doch für Simon würde er immer Mike bleiben. Mike war Mike, denn so hatte er sich selbst immer genannt.
Mit jeder Minute, die sie unterwegs waren, ging es Simon schlechter. Er konnte sich kaum auf Tilias Worte konzentrieren. Was sie erzählte, hatte etwas mit dem Autohaus zu tun, in dem sowohl Tilia als auch Mike arbeiteten, aber Simon bekam es kaum mit. Er starrte aus dem Fenster und versuchte sich vorzustellen, er säße nicht in diesem engen Auto, sondern ginge irgendwo dort draußen spazieren.
Draußen.
Auf diesen Gedanken konzentrierte er sich mit aller Kraft.
Draußen im Freien.
Unter dem weiten, freien Himmel.
Frei.
Ich bin draußen und frei.
Ich bin …
Seine Hand krampfte sich um den Haltegriff der Tür und sein Herz raste jetzt. Panik stieg in ihm auf wie ein Monster aus einem tiefen, dunklen See.
Draußen, dachte er wieder. Ich bin draußen und frei, draußen und frei, draußen und frei!
Doch das Panikmonster ließ sich davon nicht zurückhalten. Es war der Oberfläche schon sehr nahe.
Wieder sagte Tilia etwas, doch Simon verstand sie nicht. Ihre Stimme klang auf einmal weit entfernt.
Simon sah sich zu ihr um, wollte fragen, was sie gerade gesagt hatte … Aber vor Schreck erstarrte er wie zu Stein.
Das war nicht mehr seine Tante neben ihm. Nun saß sein Vater auf dem Fahrersitz und er sah entsetzlich aus. Simon erkannte ihn nur noch an seiner Kleidung. Sein Gesicht war von Brandwunden bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Es sah aus, als habe man ihn mit fleischfarbenem Wachs übergossen, aus dem grauenhafte rote Pusteln hervorwucherten. Einzig seine Augen waren noch dieselben. Zuletzt hatte Simon die Augen seines Vaters ein paar Minuten vor dem Unfall im Rückspiegel gesehen. Nun sah er, was nach dem Unfall von seinem Gesicht übrig geblieben war.
Es war unvorstellbar schrecklich.
Ich drehe durch, schoss es ihm durch den Kopf. Ich werde verrückt, komplett verrückt!
Er presste die Augen zu und hoffte, dass der Spuk damit verschwinden würde. Doch als er wieder hinsah, saß das Ding noch immer neben ihm.
»Geht es dir nicht gut, Junge?«
Das war nicht die Stimme seines Vaters, dafür war sie viel zu tief. Sie hörte sich verzerrt an und hallte, als spräche er aus einer Gruft zu ihm.
»Du schwitzt ja. Soll ich die Klimaanlage noch weiter aufdrehen?«
Dann veränderten sich die Augen des Dings. Sie wuchsen, dehnten sich in den wachsartigen Augenhöhlen aus, verdunkelten sich, wurden völlig schwarz. Bald hatten diese Augen überhaupt nichts Menschliches mehr an sich. Sie schillerten wie Öllachen und Simon erkannte in ihrem Blick unendlichen Zorn.
Das war nicht sein Vater! Wie hatte er nur je glauben können, dass er das war?
Ich bin gekommen, um dich zu holen, schrie ihn das brandnarbige Ungeheuer an, ohne dabei den lippenlosen Mund zu bewegen. Seine Stimme gab es nun nur noch in Simons Kopf.
Ja, mein Junge, du hättest ebenfalls sterben sollen!
Simon stieß einen Schrei aus und riss die Tür auf. Reifen kreischten auf dem Asphalt und der Wagen machte abrupt halt. Simon spürte den hässlich-vertrauten Ruck, als ihn der Sicherheitsgurt zurück in den Sitz riss.
Wieder hörte er eine Stimme, doch diesmal war sie real. Tilia redete auf ihn ein. Das Ungeheuer auf dem Fahrersitz war verschwunden.
»Simon, um Himmels willen, was ist denn los mit dir?«
Er rang um Atem. Noch immer raste sein Herz, als wolle es ihm den Brustkorb sprengen. Etwas tief in ihm schien zu brüllen wie ein zu Tode geängstigtes Tier.
Raus!
Raus!
RAUS!
»Ich … Ich muss hier raus!«
Hektisch versuchte er, den Gurt zu lösen, doch es ging nicht. Seine Hände zitterten viel zu sehr.
»Bitte«, schrie er, »ich muss hier raus!«
Endlich klickte die Gurtschnalle und Simon war frei. Ohne auf irgendetwas zu achten, sprang er aus dem Auto, hinaus auf den Grünstreifen zwischen Straße und Radweg.
Dort sank er auf die Knie, sah zum wolkenlosen Himmel empor und atmete tief durch.
Der Himmel, dachte er. So blau. So weit.
Tilia stieg aus und lief zu ihm. Sie kniete sich neben Simon und legte die Arme um ihn.
»Es tut mir leid«, schluchzte sie. »Es tut mir so leid! Das konnte ich doch nicht wissen.«
Simon sah sie an und schüttelte den Kopf. »Es muss dir nicht leidtun. Diese Panik … Sie kam so plötzlich. Ich habe es auch nicht gewusst.«
Sie blieben noch eine Weile wortlos auf dem schmalen Grasstreifen sitzen. Simon starrte auf Tilias Fiesta, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht die rechte Straßenseite blockierte.
Immer wieder hupten Autos. Der Feierabendverkehr setzte ein. Ein Fahrer beschimpfte sie durchs offene Fenster, ein anderer zeigte ihnen den Vogel.
Simon bedauerte, dass er seine Tante in Schwierigkeiten brachte, aber er würde keinesfalls wieder in das Auto einsteigen. Für nichts in der Welt.
8.
Die Strecke von Fahlenberg nach Kössingen war zu weit, um sie zu Fuß zu gehen, erst recht an diesem schwül-heißen Nachmittag. Also versuchten sie es mit dem Linienbus, nachdem Tilia ihren Wagen wieder auf dem Klinikparkplatz abgestellt hatte.
Die Haltestelle war nicht weit entfernt, und als der Bus sich näherte, kehrte Simons Nervosität zurück. Er erinnerte sich an das, was ihm Dr. Forstner von der Angst vor der Angst erzählt hatte. Sie war der eigentliche Feind, den es zu bekämpfen galt. Also nahm Simon all seinen Mut zusammen und stieg ein.
Es funktionierte. Keine Panikattacke. Das Innere des Busses war geräumig und nicht annähernd so beengend wie ein Auto.
Simon wählte einen Stehplatz neben der hinteren Tür. Während der gesamten Fahrt ließ er die Haltestange nicht los. Sein Daumen ruhte neben dem roten Druckknopf für den Bedarfshalt.
Er konzentrierte sich auf das STOPP auf diesem Knopf. Diese fünf Großbuchstaben beruhigten ihn. Wenn es ihm zu viel wurde, konnte er einfach den Knopf drücken und sofort durch die Doppeltür hinaus ins Freie gelangen.
Jedenfalls redete er sich das ein. Natürlich wusste er, dass der Fahrer ihn erst an der nächsten Haltestelle aussteigen lassen würde. Die Macht der Autosuggestion, so hatte es Dr. Forstner genannt. Wenn man sich etwas fest genug einredete, begann man selbst daran zu glauben.
Simon beschloss, dass diese Macht ihn künftig vor den Monstern beschützen sollte, die ihn verfolgten.
9.
Tilias Haus befand sich am östlichen Rand des kleinen Ortes Kössingen, nicht weit vom Ufer der Fahle entfernt. Das ehemalige Bauernhaus mit dem vorgezogenen Dach war ein schmucker, L-förmiger Bau, in dessen hinterem Teil sich eine kleine Einliegerwohnung befand. Dort war Mike vor zwei Jahren eingezogen.
Früher war es das Haus von Simons Großeltern gewesen. Tilia und sein Vater waren hier aufgewachsen. In gewisser Weise kehrte er nun an den Ort seiner Wurzeln zurück, dachte Simon.
Dennoch fühlte er sich hier fremd. Das Gästezimmer, das seine Tante für ihn vorbereitet hatte, war klein und mit alten Möbeln vollgestellt. Der mit Bauernmalerei verzierte Kleiderschrank musste noch aus dem vorigen Jahrhundert stammen und an dem Tisch neben dem Fenster zum Hof hatte Simons Vater wahrscheinlich schon seine Hausaufgaben gemacht.
Tilia hatte geputzt und Staub gewischt, aber der Zitronenduft des Putzmittels vermochte nicht, den eigentlichen Geruch des Zimmers zu überdecken. Es roch nach einer Mischung aus Lavendel und Mottenkugeln, die Simon mit den Erinnerungen an seine Großmutter verband.
Schlagartig überkam ihn die Sehnsucht nach seinem Zimmer in der Stuttgarter Stadtwohnung, ebenso wie er seine Eltern nun noch viel mehr vermisste. Ständig daran erinnert zu werden, dass sein altes Leben unwiederbringlich verloren war, verursachte bei ihm einen beinahe körperlichen Schmerz.
Wieder einmal verstand er, was die Leute meinten, wenn sie davon sprachen, dass einem etwas »beinahe das Herz zerriss«.
»Gefällt es dir?«, fragte Tilia und stellte Simons Tasche auf dem Bett ab.
»Es ist nett«, sagte Simon und musste daran denken, was Mike immer gesagt hatte: ›Nett‹ ist die kleine Schwester von ›Scheiße‹. Da er nicht undankbar erscheinen wollte, fügte er schnell hinzu: »Vielen Dank, dass ich bei dir wohnen darf.«
Seine Tante nickte ernst. »Das ist doch selbstverständlich. Ich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst.«
Wieder sah Simon sich um. Er war ein Fremder in einer fremden Umgebung.
»Was ist eigentlich aus unserer Wohnung geworden?«, fragte er.
»Nun ja …« Tilia sah ihn kurz an, dann flackerte ihr Blick zur Seite. »Wir, das heißt Michael und ich, haben es für das Beste gehalten, die Wohnung zu verkaufen. Den Erlös haben wir auf einem Konto für euch beide angelegt. Falls du einmal studieren willst oder irgendeine andere Unterstützung brauchst.«
»Was?« Simon glaubte seinem Ohren nicht zu trauen. »Ihr habt die Wohnung verkauft? Ohne mich zu fragen?«
Wieder wich Tilia seinem Blick aus. »Wir … Also, wir dachten, dass wir dich damit nicht belasten sollten. Es ging dir ja nicht gut. Wir hatten Sorge, dass dich das zu sehr aufwühlen könnte.«
Was für eine höfliche Umschreibung dafür, dass man die Meinung eines Mitglieds im ehrenwerten Club der Durchgeknallten nicht ernst nehmen kann, dachte er und spürte, dass er vor Wut am ganzen Leib zu zittern begann.
»Und unsere Sachen? Die Möbel, Vaters Bücher …«
»Mike hat sie einem Wohltätigkeitsverein vermacht, den euer Vater unterstützt hat. Ich bin überzeugt, Lars wäre damit einverstanden gewesen.«
»Ihr habt wirklich alles weggegeben? Alles, das …«
Simon verstummte, ballte die Hände zu Fäusten und atmete tief durch. Er musste sich beruhigen. Wenn er jetzt ausrastete, würde er sich nur noch weitere Probleme einhandeln, und davon hatte er beileibe schon genug.
Trotzdem tat die Vorstellung höllisch weh, dass man ihn bei der Entscheidung übergangen hatte und nun nichts mehr von seinem ehemaligen Zuhause übrig geblieben war. All die Dinge waren weg, zu denen er im Lauf seines Lebens eine Beziehung aufgebaut hatte – weil Dinge nun einmal verlässlicher und vor allem verständlicher waren als Menschen. Eine CD blieb immer eine CD, und ein Buch blieb immer ein Buch, sie veränderten sich nicht. Menschen schon, und das verunsicherte ihn oft. Gerade deshalb war es ihm wichtig, von vertrauten Dingen umgeben zu sein. Er hätte sich nie davon trennen können, jedenfalls nicht von allem.
Nur in einem stimmte er seiner Tante zu: Sein Vater hätte sicherlich gewollt, dass die Sachen für die Wohltätigkeit gestiftet wurden. Er hatte sich schon seit Jahren in einer Organisation für krebskranke Kinder engagiert. Irgendetwas verband Simon damit, eine Erinnerung, aber ihm wollte nicht mehr einfallen, was es war. Die Erinnerung war zum Greifen nahe, wie das berühmte Wort, das einem auf der Zunge lag, aber er konnte sie nicht erreichen.
Wieder eine dieser verhassten Gedächtnislücken. Sie gaben ihm das Gefühl, sein Gehirn sei so löchrig wie ein Schweizer Käse.
Aber warum war es das?
War wirklich nur der Schock daran schuld?
Er ertappte sich dabei, dass er wieder an seinen Narben kratzte, und schob die Hände in die Hosentaschen.
»Deine Sachen haben wir natürlich aufgehoben«, sagte Tilia schnell. »Michael hat alles in Kartons verpackt. Sie stehen hier im Keller. Das Gästezimmer ist dafür leider zu klein.«
Wie auf ein Stichwort hin, hörte Simon Mikes Stimme aus dem Erdgeschoss. »Hallo ihr beiden, wo steckt ihr?«
Dann folgten schnelle Schritte auf der Treppe und Mike erschien in der Tür. Er kam direkt von der Arbeit und trug noch seinen Blaumann.
Seit ihrem letzten Wiedersehen bei Tilias Neujahrsfeier hatte er sich kaum verändert. Nur war sein Gesicht jetzt sonnengebräunt, das dunkle Haar kurz geschnitten, und er wirkte etwas gepflegter als beim letzten Mal, aber mit seinem Rasierer stand er noch immer auf Kriegsfuß.
Als er Simon sah, grinste er breit. »Hey, Kleiner.«
Vor Freude machte Simons Herz einen Sprung. »Mike!«
Sie fielen sich in die Arme. Simon zitterte ein wenig. Erst jetzt wurde ihm vollends bewusst, wie sehr ihm sein Bruder gefehlt hatte. Er war alles, was ihm von seinem früheren Leben noch geblieben war.
»Mike«, flüsterte er, und dann noch einmal: »Oh Mann, Mike!«
»Tut gut, dich wiederzusehen, Kleiner. Um ehrlich zu sein, hatte ich schon befürchtet, dass du sauer auf mich bist.«
»Sauer? Warum denn?«
»Weil ich dich nie im Krankenhaus besucht habe.«
»Quatsch«, sagte Simon. »Enttäuscht vielleicht, aber nicht sauer. Ich habe ja gewusst, dass du Krankenhäuser nicht ausstehen kannst. Aber du hättest mir wenigstens mal texten können.«
Mike löste sich aus der Umarmung und sah Simon für eine Weile an. »Ja, das hätte ich tun sollen. Aber ich wusste nicht, was ich dir … wie ich mit dir … Ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.« Er zuckte hilflos mit den Schultern.
»Ich verstehe schon«, sagte Simon. Wenigstens war sein Bruder ehrlich und suchte nicht nach irgendwelchen Ausreden. »Hauptsache, du hältst mich nicht für einen Spinner.«
Mike grinste. »Auch wenn du schon immer einer gewesen bist?«
»So wie du.« Simon erwiderte das Grinsen, dann wurde er wieder ernst. »Mike, du musst mir versprechen, dass wir jetzt für immer zusammenbleiben.«
»Ich bin immer für dich da, Kleiner. Ehrenwort! Vergiss das nie.«
Etwas lag in Mikes Augen, das Simon nicht deuten konnte. Aber das war jetzt auch egal. Sie waren wieder zusammen, das allein zählte jetzt.
Mit Mike an seiner Seite würden die bösen Träume verschwinden. Das hoffte er mehr als alles andere.
10.
Wenig später saß Simon am Küchentisch und hörte seinem Bruder zu. Dabei fiel ihm auf, dass Mike alle ernsten Themen mied und kein Wort darüber verlor, wie es ihm in den Monaten seit dem Tod ihrer Eltern ergangen war.
Auch in diesem Punkt hatte sich Mike kein bisschen verändert. Was tief in ihm vorging, hatte er schon immer für sich behalten und mit sich selbst ausgemacht. Es war, als fürchte er sich davor, allzu viel Gefühle zu zeigen, weil ihm dies als Schwäche ausgelegt werden könnte. Mike hatte schon immer so sein wollen wie seine Idole auf den Postern in seinem ehemaligen Jugendzimmer – Bruce Willis, Vin Diesel, Schwarzenegger und Dwayne »The Rock« Johnson, allesamt coole Typen, denen nichts etwas anhaben konnte. Deshalb überspielte er die ernsten Themen wohl lieber und erzählte Simon stattdessen voller Begeisterung von einem roten Ford Mustang, einem Oldtimer von 1969, den er derzeit für einen Kunden restaurierte.