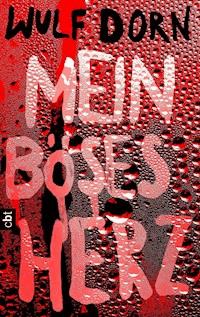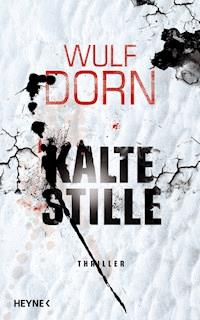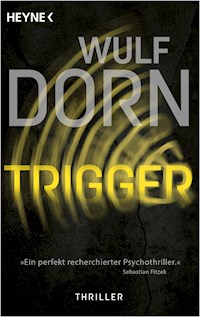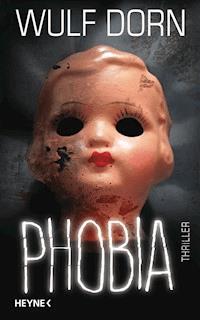
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Angst hat ein Zuhause
Eine Dezembernacht im Londoner Stadtteil Forest Hill. Sarah Bridgewater erwacht, als sie ihren Mann überraschend früh von einer Geschäftsreise nach Hause kommen hört. Doch der Mann, den sie in der Küche antrifft, ist nicht Stephen. Er trägt jedoch den Anzug ihres Mannes, hat dessen Koffer bei sich und ist mit Stephens Auto nach Hause gekommen. Der Fremde behauptet, Stephen zu sein, und weiß Dinge, die nur Sarahs Mann wissen kann.
Für Sarah und ihren sechsjährigen Sohn Harvey beginnt der schlimmste Alptraum ihres Lebens. Denn der Unbekannte verschwindet ebenso plötzlich wieder, wie er bei ihr aufgetaucht ist, und niemand will ihr glauben. Nur ihr Jugendfreund, der Psychiater Mark Behrendt, kann ihr jetzt noch helfen. Ein psychologisches Duell mit dem Unbekannten beginnt. Und von Stephen Bridgewater fehlt weiterhin jede Spur …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Eine Dezembernacht im Londoner Stadtteil Forest Hill. Sarah Bridgewater erwacht, als sie ihren Mann überraschend früh von einer Geschäftsreise nach Hause kommen hört. Doch der Mann, den sie in der Küche antrifft, ist nicht Stephen. Er trägt jedoch den Anzug ihres Mannes, hat dessen Koffer bei sich und ist mit Stephens Auto nach Hause gekommen. Der Fremde behauptet, Stephen zu sein, und weiß Dinge, die nur Sarahs Mann wissen kann. Für Sarah und ihren sechsjährigen Sohn Harvey beginnt der schlimmste Alptraum ihres Lebens. Denn der Unbekannte verschwindet ebenso plötzlich wieder, wie er bei ihr aufgetaucht ist, und niemand will ihr glauben. Nur ihr Jugendfreund, der Psychiater Mark Behrendt, kann ihr jetzt noch helfen. Ein psychologisches Duell mit dem Unbekannten beginnt. Und von Stephen Bridgewater fehlt weiterhin jede Spur …
Der Autor
Wulf Dorn (*1969) war zwanzig Jahre in einer psychiatrischen Klinik tätig, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Mit seinem 2009 erschienenen Debütroman Trigger gelang ihm ein internationaler Bestseller, dem weitere folgten. Dorns Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und begeistern eine weltweite Leserschaft. Für seine Storys und Romane wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem französischen Prix Polar, dem ELLE Readers Award und dem Glauser Preis.
Lieferbare Titel
Trigger Kalte Stille Dunkler Wahn Phobia Die Kinder Trigger – Das Böse kehrt zurück
WULF DORN
THRILLER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright © 2013 by Wulf Dorn
Copyright © 2013 by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCovergestaltung: Eisele Grafik-Design, Münchenunter Verwendung eines Fotos von Tarek Ahmed/Antiqalo
Redaktion: Heiko Arntz
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-08717-3V005
www.heyne.de
Für Kirsten und Markus
Gin and Tonic
Vorbemerkung des Autors
Dieser Roman wurde durch mehrere wahre Begebenheiten inspiriert, die jedoch (im Gegensatz zu meiner Geschichte) nicht in direktem Zusammenhang stehen.
Mir einer Ausnahme sind sämtliche Namen und Personen frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeit oder Namensgleichheit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig.
Bei der Darstellung der Schauplätze habe ich mir, wo nötig, einige schriftstellerische Freiheiten erlaubt. Ortskundige Leser bitte ich dafür um Nachsicht.
»Das Leben ist nur der kurze Sieg über das Unausweichliche.«
T. C. BOYLE
»Und ich will dir weisen ein Ding, das weder
Dein Schatten am Morgen ist, der dir nachfolgt,
Noch dein Schatten am Abend, der dir begegnet;
Ich zeige dir die Angst in einer Handvoll Staub.«
T. S. ELIOT
»We are Nobodies,
Wanna be Somebodies.
When we’re dead,
They’ll know just who we are.«
MARILYN MANSON
»Who made who?
Who turned the screw?«
AC/DC
Teil 1 Der erste Schritt
1.
Die Zweizimmerwohnung war muffig, beengend und düster. Das graue Licht des ersten Dezembernachmittags fand nur mühsam den Weg durch das einzige Fenster der Wohnküche. Gegenüber versperrte eine schmutzige Fassade die Sicht. Das rußgeschwärzte Mauerwerk erweckte den Eindruck, als sei die Welt jenseits des Fensters nach nur wenigen Metern zu Ende.
Wäre nicht das gedämpfte Brummen des Brixtoner Feierabendverkehrs auf der nahen Coldharbour Lane zu hören gewesen, hätte er glauben können, in diesem Wohnblock bei lebendigem Leibe eingemauert zu sein.
Ein tristes Grab.
Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Endlich hatte das Scharren und Keuchen aufgehört. Es hatte nicht lange gedauert, nur ein oder zwei Minuten, dennoch war es ihm wie eine Ewigkeit vorgekommen. Diese hektischen, panischen Bewegungen im Raum nebenan. Das verzweifelte Ringen um Atem.
Doch obwohl es nun wieder ruhig war, fühlte er keine Erleichterung. Angespannt lauschte er in die Stille, ob es wirklich zu Ende war.
Dann nickte er. Ja, das Scharren war vorbei, ebenso das Keuchen, aber ab jetzt würden ihn diese Laute in seinem Kopf verfolgen – noch für lange Zeit, dessen war er sich sicher. Sie würden ihn in seinen Träumen heimsuchen, wie all die anderen Dämonen seiner Vergangenheit.
Wie das Licht jenes Frühsommermorgens, das sich in den Schaufensterscheiben gespiegelt hat. Und Amys Lächeln. Gott, wie glücklich sie an diesem Morgen gewesen ist! Und dann die entsetzten Züge des Mannes, der …
»Hör auf damit«, befahl er sich. »Hör sofort auf damit! Hast du verstanden?«
Er ballte die Fäuste. Ihm war nach Davonlaufen zumute, aber dafür war es jetzt zu spät. Also kämpfte er gegen das bleierne Gefühl in seiner Brust an, das ihm das Atmen erschwerte, und holte tief Luft, wieder und wieder.
Dann wandte er sich vom Fenster ab, ging zu dem kleinen Tisch neben dem Waschbecken in jener Ecke des Raumes, die als provisorische Küche diente, und schaltete beide Platten des Elektrokochers ein.
Während er den Topf mit Wasser füllte, vermied er, in den Wandspiegel über dem Becken zu sehen. Er konnte seinen Anblick nicht ertragen. Ganz besonders heute nicht.
Wie nicht anders zu erwarten, fand er in dem kleinen Wandregal nur billigen Tee aus dem Discounter. Gut, dass er daran gedacht hatte, einen Beutel seiner Lieblingssorte einzustecken, einen erlesenen Earl Grey, der mit Bergamotte-Öl versetzt war.
Er tat den Beutel in eine Tasse und sah im Kühlschrank nach Milch. Dort befand sich eine angebrochene Flasche, aber der Inhalt roch sauer. Also griff er wieder in seine Jacke und holte ein Päckchen Milchpulver heraus, das er vorsorglich mitgebracht hatte. Dann sah er zur offenen Schlafzimmertür.
Es war an der Zeit, zu Jay zu gehen, ehe das Wasser kochte. Allzu lange durfte er sich hier nicht mehr aufhalten, das hätte nicht seiner Routine entsprochen, aber die Tasse Tee war wichtig, sehr wichtig.
Trotz aller inneren Widerstände ging er auf die Tür zu. Das Schlafzimmer war noch kleiner als die Wohnküche. Auch hier schienen die wenigen Einrichtungsgegenstände vom Sperrmüll zu stammen oder auf Flohmärkten zusammengetragen worden zu sein. Vielleicht in Camden Lock oder in der Portobello Road. Jays altes Revier. Er hatte eine Schwäche für Flohmärkte gehabt.
Guter, alter Jay. Was hatte er ihm nur angetan?
Den größten Teil des Schlafzimmers nahmen ein altmodisches Doppelbett und ein türenloser Wandschrank ein. Er erblickte die dürren Beine des Toten schon bevor er den Raum betrat.
Jay lehnte seltsam verkrümmt gegen den Bettrahmen. Er war von der Matratze auf den Boden gerutscht, und fast sah es aus, als sei er im Sitzen eingeschlafen. Gottlob hatte er nun die Augen geschlossen, und auf seine hageren, mit weißen Bartstoppeln übersäten Zügen war ein friedlicher Ausdruck getreten. Nur die verkrampfte Haltung seiner Hände, das bläulich verfärbte Gesicht und der weiße Schaum, der ihm vom Mundwinkel troff, straften diesen Eindruck Lügen.
»Ich hatte dir doch gesagt, du sollst dich hinlegen«, murmelte er ihm zu und nahm ihm die Kopfhörer ab.
Dann griff er nach der klobigen Fernbedienung für den uralten Sanyo-Fernseher, der über dem Fußende des Bettes an einer Wandhalterung angebracht war. Er musste mehrmals auf den abgenutzten Ausschalter drücken, ehe die Bildröhre mit einem leisen Plopp-Geräusch erlosch, und es bedurfte ebenfalls mehrerer Anläufe, bis der nicht minder betagte DVD-Spieler den Film, den er Jay mitgebracht hatte, schließlich wieder ausspie.
Er hatte Jay idyllische Aufnahmen von Sommerwiesen, Berglandschaften, Wäldern und Flüssen ausgesucht, untermalt von Edvard Griegs »Morgenstimmung« und Vivaldis »Frühling«. Und da er gewusst hatte, dass die Lautsprecher des Fernsehers längst nicht mehr richtig funktionierten, hatte er Jay eigens Kopfhörer dafür besorgt.
Jay hatte klassische Musik geliebt, und er hatte ihm etwas Schönes mit auf den Weg ins Jenseits geben wollen.
Auch wenn die Bilder auf dem alten Monitor einen Stich ins Violette gehabt hatten, schien Jay der Film gefallen zu haben. Zumindest hatte er anfangs gelächelt.
Doch dann war alles schiefgelaufen. Die Dosis der Injektion musste zu gering gewesen sein. Er musste sich verschätzt haben, immerhin hatte er so etwas noch nie zuvor getan.
Statt friedlich einzuschlafen, war Jay nach kurzer Zeit von heftigen Krämpfen geschüttelt worden. Das Lächeln war schlagartig von seinem Gesicht verschwunden, und er hatte zu zucken begonnen. Mit weit aufgerissenen Augen hatte er sich an die Kehle gegriffen und verzweifelt nach Luft geschnappt.
»Leg dich wieder hin«, hatte er ihm zugerufen. »Leg dich einfach hin!«
Doch Jay hatte ihn wegen der Kopfhörer nicht hören können. Zwar hatte er versucht, sie sich vom Kopf zu reißen, doch es war ihm nicht gelungen, weil er viel zu sehr damit beschäftigt gewesen war, Luft zu bekommen. Immer wieder hatte er am Kragen seines Flanellhemdes gezerrt und dann wie wild zu strampeln begonnen. Seine zerschlissenen Pantoffeln waren durch die Luft geflogen, und seine Wollsocken hatten auf dem Veloursteppich gerieben, als habe er vor, in aller Eile ein Loch in den Boden zu scharren.
Er war vor Jay zurückgewichen, hatte ihm hilflos zugesehen, und schließlich hatte er den Anblick nicht mehr ausgehalten. Dieses Scharren war unerträglich gewesen. Dieses Keuchen, das fast wie ein Wimmern geklungen hatte. Dieser Ausdruck in Jays Augen, diese Panik, diese Angst …
Wie sehr wir uns doch davor fürchten, loszulassen.
Er hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und war aus dem Schlafzimmer gelaufen.
Dann hatte er in dem kleinen Wohnzimmer gewartet, den Blick starr aus dem Fenster auf die Mauer gerichtet, und hatte um seinen einzigen Freund geweint, der nebenan qualvoll starb.
Aber nun war es endlich vorbei, und der erste Schritt war getan.
Er steckte die DVD und die Kopfhörer in eine Plastiktüte, die er ein paar Straßen weiter in einer Mülltonne entsorgen würde. Das Etui mit dem Injektionsbesteck schob er in die Innentasche seiner Jacke zurück. Er würde es mindestens noch einmal brauchen.
Dann bückte er sich und hob Jay auf das Bett zurück. Auch wenn der schlaffe Körper des Alten kaum mehr als hundertzwanzig Pfund wog, fühlte er sich unendlich schwer an.
»Es tut mir leid, alter Junge«, flüsterte er. »So war es nicht geplant. Aber jetzt hast du’s ja hinter dir. Das hast du dir doch gewünscht.«
Seufzend ging er nach nebenan, wo unterdessen das Wasser kochte. Er goss die Tasse auf, schüttete den Rest des Wassers ins Waschbecken und reinigte den Topf gründlich von seinen Fingerabdrücken, ehe er ihn mit dem Spüllappen umfasste und in die Ablage unter dem Tisch zurückstellte.
Dann starrte er wieder aus dem Fenster auf die Mauer und nippte an dem Tee. Auch wenn er auf richtige Milch verzichten musste, hatte er das Gefühl, noch nie einen köstlicheren Tee getrunken zu haben.
Liegt wohl daran, dass es mein letzter ist, dachte er.
Zukünftig würde er Tee nicht mehr mögen. Stattdessen würde er ab sofort Kaffee trinken – vorzugsweise kolumbianischen Arabica, schwarz mit ein wenig Zucker. Und das war nur eines von sehr vielen Details seiner Metamorphose.
Nachdem er ausgetrunken hatte, wusch er auch die Tasse ab, rieb sie übergründlich mit Jays einzigem Geschirrtuch trocken und stellte sie zu dem Kochtopf.
Ich habe den ersten Schritt getan, dachte er wieder. Nun war es an der Zeit für den nächsten.
Für einen kurzen Augenblick schloss er die Augen und bereitete sich auf das vor, was nun folgen würde. Er machte sich noch einmal deutlich, dass sein Plan richtig war.
Er würde nichts Falsches tun, ganz im Gegenteil. Was er vorhatte, würde eine Welt verändern. Nicht die ganze Welt, eher einen Mikrokosmos. Aber hieß es nicht, dass man im Kleinen beginnen musste, wenn man Großes erreichen wollte?
Er rollte das Geschirrtuch zusammen und schob es sich zwischen die Zähne. Dann konzentrierte er sich mit aller Kraft auf den feuchten modrigen Geschmack des Stoffes.
Sein Herz schlug wild, und etwas tief in ihm schien sich wehren zu wollen. Er hatte Angst, aber das war auch gut so. Diese Angst würde ihn weiter antreiben. Sie war seine Motivation, nicht aufzugeben und die Verwandlung zu vollziehen. Wenn er sein Ziel erreichen wollte, musste er sich selbst aufgeben, ganz gleich, wie sehr er sich davor fürchtete.
Mit diesem Bewusstsein biss er fester auf den Stoff. Dann presste er die Fingerkuppen auf die rot glühenden Platten des Kochers.
Teil 2 Das Unbekannte im Vertrauten
2.
Sehr viel später, als alles vorüber war, schrieb Sarah Bridgewater in ihr Tagebuch: Das Schicksal ist ein launischer Weichensteller. Es führt Menschen zusammen, nur um sie wieder zu trennen. Und wenn es ihm gefällt, begegnen sie sich wieder – auf Wegen, die man sich in seiner wildesten Fantasie nicht vorstellen kann.
Ihre Hände zitterten, während sie diese Zeilen schrieb und sich an alles erinnerte.
Die Angst war aus der Stille gekommen. Als habe sie auf den richtigen Moment gelauert, um dann mit aller Macht über sie und ihre Familie hereinzubrechen.
Rückblickend wusste sie, dass es kleine Vorzeichen gegeben hatte. Erste leise Warnungen, die ihr jedoch entgangen waren.
So hatte das Unheil seinen Lauf genommen, ohne dass jemand es aufhalten konnte. Es hatte sich aus der Dunkelheit angeschlichen und unvermittelt zugeschlagen.
Alles hatte mit Harveys Albtraum von einem großen schwarzen Hund begonnen. Der Rest war eine unglaubliche Geschichte.
3.
In der Nacht zum 4. Dezember wehte ein frostiger Wind durch die Straßen von Forest Hill. Das Thermometer war in den letzten Tagen auf den Gefrierpunkt gesunken, doch entgegen der Wetterprognosen blieb der erhoffte Schnee zur Adventszeit aus.
Das Haus der Familie Bridgewater befand sich in einem der besseren Wohnviertel Südlondons. Es war von einer hohen Hecke umgeben, die nur durch die breite Zufahrt zum Eingang unterbrochen wurde. Wenn man in dieser Zufahrt stand, fiel einem die außergewöhnliche Bauweise des zweistöckigen Gebäudes auf. Elemente aus Glas und Beton fügten sich in georgianische Backsteinwände, sodass traditioneller britischer Klassizismus und Modernismus aufeinandertrafen, jedoch ohne disharmonisch zu wirken.
Stephen Bridgewater hatte das Haus selbst entworfen und dafür sowohl einen Architektur- als auch einen Umweltpreis erhalten. Für den Bau hatte er ein neuartiges Wärmedämmungskonzept angewandt, das sich als überaus wirkungsvoll und zudem noch kostengünstig erwies. Eine bessere Werbung für seine Arbeit hätte er sich nicht wünschen können. Bald schon waren sein Design und das Konzept derart gefragt gewesen, dass er seine Anstellung in einem Londoner Architekturbüro hatte kündigen und ein eigenes Ein-Mann-Unternehmen gründen können.
Seine anfänglichen Bedenken, das Bridgewater-Modell könne eventuell nur ein vorübergehender Trend sein, der wieder abflaute, noch ehe sein Unternehmen vollends Fuß in der Branche gefasst hatte, erwiesen sich als unbegründet. Inzwischen erhielt Stephen Anfragen von Privat- und Geschäftsleuten aus dem ganzen Land. Dementsprechend häufig war er zu Kundenterminen unterwegs.
So auch in dieser Nacht.
4.
Es war bereits gegen halb eins, und das Haus lag im Dunkeln. Nur hinter einem der Fenster im ersten Stock brannte noch Licht.
Wie immer in den letzten Monaten, wenn Stephen nicht zu Hause war, fand Sarah keinen Schlaf. Sie kam sich deswegen ein wenig albern vor, schließlich war die Abwesenheit ihres Mannes früher nie ein Problem für sie gewesen. Im Lauf ihrer fünfzehnjährigen Ehe hatte Stephen natürlich schon öfter die eine oder andere Nacht außer Haus verbracht. Und auch wenn Sarah selbst hatte geschäftlich verreisen müssen, hatte sie immer gut schlafen können, selbst in einem noch so hellhörigen Hotelzimmer.
Doch dann hatte sich etwas verändert. Ganz allmählich und zunächst unmerklich. Eine namenlose Angst, ein entsetzliches Grauen war aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins zur Oberfläche gestiegen. Zum ersten Mal war diese Angst vor etwas mehr als einem Jahr aufgetaucht. Seither war sie zu ihrem stetigen Begleiter geworden und trat immer dann in Erscheinung, wenn sie allein war.
Ihr Arzt hatte diese irrationale Angst als eine phobische Störung bezeichnet und ihr einen Therapeuten empfohlen, mit dem sie gemeinsam die Ursache ergründen sollte. Doch die Therapie hatte nicht so angeschlagen, wie sie es sich erhofft hatte, und Sarah musste immer häufiger an eine Formulierung denken, die sie einmal in einem Roman von Shirley Jackson gelesen hatte: Was auch immer dort umgehen mochte, ging allein um.
Auch jetzt war die Angst wieder hier bei ihr im Schlafzimmer.
Wie ein eisiger Windhauch.
Schnell schüttelte sie diesen Gedanken ab, sah kurz zur Uhr und vertiefte sich dann wieder in das Manuskript, das Nora ihr geschickt hatte.
Das ist der Vorteil, wenn man von Zuhause aus arbeitet, dachte sie. Man ist Herr seiner Zeit und kann in schlaflosen Nächten die Arbeit sogar mit ins Bett nehmen.
Sie überflog die ersten Seiten und las dann noch einmal das kurze Anschreiben, das Nora dem Manuskript beigelegt hatte.
Sorry, Liebes,
es wird Dir bestimmt wieder nicht gefallen. Aber so etwas verkauft sich nun einmal. Wenigstens stammt es diesmal von unserem Goldjungen. Du wirst es an Deinem Honorar merken.
Lass mich wissen, falls Du es trotzdem nicht machen willst. Keine Sorge, ich würde es verstehen.
Wir vermissen Dich hier!
Alles erdenklich Liebe und Gute für Dich,
Nora
Sarah lächelte. Ja, auch sie vermisste die Zeit, in der sie noch Tür an Tür gearbeitet hatten. Ihr fehlten Noras trockener Humor und ihre erfrischend jugendliche Art, die sie sich beibehalten hatte, auch wenn ihr fünfzigster Geburtstag schon ein gutes Stück hinter ihr lag.
Aber es gab Gründe, warum Sarah nicht mehr in den Verlag zurückkehren wollte. Triftige Gründe. Zum Beispiel die Türklinke zu ihrem Büro, die sie plötzlich nicht mehr hatte berühren können, ohne von Panikattacken heimgesucht zu werden. Oder Konferenzräume, in denen ihr scheinbar ohne jeden ersichtlichen Grund der kalte Schweiß ausgebrochen war und sie geglaubt hatte, sie müsse sich jeden Moment übergeben, wenn sie nicht sofort ins Freie lief.
Es waren Gründe, die jedem Außenstehenden verrückt erscheinen mussten und die deshalb nur schwer erklärbar waren. Immerhin hatte nicht einmal ihr Therapeut sie verstanden, auch wenn er ihr mit seinem einfühlsamen Blick zugenickt hatte.
Also blieb sie hier, in vertrauter heimischer Umgebung, und las, was auch immer Nora ihrem literarischen Urteil anvertraute. Sie hatte noch nie die Arbeit an einem Manuskript abgelehnt und würde es auch diesmal nicht tun. Dafür schätzte sie Noras freundschaftliche Unterstützung viel zu sehr. Ganz besonders, weil Nora nie nach den Gründen für Sarahs plötzliche Kündigung gefragt hatte. Es war ihr sichtlich schwergefallen, aber sie hatte Sarahs Entscheidung respektiert und ihr angeboten, sie auch weiterhin zu unterstützen, wo immer sie konnte.
»Sofern du das möchtest«, hatte sie hinzugefügt, und Sarah hatte ihr dankbar versichert, dass sie es möchte.
Deshalb widmete sie sich weiter dem neuesten Werk des jungen Autors, den die einschlägige Presse als den »Großmeister des Horrors« titulierte.
Es war eine der üblichen Serienkiller-Storys, die sich derzeit in den Buchläden türmten und reißenden Absatz erfuhren. Diesmal hatte es ein Psychopath auf schwangere Frauen abgesehen, denen er die Embryonen aus dem Körper schnitt, um seine Opfer anschließend damit zu ersticken.
Großmeister des Ekels wäre zutreffender, dachte sie und schüttelte missmutig den Kopf. Vor ihr lag eine weitere, über vierhundertseitige Aneinanderreihung realitätsferner Gewaltfantasien, die mit den Grausamkeiten ihrer Konkurrenz wetteiferte, um den Blutdurst der Leser zu befriedigen. Rasant heruntergeschrieben, ohne jeden Tiefgang.
Aber sie würde es durchstehen und sich einfach auf die sprachliche Überarbeitung konzentrieren, wie immer in solchen Fällen. Nora zuliebe, und auch für sich selbst. Denn solange sie von zu Hause aus arbeiten konnte, kam sie sich nicht völlig unnütz vor – trotz des zwangsweisen Abbruchs ihrer Karriere, und auch wenn Stephen immer wieder beteuerte, dass sie nicht arbeiten müsse, schließlich verdiene er genug.
Er schien sie nicht zu verstehen. Oder vielleicht wollte er auch einfach nicht verstehen, wollte nicht riskieren, einen Blick hinter die Fassade ihrer Ehe zu werfen. Dorthin, wo sich etwas Unbekanntes hinter allem Glück und vorgeblicher Zufriedenheit eingenistet hatte. Etwas, vor dem man sich vielleicht fürchten musste.
Und dass dieses Etwas existierte, wusste sie tief in ihrem Innern nur zu gut. Sie wollte nur nicht daran denken.
Nicht jetzt und erst recht nicht allein.
Also würde sie eine weitere schlaflose Nacht im Bett verbringen und Manuskripte lesen, die sie eigentlich nicht mochte.
Etwa eine Viertelstunde und etliche Grausamkeiten später – sie hatte gerade erfahren, was man mit Batteriesäure an weiblichen Genitalien anrichten konnte – hörte sie das leise Trappeln nackter Füße auf dem Gang.
»Mummy!«
Harvey kam ins Schlafzimmer gelaufen, und Sarah fuhr beim Anblick ihres sechsjährigen Sohnes erschrocken hoch. Sein Gesicht, auf dem sich eine Schlaffalte über die linke Wange zog, glänzte vor Schweiß, und das feine blonde Haar klebte ihm an der Stirn. Tränen standen in seinen Augen.
»Harvey, Schatz, was ist denn los?«
Er kam zu ihr, kroch unter die Decke und schmiegte sich an seine Mutter.
»Da ist jemand im Garten.«
Sie hob erstaunt die Brauen. »Wie? Wer um alles in der Welt sollte denn mitten in der Nacht in unserem Garten sein?«
»Ein Mann.«
»Ein Mann? Liebling, das war bestimmt nur wieder so ein Traum, wie der von dem schwarzen Hund.«
»Nein«, versicherte Harvey und lugte ängstlich unter der Decke hervor. »Ich bin aufgewacht, weil er an mein Fenster geklopft hat, immer wieder.«
»Er soll an dein Fenster geklopft haben? Aber das kann nicht sein.«
»Doch«, beharrte er und klammerte sich noch fester an sie.
»Schatz, wir sind hier im ersten Stock. Er müsste fliegen können, um an dein Fenster zu klopfen.«
»Er hat es aber getan. Wirklich!«
Sie strich ihm zärtlich das schweißfeuchte Haar aus der Stirn. »Also gut, lass uns rübergehen und nachsehen, dann wirst du mir glauben, dass es nur ein böser Traum gewesen ist.«
Harveys Augen weiteten sich. »Nein, lieber nicht! Vielleicht ist er noch da.«
Nun begann Sarah sich Sorgen zu machen. Zwar war sie gewohnt, dass hin und wieder die Fantasie mit Harvey durchging, wie bei allen Kindern seines Alters, und er hatte auch schon häufiger Albträume gehabt – erst vor einigen Wochen hatte er steif und fest behauptet, nachts einen großen schwarzen Hund in der Küche gesehen zu haben –, aber diesmal klang er anders als sonst.
Ängstlicher.
Überzeugter.
Sie sah die Furcht in den Augen ihres Sohnes und überspielte ihre Beunruhigung mit einem Lächeln.
»Also, mein Schatz, pass auf, wenn da wirklich ein Mann ist, werde ich ihn verjagen. Schließlich haben fremde Männer nichts in unserem Garten verloren. Und erst recht dürfen sie nicht an dein Fenster klopfen, wenn du schlafen sollst.«
»Du willst ihn verjagen? Ganz allein?«
»Sicher.« Sarah schlug die Decke zurück und stand auf. »Traust du mir das nicht zu?«
»Aber er ist groß. Mindestens so groß wie Dad.«
Sie streifte ihren Morgenmantel über und stemmte die Hände in die Hüften. Dann warf sie mit einer bühnenreifen Geste ihr langes blondes Haar zurück und sprach mit verstellter Stimme, die sich nach dem Riesen aus Harveys Lieblingsmärchen »Jack und die Bohnenranke« anhören sollte. »Na, dann warte mal ab, wie der sich aus dem Staub macht, wenn er deine riesenhafte Mum sieht. Sonst zermahle ich seine Knochen und mache daraus Brot. Fee! Fie! Foe! Fum!«
Sie hatte ihm diese Geschichte schon unzählige Male vorgelesen, und an dieser Stelle hatte Harvey immer gelacht, aber jetzt blieb er ernst.
Hatte er vielleicht doch jemanden gesehen?
Unsinn, schalt sie sich. Er hat nur wieder schlecht geträumt, das ist alles.
Doch als sie auf den dunklen Gang hinaustrat, war ihr selbst ein wenig mulmig zumute. Und dann hörte auch sie das Klopfen.
Sie blieb abrupt stehen und musste schlucken.
Kein Wunder, dass der Junge sich davor fürchtete. Es klang unheimlich.
Wie Fingernägel auf Glas.
5.
Es lag nun etwa ein Jahr zurück, dass ein mysteriöser Mann in Northumberland für Schlagzeilen gesorgt hatte. Immer wieder war er an verschiedenen Orten aufgetaucht und hatte Kinder erschreckt. Er sprang aus Hausecken und Seitengassen und verfolgte sie mit Gebrüll und irrem Gelächter, ehe er wieder verschwand.
Mehr tat er nicht, aber es genügte völlig, um die ganze Grafschaft in Angst und Schrecken zu versetzen. Beinahe täglich gab es neue Meldungen aus Newcastle, Rochester, Bamburgh, Corbridge, Warkworth und etlichen anderen Orten.
Die meisten dieser Vorfälle ereigneten sich am helllichten Tag, wenn die Kinder zur Schule gingen oder auf dem Nachhauseweg waren. Nur in zwei Fällen war der unheimliche Mann auch abends in Erscheinung getreten – aber dennoch gab es außer den Kindern selbst keine Zeugen. Jedes Mal verschwand der Mann, der von den Kindern als groß und sehr dürr und hässlich beschrieben wurde, auf ebenso geheimnisvolle Weise, wie er erschienen war.
Da sich die Vorfälle über die gesamte Region erstreckten und keinem Muster zu folgen schienen, gestaltete sich die Suche schwierig. In Anlehnung an die Legenden über schottische Quälgeister titulierte ein Journalist den Unbekannten deswegen als »Bogle« und fügte seinem Artikel die scherzhafte Bemerkung hinzu, dieses Gespenst habe sich wohl über die schottische Grenze verirrt.
Und dann endeten die Vorfälle ebenso plötzlich, wie sie begonnen hatten. Als ob der Bogle die Gerüchte, er sei tatsächlich eine Spukgestalt, bestätigen wollte.
Bald darauf gab es Vermutungen, es habe sich um einen gewissen Colin Atwood gehandelt, der zwei Wochen nach dem letzten Bogle-Vorfall tot in seiner Wohnung aufgefunden worden war.
Vieles sprach dafür, denn Atwoods Aussehen entsprach durchaus den Beschreibungen der kindlichen Zeugen, und er hatte in seiner Wohnsiedlung auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Kinder nicht ausstehen konnte. Außerdem hielten ihn die meisten seiner Nachbarn für geisteskrank. Dies bestätigte sich, als man Atwoods bereits stark verweste Leiche gefunden und die verwahrloste Wohnung auf Spuren eines möglichen Verbrechens untersucht hatte. Dabei waren die Ermittler auf eine makabre Sammlung toter Mäuse, Ratten und Vögel gestoßen, die Atwood im Kühlschrank aufbewahrt hatte. Jeder Kadaver war in ein Stück Wachspapier eingewickelt, auf das er mit einem Filzstift »Lasset die Kindlein zu mir kommen« geschrieben hatte.
Dennoch wollten sich die Ermittler nicht auf Atwood festlegen, da er für einige der Vorfälle ein Alibi hatte, wie sich herausstellte. Es gab zuverlässige Augenzeugen, die ihn in drei Fällen zur Tatzeit in einer Suppenküche unweit seiner Wohnung gesehen haben wollten.
Aber als der Bogle nicht mehr auftauchte, legte man den Fall zu den Akten. Die Kinder, die den Mann gesehen hatten, wurden nicht weiter befragt. Aufgrund des Zustands von Atwoods Leiche und da es kein einziges brauchbares Foto von ihm zu Lebzeiten gab, hatte man ihnen die Bilder des Toten ersparen wollen.
So war bis zum heutigen Tag ungeklärt geblieben, wer der mysteriöse Kinderschreck tatsächlich gewesen war, und während Sarah sich nun Harveys Zimmer näherte und das merkwürdige Klopfen hörte, fragte sie sich, ob der Bogle vielleicht doch noch am Leben war.
Vielleicht war er jetzt nach Forest Hill gekommen.
6.
Das Kinderzimmer befand sich am anderen Ende des Gangs. Harvey hatte die Tür halb offen stehen lassen, und Sarahs Herz pochte heftig, während sie darauf zuging.
Dieses Klopfen am Fenster. Es klang so seltsam, so drängend. Als ob tatsächlich jemand voller Ungeduld mit den Fingernägeln gegen die Scheibe trommelte.
Aber das konnte nicht sein. Es war gänzlich unmöglich, dass jemand dort draußen war. Die Fassade hatte keine Vorsprünge, an denen man hochklettern konnte. Er hätte eine Leiter mitbringen müssen.
Obwohl … nicht unbedingt, kam es ihr in den Sinn. Stephen bewahrt unsere Leiter in dem kleinen Geräteschuppen hinter dem Carport auf. Vielleicht hat er vergessen, den Schuppen abzuschließen?
Da war sie wieder, ihre stetige Begleiterin, die ihr frostig in den Nacken blies. Diesmal ließ sie sich nicht so einfach abschütteln wie vorhin. Trotzdem nahm Sarah sich zusammen und ging weiter.
Ich muss da hinein. Wegen Harvey.
Gerade als sie das Zimmer erreicht hatte, hörte das Klopfen auf.
»Mummy, bleib hier«, hörte sie Harvey flüstern, der ihr nachgeschlichen war. »Vielleicht kann er ja doch fliegen.«
Auch wenn es ihr schwerfiel, lächelte sie ihm zu. »Du wartest hier, versprochen?«
»Okay.«
Sie betrat das Kinderzimmer, sah zum dunklen Fenster und tastete nach dem Lichtschalter.
Fast schon erwartete sie die hässliche Fratze eines Verrückten zu sehen, der zu ihr hereingrinste, dann fand sie den Schalter und musste geblendet blinzeln. Beinahe gleichzeitig begann das Trommeln wieder, und dann sah sie es.
Sarah ging zum Fenster und atmete erleichtert auf.
Na also, keine langen dürren Finger. Kein Bogle, und auch sonst niemand.
Hinter ihrer eigenen Reflexion erkannte sie den dürren Ast, den der Wind von der großen Eibe vor Harveys Fenster abgebrochen hatte. Nun hing er an einem schmalen Stück Rinde vom Stamm. In der Dunkelheit ähnelte er tatsächlich einem gespenstischen Arm, der an einem letzten Sehnenstrang baumelte. Er schaukelte im Wind hin und her, und die Spitzen der Zweige klopften wie Totenfinger gegen die Scheibe.
»Es ist nur ein abgebrochener Ast, Schatz«, sagte sie in Harveys Richtung und winkte ihm aufmunternd zu. »Komm her und sieh es dir selbst an. Das war der Wind. Sobald dein Vater wieder zu Hause ist, muss er unbedingt den Baum zurückstutzen, ehe noch etwas passiert. Das wollte er schon längst getan haben.«
Doch Harvey schien ihre Erleichterung nicht zu teilen. Er blieb, wo er war, und schüttelte den Kopf. »Und was ist mit dem Mann im Garten?«
Sarah schaute aus dem Fenster. Durch die hohe Hecke fiel kaum Licht, sodass der Garten auf der Rückseite des Hauses fast völlig im Dunkeln lag.
Sie hielt nach einem Schatten, einem Busch oder Baum Ausschau, der den Umrissen eines Mannes ähnelte, doch da war nichts. Selbst mit viel Fantasie ließ sich nichts auch nur annähernd Verdächtiges ausmachen.
»Schatz, da ist niemand.«
»Aber da war einer.«
Sarah ging zu ihrem Sohn und nahm ihn in die Arme. »Das glaube ich dir, aber jetzt ist er weg. Du musst dich nicht mehr fürchten.«
»Und wenn er wieder zurückkommt?«
»Das wird er nicht wagen. Er hat das Licht in deinem Fenster gesehen und ist bestimmt erschrocken.«
»Glaubst du?«
»Ganz sicher.«
Für einen Moment sah Harvey zum Fenster, dann schaute er wieder zu seiner Mutter auf. »Kann ich trotzdem heute Nacht bei dir schlafen?«
Es war ein Blick, zu dem keine Mutter auf der Welt hätte Nein sagen können.
7.
Wenig später war Harvey tief und fest eingeschlafen. Anfangs hatte er sich noch an Sarah geschmiegt, doch nun lag er auf Stephens Seite des Bettes und hatte Arme und Beine weit von sich gestreckt.
Im Dunkeln hörte Sarah seine gleichmäßigen Atemzüge. Falls Harvey wieder träumte, musste es diesmal etwas Angenehmes sein. Kein unheimlicher Mann, der zu seinem Fenster hochflog und ihn aus dem Schlaf klopfte.
Das ist der Unterschied zwischen der Angst eines Kindes und der eines Erwachsenen, dachte sie, während sie weiter schlaflos dem Wind lauschte. Kinder fürchten sich vor irrationalen Dingen, vor unheimlichen fliegenden Männern und Monstern im Kleiderschrank, und dann schlafen sie wieder ein, weil sie ihren Eltern glauben, dass sie sie vor dem Bösen in der Welt beschützen werden. Kinder wissen noch nicht viel von den wahren Schreckgestalten, die jenseits der dunklen Fensterscheibe auf sie lauern. Von den Ängsten, die weitaus komplexer sind als jeder schwarze Mann und jedes noch so grässliche Monster. Denn sie haben kein Gesicht, keine Gestalt, sosehr man auch versucht, sie beim Namen zu nennen.
So war es auch vorhin wieder mit ihrer eigenen Angst gewesen. Denn wenn sie ehrlich mit sich war, hatte sie sich nicht nur vor dem Bogle gefürchtet. Vielmehr war es die Angst gewesen, Harvey nicht vor ihm beschützen zu können.
Die Angst, allein mit dieser Situation konfrontiert zu sein.
Die Angst vor dem Vertrauen ihres kleinen Sohnes.
Die Angst, zu versagen.
Es war dieselbe Angst, die es ihr nach ihrer Beförderung unmöglich gemacht hatte, die Tür zu ihrem Büro zu öffnen. Oder die sie befallen hatte, wenn sie vor einem größeren Kreis von Kollegen sprechen musste.
Woher diese Angst kam, war ihr schleierhaft. Sie hatte noch nie versagt, im Gegenteil. Bis zu ihrer Kündigung hatte sie auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken können. Alles war so verlaufen, wie sie es geplant hatte. Fast zu ihrer eigenen Verwunderung, denn während ihrer Schulzeit hatte es eine Menge Probleme zu Hause gegeben. Ein alkoholkranker Vater und eine depressive Mutter waren nicht gerade die Pole-Position für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben.
Doch Sarahs Ehrgeiz war groß gewesen. Angefacht vom Wunsch, das tägliche Drama ihrer Eltern so schnell wie möglich hinter sich zu lassen, hatte sie sich zur Einserschülerin hochgearbeitet, was ihr schließlich ein Stipendium in Oxford eingebracht hatte. Während des Studiums hatte sie Stephen kennengelernt, und auch wenn es noch Jahre gedauert hatte, ehe sie sich schließlich das Ja-Wort gegeben hatten, war ihr klar gewesen, dass sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen wollte.
Ein Ziel, ein Plan. Das war stets ihr Motto gewesen.
Ja, bisher hatte sie alles erreicht, was man erreichen konnte: Sie hatte eine glückliche Beziehung, ein gesundes Kind, dem es an nichts mangelte, und einen Beruf, der sie erfüllte. Gleich nach dem Studium hatte sie einen Job als Redaktionsassistentin in einem auflagenstarken Modemagazin bekommen, war dann in die Buchbranche gewechselt und am Ende bis zur Cheflektorin der Belletristikabteilung eines namhaften Verlagshauses aufgestiegen.
Und dann, wie aus heiterem Himmel, hatte die Angst sie angefallen und sich in ihr festgebissen wie ein Raubtier. Eine Phobie, die ohne Gestalt und ohne Gesicht war, die jedoch eine Stimme hatte. Eine Stimme, die ihr zuflüsterte: Du wirst versagen. Irgendwann wirst du versagen, und dann wird dein Kartenhaus zusammenbrechen. Es wird das Ende deiner heilen Welt sein. Deine ganz persönliche Apokalypse.
Allein diese innere Stimme zu hören, war schon verrückt genug. Aber noch verrückter war, dass sie ihr glaubte, aus welchem Grund auch immer.
Denn irgendeinen Grund musste es schließlich für ihre Angst geben. Niemand fürchtete sich einfach nur so.
Das Brummen eines Motors holte sie aus ihren Gedanken zurück. Ein Wagen näherte sich dem Haus und ließ einen Lichtstreifen über die Schlafzimmerdecke wandern. Das Licht verharrte, das Motorbrummen verstummte, und es wurde wieder Nacht.
Sarah runzelte die Stirn. Das Licht von Scheinwerfern konnte man vom Schlafzimmer aus nur sehen, wenn ein Auto direkt auf die Zufahrt zum Carport fuhr.
Wer hält mitten in der Nacht vor unserem Haus?
Sie hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als sie das gedämpfte Schlagen einer Autotür vernahm – so als bemühte sich der Fahrer, so wenig Lärm wie möglich zu machen, um keinen der Anwohner zu wecken.
Es war ein merkwürdig vertrautes Geräusch, dem ein noch vertrauteres folgte.
Seit einigen Wochen gab der Kofferraumdeckel ihres Mercedes beim Öffnen ein unangenehmes Quietschen von sich. Stephen hatte den Wagen in die Werkstatt bringen wollen, nachdem seine Versuche, dem Problem mit Schmierfett und Kriechöl Herr zu werden, gescheitert waren. Aber er hatte es ebenso vor sich hergeschoben wie das Zurückschneiden des Baumes vor Harveys Fenster.
Aber warum kam Stephen schon wieder zurück? Er war doch erst am Nachmittag losgefahren.
Sie setzte sich im Bett auf und lauschte in die Stille, ob sie sich nicht vielleicht doch getäuscht hatte. Harvey schlief noch immer seelenruhig neben ihr.
Dann hörte sie leise Schritte, die sich über den gepflasterten Weg vom Carport dem Haus näherten, und gleich darauf den Schlüssel, der sich im Türschloss drehte. Jedes dieser Geräusche war ihr vertraut, vom Klang seiner Schritte bis hin zu der vorsichtigen Art, mit der er die Haustür hinter sich schloss, wenn er spät nach Hause kam und er wusste, dass Harvey und sie bereits schliefen. Und falls Sarah doch noch Zweifel gehegt hätte, wären sie spätestens beim Klappern seines Schlüsselbunds auf der Flurkommode ausgeräumt. Stephen legte seine Schlüssel nie in die Schlüsselschale, ganz gleich, wie oft Sarah ihn auch darum bat – sondern immer daneben. Im Gegensatz zu ihr, war es um seine Ordnungsliebe nicht besonders gut bestellt.
Etwas musste mit seinem neuen Kunden schiefgelaufen sein. Schließlich war er davon ausgegangen, dass er frühestens in drei Tagen wieder zurück sein würde.
Vorsichtig schlug sie die Bettdecke beiseite, sah noch einmal zu ihrem schlafenden Sohn und schlich dann auf Zehenspitzen in den Gang, um Harvey nicht zu wecken.
Von unten drang das klimpernde Geräusch der Flaschen in der Kühlschranktür zu ihr herauf. Ebenfalls ein höchst vertrautes Geräusch. Der kleine Imbiss gehörte zu den festen Ritualen ihres Mannes, wenn er nach einer langen Fahrt nach Hause kam.
Sarah beschloss, Stephen bei einem Glas Milch Gesellschaft zu leisten, damit er ihr erzählen konnte, was geschehen war.
Leise stieg sie die Treppe hinunter.
Den Bogle hatte sie längst wieder vergessen.
8.
Der untere Flur war dunkel. Wie immer hatte Stephen kein Licht gemacht, um niemanden zu wecken, falls eine der oberen Schlafzimmertüren offen stand – und Harveys Zimmertür stand in letzter Zeit häufiger offen, seit er von dem schwarzen Riesenhund geträumt hatte –, aber es fiel ausreichend Straßenlicht durch das Gangfenster.
Als Sarah den Fuß der Treppe erreicht hatte, erkannte sie Stephens Koffer vor der Flurkommode und seinen gefalteten Mantel, den er darübergelegt hatte.
Aus der Küche drang ein schmaler Lichtstreifen auf den Parkettboden. Sie ging darauf zu und rieb sich müde übers Gesicht. Ihr fehlte Schlaf, aber den würde sie jetzt wohl endlich bekommen, da Stephen wieder zu Hause war. Stephens Gegenwart hatte eine beruhigende Wirkung auf sie. Er gab ihr ein sicheres Gefühl, auch wenn sie das ihm gegenüber verschwieg, weil es sich in ihren Ohren kindisch anhörte.
»Stephen?« Sie dämpfte ihre Stimme, da das Treppenhaus recht hellhörig war. »Warum bist du schon wieder zurück?«
Der Lichtstreifen kam vom halb geöffneten Kühlschrank. Stephen stand hinter der Tür, sodass sie nur seine Beine sah. Wie immer inspizierte er zuerst die Lebensmittel, ehe er sich für etwas entschied.
Und da auf einmal begann Sarahs Herz wieder zu rasen.
Diese Beine, schoss es ihr durch den Kopf, und sie spürte etwas Eiskaltes, das ihre Wirbelsäule entlangkroch. Was ist mit Stephens Beinen los?
Dieser scheinbar irrationale Gedanke kam ihr so plötzlich, dass sie zunächst nicht verstand, warum eine derart heftige Beunruhigung damit einherging. Doch gerade als ihr klar wurde, dass diese Beine viel zu dünn und zu lang für Stephens Anzughose waren, sodass sie seine braunen Socken zwischen Hosensaum und Schuhen erkennen konnte, trat er einen Schritt zurück, und Sarah versteinerte vor Schreck.
Es war nicht Stephen. Der Mann hatte sich wie Stephen angehört, er hatte sich wie Stephen bewegt, er trug Stephens Anzug, hatte Stephens Koffer und Mantel bei sich und Stephens Schlüsselbund benutzt, aber er war nicht Stephen.
Vor Entsetzen wie gelähmt starrte sie ihn an. Der Unbekannte war größer als ihr Mann, er musste ihn um mindestens einen Kopf überragen. Er war hager, als ob er lange Zeit gehungert hätte, doch das ließ ihn nicht weniger bedrohlich erscheinen. Im Gegenteil, trotz seiner krankhaft dürren Statur machte er einen auf absurde Weise kräftigen Eindruck.
Sarah fielen drei Worte ein.
Groß. Sehnig. Schnell.
Am meisten jedoch erschreckte sie sein Gesicht.
Nein, das ist kein Gesicht, dachte sie entsetzt. Es ist eine Fratze. O Gott!
Die Züge des Eindringlings waren von zahllosen Brandnarben entstellt, die im fahlen Licht des noch immer geöffneten Kühlschranks wie eine Maske wirkten. Eine Maske, die man vielleicht zu Halloween trug und bei der man sicher sein konnte, dass man damit Leute auf der Straße erschrecken würde.
Doch dieses entstellte Gesicht, das sie unter den dichten blonden Stoppelhaaren ansah, mit all den rötlichen Erhebungen, die einer makabren topografischen Karte glichen, war nicht aus Latex oder Plastik. Es war keine Maske. Es war aus Fleisch und Blut.
Und dann verzog sich diese Fratze zu einem Lächeln.
»Hallo, Liebling.«
Seine Stimme klang tiefer als die von Stephen, und sie hörte sich irgendwie knarrend an, als sei nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine Stimmbänder voller Narben.
»Haben wir noch etwas von der Mortadella übrig?«
Ihr Blick fiel auf seine Hand mit dem Teller, auf dem zwei Brotscheiben, eine kleine Portion Mixed Pickles und ein Messer lagen. Ihr schärfstes Küchenmesser, mit dem man sich leicht in den Finger schneiden konnte, wenn man nicht aufpasste. Das hatte sie selbst schon schmerzlich erfahren müssen.
Das ist nur ein Traum. Es muss ein Traum sein! Harvey hat neulich in der Küche einen schwarzen Hund gesehen, und ich sehe jetzt in der Küche diesen Mann. Bestimmt werde ich gleich aufwachen. Ja, so wird es sein.
»Du bist so blass. Ist alles in Ordnung mit dir?«
Die Albtraumversion ihres Mannes musterte sie aufmerksam, und Sarah wurde klar, dass sie nicht träumte. Wem immer sie gerade auch begegnete, es gab ihn wirklich. Er stand leibhaftig vor ihr. Sie roch den Essig der Pickles tatsächlich, spürte die Kälte aus dem Eisschrank, sah den Narbenmann – und das Messer auf dem Teller.
»Wer sind Sie?«
Ihre Stimme war belegt, kaum mehr als ein heiseres Flüstern.
»Schade.« Er zuckte mit den Schultern, stellte den Teller auf der Arbeitsfläche neben der Butterdose ab und nahm das Messer in die Hand. »Ich musste während der ganzen Fahrt an die Mortadella denken.«
»Wer, zum Teufel, sind Sie?«
Er ging nicht auf ihre Frage ein. »Hast du gesehen?«, fuhr er ungerührt fort. »Ich habe dir Blumen mitgebracht.« Er deutete mit der Klinge zum Küchentisch, wo in einer bauchigen Glasvase tatsächlich ein frischer Blumenstrauß stand. »Und sei mir nicht böse, aber ich habe Harvey nun doch die Spielkonsole gekauft. Ich weiß, du bist dagegen, aber er wünscht sie sich doch so sehr. Wir sollten sie ihm zu Weihnachten schenken.«
Sarah spürte, dass sie kurz davor stand, in Panik zu verfallen, und es kostete sie immense Kraft, sich zusammenzureißen.
»Was wollen Sie?« Ihre Stimme zitterte. »Geld? Wir haben nicht viel Geld im Hause.«
»Möchtest du auch ein Sandwich?«
Er öffnete die Butterdose und bestrich die Brotscheiben. Sarah starrte auf seine Hände, die ebenso narbig wie sein Gesicht waren, und überlegte fieberhaft, was sie nur tun sollte.
»Bitte«, flüsterte sie, »gehen Sie wieder.«
Er hob den Kopf und sah sie an. »Ich habe dir schon lange keine Blumen mehr geschenkt. Das tut mir leid. Überhaupt tut mir vieles leid. Ich habe mir kaum noch Zeit für euch genommen und immer nur an die Arbeit gedacht. Aber das soll sich ab sofort ändern.«
Sarah ballte die Hände zu Fäusten und versuchte verzweifelt, ihre Gedanken zu ordnen, die wie ein aufgeschreckter Vogelschwarm durch ihren Kopf flatterten.
Nein, dieser Mann würde nicht auf ihr Flehen und Betteln eingehen. Er würde das Haus nicht verlassen, ganz gleich, was sie ihm dafür anbot.
Sie stand einem Verrückten gegenüber – einem Verrückten, der Stephens Kleider trug, auch wenn sie ihm viel zu klein waren, und der sich gerade Buttersandwiches mit ihrem schärfsten Küchenmesser strich.
»Wo ist mein Mann? Warum tragen Sie seine Sachen? Was haben Sie ihm angetan?«
»Ich kann verstehen, dass du mir das nicht glauben wirst«, sagte er und teilte die Brotscheiben in Dreieckshälften, »aber ich bin fest entschlossen, mich ab sofort zu ändern. Das bin ich Harvey und dir schuldig.«
Sarah fuhr sich mit der trockenen Zunge über die Lippen.
Er hält sich für Stephen, dachte sie. Zumindest möchte er, dass ich das glaube. Ich darf ihn auf keinen Fall reizen. Er hat das Messer, und über uns schläft Harvey.
Sie beschloss, auf sein Spiel einzugehen, um Zeit zu schinden. Zeit, um sich klar zu werden, was sie tun sollte.
»Die … Mortadella haben wir aufgegessen«, sagte sie und rang bei jedem Wort um Beherrschung. »Aber es ist noch Truthahn übrig. Und Tiramisu. Das magst du doch so gern. Es ist von unserem Lieblingsitaliener.«
Nun legte er die Stirn in Falten, was sein maskenhaftes Narbengesicht noch hässlicher und unechter wirken ließ.
»Von … Vittorio?« Er klang verwundert und ging nun zum ersten Mal in dieser höchst merkwürdigen Unterhaltung auf sie ein. »Der hat doch schon seit fast einem Jahr geschlossen.«
Sarah fuhr zusammen. Woher wusste er das?
»Ich … ich meinte, es ist fast so gut wie das von Vittorio«, sagte sie und rang sich ein Lächeln ab.
»Na, dann sollte ich es wohl probieren.«
Er lächelte zurück und zwinkerte ihr zu, dann sah er wieder in den Kühlschrank.
Sarah schaute auf das Messer. Sie könnte die Hand jetzt packen, überlegte sie. Die Gelegenheit wäre günstig. Aber dann würde er sich wehren, und die Situation würde eskalieren.
»Mummy?«
Harveys Stimme vom oberen Ende der Treppe ließ sie zusammenfahren.
O Gott! Er darf auf keinen Fall herunterkommen!
Eilig trat sie einen Schritt auf den Flur hinaus, ohne dabei den Fremden aus den Augen zu lassen, der sich nun umdrehte und an ihr vorbei zur Treppe sah.
»Geh sofort zurück ins Bett, Schatz«, rief sie Harvey zu. »Ich bin gleich wieder bei dir.«
»Was machst du da unten?« Harvey klang verschlafen, aber wie immer war er neugierig.
»Ich trinke nur schnell einen Schluck Wasser, und dann komme ich wieder ins Bett. Leg dich schon mal hin.«
Für einen Moment war es still im Gang, und Sarah dachte voller Panik, was wohl geschehen würde, wenn Harvey nicht auf sie hörte und die Treppe herunterkäme.
Sie hielt unweigerlich den Atem an, und ihre Fingernägel gruben sich immer fester in ihre Handflächen.
Bitte, Schatz, flehte sie in Gedanken. Geh zurück! Geh bitte zurück!
»Okay, Mummy, aber komm bald, ja?«
Als gleich darauf seine patschenden nackten Füße zu hören waren und die Schlafzimmertür geschlossen wurde, fiel ihr ein Felsbrocken vom Herzen.
Der Unbekannte hatte ihre Unterhaltung reglos verfolgt, die Schüssel mit dem Tiramisu in der einen Hand, das Messer in der anderen.
»Träumt er immer noch diese wirren Sachen?«
Sarah hatte keine Ahnung, woher er all diese Dinge wusste, aber das war jetzt auch nicht wichtig. Sie musste Hilfe rufen, ohne Harvey dabei in Gefahr zu bringen.
»Ja.« Sie nickte. »Er hatte vorhin einen Albtraum. Ich sehe wohl besser mal nach ihm.«
»Das ist meine Schuld«, entgegnete der Unbekannte, und für einen Augenblick kam Sarah die abwegige Hoffnung, er habe soeben eingesehen, dass er sie und ihren Sohn erschreckt hatte und besser gehen sollte. Aber dann fügte er hinzu: »Wie gesagt, ich habe euch beide vernachlässigt. Ich war viel zu selten zu Hause. Kein Wunder, wenn unser Sohn schlechte Träume hat.«
Sein Blick war besorgt, und das irritierte Sarah am meisten. Dieser Mann sah sie an wie ein fürsorglicher Vater, der feststellte, dass er Fehler bei der Erziehung seines Kindes gemacht hatte. So wie Stephen sie angesehen hätte, wenn ihm diese Einsicht gekommen wäre.
Nein, dieser Mann würde nicht mehr gehen. Er hatte Stephens Platz eingenommen.
Was mochte er dem wahren Stephen angetan haben?
Sie verdrängte diesen Gedanken und konzentrierte sich auf die Gegenwart. Stephen konnte sie jetzt nicht helfen. Die Sicherheit ihres Sohnes war im Moment alles, was zählte. Es fiel ihr unendlich schwer, nicht zu schreien, und stattdessen weiter auf das schreckliche Spiel einzugehen.
»Iss erst einmal was«, sagte sie mit gepresster Stimme, die ganz nach der liebevollen Ehefrau klingen sollte. »Wir reden morgen früh über alles.«
»Gut, das werden wir.« Er schien zufrieden. »Geh ruhig schon hoch. Ich komme gleich nach.«
»In Ordnung. Guten Appetit.«
Sie zwang sich erneut zu einem Lächeln und ging auf den Flur. Dabei musste sie sich beherrschen, nicht die Treppe hochzustürmen, denn sie spürte noch immer seine Blicke im Nacken.
»Sarah?«
Sie blieb abrupt stehen, hielt den Atem an und sah sich langsam um.
Jetzt ist es so weit, durchfuhr es sie. Er wollte mich nur in falscher Sicherheit wiegen. Jetzt wird er durchdrehen. Auf keinen Fall wird er mich zu Harvey gehen lassen.
Alles in ihr war angespannt. Sie bereitete sich innerlich darauf vor, dass er sie nun angreifen würde und sie sich wehren musste.
Doch er tat nichts dergleichen. Er stand nur weiterhin in der Küche.
»Ich liebe euch, Sarah.«
Es klang auf erschreckende Weise aufrichtig.
Sarah verzog das Gesicht. Es hätte ein weiteres Lächeln werden sollen, doch es missglückte kläglich.
»Ja … natürlich. Das … das weiß ich doch.«
Sie schaute zur Haustür, die sich unmittelbar neben der Küche befand, und dann zur Treppe. Die Versuchung, blindlings loszurennen und Hilfe zu holen, war groß. Aber Harvey wartete oben im Schlafzimmer.
»Das Tiramisu sieht übrigens großartig aus.«
Er deutete mit dem Messer auf die Schüssel. Das Licht des Kühlschranks spiegelte sich in der Klinge.
»J-ja«, stammelte sie. »Lass es dir schmecken.«
»Werde ich. Und dann schlafen wir drei mal so richtig lange aus.«
Wieder zwinkerte er ihr zu, und die Art, wie er sie dabei musterte, ließ sie schaudern.
»Ja«, stieß sie hervor. »Gute Idee.«
»Also bis gleich.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab, schloss den Kühlschrank und setzte sich im Dunkeln an den Tisch, um zu essen.
Sarah sah ihm fassungslos zu. Zuerst konnte sie gar nicht glauben, dass er sie tatsächlich gehen ließ, aber dann nutzte sie ihre Chance. Sie nahm das Telefon aus der Ladestation, das neben Stephens Schlüsselbund auf der Flurkommode stand, und ging die Treppe hoch. Erst als sie sich außer Sichtweite des Wahnsinnigen wusste, begann sie zu rennen.
9.
So schnell sie konnte, eilte sie zum Schlafzimmer, schloss leise die Tür und lehnte sich heftig atmend dagegen.
Erst jetzt bemerkte sie, dass sie völlig durchgeschwitzt war. Ihr Nachthemd unter dem Morgenmantel klebte ihr am Leib, als habe sie darin eine Dusche genommen.
»Mummy?« Harvey saß im Bett und sah sie fragend an. »Was ist denn …«
Sarah unterbrach ihn mit einem schnellen Winken. »Pssst! Wir müssen ganz leise sein!«
»Aber …«
»Pssst«, machte sie wieder, lief zu ihm und schloss ihn in die Arme.
Harvey verstummte, aber nun waren seine Augen wieder so groß wie vorhin, als er ihr von dem Mann vor seinem Fenster erzählt hatte.
»Alles wird gut, Schatz«, flüsterte sie ihm zu und sah sich dabei hektisch um. »Aber sei leise, ja?«
In der Schlafzimmertür steckte kein Schlüssel. Wozu auch? Hier musste man vor niemandem abschließen. Deshalb hatte Stephen bei ihrem Einzug alle Türschlüssel eingesammelt – alle, bis auf den der Gästetoilette im Erdgeschoss –, weil es im Haus einer Familie keine Schlüssel brauchte, wie er sagte, und um zu vermeiden, dass sich ihr damals zweijähriger Sohn versehentlich in einem Raum einschloss.
Ich komme gleich nach, hallten die Worte des Unbekannten in ihrem Kopf wider. Er würde sein Buttersandwich essen, vielleicht auch den Rest Tiramisu, und dann würde er zu ihnen hochkommen.
Und er würde das Messer mitbringen, davon war sie überzeugt. Wie hatte er doch vorhin gesagt?
Und dann schlafen wir drei mal so richtig lange aus.
Dieses Zwinkern … Sie wollte lieber nicht darüber nachdenken, wie dieser Satz gemeint war.
Fieberhaft überlegte sie, wo Stephen die Schlüssel deponiert hatte.
In einem Karton, ja, daran konnte sie sich noch erinnern. Aber wo war dieser verdammte Karton jetzt? Hier im Schlafzimmer? Vielleicht auf dem Schrank?
Sie hatte keine Zeit, danach zu suchen, selbst wenn der Unbekannte ein nur halb so schneller Esser wie ihr wirklicher Mann war.
Die Tudor-Kommode neben der Tür zum Elternbadezimmer war zu schwer, sie würde sie unmöglich vor die Schlafzimmertür schieben können. Außerdem würde der Eindringling das hören und sofort nach oben gelaufen kommen.
»Mummy«, flüsterte Harvey und begann zu zittern. »Der fliegende Mann. Ist er wieder da?«
Sie schluckte. Was sollte sie ihrem Sohn sagen?
»Es ist alles in Ordnung«, log sie. »Ich bin ja bei dir. Lass mich nur einen Moment nachdenken.«
Im selben Augenblick fiel ihr der Stuhl neben Stephens Seite des Wandschranks auf. Er war kaum noch zu erkennen unter dem Haufen von Kleidungsstücken, den ihr Mann kurz vor seiner Abreise hinterlassen hatte – in puncto »Was soll ich anziehen?« konnte er manchmal jedes Frauenklischee in den Schatten stellen –, aber der Stuhl war stabil, und man konnte die Tür damit blockieren.
Sanft, aber bestimmt schob sie Harvey von sich und setzte ihn zurück aufs Bett. Dann sprang sie auf, packte den Turm aus Hemden, Hosen und Pullovern, warf ihn achtlos zu Boden und lief mit dem Stuhl zur Tür.
Sie verkeilte die Lehne unter dem Türgriff und atmete tief durch.
Was für ein Glück, dass Stephen damals die Türdrücker mit den Langschildern durchgesetzt hat, dachte sie und musste ein hysterisches Kichern unterdrücken. Ich wollte traditionelle Türknäufe, er den Klassizismus.
Dennoch waren sie nicht in Sicherheit. Auch wenn beim Bau dieses Hauses nur solide Materialien verwendet worden waren, konnte niemand sagen, wie lange sie vor den Angriffen eines Einbrechers geschützt sein würden – erst recht nicht, wenn es sich um einen Verrückten handelte, der sicherlich alles daransetzen würde, zu ihnen zu gelangen.
»Mummy, du machst mir Angst!«
Harvey stand kurz davor zu weinen. Sie ließ sich zu ihrem Sohn aufs Bett fallen, drückte ihn an sich und wählte mit der anderen Hand die Notrufnummer. Doch statt der Ziffern erschien auf dem Display des Mobilteils … nichts.
»Verdammt!«
Sie musste vor Aufregung zu sehr gezittert haben, also versuchte sie es erneut und drückte diesmal fester auf die Tasten. Doch das Display blieb weiterhin dunkel, und als sie die grüne Wählen-Taste betätigte, geschah wieder nichts. Und dann wurde ihr schlagartig klar, wie leicht sich das Telefon anfühlte. Vorhin, in der Aufregung, war es ihr nicht aufgefallen, aber jetzt spürte sie plötzlich den Unterschied überdeutlich.
»O nein!«
Sie ließ von Harvey ab, packte das Telefon mit beiden Händen und riss die Abdeckung von der Rückseite – verzweifelt hoffend, dass sie sich nur getäuscht hatte.
Doch sie hatte sich nicht getäuscht. Der Unbekannte hatte den Akku entnommen. Das Telefon war nun ebenso nutzlos wie ihr Handy, das wie immer in der Küche lag, keine zwei Meter von dem narbengesichtigen Eindringling entfernt.
Kein Wunder, dass dieser Wahnsinnige sie einfach hatte gehen lassen.
Sie saßen hier oben fest.
Also bis gleich.
10.
Es war so dunkel um ihn, dass er blinzeln musste, um sicher zu sein, dass er die Augen wirklich offen hatte.
Was ist mit mir geschehen?
Er fühlte sich benommen, und ihm war, als müsse er mit jedem einzelnen Gedanken durch dichten Nebel dringen.
Wo bin ich?
Sein gekrümmter Rücken schmerzte, und seine Arme fühlten sich pelzig und taub an. Ebenso seine Beine. Er wollte sich strecken, doch es ging nicht. Seine Füße drückten bereits gegen das Ende des Dunkels, wo immer er sich auch befand.
Ganz in seiner Nähe glaubte er, ein vorbeifahrendes Auto zu hören, doch es klang merkwürdig. Irgendwie gedämpft und blechern.
Er versuchte seine Umgebung zu betasten, doch auch das war unmöglich. Etwas hielt seine Hände zusammen.
Ein weiterer Gedanke schoss aus dem Nebel in seinem Kopf hervor.
Klebeband.
Dann: Meine Hände.
Dann: Ich bin gefesselt!
Aber nicht nur das. Allmählich dämmerte ihm, dass auch seine Beine zusammengebunden waren. Und als er den Mund öffnen wollte, spürte er auch dort das Ziehen eines Klebebandstreifens.
Ich bin gefesselt und geknebelt, wurde ihm klar, aber noch immer wollte sich der Nebel in seinem Kopf nicht lichten. Stattdessen drohte er erneut ohnmächtig zu werden – und wahrscheinlich wurde er es auch, denn als er die Augen mit aller Anstrengung wieder öffnete, hatte er den Eindruck, dass noch einmal Zeit verstrichen war.
Ihm war entsetzlich übel, und Schwindel ergriff ihn – so als wäre er gerade aus einem Jahrmarktskarussel gestiegen.
Nur dass er jetzt nicht stand, sondern irgendwo lag. Vielleicht in einer Kiste oder …
In einem Sarg!
Bei diesem Gedanken musste er würgen. Hektisch wollte er nach dem Klebestreifen vor seinem Mund greifen, doch es ging nicht. Wo immer er sich auch befand, der Raum war viel zu eng, um sich darin zu bewegen.
Das Würgen kam wieder und wieder, aber er wusste, dass er dem Drang, sich zu übergeben, auf keinen Fall nachgeben durfte.
Das Klebeband! Wenn ich jetzt kotze, werde ich daran ersticken!
Er biss sich auf die Zunge, so fest es nur ging. Sofort füllte sich sein Mund mit kupfernem Blutgeschmack, aber der Schmerz zeigte Wirkung. Die Übelkeit verschwand, allerdings nur, um einem nicht minder schlimmen Gefühl Platz zu machen.
Denn mit der anschwellenden Panik löste sich zwar der Nebel in seinem Kopf auf, aber nun kehrte die Erinnerung an seine Klaustrophobie zurück. Seit ihn sein älterer Bruder als Vierjährigen über mehrere Stunden in eine Besenkammer eingesperrt hatte, konnte er enge, geschlossene Räume nicht mehr ertragen. In kleinen Räumen bekam er Schweißausbrüche, spätestens wenn die Tür geschlossen wurde. Deshalb mied er auch Aufzüge oder Fahrten in der überfüllten U-Bahn zur Rushhour wie die Pest.