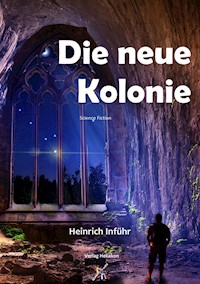
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Überall, wo die deutsche Erde zu Ende geht und die Dörfer eines anderen Volkes anheben, da wogt seit Jahrhunderten der Kampf um die Scholle zwischen den zwei Nationen. Still oder laut — der Kampf findet meist ein Echo in allen deutschen Ländern. Nur eine Ecke Deutschlands fühlte sich unbeachtet und verlassen, unbekannt und vereinsamt, sodass die Leute dort ihr Gebiet als das vergessenen Land seit alters her bezeichnen. In der nordöstlichen Steiermark, von dem Punkt an, da Slowenen, Ungarn und Deutsche zusammenstoßen bis zum Wechselgebirge, wohnt ein verträumter deutscher Volksstamm in vergessenen Land. Römische Legionäre haben dort einst die Grenzwacht gegen Osten gehalten, der sympathischste Stamm der Südslawen, die Slowenen haben nach ihnen die Gaue bezogen, um dann dem lebenskräftigen Bajuwarenstamm weichen zu müssen. Diese südlichsten Germanen haben gegen Avaren und Madjaren, gegen Türken und wieder gegen die Ungarn die Wacht gehalten. Und weil sich niemand um sie gekümmert hat, außer den Herren, die, von den Babenbergern angefangen bis zu den Habsburgern, das Land bei den Steuern nicht vergessen haben, so ist das Volk noch mehr verträumt worden, als die Deutschen sonst ohnehin sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die neue Kolonie
Heinrich Inführ
Verlag Heliakon
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Titelbild: Pixabay (PhotoVision)
Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
©2023 Verlag Heliakon
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Widmung
Die vergessenen Lande
Die Doktorarbeit in der Goldkammer
Ria Wimpffen und Vera Garwin
Kabale und Liebe auf der Pax
Beratung in New York
Der Planet erlebt eine Sensation
Die Auffindung der versunkenen Insel Atlantis
Der Funkenkrieg um die Insel Atlantis
Die Souveräne Atlantis GmbH
Die Schlacht über Atlantis
Die Abstimmung in Genf
Widmung
Dieses Buch ist dem Andenken meiner lieben Mutter gewidmet, die das Licht der Liebe in eine düstere Jugend strahlen ließ. In Graz erlosch dies Licht und ruht nun ewig.
Heinrich Inführ
Die vergessenen Lande
Der Held wird dem Leser vorgestellt
Überall, wo die deutsche Erde zu Ende geht und die Dörfer eines anderen Volkes anheben, da wogt seit Jahrhunderten der Kampf um die Scholle zwischen den zwei Nationen. Still oder laut — der Kampf findet meist ein Echo in allen deutschen Ländern. Nur eine Ecke Deutschlands fühlte sich unbeachtet und verlassen, unbekannt und vereinsamt, sodass die Leute dort ihr Gebiet als das vergessenen Land seit alters her bezeichnen. In der nordöstlichen Steiermark, von dem Punkt an, da Slowenen, Ungarn und Deutsche zusammenstoßen bis zum Wechselgebirge, wohnt ein verträumter deutscher Volksstamm in vergessenen Land. Römische Legionäre haben dort einst die Grenzwacht gegen Osten gehalten, der sympathischste Stamm der Südslawen, die Slowenen haben nach ihnen die Gaue bezogen, um dann dem lebenskräftigen Bajuwarenstamm weichen zu müssen. Diese südlichsten Germanen haben gegen Avaren und Madjaren, gegen Türken und wieder gegen die Ungarn die Wacht gehalten. Und weil sich niemand um sie gekümmert hat, außer den Herren, die, von den Babenbergern angefangen bis zu den Habsburgern, das Land bei den Steuern nicht vergessen haben, so ist das Volk noch mehr verträumt worden, als die Deutschen sonst ohnehin sind.
Dort liegt, nahe der Sprachengrenze, das Städtchen Hartenfels, von dem man weit ins Heinzenland hineinblicken kann. Ringsum kleben viele kleine Dörfer am Rand des deutschen Bodens, mit Stroh gedeckte Hütten künden die Armut der Bewohner. Dicke Krusten von traumhaften Gefühlen bedecken die Seelen der Leute und schließen sie vom lebendigen Bewusstsein ebenso ab, wie das Land selbst vom Pulsschlag des europäischen Lebens getrennt ist durch das unsichtbare Netz des Vergessenseins. Eine unwillige Ackerscholle, gleich dem ungefügen Buckel eines Vorweltriesen, trennt Hartenfels von dem Dörfchen Grafenstein, darin der Held unserer Erzählung zur Welt kam. Peter Hartberger, der Sohn der Witwe Sonja Hartberger, wuchs hier in einsamen Träumen heran. Er war ein kleiner schmächtiger Junge, der mit klugen blauen Augen in die Welt blickte. In diesen Augen lag mehr Ausdruck, als sonst bei Bauernkindern zu finden war. Peters Vater, der im Weltkriege gefallen war, musste beim Ausbruch des Krieges mit seinem jungen Weib und ihrem ungeborenen Kind aus Graubünden in die Heimat gehen. Nun war Sonja, die dunkle Bündnerin, Witwe in einem fremden Land und lebte einsam und verschlossen. Daher wuchs auch Peter wie ein Einsiedler heran.
Nach der Dorfschule kam er als Bettelstudent nach Graz. Es war dort in verschiedenen Klöstern ein jahrhundertealter Brauch, dass den Studenten in einem eigenen Stüblein neben der Eingangspforte ein kärgliches Mittagessen, wie es vom Tisch der Mönche abfiel, geboten wurde. Dorthin brachte Sonja ihren Peter, damit er studieren könne. Und Peter hielt sich, in einem elenden Dachkämmerlein wohnend, all die Jahre hindurch aufrecht trotz vieler Entbehrungen. Manchmal hatte er Hunger, denn von Mittag bis zu Mittag gab es nichts wieder. Nur ein großes Stück Brot durfte jeder Student noch mitnehmen. So wuchs der Knabe heran, war ein Jüngling und ein weltfremder Mensch, der von den Schönheiten des Lebens nur aus Büchern erfuhr. Aber seine Sehnsucht ging nicht nach diesen Schätzen, sondern sie waren von einer anderen, eigenen Art, die sein Leben und Wirken bestimmte. Peter war von irdischer Sehnsucht erfüllt, von der Liebe zur Erde.
Im Dorfwald gab es eine Stelle, nahe dem kleinen Haus, darin sie gewohnt hatten, wo der Boden beim Drübergehen seltsam hol klang. Peter war überzeugt, dass sich da drunten ein Grab eines avarischen Häuptlings mit vielen Schätzen befinde. Wie er zu dieser Meinung gekommen war, konnte er nicht sagen.
Wenn er aber abends zu der geheimen Stelle ging, vorsichtig auf den Boden stampfte und das seltsame Klingen und hohle Dröhnen hörte, dann wusste er, dass er sich nicht irren konnte: hier schlug Karl der Große einen Avarenfürsten aufs Haupt, und hier hatten, vor der Schlacht schon, die Frauen und Kinder alle aus Deutschland geraubten Schätze, die sie mit sich führten, begraben. Das Gold in der Tiefe der Erde — Peter fühlte es an jener Stelle, denn eine seltsame Unruhe ergriff ihn immer dort.
Die gleiche Unruhe und unablässige leise Spannung war es, die er im Vaterhause, solange er sich zurückerinnern konnte, auch immer gespürt hatte. Er war sich darüber schon mit 14 Jahren klar geworden, dass er anders als die andern war. Es schien ihm oft, als seien die Kameraden blind und taub, ohne das eigentliche Weltgefühl. Peter spürte jeden Baum, jeden Berg, ja auch nur einen Steinbruch als etwas Besonderes. Er konnte die Metalle auf weite Entfernung durch Geruch und Gefühl erkennen, er fühlte, wenn er über eine Brücke ging, oder wenn er nachts mit der Eisenbahn drüberfuhr, ohne etwas zu sehen, ob die Brücke aus Eisen oder aus Stein war. Peter wusste, dass er schärfer wach war als die anderen. Auch im Schlaf war er stets wach. Man konnte ihn im tiefsten Schlaf fragen: wo warst du gestern um drei Uhr? — und er antwortete, sofort völlig wach: da und dort.
In Graz galt der Bettelstudent wenig unter seinen Kameraden. Peter war sehr zurückgezogen, er hatte kaum einen, dem er Freund sagte. Wohl blickte auch er, wie die anderen alle, mit Sehnsucht nach Deutschland, von woher sie alle das Heil erhofften. Aber er war zu weich für die studentischen Sitten des Saufens und Prügelns, er war so kühl, dass er das Einschlagen von Fenstern nicht als einen studentischen Scherz, sondern als Unsinn ansah. Immer wieder zog es ihn aus der Landeshauptstadt hinaus in den Nordosten, in die vergessenen Länder. Wie ein starker Magnet übte die Landschaft einen steten Reiz auf ihn aus. Lag der Nebel über der Ebene gegen das Land der Ungarn zu, so verwob er die Weiden am Grenzbach zu seltsamen Gestalten, und Peter konnte eine alte Frau erkennen, die sich anschickte, über den Bach hinüber nach Ungarn zu gehen, wo die Heinzen wohnen. Ein großer Weidenbaum mit vielen buschigen Zweigen wurde im Herbstnebel alljährlich zu einem grimmigen Riesen, bis die Leute von Hartenfels eines Tages den Baum fällten. Da war nun ein Loch an der Stelle, und als Peter in den nächsten Ferien an den vormaligen Standort des Riesen ging, da fühlte er sich wieder merkwürdig beklommen, als ob ihm etwas geschehen wäre.
Selten sprach er über die Dinge, die ihn bewegten, mit seiner Mutter. Er liebte sie zwar zärtlich und hing an ihr mit ganzer Seele, aber sie war ihm wie eine andere Welt. Wenn sie die Geige nahm und die seltsam gezogenen Klagetöne der russischen Melodien in das Land hinaus strich, da war Peter ganz hingerissen und blickte seine Mutter verzückt an. Sonja (wie er sie nannte, weil sie der Vater auch so gerufen hatte) war die Tochter eines bündnerischen Schulmeisters, der während seiner Studien in Zürich eine russische Studentin kennen und lieben gelernt hatte. Die Russin — und Jüdin — kam mit Franz Molins ins Bündnerland, nach Ilanz, wo die Deutschen mit den Romanischen um den Boden ringen. Sonja wieder, die Tochter des Molins, studierte ebenfalls in Zürich und dort hatte sie den Heinrich Hartberger, Peters Vater, kennengelernt. Der war dann in der Schweiz geblieben, wo ihm Land und Leute besser gefielen als daheim, hatte sich in Fellers als Bauer niedergelassen. Er war studierter Arzt, mochte aber weder von der Wissenschaft im Allgemeinen noch von der Medizin im Besonderen etwas wissen. Er ließ sein väterliches Haus in Grafenstein durch einen benachbarten Bauern in Ordnung halten und lebte mit Sonja in Fellers. Erst als der Völkerkrieg kam, kehrte er mit seiner Frau nach der Steiermark zurück. Und dort wurde Peter geboren, während der Vater im Feld war. Peter hatte seinen Vater nie gesehen — was er von ihm wusste, war von der Mutter erzählt. Und die Mutter hatte die Gewohnheit, alles in direkter Rede zu erzählen. Sie sagte also nicht: und dann rief mich der Vater ins Haus — sondern sie erzählte es so: da rief der Vater: »Sonja, komm ins Haus« … daher glaubte Peter allmählich, er habe den Vater noch reden und rufen gehört. Und er glaubte auch genau zu wissen, wie der Vater ausgesehen habe. Der junge Peter Hartberger war trotz aller Verträumtheit immer einer der besten Schüler gewesen. Aber nichts hatte ihn so sehr angezogen wie das Studium der Geschichte. Wie kam er, der kleine Bettelstudent, dazu, sich außer dem üblichen Lehrbuch der Geschichte noch in einem Kramladen ein dickes altes Geschichtsbuch zu kaufen? Niemand verstand das; aber es war eine Tatsache. Und Peter war dafür bekannt, dass er immer noch etwas Besonderes zu erzählen wisse, was nicht einmal der Herr Professor wusste. Und doch wollte Peter keineswegs Geschichte studieren: er fühlte sich zur Technik berufen und er hatte die innere Gewissheit, dass er Großes leisten werde. Er ging oft tagelang nicht in die Schule, sondern streifte im Land umher, immer einsam und innerlich horchend. Wenn er dann wieder in die Schule kam, gab es in seiner Seele ein seltsames dissonierendes Gewirr von Traum und Wirklichkeit. Die Mitschüler nannten ihn, teils anerkennend und teils spöttisch, den „Philosophen in der Dachkammer“ — nach dem Helden eines französischen Stückes, das in der Schule gelesen werden war. Peter schwieg dazu; aber in seinem Inneren dachte er: ich bin Techniker, kein Philosoph!
Er kam sich wie ein Stück Erde vor; und weil niemand draußen, in der eigentlichen Welt, nach der er sich sehnte, von ihm etwas wusste, so nannte er sich den „Mitvergessenen“, nämlich mitsamt dem Land Vergessenen. Aber er wollte, sobald er mit den üblichen Prüfungen fertig war, hinaus aus der engen Heimat nach Berlin. Mochte auch Deutschland arm und krank sein — es war doch das große Deutschland, dem die Franzosen alles rauben konnten, nur nicht seine Geschichte! Frankreich hat die Albigenser zu Tausenden wie Vieh geschlachtet, es hat die Hugenotten meuchlings gemordet — und Deutschland hat seinen herrlichen Luther gehabt, seinen Melanchthon. Deutschland hat seinen Schiller, seinen Goethe — was haben die Franzosen Gleichwertiges gehabt? — fragte sich Peter; und er zögerte nicht, sich zu sagen nichts Gleichwertiges. Man hatte Racine in der Klasse gelesen, „Phèdre“, und er hatte Akt für Akt selbst in gebundener Sprache übersetzt — bis ihm der Lehrer mitteilte, dass diese Arbeit bereits von einem größeren Deutschen vor ihm durchgeführt worden sei … aber trotzdem oder (wie Peter sich im stillen manchmal sagte) infolgedessen erst mit Grund und Recht kam Peter zum Schluss, dass die Kulturgeschichte Deutschlands viel großartigere Leistungen zeige als diejenige Frankreichs. Freilich — wer kann so etwas mathematisch beweisen? Werden nicht die Knaben in den Schulen Frankreichs zu dem entgegengesetzten Schluss kommen? Aber sicher ist doch, obwohl Peters Geschichtslehrer dergleichen nicht vortrug, folgendes. Frankreich hat eine niederträchtig gemeine Revolution gehabt und es hat nachher Europa ein Vierteljahrhundert in Blut getaucht. Deutschlands Fürsten aber sind von ihren Thronen gegangen, als es Zeit war, und niemand hat das Bedürfnis gehabt, die Revolution durch Mord und Schändung zu feiern. Das alles fühlte Peter stark in seinem Inneren; ihm war die Geschichte der Völker nicht ein Gegenstand der Schulweisheit, sondern ein inneres Erleben. Und darum war er ganz und gar von dem Plan eingenommen, dass er sich vom Bann der vergessenen Lande loslösen müsse, um etwas Großes für das deutsche Volk zu leisten. Aber was und wie, das war ihm völlig unklar; nur das eine erkannte er: Deutschland braucht eine technische Großleistung.
Die Doktorarbeit in der Goldkammer
Der Held befindet sich in einer unglücklichen Periode seines Lebens.
Als Peter Hartberger 24 Jahre alt war, sein Ingenieurdiplom in der Tasche und das Herz zum Überschäumen voll Sehnsucht nach Berlin hatte, da beschloss er, nicht länger zu zögern. Er nahm von den vergessenen Land und von seiner lieben Mutter einen langen und schweren Abschied. Noch einmal durchwanderte er das geliebte Land, ging zu Fuß über das Wechselgebirge in die Bucklige Welt, wie die Gegend nördlich der vergessenen Land heißt, und dann fuhr er, ohne sich nur eine halbe Stunde länger als nötig in Wien aufzuhalten, nach Berlin. Ein kleiner Spargroschen, den der Vater in der Schweiz hatte stehen lassen, war unerwartet entdeckt worden und half ihm, seine Reise auszuführen. Während der langen Fahrt, die er ohne Unterbrechung durchmachte, saß er grübelnd im Abteil, ohne sich auch nur die Gegend durchs Fenster hindurch anzusehen. Er fühlte etwas wie eine Verwandlung in sich vorgehen. Er war durchaus gespalten, denn während sein Unterbewusstsein dunkle Träume abrollte, war sein bewussteres Denken auf die Fragen der nächsten Tage eingestellt. Wohin werde ich gehen? Berlin ist groß, niemand kennt mich dort. Peter hatte weder Empfehlungsbriefe noch auch nur Adressen — er fuhr aufs Geratewohl in ein unbekanntes Schicksal hinein.
Eine Stunde nach seiner Ankunft in Berlin stand er bereits vor dem Universitätsgebäude und fragte nach Professor Frelda. Diesen Namen kannte er aus einem Buch, das der Professor geschrieben hatte. Peter hatte das Buch allerdings nicht gelesen — aber Frelda war ein Physiker und Peter hatte die Meinung, mit einem solchen Mann müsste sich reden lassen.
»Ich möchte«, so sagte er ohne jede Einleitung zu dem Professor, »die Richtigkeit der newtonschen Gravitationsformel nachprüfen. Ich kann nicht glauben, dass die Temperatur der Körper ohne Einfluss sein sollte auf die Größe der Anziehung. Auch kann ich es nicht begreifen, dass wirklich alle Körper gleich schnell fallen.« —
»Dass alle Körper gleich schnell fallen, lehrt doch das Fallgesetz des Galilei; und dass die Anziehung der Massen mit der Temperatur nichts zu schaffen hat, zeigt sich ja darin, dass in der newtonschen Formel für die Gravitation die Temperatur gar nicht vorkommt; wie sollte sie also den Vorgang beeinflussen?«, fragte mit starker Ironie der Professor.
Peters irdische Gefühle empörten sich. Wie — hatte er nicht wieder auf der Reise die Verschiedenheit der Stoffe gespürt? »Und wozu«, fragte der Professor, »wollen Sie denn dies alles untersuchen?«
»Ich will«, sagte Peter, der auf diese Frage gefasst war, »eine Doktorarbeit machen.« Dies beruhigte Frelda einigermaßen. Denn es war ihm beiläufig der Gedanke gekommen, der Mann vor ihm könnte etwa nicht ganz normal sein. Dass aber ein Mann, der die Würde eines Doktors erstrebt, abnormal wäre, hielt Frelda für ausgeschlossen. Etwas wohlwollender betrachtete er den steirischen Jüngling, der mit seinen 24 Jahren schon einen Vollbart trug, dessen rotblonde Töne sich allerdings im Zimmer des Berliner Professors seltsam genug ausnahmen. Peter berichtete, etwas umständlich und breitspurig, was er sich in einsamen Stunden ausgedacht. Er vermied dabei sorgfältig alles, was dem trockenen Professor zu ungewöhnlich klingen konnte.
Dennoch, je länger Peter sprach, desto mehr bekam der Professor das Gefühl, dass er einem überspannten Menschen gegenüberstehe.
»Ich bin überzeugt«, sagte Peter, »dass in der Materie Leben und Individualität steckt!« Der Professor trommelte nervös mit Zeigefinger und Mittelfinger auf seiner Hosennaht. »Unsere Versuche, sogenannte Naturgesetze aufzustellen, sind ja in Wahrheit nur vorläufige und ungefähre Feststellungen. Man könnte doch eigentlich mit Recht sagen, wir kennen die Natur zu wenig, als dass wir imstande wären, Naturgesetze aufzustellen. Was wissen wir beispielsweise vom Erdkern?«
»Und ferner«, fuhr Peter unbeirrt fort, »wer bürgt, dass nicht durch Auffindung einer einzigen neuen Tatsache das ganze bestehende Weltbild über den Haufen geworfen wird? Ich meinesteils halte es beispielsweise für möglich, dass die Gravitation zwischen zwei Körpern bei genügend hoher Temperatur umschlägt und zu einer Abstoßung wird.«
»Gravitation soll Abstoßung werden?« entgegnete Frelda mit einem überlegenen Lächeln … »da müsste doch in der Newtonschen Formel zumindest eine Quadratwurzel vorkommen …«
»Müssen wir nicht«, wendete da Peter ein, indem er sich einer großen Überlegenheit innerlich bewusst war, »von den Formeln ganz abgesehen, wenn wir den Naturwahrheiten auf die Spur kommen wollen? — Müssen wir nicht der freien schöpferischen Fantasie Spielraum gewähren und die starre Gebundenheit des mathematischen Gewandes beiseite lassen? Sind nicht die philosophischen Überlegungen wichtiger und weiterführend als mathematische Ausdrücke?«
»Ich verstehe nicht«, erwiderte Frelda scharf, »was Sie mit Philosophie in der Physik wollen. Die Physik hat sich von der Philosophie gar nichts sagen zu lassen. — Aber, um zur Sache zu kommen: ich bin bereit, Ihnen ein Thema aus diesem Gebiet zu geben. Messen Sie die Gravitation verschiedener Stoffe. Meinetwegen Gold und Lithium, als die beiden im Atomgewicht am weitesten auseinanderstehenden Körper, die wir einigermaßen in größeren Mengen besitzen. Das gibt also drei Versuchsreihen: Gold mit Gold, Lithium mit Lithium und schließlich Gold mit Lithium. Später variieren wir die Temperatur. Schließlich wäre es ja nicht die erste Doktorarbeit, deren Resultat lautet: aufgrund meiner Untersuchungen teile ich mit, dass ich nichts gefunden habe!«
Peter begann den Mann, der so lieblos von der Materie sprach, zu hassen. Aber er nahm den Vorschlag an. Wenige Tage darauf sollte begonnen werden. Der Professor ließ alle Apparate in eine Kammer der Reichsbank bringen und erwirkte vom Direktorium die Erlaubnis zur Durchführung der Untersuchungen. Allerdings müsste sich Peter beim Eintritt und Austritt eine körperliche Untersuchung gefallen lassen und überdies würde er ständig durch ein Guckloch von einem Beamten beobachtet. Von dieser zweiten Bedingung sagte man weder dem jungen Ingenieur noch dem Professor etwas.
Inzwischen hatte Peter ein Zimmer bei einfachen Leuten in der Elsässerstraße gefunden. Er studierte die Straßen und die Restaurants, die Gesichter der Menschen und versuchte eine persönliche Stellung zu der Tatsache Berlin zu gewinnen. Berlin enttäuschte ihn nicht — nur Frelda hatte ihn schwer enttäuscht. Aber was ging ihn schließlich der Mann an? Peter Hartberger sagte sich: von hier aus musst du eben den Weg suchen, der zur Großtat führt. Eine Untersuchung über Gravitation kann man gewiss auch in Graz machen. Aber der Weg in die große Welt musste von hier aus versucht werden. Darum die Doktorarbeit in Berlin. Irgendwie musste dann aus dieser wissenschaftlichen Untersuchung die Möglichkeit einer technischen Anwendung fließen, die eben nur von Berlin aus gemacht werden konnte. — Dazwischen kamen schwache Erinnerungen an die vergessenen Lande und stärkere an Sonja. Was würde sie jetzt machen?
Am festgesetzten Tag begab sich Peter in die Reichsbank und fragte nach Professor Frelda. Er fühlte eine unerklärliche Ruhelosigkeit in sich. Frelda war schon unten, wohin ihn der Diener führte. Peter sah den Professor wie in einem Nebel und dagegen sein väterliches Haus in Grafenstein wie hineingezaubert in diesen Raum, wo zwischen zwei großen Goldbarren die Apparate aufgestellt waren. »Sie können also beginnen«, sagte Frelda zu dem jungen Ingenieur. »Sie haben ein Tagebuch zu führen und mir wöchentlich einmal Bericht zu erstatten über die Fortschritte der Arbeit. Ich selbst werde gelegentlich kommen, um nach Ihnen zu sehen …«
Peter stand stumm vor Frelda und erwiderte kein Wort. Dieser ging kopfschüttelnd hinaus. Einen Augenblick lang erschien sein Röntgenbild im dunklen Vorraum — das war die Kontrolle, um etwa mitgenommene Metallmassen zu entdecken. »Sehen Sie sich gelegentlich einmal nach dem Mann um«, sagte Frelda zum Hausbeamten, »ich habe den Eindruck, als ob der Doktorand beim Anblick der Goldbarren ein wenig den Verstand verloren hätte.«
Peter aber stand immer noch am gleichen Fleck, den Blick starr auf den Boden geheftet. Er sah aber nicht den Boden der Goldkammer, sondern er sah ganz deutlich den Keller daheim, den er stets nur sehr ungern betreten hatte, weil er sich nicht wohl fühlte darin. Peter hatte immer behauptet, dass die Luft im Keller drückend sei. Aber hier — was war mit ihm? Peter bedeckte die Augen mit den Händen und versuchte aus dem Raum herauszukommen. Aber er konnte keinen Schritt machen, er war wie gebannt, das Bewusstsein verließ ihn, er klammerte sich an den vor ihm liegenden Goldbarren an. So stand er, über den Barren gebeugt, das Gold mit beiden Händen umfassend, untätig und in Trance.
Der Beamte am Guckloch war sich bald genug klar über dieses Gebaren. Was für ein einfältiger Tropf musste doch dieser Mensch sein, wenn er den Berlinern zutraute, sie würden auf einen so plumpen Trick hereinfallen! Nein — so dumm waren die Leute in Berlin denn doch nicht. Peter wurde plötzlich von hinten gepackt und von vier kräftigen Händen aus der Kammer geleitet. Vor der Reichsbank stand schon ein Auto und mit diesem ging es geradeswegs aufs Polizeipräsidium.
Peter fühlte sich sofort wohler, als der Druck der Kammer von ihm gewichen war. Einigermaßen verwundert betrachtete er die Begleitung im Auto und fragte, sich die Augen reibend: »Was ist geschehen?« Aber man antwortete ihm nicht. Im Vorzimmer des Polizeipräsidenten fand er Professor Frelda, der seinerseits Peter ebenso erstaunt betrachtete wie dieser ihn. Schon aber wurden beide ins Zimmer des Präsidenten gerufen. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe Peter begriff, dass man ihn des versuchten Betrugs und Raubes beschuldigte. Frelda aber seinerseits konnte auch nicht glauben, dass dieser blonde Hüne ein Dieb und Hochstapler sei. »Peter Hartberger«, sagte Frelda zum Präsidenten, »hat mir seine sämtlichen Schulzeugnisse gezeigt, ich habe sein Ingenieurdiplom noch in meinem Schreibtisch. Der junge Mann ist vielleicht nicht ganz geistig normal — aber ein Verbrecher ist er nicht.« —
Der Polizeipräsident ließ sich so leicht nicht fangen; vielleicht waren die beiden im Einverständnis? — Er erklärte, Peter vorläufig in Schutzhaft nehmen zu müssen. Binnen einer halben Stunde wollte er mit der Polizei in Graz die Frage geklärt haben. Vielleicht Würde Professor Frelda die Liebenswürdigkeit haben, so lange hier zu warten?
Draußen im Vorraum fragte Frelda: »Haben Sie eine Beobachtungsreihe schon begonnen?«
»Nein«, sagte Peter, »ich wurde ja gleich gepackt und herausgeführt!«
»Das kann nicht stimmen«, bemerkte Frelda; »Sie sind ja doch gegen 9 Uhr in die Goldkammer gegangen, nach den Mitteilungen des Präsidenten sind Sie aber erst um 11 Uhr herausgeholt worden, nachdem man Ihr eigentümliches Verhalten durch ein Guckloch einwandfrei festgestellt, sogar fotografisch aufgenommen hatte.« —
Peter konnte dafür keine Erklärung geben. Frelda schwieg und sagte sich, dass es sich doch wohl um einen Geisteskranken handeln müsse. Es tat ihm die verlorene Zeit leid.
Nun kam der Präsident selbst ins Vorzimmer und sagte zu den Herren: »Die Auskunft aus Graz lautet günstig, man kennt dort Peter Hartberger. Es liegt für mich kein Anlass vor, die Untersuchung weiter zu führen. Herr Hartberger ist also entlassen. Ich muss aber hinzufügen, dass sich die Reichsbank weigert, Herrn Hartberger wieder zu wissenschaftlichen Untersuchungen in die Goldkammern zu lassen.« — Damit verschwand er.
»Und ich meinerseits muss erklären«, sagte Frelda zu Peter, »dass ich keine Lust habe, mich weiter mit Ihren sonderbaren Schwärmereien abzugeben.« Damit ging der Professor hinaus. Peter stand eine Weile stumm im Zimmer.
»Sie können gehen«, sagte der Beamte hinter ihm; »seien Sie froh, dass die Sache so glimpflich abgelaufen ist.«
Als Peter wieder auf der Straße war, hatte er das Gefühl, dass nun alles zusammengebrochen sei. So unklar seine Zukunftspläne auch gewesen waren — er hatte sie als etwas Bestimmtes und Sicheres betrachtet. Nun war, so schien es ihm, alles eingestürzt. Er konnte sich vor allem nicht erklären, was mit ihm vorgegangen war, nachdem er die Kammer betreten hatte. Offenbar war ihm unwohl geworden, er hatte ein Schwindelgefühl gehabt. Das war bei Peter nicht selten. Und dennoch — irgendetwas Unerklärliches war hier mit im Spiel.
Peter ging nach Hause in sein Zimmer in die Elsässerstraße. Eines war ihm klar: dass er im Augenblick gar nicht wusste, was er tun sollte. Nicht einen Moment dachte er an die Rückkehr. Er dachte überhaupt nie an die vergessenen Land — nur in der Kammer der Reichsbank war die Heimat wie eine Vision erschienen. — Daheim in seinem Stübchen fand er einen Brief von Sonja. Darin lag eine 100 Dollar Note und eine Anweisung auf einen Platz auf der Pax der deutsch-amerikanischen Sternenlinie. Dazu schrieb die Mutter: ihr Onkel Heinrich aus Boston, der Bruder ihres Vaters Franz Molins, der einst nach Amerika ausgewandert war, hätte ihr eine Einladung geschickt, zu ihm nach Boston zu kommen. Von Peters Existenz wusste er nichts. Nun meinte Sonja, sie fände es richtiger, wenn Peter hinüberginge. Sei es dort passend, so könnte sie immer noch nachkommen. Sonja war nie von dem Berliner Plan entzückt gewesen.
Irgendetwas sträubte sich in Peter, der Einladung nachzukommen. Sollte er Berlin den Rücken kehren, ohne etwas geleistet zu haben? Peter nahm Hut und Stock, ging auf die Straße und bestieg die nächste Elektrische. Mit dem Rücken in die Fahrtrichtung, den Blick auf die entschwindenden Schienen und die sich perspektivisch verkleinernde Straße stand der Ingenieur grübelnd auf der hinteren Plattform der neuen Straßenblitzbahn. Peter war ratlos. Dennoch war er nicht unglücklich. Er war von seiner Mission überzeugt. Allerdings schien der Weg, den er versucht hatte, nun abgeschnitten. Konnte er nicht auf diesem Weg, der seiner inneren Stimme entsprach, seine Sendung erfüllen, so musste ein Anstoß von außen kommen. Peter wies diesen Gedanken zurück: das wäre Fatalismus. Und doch geschieht, was kommen muss. Hier flutet das Leben von Tausenden, die in Hast und Eile aneinander vorbeilaufen. Würde er das Schicksal dieser Menschen einst mitgestalten? Ein großes blaues Auto kam von rückwärts her mit unheimlicher Geschwindigkeit; Peter erkannte es, es war ein Entente-Auto. Die Straßenbahn verlangsamte ihr Tempo, es kam eine Haltestelle. Ein Mädchen, das unmittelbar neben ihm stand, das er aber bis jetzt nicht beachtet hatte, wollte eben abspringen. Wie ein Blitz schoss es Peter durch den Kopf: das Auto kommt in der nächsten Stunde hier vorbei! Mit beiden Händen ergriff er das junge Mädchen und zog sie energisch auf die Plattform zurück. Im nächsten Augenblick sauste das blaue Riesenauto vorbei.
Vielseitiges Geschrei ertönte. Alle waren über das Auto empört, es hatte in der Tat einen jungen Mann, der vom vorderen Wagen absprang, überfahren und auf der Stelle getötet. Die Menge nahm eine drohende Haltung an; das Auto war durch Funkenschuss eines Polizisten angehalten werden, sonst wäre es längst verschwunden gewesen. Mit Mühe konnte der darin sitzende französische General vor dem Zorn der Menge gerettet werden.
Einen Augenblick lang hatte Peter in das Gesicht des jungen Mädchens geblickt und sie hatte ihn mit erschreckten Augen angesehen. Im nächsten Moment waren sie voneinander getrennt worden.
Ria Wimpffen und Vera Garwin
Der Stern des Helden geht auf
Seit zwei Jahren studierte Ria Wimpffen in Berlin Musik. Nicht nur, weil Deutschland das klassische Land der Tonkunst ist, sondern auch weil sie sich als amerikanische Deutsche schon immer einen Aufenthalt in der Heimat ihres Großvaters gewünscht hatte. Deutschland war wieder geworden, was es jahrhundertelang gewesen war: das Land der Dichter und Denker, die Heimat großer Künstler. So war es natürlich, dass alle Völker der Erde mit Liebe und Verehrung auf Deutschland blickten, das von einem grausamen und herrschsüchtigen Nachbar gequält wurde. Nicht nur die stammverwandten Völker, auch die rassefremden näherten sich dem deutschen Kulturkreis. Ganz besonders schloss sich jenes Zweite Deutschland an das verarmte Mutterland an, das aus den Deutschen in Amerika bestand.
Ria war die einzige Tochter von Martin Wimpffen, der als Sportsmann wie als Bankier in New York angesehen war. Im Weltkrieg hatte er den Militärdienst gegen die Heimat seines Vaters verweigert und man hatte ihn dafür ins Gefängnis geworfen. Im Laufe der Jahre verschwand der Hass gegen Deutschland. Nicht wenige Amerikaner kamen zur Überzeugung, dass der Zustand der Welt nach dem großen Ringen nicht besser war als vorher und dass sich der Tod von 60000 tapferen Amerikanern nicht gelohnt habe. Man fing auch an, Geschichte zu studieren. Es vollzog sich ein derartiger Umschwung in der öffentlichen Meinung dieses großen Landes, dass Amerika in der ganzen Welt fast als Schutzmacht des deutschen Volkes galt. Freilich waren die Anhänger Frankreichs immer noch mächtig und kämpften einen erbitterten Zeitungskrieg gegen Deutschland. Seit die Zollschranken gegen Kanada und Mexiko gefallen waren, war der nordamerikanische Kontinent die größte Macht der Erde geworden. Und in diesem gewaltigen Staate setzte sich der längst verklungene Weltkrieg als Kulturfehde zwischen dem deutschen und dem französischen Wesen fort. Krieg und Frieden hatten erwiesen, dass die Menschheit noch manchen Schritt vorwärts zu gehen habe, ehe sie dahin gelangt, ein friedlicher Bund der Völker zu werden.
Martin Wimpffen war der Vorstand der „Deutsch-Amerikanischen Sternenliga“, eines kulturellen Bundes zur geistigen Verbindung Deutschlands und Amerikas. Die Liga gab eine eigene Zeitung heraus, sie unterhielt eine Luftflotte für den Reisendenverkehr über den Ozean und hatte auch zwei eigene große Dampfer im Dienst. Die Ziele der Liga waren rein humanitäre und kulturelle. Insbesondere die technischen Probleme waren es, die ein wichtiger Gegenstand der Obsorge der Sternenliga wurden. Ein besonderes Laboratorium in Washington diente dazu, neue Erfindungen zu prüfen und sie, falls sie sich als aussiehtsreich erwiesen hatten, praktisch zu verwerten. »Alle Menschen glücklich zu machen«, erklärte Martin Wimpffen, »ist ebenso sehr ein technisches wie ein ethisches Problem.«
Die amerikanische Kolonie war, neben der russischen, in Berlin die stärkste. Ria spielte in der amerikanischen Kolonie nicht nur deswegen eine Rolle, weil sie die Tochter ihres Vaters war, sondern auch, weil sie die erfolgreichste Komponistin wurde. Ria war eine eifrige Anhängerin des Völkerbundes, und die von ihr komponierte Völkerbundshymne wurde bereits auf der ganzen Erde gespielt. Aber ihre größten Erfolge erreichte sie im Violinspiel. Wenn sie ihre Geige ertönen ließ, lauschte der ganze Erdball. Die Sternenliga gab einmal wöchentlich ein Ria-Wimpffen-Konzert, das eine halbe Stunde dauerte. Wer die neuen Interferenzapparate der Liga daheim hatte, konnte die Töne aus Berlin in seinem Zimmer in vollkommener Klarheit vernehmen. Ria spielte im großen Brucknersaal, der 15000 Personen fasste und in dem zahlreiche Aufnehmer die Töne sammelten. Mit drei Wellenlängen lief das Konzert über den Planeten und nur die automatische Dechiffrierung der Ligahörer setzte die drei Teile richtig zusammen.
Ria war die lebendige Bejahung der Frage, ob deutsches Blut und amerikanisches Wesen eine glückliche Kombination ergebe. Ihre ungewöhnliche Schönheit wurde in Berlin ebenso berühmt wie ihr musikalisches Talent. Die seltene Harmonie, in der sich ihre ganze Jugendzeit abspielte, die Hingabe an die höchsten Aufgaben der Menschheit und der Einfluss der väterlichen Weltanschauung hatten Ria Wimpffen zu einem auch für New Yorker Begriffe ungewöhnlichen Wesen gemacht. Inmitten der allgemeinen Abkehr von den Gedanken an internationale Verbrüderung erregte ihr lebhaftes Eintreten für die Ideale des Völkerbundes großes Aufsehen. Ria war von dem Gedanken durchdrungen, dass das deutsche Volk dazu berufen sei, jene Mission wirklich auszuführen, die den Russen nicht geglückt war: die Vereinigung aller Völker unter dem Banner gemeinsamer Ideale. Und Ria versteifte sich darauf, dass diese weltgeschichtliche Mission vermittelst des Völkerbundes erfüllt werden sollte. Aber der Völkerbund genoss kein sehr großes Ansehen und Rias Vater hielt nicht viel von der Möglichkeit einer künftigen Änderung dieser Sachlage.
Martin Wimpffen hätte seinem geliebten Kinde gerne eine fürstliche Wohnung in Berlin gegeben; aber Ria wollte keinerlei Luxus, sie lebte in einer einfachen Zweizimmerwohnung im Berliner Liga-Hotel. Ein Auto lehnte sie ab, dagegen war sie eine gewandte Fliegerin. Der Segelflug war der einzige Sport, den sie trieb. Darüber war freilich ihr Vater wenig erbaut. Das Kleinflugzeug war noch zu wenig sicher. Auch für die Überfahrten über den Ozean, wenn Ria in den Ferien nach Hause kam, empfahl Martin seiner Tochter stets, die Dampfer statt der Zeppeline zu nehmen.
Im Grunde hatte Ria nur einen gewichtigen Kreis persönlicher Interessen: das war die Kunst. Neben der Musik gab es für sie vor allem noch den Tanz, der ihr als die Vollendung aller Kunst erschien. Sie war sich darüber klar, dass Tanz und Musik eine weit höhere Stellung im menschlichen Seelenleben einnehmen als jede andere Kunst. Malerei und Poesie erschienen ihr nur als willige Dienerinnen für bestimmte Einzelaufgaben, Tanz und Musik aber als allumfassend. Kurze Zeit nach ihrem Eintreffen in Europa hatte Ria eine Rundreise durch die deutschen Tanzschulen gemacht. Dabei hatte sie in einer berühmten Schule eine russische Jüdin entdeckt, die Tochter eines in Berlin lebenden Emigranten, Vera Garwin. Diese war in Berlin geboren und aufgewachsen. Der Vater war ein eifriger Sozialist, Führer der russischen Emigranten; für ihn war alles eine Frage von Organisation und Taktik. Vera aber hatte keinerlei Beziehungen zur Politik — sie war von den ersten Tagen an, da sie zu geistiger Regsamkeit erwachte, zum Dichten und Tanzen geneigt.
Ria Wimpffen hatte mit scharfem Blick in einer übenden Gruppe der Meisterin Mary Lohmann die junge Vera Garwin entdeckt. Ria sah sofort ein überragendes Tanztalent, das noch nicht erkannt war. Und wer weiß, ob es jemals entdeckt würde? Ob nicht die Tingeltangelkunst des abendlichen Berlin dieses ungeheure Talent verzehren würde? Ria nahm ohne viel Umschweife Vera zu sich nach Berlin. Beide wohnten zusammen. Vera, die aus bescheidenen Verhältnissen und aus einem Leben voll wirtschaftlicher Schwierigkeiten in ein sorgenfreies Dasein gestellt wurde, entwickelte sich in kurzer Zeit zu ungeahnter Größe. Als sie zum ersten Mal in Berlin öffentlich auftrat, kam auch Mary Lohmann, sie zu sehen. Die Meisterin war über alle Maßen erstaunt, ein solches Talent in ihrer Schule übersehen zu haben. Freilich — dass der Brucknersaal in Berlin bis auf den letzten Platz voll war, dies war nur der großen Beliebtheit Rias bei den Berlinern zuzuschreiben. Aber der überwältigende Erfolg, den Vera gleich beim ersten Auftreten errang, war ganz das Verdienst der unvergleichlichen Kunst der Garwin. Die Kompositionen Rias, ihre Begleitung zu Veras Tanz waren wohl Meisterwerke, aber sie ordneten sich dem königlichen Tanz Veras unter.
Die Kunst soll keinen Zweck haben; dennoch: Ria und Vera waren darin einig: wenn etwas imstande wäre, die Menschen einander näher zu bringen, so war es die Kunst. Freilich wurde immer gesagt, die Wissenschaft sei international und sie nähere die Völker. Aber, so sagte Ria, diese Annäherung ist eine kalte und förmliche, eine ganz äußerliche, wie etwa Menschen dadurch einander nahekommen, dass sie in der Eisenbahn nebeneinander sitzen. Nicht anders. Die Kunst aber und vor allem die menschlich ausdrucksvollste Tanzkunst, ist imstande, die Menschen und die Völker zu einer weitergehenden, zu einer innerlichen Annäherung zu bringen.
Vera Garwin, ganz im deutschen Kulturkreis aufgewachsen, war ein junges brausendes Talent. In ihrer Seele lagen gewaltige dämonische Kräfte. Sie war sich ihrer Macht bewusst und wollte sie benützen, um die Menschen zu zwingen, sich dem Schönen und Guten zu widmen. »Die Wahrheit«, so sagte sie spöttisch, »ist seit Jahrtausenden Gegenstand des Streites zwischen den Völkern gewesen. Nur das Gute und Schöne kann Brücke werden, Getrenntes zu verbinden.«
Veras Gedanken über die Macht der Tanzkunst waren von hinreißender Größe. Dieses 18jährige Mädchen hatte etwas intuitiv erkannt, was zu jener Zeit noch eine unentdeckte Wahrheit war: dass der Tanz schlechthin Erlösung bedeutet. Darin sprach sich das persönliche Erlebnis Veras aus. In ihr kämpfte eine ererbte melancholische Anlage, von der Mutter her, mit dem ungestümen Lebenswillen ihres eigenen Ich. Denn jeder Mensch ist ein vielfach Gespaltener, sagte sie. Einmal ist er, was der Vater war und was die Mutter war, nebst alledem was die andern Ahnen waren und gaben. Aber schließlich und endlich ist er auch ein Eigener. Alle diese vielfachen Seelen ringen in der einen Seele des nun Lebenden miteinander und glücklich derjenige, der die eigene Seele aus dem Bann der Ahnen freimacht. Und diese Befreiung ist das Werk der Musik und, noch vollkommener, das Werk des Tanzes. Wer nicht auf diesem oder jenem Weg oder auf einem ähnlichen gleichwertigen frei und erwachend wird, bleibt als Persönlichkeit stets schlafend, er wird nicht erlöst.
Die blonde Ria hörte solchen Theorien Veras mit Staunen und Freude zu. Seit jenem ersten öffentlichen Auftreten Veras im Brucknersaal hatte sie nachklingende Erinnerungen und Visionen. Veras Anschauungen hatten doch wirklich etwas Großes. Die Macht des künstlerischen Tanzes auf die Menschen ist grenzenlos. Liegt nicht in der Seele der Völker eine tiefe Traurigkeit — vielleicht die Erinnerung an einen Jahrtausend langen Kampf mit den Gewalten der Natur in der Epoche der Eiszeiten? Klagen nicht alle Volkslieder bei den Deutschen und bei den Slawen das Leid vergangener Geschlechter? Liegt in dieser volkstümlichen Klage nicht die Sehnsucht nach der Erlösung begründet? Vera vertrat den indischen Standpunkt: die Seele ist der Atem des Leibes. Und sie leitete den uralten Gedanken in moderne Bahnen. Jene Formen von Linien und Bewegungen, die den innersten unbewussten Anlagen entsprechen, sind es, die imstande sind, die inneren Spannungen zu lösen. Diese Lösung — ist eben die Erlösung, die das dunkle Mittelalter in ein fernes Jenseits verlegt hatte. Jenes grausame Mittelalter, das den Leib als ein zu verachtendes Gefäß der Seele behandelt hatte, und dabei Körper und Geist von Millionen Menschen geschändet hat. Wie aus einem bösen Traum ist die europäische Menschheit langsam aus dem Banne mittelalterlicher Anschauungen erwacht. Noch ist die Erlösung nicht vollendet. Die Vollendung kommt durch den Tanz.
Der Tanz ist in erster Linie Erlösung für den Tänzer. Wenn er auftritt, so ist er ein bereits Erlöster, der vor Unerlösten tanzt. Und er muss den Unerlösten durch den künstlerischen Genuss die Befreiung bringen.
Das war die Theorie der Jüdin Garwin. Es war eine andere Art Intelligenz als die der germanischen Ria. Müssen die Menschen nicht froh sein, vielerlei Arten von Intelligenz unter sich zu haben?
Aber wer kann sich der Erlösung freuen? Während in Vera nur der künstlerische Stolz und die ungebändigte Freude am Schönen dazu drängte, auf Massen zu wirken, war Ria bedacht, diese Wirkung einem großen humanitären Zwecke unterzuordnen. Wer willig ist, kann erlöst werden! Die vollkommenste Erfindung auf dem Gebiete der elektrischen Fernschau, der von der Sternenliga erworbene Fernfilm des Amerikaners Albany, ermöglichte seit wenigen Monaten eine so vollkommene Wiedergabe einer Vorführung auf beliebig weite Strecken, wie sie nicht für möglich gehalten worden war. Ohne alle störenden Nebenlichtwirkungen erscheint in dem offenen Raum der Fernbühne das plastische Bild der Tänzerin in den natürlichen Farben, die sie für ihr Kostüm gewählt hat Niemand kann diese Erscheinung von der Wirklichkeit unterscheiden. Der Apparat war noch nicht in der Öffentlichkeit, die Liga war eben daran, in allen größeren Orten der Staaten geeignete Lokale einzurichten. Dann sollten an ein und demselben Tag in allen Theatern die Vorführungen beginnen. Seit jenem großen Erfolg Veras war Ria entschlossen, Vera Garwin einladen zu lassen, in der Union zur Eröffnung des Fernfilms zu tanzen. Noch hatte sie Vera nichts davon gesagt. Sie wollte zuerst alles mit dem Vater regeln.
Ria kam eben von einer Besprechung mit ihrem Vater aus der Fernzelle des Funkamtes zurück, als sie das sonderbare Erlebnis auf der Schnellbahn hatte. Sie sah den jungen Mann, der sie so kräftig gepackt hatte, einen Augenblick vor sich, dann wurden sie durch den Tumult getrennt. Ria stand noch einige Minuten auf demselben Fleck, in Erwartung, dass der blonde Vollbärtige sich wieder zeigen würde. Aber Peter Hartberger kam nicht. Doch musste Ria immer denken: wo habe ich den schon gesehen?
Das gleiche dachte aber auch Peter. Obschon seine ärmliche Jugend und Kindheit, das Traumhafte seines bisherigen Lebens ihn in eine völlig andere Gedankenwelt stellten als wir sie eben geschildert, so lagen doch in seinem Inneren alle Kräfte bereit, eine neue Offenbarung zu begreifen. Er ging zwar achtlos vorüber an allen großen Tanzvorführungen, mit denen in diesen Tagen die Berliner beglückt wurden. Er sagte sich: hier ist eine andere Welt; du arbeitest in deiner und jene in ihrer Welt. Dass er selber auch der Erlösung bedurfte — daran dachte er nicht. Er hatte nur die Aufgabe des Einzelnen in Hinsicht auf das Wohl des Volkes im Sinn. Und hier sah er seinen Weg nur dunkel: die technische Befreiung Deutschlands.
Das Abenteuer in der Schnellbahn ließ Peter kalt. Aber dieses Mädchengesicht, dem er einen Moment in die Augen geblickt hatte — wo war ihm dieses blonde Mädchen schon begegnet? Während er seine wenigen Habseligkeiten in Ordnung brachte, mechanisch, wie einer fremden Gewalt folgend, forschte er in seinen Erinnerungen. Er hatte bis jetzt sehr wenig mit jungen Mädchen zu tun gehabt. Da war die blonde filia hospitalis vom Grieskai, die er platonisch verehrte. Da war eine schwarzäugige Slowenin, die in der Dachkammer neben ihm gewohnt hatte. Aber dieses kühne Gesicht mit den stahlblauen Augen — lange vorher musste er es schon gesehen haben, denn wie ein Traum aus der Kindheit sahen ihn diese Augen an. Wo hatte er sie schon getroffen? —
Peter hielt im Packen inne. Er schüttelte sich. Die blonden Gedanken wollten ihn nicht verlassen. Er beschloss, etwas zu tun, was er seit der Abreise aus den vergessenen Landen nicht getan hatte: spazieren zu gehen. Er nahm sein steirisches Lodenhütchen mit der Auerhahnfeder — er hatte allerdings bemerkt, dass es nicht recht nach Berlin passte. Aber er wollte mit seinen geringen Mitteln aushalten. Die Leute blickten ihm zwar spöttisch nach, da er nun im Tiergarten in Joppe und Lodenhut herumschleuderte — aber mochten sie es immerhin. Er setzte sich auf eine Bank. Morgen wollte er seine Fahrkarte holen. Er ergab sich. Vielleicht war Boston nur ein Zwischenkapitel — nach Deutschland musste er doch wieder zurück.
Martin Wimpffen hatte inzwischen seinen Sekretär, Ernest Blossom, im Zeppelin nach Berlin geschickt, Ria zur Rückkehr zu mahnen. Er hatte ihr einen Platz auf der Pax, dem Gigantenschiff der Sternenliga, gemietet. Blossom sollte Ria nach Hause bringen. Von Vera wusste Wimpffen noch nichts. Ria hatte diesen Punkt einer mündlichen Besprechung vorbehalten, ohne Fernkabine. Ria hatte Blossom nie leiden mögen. Dieser Vollblutamerikaner war der Typ eines Strebers. Es war ihr unbegreiflich, dass der Vater diesen Menschen nicht durchschaute.
Blossom war zum ersten Mal in Berlin. Er wollte die Götzen des alten Deutschland sehen und bat um einen Gang durch die Siegesallee. Ria wollte den Sekretär ihres Vaters abweisen. Allein Vera Garwin, die an dem glatt rasierten Amerikaner ein eigentümliches Gefallen fand, wollte ihm Berlin zeigen. So gingen sie denn zu dritt durch die Straßen des herbstlichen Berlin.
Blossom fühlte die heimliche Abneigung Rias gegen sich. Heute stärker als vor zwei Jahren, da er zum ersten Mal Versuche gemacht hatte, ihr näher zu kommen. Trotzdem war er jetzt mehr als je entschlossen, Ria in seine Gewalt zu bekommen. Blossom war nicht der Mann, der vor irgendeiner Schwierigkeit zurückgeschreckt wäre. Er wollte nicht nur Ria, sondern auch das Geld und den Einfluss des Vaters. Dies letztere um so mehr, als er diese Macht und diesen Einfluss zur Stärkung seiner eigenen amerikanisch-nationalistischen Pläne, die in der Richtung frankophiler Kultur gingen, benützen wollte. So war sein Plan: die angesehene und in der Sternenliga vorhandene deutsche Kulturmacht in Amerika in seine Hand zu bekommen, nicht um sie zu vernichten, sondern, mehr noch: um sie in den Dienst der Feinde des deutschen Volkes zu lotsen. Blossom führte die ganze Privatkorrespondenz von Martin Wimpffen und auch ein Teil der Liga-Akten ging durch seine Hände.
Welcher Zufall führte diese drei Menschen an jener Bank vorbei, auf der Peter Hartberger saß? Mit einem Blick erkannten sich Ria und der vollbärtige Steirer. Einen Augenblick lang zögerte Ria — sie wollte zu dem jungen Mann eilen, ihm für seine gestrige geistesgegenwärtige Tat danken. Was hielt sie zurück? Blossom war aufmerksam geworden. Er sah von Ria auf den jungen Mann hin, der ihm in seiner alpenländischen Bekleidung wie ein Bär vorkam. Aber schon war Ria entschlossen — sie ging ruhig weiter, ohne von der stummen Frage Blossoms Notiz zu nehmen. Sie fühlte in ihrem Innern, dass sie den Unbekannten in Gefahr brächte, wenn sie vor Blossom mit ihm sprechen würde. Es war eine Schwäche — sagte sie sich nachher. Was sollte Blossom, der sie ja gar nichts anging, mit dem sie nichts zu schaffen hatte, den sie bisher kaum beachtet, sicherlich aber nicht gefürchtet hatte — was sollte er gegen diesen blonden Hühnen einzuwenden haben? — Indes, eine innere Stimme trieb sie fort. Aber bei all diesen blitzschnell und halb unterbewusst verlaufenden Überlegungen blieb schließlich, als sie zwischen Vera und Blossom wieder langsam weiter schritt, der eine Gedanke klar an der Oberfläche: wo habe ich diese Augen, die ich gestern und heute sah, vor langer Zeit schon einmal irgendwo gesehen?
Peter war auf der Bank sitzen geblieben. Er sah den dreien sinnend nach. Wie gehörten diese drei zusammen? Niemand von ihnen blickte sich nach Peter um. Hatte das blonde Mädchen ihn nicht wiedererkannt? Wollte sie ihn nicht erkennen? Das war unmöglich, denn er hatte deutlich einen Blick frohen Erkennens gefühlt. Einige Worte hätte er denn doch verdient. Peter war sich darüber klar, dass er dem Mädchen, wenn nicht das Leben, so doch mindestens die gesunden Glieder gerettet habe. Er fühlte stets mechanisch mögliche Gefahren voraus und war, Obschon scheinbar langsam im Handeln, doch im Moment der Gefahr äußerst rasch. Er war ein geübter Turner und Ringer, ein geschickter Kletterer. Er hatte in jenem Augenblick erkannt, dass die Bewegung des jungen Mädchens und des heranbrausenden Autos zu einem Unglück führen müssten — und er hatte blitzschnell gehandelt. Warum sagte die Fremde nicht wenigstens »Ich danke Ihnen.« Heute nicht und gestern nicht! — Peter schüttelte unwillig den Kopf. Er wollte fort. Peter war Fatalist. Wenn es ihm beschieden war — nun, dann würde er sie gewiss wiedersehen. War ihm in den Sternen etwas anderes gesponnen, so hätte der freundlichste Dank und Gruß jenes blauäugigen Mädchens daran nichts geändert.
Dennoch — da war noch irgendetwas Unerklärliches: wo hatte er sie vor langer Zeit schon gesehen, diese blonde Unbekannte mit den stahlblauen Augen? Ja, wo??
Die Menschen sind miteinander oft nahe verwandt, ohne es zu wissen. Dann mag es sein, dass der Klang der Sympathie nichts anderes ist als die Sprache des Blutes. Man sieht seine eigenen Ahnen; man fühlt ein Stück von sich selbst. Das ist das Gedächtnis des Blutes, eine über das persönliche Leben hinausgehende Vorzeit-Erinnerung. War es das? Oder hatte eine Traumgestalt aus seinen Kinderjahren Leben bekommen? —





























