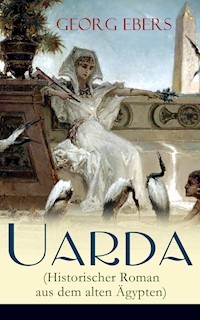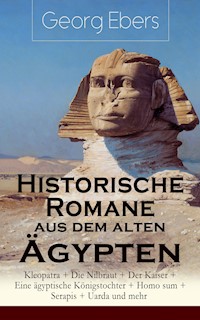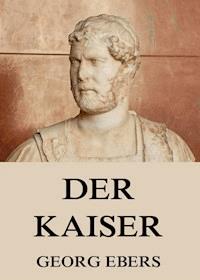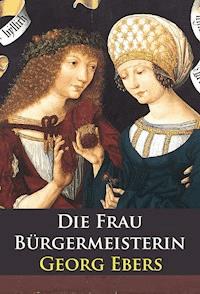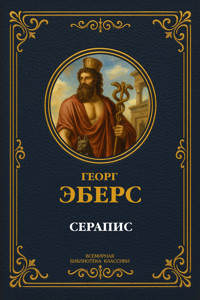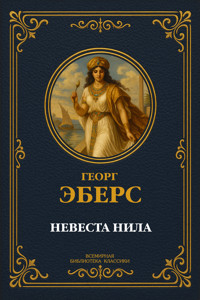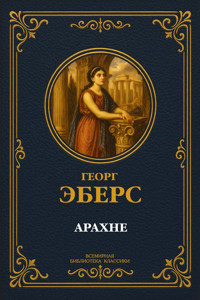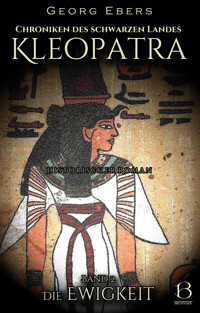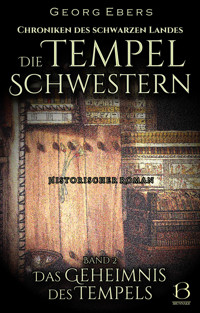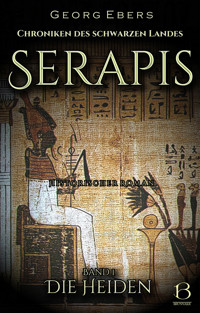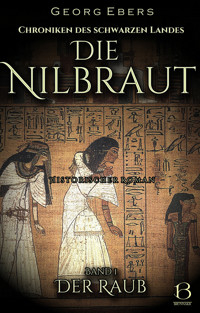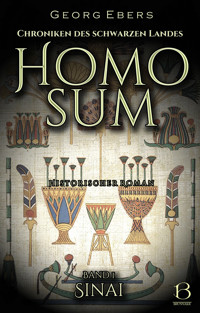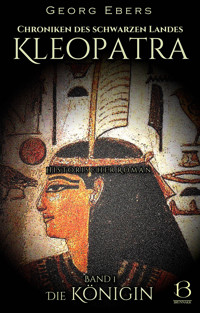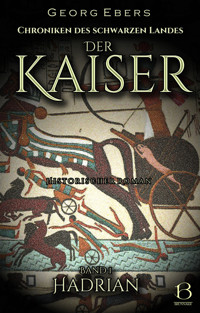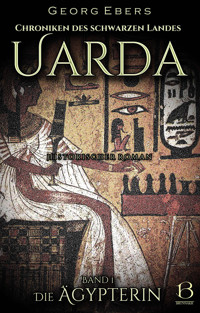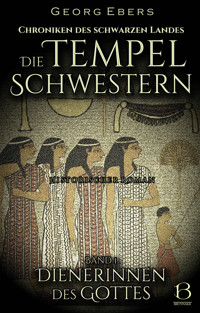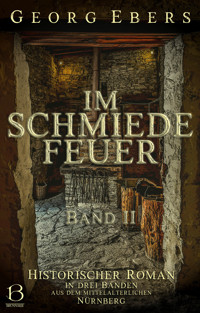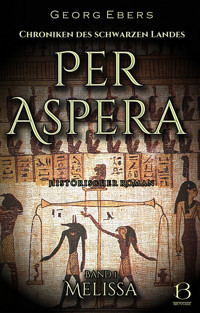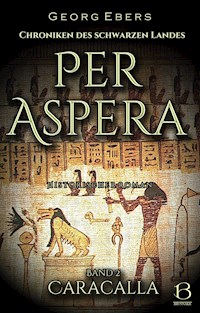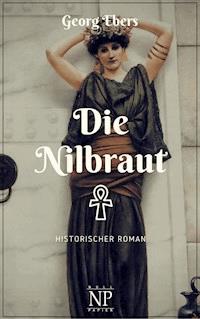
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die Nilbraut war ein unglückliches Opfer ägyptischen Aberglaubens, welches in früherer Zeit, wenn der Nil zögerte zu steigen und das Land zu überschwemmen, in die Flut gestürzt wurde. Die Heldin des Romans, Paula, ist eine Griechin, deren Vater verschollen ist und die nun bei ihren Verwandten im ägyptischen Memphis lebt. Orion, der Sohn des Statthalters soll ein reiches Mädchen in Memphis heiraten; sein Herz aber gehört der schönen Paula. Können beide Liebenden zueinander finden oder ist das Schicksal der Nilbraut unabwendbar? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1067
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Georg Ebers
Die Nilbraut
Historischer Roman
Georg Ebers
Die Nilbraut
Historischer Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-93-9
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Besprechung des Romans
Vorwort.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebenzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Achtundzwanzigstes Kapitel.
Neunundzwanzigstes Kapitel.
Dreißigstes Kapitel.
Einunddreißigstes Kapitel.
Zweiunddreißigstes Kapitel.
Dreiunddreißigstes Kapitel.
Vierunddreißigstes Kapitel.
Fünfunddreißigstes Kapitel.
Sechsunddreißigstes Kapitel.
Siebenunddreißigstes Kapitel.
Achtunddreißigstes Kapitel.
Neununddreißigstes Kapitel.
Vierzigstes Kapitel.
Einundvierzigstes Kapitel.
Zweiundvierzigstes Kapitel.
Dreiundvierzigstes Kapitel.
Vierundvierzigstes Kapitel.
Fünfundvierzigstes Kapitel.
Sechsundvierzigstes Kapitel.
Siebenundvierzigstes Kapitel.
Achtundvierzigstes Kapitel.
Neunundvierzigstes Kapitel.
Fünfzigstes Kapitel.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Herrn Carl Hallberger
widmet dies Buch am Abschluss eines Vierteljahrhunderts treuer, nie getrübter, immer fester geknüpfter Freundschaft
Georg Ebers.
Besprechung des Romans
ACHTUNG: Dieser Abschnitt verrät wichtige Teile der Handlung. (Der Verleger)
Die Nilbraut war ein unglückliches Opfer ägyptischen Aberglaubens, welches in früherer Zeit, wenn der Nil zögerte zu steigen und das Land zu überschwemmen, in die Flut gestürzt wurde. Solche Opferung kam auch noch vor zur Zeit, als das Heidentum der Ägypter längst christlicher Gesittung gewichen war und die fanatischen Anhänger des Propheten siegreich in das alte Nilland eingedrungen waren. Wenigstens in dem neuen Romane von Georg Ebers, der diesen Titel führt (Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt), bildet ein solches Jungfrauenopfer den Höhepunkt der Handlung: Wir wissen nicht, ob der Dichter an eine geschichtliche Tatsache anknüpft oder ob diese Erneuerung alter Bräuche in so später Zeit eine freie Erfindung seiner Fantasie ist.
Der neue Roman von Ebers beginnt mit der Darstellung von Vorgängen, welche die Teilnahme der Leser alsbald gefangen nehmen: Es ist das um so höher anzuschlagen, als Vieles, was uns da vorgeführt wird, am Anfange sehr fremdartig gemahnt. Mit einem hohen Beamten, welcher den Titel Mukaukias führt, müssen wir uns erst allmählich befreunden, und die Glaubensstreitigkeiten zwischen den melchitischen und jakobitischen Christen, die sich gegenseitig mit grimmem Hasse verfolgen, sind auch nicht danach angetan, uns sonderlich zu interessieren. Sie bilden zwar einen Angelpunkt der Handlung; aber erst, wenn wir für die Menschen, welche in diese Kämpfe verwickelt sind, ausreichende Teilnahme gewonnen haben, überwinden wir das Fremdartige dieser uns so fernliegenden dogmatischen Streitigkeiten und folgen mit Anteil den Geschicken der Einzelnen, die in diese hässlichen Kämpfe eines beschränkten Glaubensfanatismus verstrickt sind.
Die Heldin des Romans, Paula, ist eine Griechin, deren Vater, ein tapferer Streiter im Kampfe gegen die Moslemin, verschollen ist und die bei ihren Verwandten in der Familie des Statthalters in Memphis lebt. Der Sohn des Hauses, Orion, von Byzanz zurückgekehrt, soll ein reiches Mädchen in Memphis heiraten; sein Herz aber gehört der schönen Paula, die sich indes anfangs von dem Ungetreuen abwendet. Der Diebstahl eines prachtvollen Smaragds, dessen sich Orion schuldig macht, den er aus einem vom Vater gekauften Teppich entwendet und einer früheren Geliebten nach Konstantinopel schickt, entfremdet ihm Paulas Herz noch mehr; Orion verleitet die ihm bestimmte Braut Katharina zu falscher Aussage vor Gericht; Paula, welche Orion verderben konnte, da sie Zeugin jenes Diebstahls war, verschont ihn. Wie nun jener Smaragd mit einem andern, welcher Paula gehört und den sie veräußert, um einen Boten zu bezahlen, der ihren verschollenen Vater aufsucht, verwechselt wird: Das hat einen gewissen märchenhaften Reiz, und in der Tat liest sich der erste Band wie ein buntes orientalisches Märchen. Auch später tauchen Gestalten auf, die aus den Erzählungen einer Scheherezade entsprungen zu sein scheinen: So der fanatische ägyptische Magier, welcher Paula um jeden Preis verderben will, und der schwarze Vizefeldherr des Kalifen, Obadah, ein grimmes Raubtier. Paula und Orion haben sich wiedergefunden; aber da sie die Flucht melchitischer Nonnen begünstigten, verfallen sie dem Gericht der arabischen Machthaber und der christlichen Geistlichen. Da zugleich die Seuche Ägypten verheert, der Nil nicht steigen will, so wird die zum Tode verurteilte Paula dazu bestimmt, das Opfer des Stromgottes zu werden. Alles ist schon zum Feste gerüstet, das Opfer soll in die Flut gestoßen werden: Da erscheint Katharina, die an Paulas Stelle sich freiwillig dem Tode weiht.
Dieser Roman von Georg Ebers, der nur in der Mitte etwas zu sehr ins Breite geht, während der erste und letzte Band interessant und spannend sind, ist mit vielem Geschick entworfen und bewährt eine originelle Erfindungskraft; alle Fäden sind gut geschürzt und gleiten dem Dichter nirgends aus der Hand. Dass seine Fantasie dabei nicht ins Blaue schweift, sondern durch geschichtliche Studien wohlgeschult ist, gibt dem Ganzen einen festen Halt, und durch Klarheit der Darstellung vermag uns der Verfasser in einer Zeit zu orientieren, in welcher sich Ägypten in einen bunten Völkermarkt verwandelt hatte und die Glaubenskämpfe innerhalb der christlichen Kirche wie zwischen den Christen und den Moslem mit ihren oft verwirrenden Stichwörtern durch einander wogten.
Der Dichter, dessen andauerndes, schweres Leiden die allgemeinste Teilnahme erweckt, hat in Richard Gosche (»Georg Ebers«, Leipzig, Schloemp) einen Biografen gefunden, der seinen Verdiensten durchaus gerecht wird.
Die Gartenlaube, Heft 3, 1887
Vorwort.
»Die Nilbraut« ist keines Vorwortes bedürftig.
Nur für die Fachgenossen hab’ ich zu bemerken, dass ich mich von der Autorität des trefflichen de Goeje habe bestimmen lassen, an der eigenen Vermutung festzuhalten, das Wort Mukaukas sei nicht für den Namen, sondern für den Titel des Mannes zu halten, den die arabischen Quellen, deren ich mich zu bedienen hatte, als denjenigen bezeichnen, welcher als Statthalter des byzantinischen Kaisers die ihm anvertraute Provinz der muslimischen Macht überantwortete. Karabaceks dem Mukaukas gewidmete Untersuchungen waren mir leider nicht mehr zu benützen gestattet.
Dass ich den alten Horus Apollon (Horapollon) in das siebente Jahrhundert versetze, wird mir jeder mit Recht verdenken, der den Verfasser der Hieroglyphica für denselben hält wie den ägyptischen Gelehrten gleichen Namens, der nach Suidas unter Theodosius lebte und den schon Stephanus von Byzanz (Ende des fünften Jahrhunderts) erwähnt. Doch der erstgenannte Lexikograph, Suidas, zählt die Werke des Grammatikers und Kommentators griechischer Dichter Horapollon aus, ohne die Hieroglyphica, auf die es hier allein ankommt, zu erwähnen, und alle anderen Alten, welche des Namens Horapollon gedenken, lassen, wie auch C. Leemans, der beste Kenner der Hieroglyphica, zugibt, volle Freiheit, zwei Horapollon anzunehmen, von denen der zweite recht wohl erst im siebenten Jahrhundert gelebt haben kann, da zu seiner Zeit die genauere Kenntnis der Hieroglyphenschrift schon vielfältiger verloren gegangen sein musste, als wir dies für das vierte Jahrhundert nach Christus annehmen möchten, wenn wir bedenken, dass sich noch gut ausgeführte hieroglyphische Inschriften aus der Zeit des Decius 250 n. Chr. erhalten haben. Der ägyptische Kommentator griechischer Dichter hat schwerlich eines Übersetzers bedurft, während die Hieroglyphica erst von Philippus ins Griechische übertragen worden zu sein scheinen. Unsere Kombination, nach welcher der auf ägyptisch Horus (Sohn der Isis) genannte Schriftsteller der Isisinsel Philae entstammte, auf welcher der heidnisch-ägyptische Kultus am längsten geübt ward und wo sich auch einige Kenntnis der Hieroglyphenschrift bis spät erhalten haben wird, trägt den wahren Verhältnissen in der von uns gewählten Epoche Rechnung.
Tutzing am Starnberger See, den 1. Oktober 1886.
Georg Ebers.
Erstes Kapitel.
Die Hälfte eines Lustrums war vergangen, seitdem sich Ägypten der jungen, mit unerhörter Kraft und Schnelligkeit aufgewachsenen Macht der Araber unterworfen hatte. Leichten Kaufes war es einer wohl geführten kleinen Schar muslimischer Krieger in die Hände gefallen, und die schöne Provinz, welche noch vor kurzem eine Zier des byzantinischen Kaiserreiches und die treueste Pflegerin des Christentums gewesen, gehorchte jetzt dem Kalifen Omar und musste es dulden, den Halbmond sich überall neben dem Kreuze erheben zu sehen.
Ein heißerer Sommer hatte das unglückliche Land nur selten gedrückt, und der Nil, dessen Wachstum man in der »Nacht des Tropfens« am 17. Juni wie immer mit festlichen Vorbereitungen erwartet, hatte bisher die Hoffnung der Ägypter betrogen und war, statt zu steigen, kleiner und kleiner geworden. – In dieser Zeit der Besorgnis – am 10. Juli des Jahres 643 – zog eine Karawane von Norden her in Memphis ein.
In der entvölkerten, verfallenden Pyramidenstadt, welche sich in Form eines mächtigen Schilfblattes nur in die Länge entwickelt hatte, da ihrem Wachstun. in die Breite durch den Nil und das libysche Gebirge Schranken gesetzt waren, zog schon diese kleine Karawane die Blicke der Vorübergehenden auf sich, während es die Memphiten in früheren Jahren kaum für der Mühe wert geachtet hatten, den Kopf aufzuheben, wenn unabsehbare, mit Handelsgütern befrachtete Wagenreihen, wenn stattliche Züge von Ochsenwagen, glänzende kaiserliche Reitermanipeln oder endlose Prozessionen die mehr als meilenlange Hauptstraße belebten.
Der Kaufherr, welcher aus einem Dromedar von ausgesucht edler Zucht der Karawane voranritt, war ein hagerer, in weiche Seide gekleideter Muslim. Ein breiter Turban bedeckte den kleinen Kopf dieses Mannes und warf einigen Schatten auf sein zartes, ältliches Gesicht.
Der Ägypter, welcher neben dem Kaufherrn als Führer auf einem flinken Eselein dahinritt, sah oft und gern in dies an sich nicht schöne Antlitz mit den eingefallenen Wangen, dem spärlichen Vollbart und der großen Adlernase; denn es glänzten aus demselben zwei helle Augen von anmutender Besonnenheit und herzlicher Güte. Aber dieser schmächtige alte Herr, dem Schmerz und Krankheit manche Furche in die wohlwollenden Züge gegraben, verstand auch zu befehlen und seinem Willen Geltung zu verschaffen, das sah man dem feinen, fest geschlossenen Munde an, und dem Eifer, womit die trotzigen, bärtigen, bis an die Zähne bewaffneten Kriegergestalten, welche ihm folgten, seinen Winken gehorchten.
Sein ägyptischer Begleiter, der Vorsteher der Hermeneuten oder Fremdenführerzunft, ein mürrischer, bräunlicher Memphit, zog, wenn er einmal sich den wilden Dromedarreitern unversehens näherte, den Rücken ein, als sei er eines Hiebes oder Stoßes gewärtig, während er dem Kaufherrn Haschim, dem Eigner der Karawane, furchtlos und mit der ausgiebigen Sprechlust seines Standes Rede und Antwort gab.
»Wie gut Du hier in Memphis Bescheid weißt!« sagte der Ägypter, nachdem der alte Herr seinem Erstaunen über die traurige Veränderung und den Rückgang der Stadt, Ausdruck gegeben.
»Vor dreißig Jahren«, entgegnete der Kaufmann, »hat mich mein Geschäft häufig hieher geführt. Wie viele Häuser stehen jetzt leer und fallen zusammen, in denen es damals nur für schweres Geld Unterkunft gab! Überall Trümmer! Wer hat diese schöne Kirche so jämmerlich verstümmelt? Von den Meinen, ich weiß es von dem Feldherrn Amr selbst, ist kein christliches Gotteshaus angetastet worden.«
»Es war ja die Hauptkirche der Melchiten, der Kaiserknechte«, rief der Führer, als liege schon darin die Erklärung für das Geschehene; der Kaufherr aber nahm das nicht an, sondern fragte: »Nun, und was liegt denn so Schlimmes in ihrer Lehre?«
»Was?« versetzte der Ägypter, und seine Augen begannen zornig zu funkeln. »Was? Sie zerstücken die göttliche Person des Heilands und legen ihr verschiedene Naturen bei. Und dazu! Alle Griechen hier zu Lande haben, bevor die Deinen dem Gräuel ein Ende machten, uns, die Herren des Landes, gestützt auf die kaiserliche Macht, wie Sklaven geknechtet. In ihre Kirchen trieben sie uns mit Gewalt, und was ägyptischen Blutes war, wie Rebellen und Aussätzige ward es behandelt. Verlacht und verketzert haben sie uns wegen unsers Glaubens an die eine göttliche Natur unsers Heilands.«
»Und darum«, fiel ihm der Kaufherr ins Wort, »habt ihr, sobald wir die Griechen vertrieben, unmilder gegen sie und ihre Gotteshäuser gehandelt als wir, die ihr ›Ungläubige‹ scheltet, gegen euch.«
»Milde gegen sie?« entgegnete der Ägypter höhnisch und schaute mit einem bösen Blick auf das zerstörte Bauwerk. – »Sie haben geerntet, was sie gesäet, und wer jetzt in Ägypten – gelobt sei der Heiland! – nicht an euren einigen Gott glaubt, der bekennt sich zu der einen Natur unsers Herrn Jesus Christus. Die Melchitenrotte, ihr habt sie vertrieben, und an uns ist es dann gewesen, Hand an die Häuser ihres erbärmlichen Heilands zu legen, den sie aus der Synode zu Chalcedon – verdammt soll sie sein! – seiner göttlichen Würde entkleidet.«
»Aber die Melchiten sind doch immer eure Glaubensgenossen, sind Christen«, sagte der Kaufherr.
»Christen?« wiederholte der Führer und zuckte verächtlich die Achseln. »Mögen sie sich selbst dafür halten! Was mich und mit mir groß und klein in diesem Lande angeht, sind wir der Meinung, dass sie mitnichten berechtigt sind, sich unsre Glaubensgenossen, sich Christen zu nennen. Verflucht sind sie alle und sollen sie sein samt ihren hundert, nein tausend teuflischen Ketzereien, die unsern Gott und Erlöser zu einem Dinge machen möchten wie das Götterbild dort an dem steinernen Pfosten. Oben ist’s eine Kuh, unten ein Mensch, und welcher verständige Mann, frag’ ich, kann zu solchem Zwitterbalg beten? Wir Jakobiten, Monophysiten oder wie man uns sonst nennt, geben von der göttlichen Natur unsers Herrn und Heilands kein Titelchen preis, und soll es nun einmal mit dem alten Glauben vorbei sein, so will ich ein Muslim werden und mich zu eurem großen einigen Gott bekehren; denn bevor ich mich zu der Ketzerei der Melchiten bekenne, lieber lasse ich mich mit Weib und Kind in Stücke zerhacken. Wer weiß, wie’s noch kommt! Es bringt ja auch manchen Vorteil, der eure zu werden; denn ihr habt die Macht, und ihr mögt sie behalten! Von Fremden werden wir nun einmal beherrscht, und wer zahlte nicht lieber die kleinere Steuer an den weisen und gesunden Kalifen in Medina als die größere an die melchitische, bresthafte Kaiserbrut in Konstantinopel? Der Mukaukas Georg ist gewiss kein schlechter Mann; aber wie er den Widerstand gegen euch so schnell aufgab, ist er der gleichen Meinung gewesen. Als rechtliche, fromme Leute, unsre Nachbarn, vielleicht sogar unsre Stammverwandten, zieht er euch, ich weiß es von meinem Bruder, den byzantinischen Ketzern, Menschenschindern und Bluthunden vor; und dabei ist der Mukaukas ein so guter Christ wie nur einer.«
Der Araber hatte dem Memphiten, den sein Führeramt zwang, sich selbst zu unterbrechen, aufmerksam und bisweilen mit seinem Lächeln zugehört. Jetzt ließ der Ägypter die Karawane in eine Gasse einbiegen, welche zu der dem Strome gleichlaufenden Straße führte, in der sich einige von Gärten umgebene Häuser stattlich erhoben.
Sobald Mensch und Tier auf dem bessern Pflaster weiter zogen, sagte der Kaufherr: »Ich habe den Vater des Mannes, den Du da nanntest, recht wohl gekannt. Er war ein reicher und dabei wohlgesinnter Herr, und auch von seinem Sohne hört’ ich nur Gutes. Darf er immer noch den Titel ›Statthalter‹ oder – wie sagtest Du gleich? – eines Mukaukas führen?«
»Gewiss, Meister!« entgegnete der Hermeneut. »Es gibt in Ägypten kein älteres Geschlecht als das seine, und wenn der alte Menas schon reich war, so ist es der Mukaukas Georg noch mehr, durch Erbschaft und das Heiratsgut seiner Gattin. Einen verständigeren, gerechteren Statthalter können wir uns nicht wünschen! Auch den Unterbeamten sieht er auf die Finger, aber so schnell wie sonst werden die Geschäfte doch nicht mehr erledigt; denn wenn er auch kaum älter ist als ich, und ich stehe am Ende der Fünfzig, so kommt er doch aus dem Kranksein nicht mehr heraus, und schon seit Monaten hat ihn niemand mehr ausfahren sehen; selbst wenn euer Statthalter ihn sehen will, kommt er von drüben herüber. Ein Jammer ist’s um den Mann, und wer hat ihm den stattlichen Leib zu Grunde gerichtet? Die Melchitenhunde sind es gewesen! Frag’ nur am Nil, so lang er ist, nach dem Urheber eines Unglücks, und Du wirst immer dieselbe Antwort bekommen. Wo der Melchit, der Grieche hintrat, da war’s aus mit dem Graswuchs!«
»Aber dem Mukaukas, dem höchsten Beamten des Kaisers …« hob der Araber an; doch der andere unterbrach ihn und rief:
»Er, denkst Du, sei sicher vor ihnen gewesen? An seine eigene Person haben sie freilich nicht getastet; aber es ist noch schlimmer gekommen; denn bei einem Aufstand der Melchiten gegen die Unsren – in Alexandria war es, und der verstorbene griechische Patriarch Cyrus hatte die Hand mit im Spiele – da sind ihm zwei Söhne, zwei schöne, blühende Männer, wie tolle Hunde erschlagen worden, und das hat ihm den Rücken gebrochen.«
»Armer Mann!« seufzte der Araber. »Und ist ihm kein anderes Kind verblieben?«
»Doch, Herr, doch! Ein Sohn und des ältesten Witwe. Die ist freilich nach dem Tod ihres Gatten ins Kloster gegangen, aber ihr Kind, die kleine Maria, zehn Jahre wird sie alt sein, hat sie bei den Großeltern gelassen.«
»Das ist schön«, rief der Kaufherr, »das wird Sonnenschein in das Haus gebracht haben.«
»Gewiss, Herr! Und es fehlte da auch sonst – eben jetzt noch – gewiss nicht an Freude. Der einzige überlebende Sohn, Orion heißt er, ist vorgestern aus Konstantinopel heimgekehrt, wo er lange gewesen, und das hat ein Leben gegeben! Die halbe Stadt war wie närrisch. Tausende sind ihm entgegengezogen, als wär’ es der Heiland; Ehrenpforten haben sie ihm gebaut, und selbst die Meinen – von Zurückhalten war da keine Rede. Alle wollten den Sohn und Erben des großen Mukaukas sehen, und die Weiber natürlich allen voran!«
»Das kommt so heraus«, sagte der Araber, »als sei der Heimgekehrte solcher Ehre nicht würdig.«
»Wie man’s ansieht«, versetzte der Ägypter und zuckte die Achseln. »Er ist einmal der einzige Sohn des ersten Mannes im Lande.«
»Verspricht aber nicht, dem Alten ähnlich zu werden?«
»Doch, doch!« rief der andere. »Mein Bruder, ein geistlicher Herr, der Vorsteher unsrer großen Schule, war sein Lehrer, und ein gleicher Kopf wie Orion, sagt er, sei ihm nicht wieder begegnet. Alles flog ihm nur so an, und dabei ist er fleißig gewesen wie armer Leute Kind. Ruhm und Ehre, meint Marcus, hätten wir, die Eltern und seine Vaterstadt Memphis von ihm zu erwarten; aber ich, ich seh’ auch die Schatten, und ich sage Dir, die Weiber verdrehen ihm den Kopf und richten ihn endlich zu Grunde. – Schön ist er, stattlicher noch als der Alte in seinen Jahren, und das macht er sich zu nutz, und wo ihm etwas Anmutiges begegnet – und es stellt sich ihm überall in den Weg –«
»Da greift der junge Taugenichts zu«, lachte der Muslim. »Wenn es weiter nichts ist, was Dich ängstigt, so freut mich’s für ihn. Er ist jung, und dergleichen gibt sich.«
»Nein, Herr; auch mein Bruder, – er ist jetzt in Alexandria und immer noch blind und närrisch eingenommen für den früheren Schüler – auch er sieht darin eine gefährliche Klippe. Wenn das sich nicht ändert, so wird er weiter und weiter abweichen von den Geboten des Herrn und Schaden nehmen an seiner Seele, und die Gefahren umstehen ihn überall wie brüllende Löwen. Die edle Gabe der Schönheit und des gewinnenden Wesens, die führt ihn noch ins Verderben; und ich wünsch’ es nicht, aber mir ahnt es …«
»Du siehst schwarz und urteilst hart«, erwiderte der Alte. »Die Jugend …«
»Auch die Jugend«, entgegnete der Führer, »die christliche wenigstens, soll sich selbst beherrschen, und wenn einer, so bin ich geneigt, dem schönen Burschen das Beste zu gönnen, und dass ich’s nur gestehe: wenn er mich grüßt, so ist mir’s gleich, als wär’ mir etwas Gutes begegnet, und so geht es noch tausend anderen Männern in Memphis, und den Weibern erst recht; doch trotz alledem hat schon manche viele bittere Tränen um ihn vergossen. Aber, bei allen Heiligen, wenn man vom Wolf spricht, gleich … Sieh nur, da ist er! … Halt, haltet ein wenig, ihr Leute! Es lohnt sich, Herr, einen Augenblick zu verziehen!«
»Das stattliche Viergespann dort an der hohen Gartenpforte ist seins?«
»Es sind die pannonischen Renner, die er mitgebracht hat, schnell wie der Blitz und dabei … Aber dort … Sieh! Ach, nun treten sie hinter den Gartenzaun zurück; aber Du, Du musst sie doch von Deinem hohen Dromedar aus sehen können. Das kleine Fräulein da bei ihm, das ist die Tochter der Witwe Susanne, der dieser Garten und der schöne Palast hinter den Bäumen gehört.«
»Ein herrlich Besitztum!« rief der Araber.
»Das will ich meinen«, entgegnete der Memphit; »der Garten reicht bis an den Nil, und wie er gepflegt ist!«
»Hat hier nicht früher der Kornhändler Philammon gewohnt?« fragte der Kaufherr, als stiegen alte Erinnerungen in ihm auf.
»Freilich! Er war Susannens Gemahl und muss ein Fünfziger gewesen sein, als er um sie freite. Die Kleine ist ihre einzige Tochter, die reichste Erbin im ganzen Gau, aber trotz ihrer sechzehn Jahre nicht recht ausgewachsen, eines alten Vaters Kind, weißt Du, und doch hübsch und lustig, eine Lachtaube in Mädchengestalt, und so schnell und beweglich! Ihre eigenen Leute haben sie das ›Bachstelzchen‹ getauft.«
»Gut, gut und treffend«, versetzte der Kaufherr vergnügt. »Klein ist sie, mehr Kind als Jungfrau, aber mir gefällt das zierliche, muntre Geschöpf. Der Sohn des Mukaukas – wie hieß er?«
»Orion, Herr«, entgegnete der andere.
»Alle Wetter«, schmunzelte der Alte, »Du hast nicht geschmeichelt, Mann! Einem Jüngling wie diesem ›Orion‹ begegnet man nicht alle Tage! Welcher Wuchs! Wie die braunen Locken ihm stehen! Und auch das trifft zu: diese Art verzieht zuerst die eigene Mutter, und die anderen Frauen folgen dann ihrem Beispiel. Er hat auch ein offenes, kluges Gesicht, hinter dem etwas steckt. Hätte er nur den purpurnen Rock und den goldenen Krimskrams in Konstantinopel gelassen! Dergleichen passt nicht mehr in diese traurige, verfallende Stadt.«
Während der letzten Worte trieb der Memphit sein Eselein wieder zum Gang an, der Araber hielt ihn indessen zurück; denn ihn fesselte, was sich hinter der Gartenmauer zutrug.
Er sah dort, wie der schöne Orion ein weißes Hündchen, einen Seidenspitz von besonderer Feinheit, der augenscheinlich ihm gehörte, dem kleinen Fräulein auf den Arm gab, sah, wie sie es küsste, und ihm einen langen Grashalm um den Hals schlang, als wollte sie ihm Maß damit nehmen. Dann wurde der Alte gewahr, wie sie beide mutwillig lachten, wie sie einander in die Augen blickten und endlich Abschied nahmen. Dabei hob sie sich auf den Zehen zu einem seltenen Strauche empor, an dessen Spitze zwei köstliche purpurne Glocken blühten, pflückte sie rasch, reichte sie ihm errötend, und wies die Hand, womit er sie beim Aufstreben zu den Blumen unterstützt hatte, mit einem fröhlichen Schlage von ihrem Arme zurück, und die sonnigste Glücksempfindung leuchtete dem Jüngling aus ihrem frischen Gesichtchen entgegen, wie er die Stelle, welche ihre Finger getroffen hatte, küsste und dann auch die Blumen mit den Lippen berührte.
Der alte Herr schaute dem allen so teilnahmvoll und heiter zu, als erwecke es die lieblichsten Erinnerungen in seinem Gemüte, und seine guten Augen lachten, als Orion, nicht weniger schalkhaft und fröhlich als sie, ihr einige Worte ins Ohr raunte, und sie den langen Grashalm aus dem Gürtel zog, ihm schnell und als gälte es, ihn zu strafen, damit über das Gesicht fuhr und darauf flüchtig wie ein Reh über Rasen und Beete, ohne seiner wiederholten Rufe: »Katharina, allerliebste, große Jungfrau Katharina!« zu achten, dem Palast entgegen floh.
Das war ein reizendes kleines Abenteuer gewesen, und der alte Haschim hielt es in seiner Seele fest und freute sich immer noch daran, als er mit den Seinen schon wieder ein ziemlich Stück Weges zurückgelegt hatte. Er war Orion, dem Sohn des Mukaukas Georg, dankbar für dies liebliche Schauspiel, und als er das Viergespann desselben in langsamem Trabe sich der Karawane nähern hörte, wandte er sich nach ihm um und behielt es im Auge.
Aber nachdem die vier Pannonier, der mit mancherlei in Silber getriebenen Figuren bedeckte Wagen und sein Lenker, die ein Ganzes von seltener Schönheit und bestem Geschmack bildeten, langsam an ihm vorbei gekommen waren, um dann windschnell auf der nun freien Straße vorwärts zu sausen und in dichten Staubwolken zu verschwinden, hatte des Kaufherrn Antlitz den heitern Ausdruck verloren, und es lag etwas tief Wehmütiges in seiner Stimme, als er einem der jungen Kameltreiber befahl, die Blumen, welche hinter ihnen im Staube lagen, vom Wege aufzulesen und ihm zu bringen.
Er war Zeuge gewesen, wie der schöne junge Mann mit einem Blick und einer Bewegung, als zürne er sich selbst, die freundliche Gabe auf den heißen Staub der Straße geschleudert.
»Dein Bruder hat Recht«, rief nun der Alte dem Memphiten zu. »Für diesen jungen Mann sind die Frauen eine gefährliche Klippe, und er für sie, wie ich fürchte. Die arme Kleine da drüben!«
»Das Bachstelzchen meinst Du?« fragte der Führer. »O, mit der könnt’ es doch leicht etwas Ernstliches werden! Die lieben Mütter machen das Ding schon fertig. Sie sitzen beide im Golde, und wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Gottlob, die Sonne steht schon über den Pyramiden! Lass Deine Leute in der großen Herberge dort einkehren. Der Wirt ist ein redlicher Mann, und es fehlt bei ihm auch nicht an Schatten!«
»Was die Tiere und Knechte angeht«, versetzte der Kaufherr, »so mögen sie hier rasten. Ich, der Karawanenführer und einige Leute wollen uns etwas stärken, und dann führst Du uns zu dem Statthalter; ich habe mit ihm zu reden. Es ist nicht mehr früh …«
»Unbesorgt!« entgegnete der Ägypter. »Der Mukaukas empfängt an so glühenden Tagen am liebsten nach Sonnenuntergang. Wenn Du mit ihm zu tun hast, bist Du mit mir an den Rechten gekommen. Lass einige Goldstücke springen, und ich schaffe Dir noch heute durch den Hausmeister Sebek Gehör – er ist mein Vetter. Während ihr hier rastet, reite ich in die Statthalterei und bring’ Dir dann Nachricht.«
Zweites Kapitel.
Die Herberge, in welche der Kaufmann Haschim mit den Seinen einzog, lag, rings von Palmen umgeben, an einer erhöhten Stelle des Weges. Vor der Zerstörung der heidnischen Altertümer im Niltal war sie ein Tempel Imhoteps, des ägyptischen Äskulap, des freundlichen Gottes der Heilkunde, gewesen, welcher auch in der Totenstadt seine besondere Verehrungsstätte besessen. Diese war halb zerstört, halb vom Wüstensande begraben worden, während ein unternehmender Wirt den hübschen Imhoteptempel in der Stadt samt dem dazu gehörenden heiligen Hain für billiges Geld angekauft hatte. Seitdem war er von einer Hand in die andere gegangen, an die massiv gebauten Tempelräume hatte sich ein großes hölzernes Haus für die Aufnahme von Reisenden geschlossen, und in dem Palmenhain, welcher bis zu dem schlecht erhaltenen Uferdamm reichte, erhoben sich Ställe und sah man eingezäunte Plätze für angetriebene Herden. So glich das Ganze einem Viehmarkt, und in der Tat kamen die Metzger und Rosskämme der Stadt gern hieher, um ihren Bedarf zu befriedigen. Dagegen zog der Palmenhain, einer der wenigen, die in der Nähe der Stadt stehen geblieben waren, die Bürger von Memphis an, um »Lüftchen zu riechen« und sich in seinem Schatten eine Güte zu tun. Hart am Strome hatte der Wirt Tische und Bänke aufstellen lassen, und in dem kleinen Hafen auf seinem Grundstück gab es Boote zu mieten. Auch wer zu seinem Vergnügen von der Stadt aus Wasserfahrten machte, der legte hier gern an und nahm unter den Palmen des Nesptah eine Erfrischung.
Die beiden Häuserreihen, welche diesen Sammelplatz für vernünftige und unvernünftige Wesen früher von der Straße getrennt und sich nach dem Nil hin neben ihm erhoben hatten, waren längst eingestürzt und von den Wirten der Erde gleich gemacht worden. Jetzt sah man unter Leitung von arabischen Vögten einige hundert Arbeiter beschäftigt, eine gewaltige Ruine aus der Zeit der ptolemäischen Könige, die kaum zweihundert Schritte von dem Palmenhain entfernt lag, abzutragen und die großen, schön behauenen Kalk- und Marmorquadern, sowie die zahlreichen hohen Säulen, welche das Dach des Zeustempels von Memphis getragen hatten, trotz der brennenden Hitze des Nachmittags aus Ochsenkarren zu laden und sie dem Damme und von dort aus auf flachen Kähnen dem östlichen Nilufer zuzuführen.
Dort errichtete Amr, der Feldherr und Stellvertreter des Kalifen, seine neue Residenz. Die Tempel der alten Götter wurden dabei als Steinbrüche benützt, und es fanden sich in ihnen nicht nur sorgsam behauene Werkstücke vom festesten Gestein, sondern auch griechische Säulen jeder Ordnung in Menge, die man jenseits des Stromes nur wieder auszustellen hatte; denn die Araber verschmähten kein Material, ja sie verwandten sorglos beim Bau ihrer Gotteshäuser Quadern und Säulen, auch wenn sie aus heidnischen Tempeln oder christlichen Kirchen kamen.
In dem Herbergentempel des Imhotep waren Wände und Decken ursprünglich über und über mit Götterbildern und hieroglyphischen Inschriften bedeckt gewesen; aber der Rauch des Herdfeuers hatte sie längst geschwärzt, glaubenseifrige Hände waren nicht müde geworden, sie zu verstümmeln, und über manche hatte man Kalk geworfen und ihn mit christlichen Symbolen oder sehr weltlichen Kritzeleien in griechischer oder der Volksschrift der Ägypter bedeckt.
In der früheren großen Tempelhalle nahm der Araber mit den Seinen die Mahlzeit ein, und alle enthielten sich dabei des Weines, mit Ausnahme des Karawanenführers, der kein Muslim war, sondern zu der persischen Sekte der Masdakiten gehörte.
Nachdem der alte Herr sich an einem besonderen Tischchen gesättigt, rief er jenen an und befahl ihm, den Ballen mit dem Teppich sicher, aber leicht ablösbar auf die Sänfte zwischen den beiden großen Lastkamelen zu legen.
»Ist schon geschehen«, versetzte der Perser, ein Prachtmensch, groß und breit wie eine Eiche, und mit einem Kopfe, den das blonde Haupthaar wie eine Löwenmähne umwallte, indem er sich den mächtigen Schnurrbart wischte.
»Desto besser«, entgegnete Haschim. »Komm mit mir ins Freie!«
Damit ging er dem Masdakiten in den Palmenhain voran.
Das Tagesgestirn war hinter den Pyramiden, der Totenstadt und der libyschen Bergkette zur Rüste gegangen, und sein Widerschein bemalte nun den östlichen Himmel und das nackte Kalkgebirge von Babylon jenseits des Stromes mit Farben von unbeschreiblich wechselvoller Schönheit. Es war, als hätten alle Rosenarten, die der erfahrenste Gärtner in Arsinoë oder Naukratis züchtete, von der goldgelben an bis zu der purpurnen und der mit tiefem violettlichem Schwarzrot gesättigten, die Farben hergegeben, um die Flächen, die Vorsprünge und Schluchten des Gebirges gedankenschnell mit zauberhaften Tinten zu übergießen.
Dem alten Manne schwoll die Brust bei diesen. Anblick, und indem er tief aufatmete, legte er die zarte Hand auf den Riesenarm des Persers und sagte: »Euer Meister Masdak lehrt, es sei Gottes Wille, dass der eine nicht mehr und nicht weniger sein eigen nenne als der andere und dass es weder Arme noch Reiche gebe auf Erden; denn jeder Besitz gehöre allen gemeinsam. Nun schau einmal mit mir hieher! Wer dies nicht gesehen, hat gar nichts gesehen; es gibt nichts Schöneres hienieden, und wem gehört es? Dem armen, einfältigen Salech dort, den wir aus Gnade halb nackt den Kamelen nachtraben lassen, ist sie so gut zu eigen wie Dir und mir und dem Kalifen. Seinen großen Werken gegenüber hat Gott uns alle so gestellt, wie es euer Meister begehrt. Wie viel Schönes ist doch im allgemeinen Besitz unseres Geschlechts! Seien wir dankbar dafür, Rustem; denn wahrlich, es ist nicht wenig. – Das Eigentum, welches der Mensch erwirbt oder verliert, damit ist es freilich etwas ganz anderes. Auf der gleichen Rennbahn stehen wir alle, und was ihr begehrt, das fordert nur, dem Schnelleren Blei an die Füße hängen, damit keiner dem andern zuvorkommt, das würde … Aber weiden wir jetzt lieber die Augen an der wundervollen Schönheit da drüben! Sieh nur, was vorhin wie diese purpurfarbene Glockenblume erschien, das wird jetzt zum Rubin, was wie Veilchen schimmerte, zum dunklen Amethyst. Der goldene Rand dort an den Wolken, der fasst die Juwelen zusammen, und das alles ist mein, ist Dein, ist unser, so lange sich Auge und Herz daran ergötzt und erhebt.«
Da lachte der Masdakit mit einem quellfrischen, wohltönenden Lachen laut auf und rief: »Ja, Meister, wer Deine Augen hätte! Es sieht freilich bunt genug aus dort am Himmel und an den Bergen, und so rote Farben hat’s daheim selten; doch was nützt uns der Zauber? Du siehst Rubinen und Amethyste da oben, aber ich? – Die Juwelen in Deinem Teppich, die bedeuten was anderes als das lustige Gefunkel! Nichts für ungut, Meister, aber für den Ballen dort gäb’ ich alle Sonnenuntergänge auf Erden, und es sollt’ mich nicht reuen!« Dabei lachte er wieder hell auf und fuhr fort: »Doch Du, Väterchen, Du würdest Dich hüten, den Handel zu schließen! – Was uns Masdakiten betrifft, so ist die Zeit für uns noch nicht gekommen!«
»Und wenn sie da wäre, und Du bekämst den Teppich?«
»Dann verkaufte ich ihn und legte den Erlös zu meinem Ersparten und ginge nach Hause und kaufte mir Land, und nähm’ mir ein hübsches Weib und züchtete Kamele und Rosse.«
»Aber übermorgen kämen die Armen, die nichts zurückgelegt und kein gutes Geschäft mit dem Abendrote gemacht haben, und jeder verlangte ein Stück Deines Landes, ein Kamel und ein Fohlen, Du bekämest nie wieder einen herrlichen Sonnenuntergang zu sehen, und Dein hübsches Weibchen würde mit Dir in die Welt ziehen, um Dir zu helfen, mit anderen zu teilen. Lassen wir’s nur beim alten, mein Rustem, und der Höchste bewahre Dir Dein braves Herz, Du närrischer Querkopf.«
Da beugte sich der Riese auf den Arm seines Herrn, und während er ihn dankbar küsste, kehrte der Fremdenführer mit langem Gesichte zurück; denn er hatte zu viel versprochen. Der Mukaukas Georg war – ein ganz unerhörtes Ereignis – gerade als er um Gehör für den Araber bitten wollte, in die Gondel getragen worden, um mit seinem Sohne und den Frauen des Hauses eine Wasserfahrt zu unternehmen. – Die Heimkehr Orions, hatte der Hausmeister gesagt, habe den alten Herrn wie verjüngt. Haschim müsse nun bis morgen warten, und er, der Führer, rate ihm, in der Stadt, in der Herberge des Sostratus, wo es an nichts fehle, zu übernachten.
Aber der Kaufherr zog es vor, hier zu bleiben. Der Aufschub bekümmerte ihn wenig, zumal er ohnehin einen ägyptischen Arzt wegen eines alten Leidens um Rat fragen wollte, und einen tüchtigeren und gelehrteren als den berühmten Philippus, versicherte der Hermeneut, könne er im ganzen Lande nicht finden. Hier draußen sei es ja schön, und von den Bänken am Ufer aus lasse sich der Komet beobachten, der sich seit einigen Tagen zeige und gewiss schlimme Zeiten verkünde. Die ganze Stadt sei wie gelähmt von Besorgnis; das zeige sich recht deutlich hier in der Wirtschaft des Nesptah; denn sonst füllten sich, wenn die abendliche Kühlung eintrete, die Tische und Bänke unter den Palmen mit Wasserfahrern und Spaziergängern, aber jetzt, wer getraue sich in diesen Angsttagen an Vergnügen zu denken?
Damit bestieg er wiederum den Esel, um den Arzt zu rufen, der alte Haschim aber begab sich am Arm des Masdakiten zu den Bänken unter den Palmen und schaute von dort aus gedankenvoll zum Sternenhimmel empor, während sein junger Gefährte von der Heimat träumte und sich dort auch ohne den kostbaren Teppich und nur für sein Erspartes Weideland kaufen, ein Haus bauen und ein hübsches Weibchen darin walten sah. Ob es blond oder braun ausfallen würde? Blond wär’ ihm lieber gewesen.
Aber hier brach sein Lustschloss zusammen; denn es näherte sich etwas auf dem Nil, das seine Aufmerksamkeit anzog und ihn veranlasste, auch seinen Herrn darauf hinzuweisen.
Vor ihnen lag der Strom wie ein breites Band von schwarzem Silberbrokat. Der zunehmende Mond spiegelte sich in seiner kaum merklich bewegten Fläche, und wo sein Wasser sich kräuselte, verbrämte er die niedrigen Wellenhäupter mit hellflimmerndem Glanze. Fledermäuse schwangen sich durch die Nachtluft von der Totenstadt her auf den Nil zu und wiegten sich über ihn hin wie vom Winde bewegte leichte Schatten. Nur wenige dreieckige Segel schwebten wie helle Riesenvögel über dem dunklen Wasser, aber von Norden, von der Stadt her, näherte sich auf dem Strome ein großer Körper mit glanzvoll und weithin schimmernden Lichtaugen den Palmen.
»Ein stattliches Boot, gewiss das des Mukaukas Georg!« sagte der Kaufherr, und langsam trieb es von der Mitte des Flusses her gerade auf den Hain zu.
Inzwischen hatte sich auch auf der Landstraße hinter der Herberge Pferdegetrappel vernehmen lassen. Haschim schaute sich um und sah Fackelträger, welche vor einem Wagen herliefen.
»Bis hieher«, sagte der Alte, »wird der Kranke fahren und dann, um die Nachtluft auf dem Wasser zu vermeiden, sich im Wagen nach Hause begeben. Seltsam, da begegne ich heut’ zum zweitenmale seinem viel besprochenen Sohne.«
Bald kam die Lustfahrtgondel des Statthalters den Palmen näher. Es war ein großes, schönes Fahrzeug von Zedernholz mit reich vergoldetem Zierrat und dem Bilde des Johannes, des Schutzheiligen der Familie, an der Spitze. Der Strahlenkranz, welcher das Haupt dieser Figur umgab, war mit Lampen besetzt, und große Laternen erhoben sich neben ihr und am Hinterteile des Bootes. Dort ruhte unter einem Baldachin der Mukaukas Georg und neben ihm seine Gattin Neforis. Ihnen gegenüber saß ihr Sohn und eine Jungfrau von hohem Wuchse, zu deren Füßen ein Kind von zehn Jahren kauerte und das liebliche Köpfchen an sie geschmiegt hielt. Eine ältere Griechin, die Erzieherin der Kleinen, saß neben einem sehr großen Manne, dem Arzte Philippus, auf einem Polster, das der Baldachin nicht mehr beschirmte. Heller Lautenklang begleitete das Boot, und derjenige, welcher die Saiten kunstfertig schlug, war der jüngst heimgekehrte Orion.
Dies alles bot einen gar erfreulichen Anblick: das schönste Bild einer vornehmen, in Liebe vereinten Familie. Aber wer war die Jungfrau an der Seite des jungen Orion? Diesmal wandte er ihr die ganze Aufmerksamkeit zu, und wenn er tiefer in die Saiten griff, suchte er ihre Augen, und es hatte dann zuweilen das Ansehen, als spiele er für sie allein, und solche Auszeichnung schien ihr in der Tat zuzukommen; denn als das Fahrzeug in den kleinen Hafen einfuhr und Haschim ihre Züge zu unterscheiden vermochte, war er überrascht von ihrer edlen, echt griechischen Schönheit.
Jetzt stiegen einige reichgekleidete Sklaven, welche mit dem Gespann auf der Straße gekommen sein mussten, auf das Boot, um den kranken Herrn in den Wagen zu tragen, und es zeigte sich nun, dass der Stuhl, worauf der Leidende saß, mit Armen versehen war, welche ihn zu heben und fortzubewegen gestatteten. Ein großer Schwarzer ergriff diese an der hinteren Seite, und wie ein anderer sich anschickte, sie an der vorderen zu erfassen, drängte ihn Orion zurück, trat an seine Stelle, hob den Stuhl und mit ihm den Vater auf und trug ihn über die Landungsbrücke, welche das Schiff mit dem Ufer verband, an Haschim vorüber dem Wagen zu. Heiter und ohne Anstrengung verrichtete der junge Mann die Arbeit des Trägers, schaute sich auch wohl liebreich nach dem Vater um, rief den anderen Frauen – nur seine Mutter, welche den Leidenden sorglich mit Tüchern umhüllt hatte, und der Arzt folgten dem Kranken – munter zu, auszusteigen und ihn hier zu erwarten, und schritt dann im Licht der Fackeln, welche ihm vorangetragen wurden, weiter.
»Armer Mann!« dachte der Kaufherr, indem er dem siechen Mukaukas nachschaute. »Aber das Traurigste und Schwerste verweht leicht wie Nebel im Winde, wenn man einen Sohn besitzt, der einen so freundlich dahinträgt.«
Erklärlich musste er nun finden, dass Orion damals die Blumen von sich geworfen; ja, wie die Jungfrau, der das Kind zärtlich am Arm hing, ans Land trat, sagte er sich, dass es die kleine Tochter der reichen Witwe Susanna allerdings schwer haben werde, neben dieser hohen, königlichen Erscheinung das Feld zu behaupten. Welch eine Gestalt, welch fürstliche Haltung hatte dies Mädchen, und wie wohllautend und liebreich klang es, als sie dem Kinde die Namen einiger Sternbilder nannte und es auf den Kometen hinwies, der eben aufging.
Haschim saß im Dunkeln und konnte ungesehen beobachten, was auf der Bank am Ufer, welche durch eine der Laternen des Schiffes beleuchtet worden war, weiter vorging, und er freute sich der unerwarteten Zerstreuung; denn was den Sohn des Mukaukas anging, erweckte seine Teilnahme und Neugier. Es lockte ihn, sich ein Urteil über diesen ungewöhnlichen jungen Mann zu bilden, und der Anblick des schönen Mädchens dort auf der Bank erwärmte sein altes Herz. Das Kind musste Maria, die Enkelin des Statthalters sein.
Jetzt brach der Wagen auf, jetzt brauste er auf der Straße von dannen, und nach einiger Zeit kehrte Orion zu den Wartenden zurück.
Armes, reiches Töchterchen der Witwe Susanna. Wie so ganz anders verkehrte er mit der schönen Jungfrau dort, als mit der Kleinen. Sein Auge hing wie berauscht an ihren Zügen, mitten in der Rede stockte er bisweilen, während er zu ihr sprach, und das, was er sagte, musste bald ernst und fesselnd, bald witzig sein; denn nicht nur sie, sondern auch die Erzieherin der Kleinen hörte ihm mit Spannung zu, und wenn die schöne Jungfrau auflachte, so klang es ganz besonders wohltönend und rein. Es lag etwas so Hoheitvolles in ihrem Wesen, dass solche Äußerung unbefangener Heiterkeit an ihr überraschte und sich ausnahm wie der Duft einer prächtigen Blume, von der man bis dahin glaubte, sie sei nur geschaffen, um dem Auge wohlzutun und nicht auch den anderen Sinnen. Und diejenige, an welche alles gerichtet war, was Orion sagte, hörte ihm nicht nur aufmerksam, sondern in einer Weise zu, welche den Kaufherrn lehrte, dass der Erzähler selbst ihr noch mehr gefiel, als was er so lebhaft mitzuteilen wusste. Wenn dies Mädchen mit dem Statthalterssohne eins ward, ja das gab ein Paar!
Nun kam die Wirtin Taus, eine behäbige, tüchtige Ägypterin in mittleren Jahren, und trug selbst ihre berühmten Spritzkuchen, die sie eben eigenhändig gebacken, Milch, Trauben und Obst auf, und dabei glänzten ihre Augen vor Freude und geschmeicheltem Ehrgeiz; denn der Sohn des großen Mukaukas, der Stolz der Stadt, der früher gar oft auf Wasserfahrten mit fröhlichen Genossen, meist griechischen Offizieren, die nun alle, alle gefallen oder aus dem Lande vertrieben waren, nicht nur um ihrer Kuchen willen bei ihr vorgesprochen hatte, erwies ihr nun die Ehre, sie so bald nach der Heimkehr aufzusuchen. Ihre geläufige Zunge stand nicht still, wie sie ihm erzählte, auch sie und ihr Mann seien ihm bis zur Ehrenpforte beim Menestore entgegengezogen, und mit ihnen ihre Emau mit ihrem Bübchen. Sie sei nämlich nun verheiratet, und diesen ersten Kleinen habe sie »Orion« getauft.
Und als der junge Mann darauf fragte, ob die Emau noch immer ein so reizendes Geschöpf sei und der Mutter so ähnlich sehe wie früher, drohte Frau Taus ihm mit dem Finger und fragte, indem sie auf die Jungfrau wies, ob der fröhliche Vogel, dem so manche bei seinem Aufbruch nachgeseufzt habe, sich endlich in den Käfig begeben, und ob die schöne Dame dort vielleicht …
Aber Orion schnitt ihr das Wort ab und sagte, noch sei er sein eigener Herr, aber er fühle schon die Schlinge am Halse. Da wurde das schöne Mädchen noch röter als bei der ersten Frage der Wirtin; er aber überwand schnell die eigene Befangenheit und versicherte munter, das Töchterchen der braven Taus sei eins der hübschesten Kinder von Memphis gewesen und nicht weniger eifrig gefeiert worden, als die Spritzkuchen ihrer trefflichen Mutter. Frau Taus möge die junge Frau von ihm grüßen.
Da entfernte sich die Wirtin gerührt und geschmeichelt, er aber griff wieder zur Laute, und während die anderen sich erfrischten, folgte er der Aufforderung der Jungfrau und sang das Lied des Alkaios, um welches sie ihn bat, mit wohllautender, aber gedämpfter Stimme zur Laute, die er meisterlich schlug. Die Augen des Mädchens hingen an seinem Munde, und er schien wiederum nur für sie in die Saiten zu greifen. Als die Zeit zum Aufbruche kam und die Frauen das Schiff bestiegen, ging er in die Herberge, um die Zeche zu zahlen. Bald kam er allein zurück, und der Kaufherr sah, wie er ein Tüchlein, das die Jungfrau auf dem Tische liegen gelassen, aufnahm und es schnell an die Lippen zog, während er dem Boote zuschritt.
Den prächtigen roten Blumen war es heute morgen weniger freundlich ergangen. Dem Mädchen dort auf dem Wasser gehörte das Herz des jungen Mannes. Seine Schwester konnt’ es nicht sein; aber wie hing es mit ihm zusammen?
Der Kaufherr sollte es bald erfahren; denn der Führer kehrte zurück und gab ihm Auskunft. – Es war Paula, die Tochter des Thomas, des weit berühmten griechischen Feldherrn, der die Stadt Damaskus so ausdauernd und tapfer gegen die Kriegsmacht des Islam verteidigt hatte. Sie war die Nichte des Mukaukas Georg; aber nur mäßig begütert, eine Verwandte des Hauses, die man nach dem Verschwinden ihres Vaters – denn auch seine Leiche hatte man nicht gefunden – in der Statthalterei aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen: eine Melchitin. Der Hermeneut war ihr schon deswegen wenig gewogen, und wenn er auch gegen ihre Schönheit nichts einzuwenden hatte, so wollte er doch wissen, dass sie stolz und hochfahrend sei und keines Menschen Liebe zu erwerben verstehe; nur das Kind, die kleine Maria, hänge wohl an ihr. Ein öffentliches Geheimnis sei es, dass sogar die Gattin ihres Oheims, die brave Neforis, die stolze Nichte nicht möge und sie nur dulde dem kranken Mann zu gefallen. Was hatte die Melchitin auch zu Memphis in einem gut jakobitischen Hause zu suchen? Jedes Wort des Führers atmete jene Abneigung, die von niedrig stehenden und gesinnten Menschen so leicht denjenigen zu teil wird, welche die Güte der eigenen Wohltäter genießen.
Aber die schöne, hoheitvolle Tochter eines großen Mannes hatte das alte Herz des Kaufherrn gewonnen, und sein Urteil blieb durch das des Memphiten ganz unbeeinflusst. Es sollte auch bald Bestätigung finden; denn der Arzt Philippus, den der Führer gerufen, ein täglicher Besucher der Statthalterei, dessen gediegenes Wesen dem Araber das größte Zutrauen einflößte, nannte Paula ein so herrliches Geschöpf, wie es der Himmel in seinen besten Stunden nur selten schaffe. Doch der da oben scheine sein eigenes Meisterwerk vergessen zu haben; denn seit Jahren sei ihr Dasein grausam getrübt.
Dem alten Herrn konnte der Arzt Linderung der Schmerzen versprechen; überhaupt sagten beide einander so wohl zu, dass sie sich erst in später Nachtstunde als gute Freunde trennten.
Drittes Kapitel.
Das Boot des Mukaukas glitt indessen, von kräftigen Ruderschlägen getrieben, ruhig dem Laufe des Stromes entgegen. Es ward darin bald geflüstert, bald gesungen. Die kleine Maria war an der Brust Paulas entschlummert, die griechische Erzieherin blickte bald nach dem Kometen, der sie beängstigte, bald auf Orion, dessen Schönheit ihr alterndes Herz entzückte, bald auf die Jungfrau, der sie nicht gönnte, von diesem Liebling der Götter so bevorzugt zu werden. Es war eine köstliche, warme, stille Nacht, und das Mondlicht, welches das Meer zwingt, flutend zu wachsen, lässt auch die wogenden Gefühle in der Menschenbrust steigen und schwellen. Was Paula forderte, das sang Orion, als sei nichts ihm fremd, was auf der Leier eines griechischen Dichters die nun hinabgesunkene Welt jemals entzückt, und je länger sie fuhren, desto heller und schöner klang seine Stimme, desto schmelzender und bestrickender ward ihr Ausdruck, mit desto feurigerem Werben wandte sie sich an das Herz des Mädchens; und so gab Paula sich dem süßen Zauber gefangen, und wenn er die Laute senkte und sie leise fragte, ob sein Vaterland nicht schön sei in solcher Nacht, welches Lied ihr das liebste, ob sie ahne, was es für ihn bedeute, im Hause der Seinen sie gefunden zu haben, ließ auch sie sich hinreißen, ihm im Flüsterton Antwort zu geben.
Unter den dichten Baumkronen des schlummernden Gartens zog er ihre Hand an die Lippen, und sie ließ es bebend geschehen. – Schwere, schwere Jahre lagen hinter ihr. Des Arztes Ausspruch war nur zu wahr gewesen. Harten Schicksalsschlägen war für sie, die stolze Tochter eines großen Vaters, eine Reihe von peinigenden Demütigungen gefolgt. Das Leben der aus Mildherzigkeit im reichen Hause aufgenommenen, wenn auch nicht armen, so doch verlassenen Anverwandten war längst zu einem schweren Dornenpfad für sie geworden, aber vorgestern hatte sich das alles geändert. Orion war ja da! Wie ein schönes Schicksalsgeschenk hatten Haus und Stadt seine Heimkehr gefeiert, und auch ihr war ein reicher Anteil daran zugefallen. Nicht wie die verlassene Verwandte, sondern wie das herrliche, vornehme Weib, das sie war, hatte er sie begrüßt. Sonnenschein ging aus von seinem Wesen, und der drang ihr mitten ins Herz und ließ sie das Haupt wieder aufrichten wie eine Blume, die man wieder unter den freien Himmel stellt, nachdem ihr Licht und Luft lang entzogen. Sein frischer Geist und froher Lebensmut erquickten ihr Herz und Sinn, die Beachtung, die er ihr schenkte, stärkte ihr gesunkenes Selbstvertrauen und erfüllte ihre Seele mit warmem Dank. Ach, und wie köstlich schien es ihr, sich dankbar, innig dankbar fühlen zu dürfen! Und dann, dann war der heutige Abend gekommen, der schönste, herrlichste, den sie seit Jahren genossen. Er hatte sie wieder gelehrt, was sie beinahe vergessen, dass sie noch jung, dass sie noch sei, dass sie das Recht besitze, glücklich zu sein, Entzücken zu empfinden und zu erwecken, vielleicht sogar zu lieben und wieder geliebt zu werden.
Sein Kuss brannte noch auf ihrer Rechten, wie sie das kühle Zimmer betrat, wo Frau Neforis hinter ihrem Spinnrocken neben dem Lager ihres kranken Gatten, der sich immer in später Stunde zur Ruhe begab, der Heimkehrenden harrte. Mit übervollem Herzen drückte Paula die Lippen auf die Hand des Oheims, des Vaters Orions, – durfte sie sagen »ihres« Orion? Dann küsste sie – wie lange war dies nicht geschehen! – auch ihre Base, seine Mutter, während sie ihr mit der kleinen Maria eine gute Nacht wünschte; Neforis aber nahm ihren Kuss kühl und verwundert hin und blickte nur forschend auf sie und ihren Sohn. Gewiss kamen ihr dabei mancherlei Gedanken, doch hielt sie es für angemessen, ihnen fürs erste keinen Ausdruck zu geben. Als habe sich nichts Besonderes ereignet, ließ sie die Mädchen sich entfernen, überwachte sie die Leute, welche ihren Gemahl in das Schlafzimmer trugen, gab sie ihm die weißen Kügelchen, deren er, um zu schlafen, bedurfte, schob sie ihm mit unermüdlicher Sorgfalt die Kissen so lange zurecht, bis ihm seine Lage behagte. Dann erst, und nachdem sie sich überzeugt hatte, dass ein Diener im Nebenzimmer wache, verließ sie ihn und suchte – es lag Gefahr im Verzug – ihren Sohn auf.
Die große, starke, etwas schwerfällige Frau war in ihrer Jugend ein stattliches, schlankes Mädchen, eine vornehme Erscheinung, ihr etwas nüchternes und unbewegliches Antlitz dagegen nie hervorragend schön gewesen. Aber die Jahre hatten ihm wenig angetan, und es war jetzt ein hübsches, volles, kühles Matronengesicht geworden, das bei langjähriger, aufopfernder Krankenpflege die Farbe verloren. Ihre Geburt und Stellung verliehen ihr etwas Sicheres und Selbstbewusstes, doch lag nichts Gewinnendes, Anziehendes in ihrem Wesen. Andermanns Leid und Freud war nicht das ihre, aber sie konnte sich darum doch bis zur Aufopferung mühen und plagen, und ihr Herz war fähig, sich für andere bis zu leidenschaftlicher Glut zu erhitzen. Freilich mussten diese anderen ihre nächsten Angehörigen sein, und nur diese. So war denn eine treuere, sorgfältigere Gattin und zärtlichere Mutter schwer zu finden, aber wollte man das, was an Liebe in ihr lebte, mit einem Gestirn vergleichen, so reichten seine kurzen Strahlen nicht über ihre allernächsten Blutsfreunde hinaus, und diese empfanden es billigerweise dankbar als etwas Besonderes und Beglückendes, in dem engen Liebeskreis dieser unfreigebigen Seele Aufnahme gefunden zu haben.
Jetzt pochte sie an Orions Wohnzimmer, und er begrüßte den späten Besuch mit Überraschung und Freude. Sie kam, um Wichtiges mit ihm zu besprechen, und tat es schon jetzt, weil Paulas und ihres Sohnes Benehmen von vorhin sie zur Eile zwang. Es war zwischen diesen beiden etwas vorgegangen, und die Nichte ihres Gatten stand weit außerhalb des engen Gebietes ihrer Liebe.
Es lasse sie nicht schlafen, leitete sie ihre Anrede ein. Sie habe einen Wunsch auf dem Herzen, und der Vater teile denselben. Orion wisse wohl, was sie meine; sie habe ja schon gestern mit ihm darüber geredet. Der Vater sei ihm liebreich entgegengekommen, habe seine Schulden gern und ohne ein tadelndes Wort bezahlt, und nun sei es an ihm, einen Strich über das alte, ungebundene Leben zu machen und einen eigenen Hausstand zu gründen. Die Braut, er wisse es ja, sei gefunden. »Vorhin«, sagte sie, »ist Susanna bei uns gewesen. Du, Bösewicht, sie gesteht es selbst, hast ihrer Katharina heute morgen das Köpfchen völlig verdreht!«
»Leider«, unterbrach er sie verdrießlich. »Dies Schöntun mit den Weibern ist mir geradezu zur Gewohnheit geworden; aber es soll von nun ab aus damit sein. ’s ist meiner nicht mehr würdig, und jetzt, liebe Mutter, jetzt fühl’ ich …«
»Dass der Ernst des Lebens beginnt«, stimmte Neforis ein. »Eben dahin zielt auch der Wunsch, der mich zu Dir führt. Du kennst ihn, und ich wüsste nicht, was Du dagegen einwenden solltest. Kurz und gut, lass mich morgen die Sache mit Frau Susanna ins reine bringen. Ihrer Tochter Neigung bist Du gewiss, sie ist die reichste Erbin im Lande, gut erzogen, und, ich wiederhole es, sie hat Dir ihr Herzchen geschenkt.«
»Und sie mag es behalten!« lachte Orion.
Da rief die Mutter erregt: »Ich bitte Dich, Deine Heiterkeit für passendere Zeiten und komische Dinge zu sparen – ich mein’ es sehr ernst, wenn ich sage: Das Mädchen ist lieb und gut und soll Dir, so Gott will, eine treue, zärtliche Gattin werden. Oder hast Du etwa das eigene Herz in Konstantinopel gelassen? Sollte Dich die schöne Verwandte des Senators Justinus … Aber Torheit! Du setzest doch wohl selbst kaum voraus, dass wir diese flatterige Griechin …«
Da umfasste sie Orion und rief zärtlich: »Nein, Mütterchen, nein! Konstantinopel liegt weit, weit hinter mir in grauen Nebeln, jenseits der äußersten Thule; aber hier, hier, ganz nah’, im Vaterhaus hab’ ich etwas viel Schöneres und Vollkommeneres gefunden, als den Leuten am Bosporus je gezeigt worden ist. Die Kleine passt nicht für einen Sohn unseres großen, breitschulterigen Stammes. Auch unsere künftigen Geschlechter sollen das gemeine Volk an Höhe in jeder Beziehung stolz überragen, und ich will kein Spielzeug zur Gattin, sondern ein Weib, wie Du es selbst in Deiner Jugend gewesen, ein hohes, vornehmes, schönes. Zu keiner Zaunkönigin, zu einer wahrhaft königlichen Jungfrau zieht mich das Herz. Was braucht’s da noch vieler Worte! Paula, die herrliche Tochter des edlen Thomas, sie hab’ ich gewählt! Vorhin ist es mir aufgegangen wie eine Offenbarung; für den Bund mit ihr bitt’ ich um euren Segen!«
Bis dahin hatte Frau Neforis den Sohn reden lassen. Was sie vernehmen zu müssen gefürchtet, frei und keck hatte er ihr’s zu hören gegeben. Und wie lang war es ihr gelungen, an sich zu halten! Jetzt aber war ihre Selbstbeherrschung zu Ende. Zitternd vor Aufregung schnitt sie ihm das Wort ab und rief mit hochgeröteten Wangen: »Nicht weiter, nicht weiter! Verhüte der Himmel, dass das, was ich da mit anhören musste, etwas anderes ist als ein flüchtiger, närrischer Einfall! Hast Du denn ganz vergessen, wer und was wir sind? Weißt Du nicht mehr, dass es Glaubensgenossen der Melchitin waren, die Dir Deine beiden lieben Brüder, uns zwei blühende Söhne erschlugen? Was gelten wir unter den Griechen, den Orthodoxen! Aber unter den Ägyptern, unter allen, welche der seligmachenden Lehre des Eutyches anhängen, unter den Monophysiten sind wir die ersten und wollen es bleiben und unser Ohr und Herz den Ketzern und ihrem Irrglauben verschließen! Ein Enkel des Menas, ein Bruder zweier Märtyrer für unser erhabenes Bekenntnis vermählt mit einer Melchitin! Tempelschänderisch, gotteslästerlich ist dieser Gedanke; ich finde dafür keine milderen Worte! Bevor ich, ehe der Vater dem nachgibt, wollen wir kinderlos enden! Und dieser Hergelaufnen willen, die nichts besitzt als ihren Bettelstolz und die zusammengescharrten Reste eines Vermögens, das nie mit dem unseren zu vergleichen gewesen, für diese Undankbare, die sich schwer bezwingt, mir, ihrer Wohltäterin, Deiner Mutter – bei Gott, ich rede die Wahrheit – auch nur den ›guten Morgen‹ zu bieten, womit ich selbst die Sklaven freundlich begrüße, um ihretwillen soll ich, sollen wir Eltern den Sohn verlieren, den einzigen, den der gnädige Himmel uns noch zu unserer Freude gelassen? Nein, nein, nein! Das sei ferne! Und Du, Orion, mein Herzensjunge, Du bist Dein Leben lang ein verwegener Bursche gewesen, aber den verruchten Mut findest Du doch nicht, dieser kalten Schönen zu liebe – in zwei Tagen hast Du sie einige Stunden gesehen – Deine alte Mutter, die Dich vierundzwanzig Jahre lang zärtlich am Herzen gehalten, zu Tode zu betrüben, und dem Vater, dessen Tage gezählt sind, den kurzen Lebensrest zu vergiften. Den Mut, Du mein Herzblatt, den findest Du nicht, nein, den kannst Du nicht finden! Und findest Du ihn dennoch in einer verfluchten Stunde, findest Du ihn, dann – ich bin Dir Dein Leben lang eine zärtliche Mutter gewesen – dann – so wahr Gott mir und dem Vater beistehen soll in unserer letzten Stunde, dann reiße ich die Liebe zu Dir aus der Seele wie ein schädliches Giftkraut, dann würde ich, und wenn mir das Herz dabei bräche …«
Da zog Orion die tief erregte Frau, welche sich längst seinen Armen entzogen, wieder an sich, legte ihr die Hand leicht an den Mund, küsste ihr beide Augen und flüsterte ihr ins Ohr:
»Er hat ja den Mut nicht und findet ihn auch schwerlich im Leben.« Dann fasste er ihre beiden Hände, schaute ihr offen ins Antlitz und rief: »Brrr! So angst wie bei diesen Drohungen ist Deinem Wagehalse noch nie zu Mut gewesen. Aber was waren das auch für grässliche Worte, und noch ärgere lagen Dir schon auf der Zunge! Mutter, Mutter Neforis! Dein Name bedeutet die Gute, aber wie böse, wie bitterböse kannst Du doch sein!«
Damit zog er die geliebte Frau fester an sich, küsste ihr in einer übermütigen Anwandlung, die ihn nach der Erschütterung, die er erfahren, wie ein Rückschlag überfiel, Haar und Schläfen und Wangen rasch hinter einander, und als sie ihn verließ, hatte er ihr gestattet, für ihn um die kleine Katharina zu werben, und dafür das Versprechen eingetauscht, dass dies noch nicht morgen, sondern frühestens übermorgen geschehen solle. Dieser Aufschub kam ihm schon wie eine Errungenschaft vor, und als er mit sich allein war und überdachte, was er da getan und der Mutter bewilligt hatte, blutete ihm zwar das Herz aus Wunden, deren Tiefe er selbst noch nicht ermaß, aber er freute sich dennoch, Paula noch nicht fester an sich gebunden zu haben. Seine Augen hatten ihr mancherlei erzählt, aber das Wort »Liebe« war noch nicht über seine Lippen gekommen, und darauf kam es doch an. Einen Handkuss einer schönen Verwandten zu geben, war dem Vetter sicher gestattet. Begehrenswert, o, wie begehrenswert war sie und blieb sie, aber um eines Mädchens willen, und wär’ es Aphrodite selbst oder eine der Musen oder Charitinnen gewesen, mit den Eltern brechen, das war ja undenkbar! Schöne Frauen gab es für ihn zu Tausenden auf Erden, aber nur eine Mutter, und wie oft hatte sein Herz schon schneller geschlagen, sich ein anderes erobert, dessen Gaben fröhlich genossen und sich dann wieder leicht und willig beruhigt.
Diesmal schien er freilich tiefer ergriffen zu sein als in früheren Fällen, und selbst die schöne persische Sklavin, um derentwillen er, kaum der Schule entwachsen, große Torheiten begangen, und die reizende Heliodora in Konstantinopel, der er noch ein Andenken schuldete, hatten so nicht auf ihn gewirkt. Diese Paula aufzugeben war schwer, aber es ging doch nicht anders! Morgen musste er versuchen, auf einen freundschaftlichen, geschwisterlichen Fuß mit ihr zu gelangen; denn dass sie sich wie die sanfte Heliodora, die ihr ja im Range gleich stand, mit seiner »Liebe« zufrieden geben werde, darauf durfte er nicht hoffen. Schön, unvergleichlich schön wär’ es doch gewesen, an der Seite dieses herrlichen Weibes durchs Leben zu fliegen! Fuhr er mit ihr durch die Hauptstadt, so war er sicher, dass alle Welt stillstehen und sich nach ihnen umschauen musste. Und wenn sie ihn liebte, und sie öffnete ihm zärtlich die Arme … O, o, warum hatte das tückische Schicksal sie zu einer Melchitin gemacht?! Und dann: leider, leider konnt’ es auch mit ihrem inneren Wesen nicht sonderlich gut beschaffen sein; hätte es ihr denn sonst nicht gelingen müssen, sich in zwei Jahren statt der Abneigung die Liebe seiner trefflichen, zärtlichen Mutter zu erwerben? Ja, am Ende war es doch gut so, wie es gekommen; aber Paulas Bild ließ dennoch nicht von ihm und verdarb ihm den Schlaf, und sein Verlangen nach ihrem Besitz kam nicht zur Ruhe.
Indessen begab sich Frau Neforis nicht sogleich zu ihrem Gatten zurück, sondern zu Paula. Diese Angelegenheit musste noch heute nach allen Seiten hin zum Abschluss gelangen! Hätte ihr Sieg dem Kranken ungetrübte Freude zu bereiten versprochen, so wäre sie mit der Freudenbotschaft zu ihm geeilt; denn sie kannte nichts Höheres als ihm einen guten Augenblick zu bereiten, aber der Mukaukas hatte ihrer Wahl nur widerwillig zugestimmt; denn auch ihm erschien Katharina zu klein und kindisch für den großen Sohn, dessen geistige Reife ihm bei mancher längeren Unterredung, die er nach seiner Heimkehr mit ihm gepflogen, zur Freude seines Vaterherzens unleugbar und bedeutend vor die Seele getreten war.