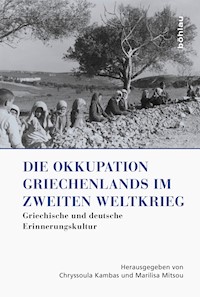
Die Okkupation Griechenlands im Zweiten Weltkrieg E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Köln
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Griechenland erinnert man sich bis heute an die deutsche Besatzung der Jahre 1941–1944, im deutschen Gedächtnis hingegen ist dieses Kriegsgeschehen vergessen oder wird beschwiegen. Die Asymmetrie der Vergangenheitsbewältigungen wird mehr als deutlich, wenn man, wie es die Beiträgerinnen und Beiträger dieses Buches getan haben, den beiden Erinnerungskulturen im öffentlichen Bewusstsein, in der Literatur und den Medien nachspürt. Vor allem in Krisenzeiten boomt das Klischee, doch der europäische Alltag mit seinen deutsch-griechischen Arbeits-, Familien- und Kulturbeziehungen setzt sich fort. Das Buch legt die interdisziplinären Grundlagen für eine überfällige Aufarbeitung und ein tragfähiges und dauerhaftes Geschichtsbewusstsein in beiden Ländern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 980
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GRIECHENLAND IN EUROPA
Kultur – Geschichte – Literatur
Herausgegeben von
Chryssoula Kambas und Marilisa Mitsou
Band 1
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung, Köln
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.
Umschlagabbildung:Zu Zwangsarbeit eingezogene Mädchen während des Straßenbaus in Kartero/Heraklion.Fotografie aus dem Archiv des Luftwaffenmajors K. Meidert,im Besitz von C. E. Mamalakis, Heraklion. Mit freundlicher Genehmigungvon C. E. Mamalakis
© 2015 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar WienUrsulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzesist unzulässig.
Korrektorat: Sabine Jansen, KölnGesamtherstellung: WBD Wissenschaftlicher Bücherdienst, Köln
ISBN 978-3-412-22467-7 (Print)
ISBN 978-3-412-50290-4
Datenkonvertierung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Einleitung – Zwei Gedächtnisse einer Vergangenheit und ihre Gegenwart
Gespaltene Erinnerungen
Hagen Fleischer
Vergangenheitspolitik und Erinnerung. Die deutsche Okkupation Griechenlands im Gedächtnis beider Länder
Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer
Die italienische Erinnerung an die Okkupation Griechenlands
Polymeris Voglis
Rückkehr der Vergangenheit. Die Erinnerung an den Widerstand in der politischen Kultur Griechenlands 1974–1989
Odette Varon-Vassard
Der Genozid an den griechischen Juden. Zeugnisse des Überlebens und Geschichtsschreibung seit 1948
Michalis Lychounas
Von der Sichtbarkeit jüdischen Lebens im nordgriechischen Raum.
Denkmalschutz und Geschichtsbewusstsein
Nadia Danova
Das Schicksal der Juden im bulgarischen Machtbereich der Jahre 1941–1944. Ein Forschungsbericht
Anna Maria Droumpouki
Das posthum gespaltene Gedächtnis von Kalavryta. Die öffentliche Geschichtswahrnehmung des Massakers in der Nachkriegszeit
Constantin Goschler
Distomo und die Glokalisierung der Entschädigung.
Vom griechischen Massakerort zum europäischen Erinnerungsort
Dimitris Kousouris
Kollaboration und Geschichtsschreibung in Griechenland
Eberhard Rondholz
Konstellation Kalter Krieg. Forschung und Geschichtspolitik zur deutschen Besatzung Griechenlands in der DDR
Gregor Kritidis
Überläufer. Deutsche Deserteure in den Reihen der griechischen Befreiungsbewegung
Andrea Schellinger
Erinnerungskultur und institutionelle Kulturmittler. Paralipomena zur Rezeption von Besatzung und Widerstand im Athener Goethe-Institut
Erfahrungen der Okkupierten
Fragiski Abatzopoulou
Griechische Juden und ihre Verfolgung als Thema der griechischen Literatur
Angela Kastrinaki
Das Bild des Deutschen in der griechischen Nachkriegsliteratur.
Ein Tauziehen politischer Kontrahenten
Panayiota Mini
Die Okkupation Griechenlands im griechischen Kino
Ulrich Moennig
Wie siamesische Zwillinge. Widerstand und Bürgerkrieg in der griechischen Nachkriegsliteratur
Athanasios Anastasiadis
Όχι οι Γερμανοί, οι δικοί μας – Nicht die Deutschen, unsere eigenen Leute.
Kollaborations-Diskurse in der Literatur der Nachgeborenen
Chryssoula Kambas
Deutsche Kriegsbesatzung auf Kreta und Leros im postmodernen deutschen Roman
Aufarbeitung oder Gedächtnisausfall
Miltos Pechlivanos
Zum historischen Gedächtnis der Geisteswissenschaften.
Die deutsche Neogräzistik und die Okkupation Griechenlands
Volker Riedel
Die deutsche Besatzung Griechenlands im Werk Franz Fühmanns
Helga Karrenbrock
Erhart Kästners Griechenland
Nafsika Mylona
Delphi und der ‚Mythos des Nationalsozialismus‘. Politisch-religiöse Implikate in Franz Spundas und Erhart Kästners Ortsbeschreibungen
Werner Liersch
Geleugnete Wahrheit. Erwin Strittmatters Einsatz in der Ägäis und sein Nachkriegsrealismus
Chryssoula Kambas
Junger Dichter als Soldat. Die Besatzung Griechenlands bei Walter Höllerer und Michael Guttenbrunner
Maria Biza
Übersetzte Zyklen von Jannis Ritsos. Ein Beitrag zum deutschen Gedächtnis an Okkupation und Widerstand
Walter Fähnders
Erasmus Schöfers Roman Tod in Athen
Martin Vöhler
Die Ägäis als Denkraum Erich Arendts
Autorenverzeichnis
Personenregister
Einleitung
Zwei Gedächtnisse einer Vergangenheit und ihre Gegenwart
Nach zweijähriger Arbeit kann nun einer deutschsprachigen Leserschaft das Buch übergeben werden, das dem 2010 erschienenen Hellas verstehen folgt.1 Hervorgegangen ist es aus dem im Juli 2012 gemeinsam an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität veranstalteten Symposium „Erinnerungskultur und Geschichtspolitik der Okkupation Griechenlands (1941–1944). Deutsch-griechisches Gedächtnis in Medien und Literatur“. Bereits während der dreitägigen Veranstaltung wurde ein Resümee, am Rande und in der öffentlichen Diskussion, mehrfach gezogen: Ein „deutsch-griechisches“ Gedächtnis dieser nichtsdestotrotz genuin beidseitigen und gemeinsamen deutsch-griechischen Geschichtsphase gibt es nicht. Der Titel des vorliegenden Buches spricht jetzt konsequenterweise von „griechischer und deutscher Erinnerungskultur“. Von Art und Gründen der Asymmetrie wird weiter unten zu sprechen sein.
Mit Tagung und Publikation, so die Idee am Beginn, sollte eine beiderseitige Bestandsaufnahme der „Aufarbeitung der Vergangenheit“ der deutschen Okkupation Griechenlands versucht werden. Von der Anlage her sollte der gesamte Zeitraum über repräsentative Einzelfallstudien abgedeckt werden, von den ersten ‚Bewältigungs‘-Anfängen über die geschichtspolitischen Diskurse der Politik und der Medien der 1990er Jahre und den kritischen Geschichtsdebatten dazu bis heute: Welche Erfahrungen, welche Gestaltungen oder Narrationen in griechischer Geschichtsschreibung, Literatur und Medien können für deutsche Leser einen Einblick in die Fülle und zugleich Veränderung des griechischen Gedächtnisses geben? Und dazu umgekehrt: Wie verlief im Laufe der Jahrzehnte in deutscher Geschichtsschreibung, Literatur und Medien der Umgang mit der deutschen Besatzung Griechenlands?2
Seit der Jahrtausendwende ist eine Reihe historischer Titel über das ‚primäre Geschehen‘ (Hockerts) in deutscher Sprache erschienen3 – die griechischen ließen sich nur in [<<9||10>>] einer voluminösen Bibliographie aufführen. Wer aber hierzulande die Tagungen aus Anlass der 70jährigen Wiederkehr des deutschen Einfalls in Griechenland besuchte,4 durfte staunen: Die hiesige scientific community der Zweite-Weltkriegs-Forscher war ausgeblieben, und das Thema wie gewohnt in der Hand der bekannten Griechenlandexperten.5 Das waren die Auspizien, unter denen wir zu gemeinsamer deutsch-griechischer Geschichtsarbeit ermuntern wollten, unserer bescheidenen kulturwissenschaftlich interdisziplinären Ressourcen aus Germanistik und Neogräzistik sehr bewusst. Allein schon um die Philologien einzubinden, bot sich das Thema der beiden Gedächtnisse an. Und entsprechend der Besatzungsmächte des Landes sollten auch Kollegen aus Italien und Bulgarien zu Wort kommen, sodass zumindest ein erster Einblick in den Stand der Aufarbeitung dort den Geschichtsvorgang zur Multilateralität hin erweitert.
Das „deutsche Vergessen“ ist ein gewolltes und dann auch ein gewachsenes. Zu seiner Genese kann man das Grundlegende in Hellas verstehen nachlesen.6 Mittlerweile ist es auch ein quasi ‚natürliches‘ Resultat von Generation und Erinnerung. Nichtsdestotrotz ist die öffentliche Ignoranz in Deutschland in Sachen der deutschen Kriegsverbrechen auf griechischem Boden zuletzt von einer gut vorbereiteten, gezielt informierenden Begleitberichterstattung während des Besuchs von Bundespräsident Gauck in Athen und Lyngiades/Epirus (März 2014) durchbrochen worden. Ansonsten gilt jedoch für das öffentliche Bewusstsein weiter, was bereits Sigrid Skarpelis-Sperk im Jahre 2000 bemerkte – und das war immerhin zwischen erster und zweiter Fassung der landesweit stark besuchten Wanderausstellung Verbrechen der Wehrmacht (Institut für Sozialforschung, Hamburg), die einen beachtlichen Griechenlandteil hatte: „Über Oradour kann man in fast allen deutschen Schulbüchern lesen. Distomo wird man vergeblich suchen. Diese Missachtung ist der griechischen Öffentlichkeit bewusst – fast in jedem Zeitungsartikel über das Distomo-Urteil wurde darauf hingewiesen. […] Das große [<<10||11>>] Verkennen von deutscher Seite ist auch angesichts der Millionen deutscher Urlauber, die jedes Jahr Griechenland bar jeglicher historischer Kenntnisse besuchen, erstaunlich.“7
Mit entsprechenden Voraussetzungen noch 2011 verfassten zwei als Experten bestaunte Journalisten des Focus – breit sekundiert vom damaligen BILD-Vize Nikolaus Blome mit Schlagzeilen und Sequenzen wie „Griechen greifen Deutschland wieder an“ – ihren verheerenden Artikel Betrüger in der Euro Familie – 2000 Jahre Niedergang. Ganz abgesehen vom bislang immer noch nicht ganz zurückgesteuerten Anklageton der wechselseitigen Berichterstattungen mittels Freund-Feind-Stereotypen: Das Ungleichgewicht zwischen Ignoranz zum einen und langjähriger, auch heute weiterlaufender europäischer Normalität zum anderen (ökonomische Verflechtungen, familiäre Verbindungen usw.) erfordert es, in beiden Ländern über Erinnern und Vergessen neu nachzudenken. Diese Konstellation bildete den entscheidenden Impuls zum Thema unserer Tagung. Alle heute unterschiedliche „Aktualität“ in beiden Ländern setzte erst kurz nach der Tagung ein.
„… für eine Partisanenuntat brauchen wir keine Sühne zu leisten.“ Geschichtspolitik der BRD und Gedächtnis
Vorab eine knappe Skizze, welche nicht hinnehmbaren, deutsch zu verantwortenden Geschehnisse bis heute ohne Aufarbeitung – und als solche ohne nachträgliche offizielle politische Anerkennung – geblieben sind: Nicht hinnehmbar für Griechenland ist die ‚Ökonomie‘ der Besatzung, verbunden mit den Repressalien gegen die Zivilbevölkerung. Bundesdeutscher Diplomatie und Rechtsprechung war es von Anfang an darum zu tun, beides auf sich beruhen zu lassen. Nicht daran zu rühren, die brutalsten Untaten Kriegsrecht und ‚Kriegsbrauch‘ zuzuschieben, das war die Richtung, wenn die damit befassten Stellen mauerten. Die Totalausbeutung des Landes, die Inflationspolitik mit der Folge von Schwarzmarkt und rapider Verarmung der breiten Masse der Bevölkerung, deren weitere Folge die mehr als 100.000 Hungertoten bereits während des ersten Besatzungswinters waren – dies alles bemühte man sich nach 1950 nicht auf die Agenda der wieder aufgenommenen Beziehungen kommen zu lassen. Das Bestreben war beiderseits, die ‚alte Freundschaft‘ vor 1941 wieder zu erneuern.
Den für Griechenland unwiederbringlichen Verlust, nach Wertsubstanz nicht verrechenbar und als Verbrechen nicht ‚wiedergutzumachen‘, haben die deutschen Massaker angerichtet. Sie sind aus Rache oder als ‚Vorbeugemaßnahme‘ gegen die „Bandengefahr“ an Zivilisten verübt worden. Außerhalb eigentlicher Kriegshandlungen mit Partisanen wurden Dorf-Bewohner hingemordet, die nicht mehr fliehen konnten bzw. die sich vom [<<11||12>>] Kriegsrecht geschützt glaubten. Deutsche Standard‚begründung‘ war, die Dörfer hätten den Widerstand unterstützt bzw. er käme aus ihrem Umfeld oder es bestehe der Verdacht dazu.8 Dieser seit 1943 nahezu tägliche Vorgang war jeweils ein Kriegsverbrechen. Nach 1950 wurden daraus „sogenannte Kriegsverbrechen“: ‚sogenannt‘, weil das Auswärtige Amt einen gerechten Selbstschutz-Charakter zunächst rechtlich zur Vorbeugung von Anklageerhebungen, insgesamt jedoch als Geschichtsversion durchdrücken wollte; es sollte ein reaktives Handeln sein auf „Morde an deutschen Soldaten“. In actu seit 1941 stellte man sogar entsprechende Schilder vor den Ruinen eines niedergebrannten Dorfes auf, die eigene ‚Gerechtigkeit‘ zu demonstrieren. Die Abschlachtung von Frauen und Kindern, ebenso die Massenerschießungen von Geiseln, galt es in der Nachkriegsdiplomatie zu einer mit dem Kriegsrecht vereinbaren Kriegshandlung zu legitimieren.
Dem kam die griechische Seite entgegen, wenn König Paul etwa behauptete, „der ‚Banditenkrieg‘ habe mehr Opfer gefordert als die Besatzungszeit.“9 Entsprechend wurden die hohen politischen Repräsentanten der BRD (Adenauer, Heuss, Erhard u. a.) vor ihren Griechenland-Reisen instruiert: „Glücklicherweise sind die Begebenheiten zur Zeit der deutschen Besetzung […] durch die Grausamkeiten des griechischen Bürgerkrieges […] überdeckt worden.“10 Mit anderen Worten: komplizierte, viel aktuellere innergriechische Verhältnisse fernab von Deutschland und jeder deutschen Beteiligung, exkulpieren die Zeit der deutschen Besatzung sogar im griechischen Gedächtnis. Müssen ‚wir‘ da päpstlicher als der Papst sein? Aussparung dieses Themas in der deutschen wie griechischen Öffentlichkeit, Mauern gegen unverbesserliche Mahner (oder „die Nonkonformisten“), das war die Devise des Auswärtigen Amtes von Beginn an. Und das [<<12||13>>] ist die Basis der langsam wieder ‚freundschaftlich‘ werdenden, sich ‚normalisierenden‘ deutsch-griechischen Beziehungen seit 1950.
Will man von einer deutschen Erinnerungsarbeit an die in Griechenland begangenen Verbrechen sprechen, um die es bei der Besatzungsaufarbeitung immer ging und weiter gehen wird, ist in diesem sensiblen Bereich anzusetzen. Es hat einzelne Initiativen, z. B. die „Aktion Sühnezeichen“,11 gegeben. Sie sind in unserem Band leider nicht mit eigenem Beitrag vertreten. Deshalb erfolgt an dieser Stelle, beispielhaft, der Hinweis auf die Lebensarbeit von Ehrengard Schramm (1900–1985). Sie war Göttinger Landtagsabgeordnete der SPD in Hannover, 1947 auch Gründungsmitglied des Deutschen Frauenrings. Die von ihrem Sohn, dem Osteuropa-Historiker Gottfried Schramm, noch mit ihrer Hilfe begonnene Zusammenstellung von Aufzeichnungen über ihre jahrzehntelange Hilfsarbeit im völlig verarmten Nachkriegsgriechenland, geben ein gutes Bild von der Art des Mauerns in den Reihen des Auswärtigen Amtes und der Athener Botschaft. Es lässt sich etwa nachverfolgen, wie das AA das Tabu der Befassung mit den Massakern, und selbst ihrer Benennung als Kriegsverbrechen, aufrichtete und an die ihm übergeordneten Staatsrepräsentanten weitergab. Zugleich liest man in Ehrengard Schramms Bericht von der Reihe derer, die ihre Hilfsaktionen möglich machten und unterstützten. Ihr Dokument erzählt also auch vom gelegentlichen Unterlaufen des Tabus innerhalb der frühen deutschen Staatsinstitutionen, also von internem Einspruch gegen die offizielle Pontius-Pilatus-Haltung.
Dominant war das AA mit seinem Druck auf die Initiatorin, ihre Schritte als absolut privat zu deklarieren. Sie selbst, zutiefst überzeugt vom Verbrechenscharakter der Massaker, wollte Einrichtungen von nützlicher Infrastruktur zur weiteren Selbsthilfe der Hinterbliebenen auf den Weg bringen. Zuvor allerdings war die Sprache einigermaßen zu lernen, waren amtliche Unterlagen zu studieren, ein Bild von Früher und Heute zu gewinnen, schließlich das Vertrauen der Lokalpolitiker und der Witwen selbst. Wichtig und nützlich, um die Reichweite ihrer Versöhnungsgeste für das offizielle Griechenland einzuschätzen, ist zu wissen: Die staatlichen Stellen in Athen stützten diese Arbeit nicht.
Alles, was man in Athen behauptet hatte, nicht zu besitzen, gab es hier [in Igoumenitsa, für die Region Epirus, Verf.] auf dem Haufen: so etwa die gedruckte Bevölkerungsstatistik von 1940 und 1951, in der jedes Dorf Griechenlands verzeichnet ist. Dazu ein riesiges Atlaswerk aus den dreißiger Jahren, in dem ich ebenfalls jedes Dorf mit Höhenangabe finden konnte. In meinem Hotel legte ich mir eine Liste der Dörfer des Epirus an und begann zu ahnen, welches schreckliche Geschehen sich hier in der Besatzungszeit abgespielt hatte. […] Hunderte von Orten waren im Krieg zerstört worden, zum guten Teil in völlig sinnlosen Revancheaktionen der [<<13||14>>] Besatzungsmacht gegen Unschuldige. Dutzende von Ortschaften hatten Massenhinrichtungen von ähnlichem Ausmaß erlebt wie in Mazedonien Klissoura und auf der Peloponnes Kalavryta.12
Ergänzend ist anzumerken: Dasselbe gilt für die Peloponnes und Westmakedonien insgesamt, für Thessalien und vor allem Kreta.
Bald bemerkte sie den (scheinbaren) Widerspruch zwischen Tagesbericht und Notizen in den Wehrmachtsakten. Etwa, wenn die Einträge zu 15 Epirus-Dörfern im Umkreis Aidonochori, Melissopetra, Aetopetra am 14.7.1943 nur knapp vermerken, „wegen Beherbergung von Banden und Niederlage von Munition“13 abgebrannt. Und wie für die nun neu aufzubauenden freundschaftlichen Beziehungen zu Griechenland die offizielle deutsche Seite auf dem legitimen Kriegshandlungscharakter („Sühnemaßnahme“) insistierte: „Wegen einer Vergeltungsaktion für eine Partisanenuntat brauchen wir keine Sühne zu leisten“14; und dann die ‚historische‘ Argumentation, die Untaten des griechischen Bürgerkriegs seien viel schlimmer gewesen als die ‚Maßnahmen‘ der deutschen Besatzungsmacht. So war die offizielle deutsche Position untermauert. In der Sache haben die höheren Staatsrepräsentanten der BRD möglicherweise eine differenziertere Einstellung gehabt. Vom Besuch Adenauers in Athen etwa, den Ehrengard Schramm miterlebte, überliefert sie in Sachen Hilfe für Kalavryta seinen Ausspruch: „Und dabei ist dies viel schlimmer als Oradour […] Ich will etwas für diesen Ort tun.“15 Aus einer nicht weiter benannten Kasse soll Adenauer einen Scheck über 50.000 DM für Kalavryta ausgestellt haben, der dann im Königshaus über 8 Monate lang unauffindbar blieb, schließlich aber wieder auftauchte.16 Man wird nach den Ausführungen zur griechischen Aufarbeitung der Besatzungszeit weiter unten verstehen, warum die [<<14||15>>] griechischen Regierungen, an ihrer Spitze der Monarch und neben ihm die Monarchin, lieber der Version des AA als der oben zitierten des ersten geschichtsträchtigen Kanzlers der BRD folgten.
Ehrengard Schramm selbst stand übrigens eventuellen Partisanenkindern anfangs nicht sehr unvoreingenommen versöhnlich gegenüber. Explizit ihnen sollte nichts von ihrer privaten Hilfe zugute kommen.17 Doch im Bewusstsein, die Massaker und Geiselerschießungen seitens der deutschen Einheiten müssen, unabhängig von Kampfhandlungen mit dem Widerstand, juristisch bewertet werden, wusste sie auch, solche Verbrechen sind überhaupt nicht gutzumachen oder irgendwie zu entschädigen. So arrangierte sie sich von vornherein mit dem privaten Charakter ihrer Hilfen. Eine öffentliche Wirkung erfolgte dennoch über die Gemeinnützigkeit des eingetragenen Vereins, sie stützte sich auf die „Trägerschaften“ des Deutschen Frauenrings und später auch der Carl Duisberg-Gesellschaft. Darüber konnten Industriebetriebe – Siemens, Bayer u. a. – zu kleineren materiellen Geschenkleistungen veranlasst und auch Parlamentsausschüsse zur Unterstützung gewonnen werden: „Dadurch gedachte ich den Eindruck zu vermeiden, es handele sich um eine Reparationsleistung. Das nämlich hätte unserer Regierung eine Flut weiterer Anträge beschert.“18 Bis heute wird den unschuldigen Opfern und ihren Nachfahren in Griechenland und anderswo, um möglichen Klagen um materielle Restitution vorzubeugen, die Anerkennung des historischen Unrechts vorenthalten. Hierbei geht es dem heutigen Deutschland, der Berliner Republik, nicht allein um die Folgen aus der Vergangenheit, es geht vor allem um den Handlungsspielraum in der Gegenwart – als Staat und im Kriegsfall, z. B. in Afghanistan.
Und trotz allem, gerade die Okkupation Griechenlands und die Nichtaufarbeitung lehren die Problematik dieses vom Haager Internationalen Gerichtshof vorläufig festgeschriebenen Freischeins für staatlich verantwortete Einsätze gegen Zivilbevölkerungen: Kalavryta, Distomo, nun auch Lyngiades,19 gelten der kritischen Öffentlichkeit in Europa als Symbolnamen für die Nichtbelangbarkeit von Staaten bei von ihnen ausgeübten, völker- und kriegsrechtswidrigen Übergriffen auf Zivilisten.20 Das am Fuße des Parnass-Gebirges gelegene griechische Dorf Distomo, dessen Einwohner durch eine SS-Polizei-Panzergrenadier-Einheit im Juni 1944 massakriert wurden, geriet in Vergessenheit, bis 1995, als die Opfergemeinde zivilrechtliche Entschädigungsklagen vor griechischen und [<<15||16>>] deutschen Gerichten erhob. Der juristische Konflikt weist auf den Zusammenhang von Entschädigung und Erinnerung, Verrechtlichung und Politisierung hin. In Bezug auf die als Vergeltung im Dezember 1943 übernommene „Säuberungs-Aktion Kalavryta“, die zur Exekution der 499 männlichen Einwohner der Stadt führte und 200 weiterer Opfer aus den umliegenden Dörfern, entstand dagegen durch unterschiedliche Argumentationsmuster eine gespaltene Erinnerung, die eine typische posttraumatische Situation in griechischen Märtyrerdörfern veranschaulicht.21
Soviel zum offiziellen Vergessenmachenwollen auf deutscher Seite. Soviel aber auch zum Mut einzelner Deutscher, Mauern und geschichtspolitische Hypokrisie zu unterlaufen, um trotz der deutscherseits begangenen schlimmsten Untaten den Überlebenden und Nachfahren praktisch versöhnend entgegenzutreten. Letzteres hat in Griechenland hohe Anerkennung bei den Betroffenen gefunden. Die Haltung des Mauerns hingegen verbittert in Griechenland bis heute. Sie geht ganz entscheidend auf die im AA aus dem Apparat des Vorgängerstaats übernommenen, mit ‚Persilschein‘ versehenen Beamten und Diplomaten zurück. Für Ehrengard Schramm ist es auf Schritte der Versöhnung vor Ort angekommen, sie würden einmal von öffentlicher Wirkung sein. Es sollte den heutigen, auch hohen Repräsentanten der Berliner Republik möglich sein, auf Basis der historischen Sachlage und endlich in Bereitschaft zu unpolemischer Geschichtsarbeit, die Unschuld der Opfer anzuerkennen. Dann könnten geschichtspolitisch, diesmal in Einklang mit dem beanspruchten Maßstab Demokratie, auch gegenüber Griechenland die Konsequenzen aus der nationalsozialistischen deutschen Vergangenheit gezogen werden. Der Bundestag als ganzer kann ebenfalls hierbei mit einer Stellungnahme in der deutschen Öffentlichkeit viel bewirken.
„Makronisos ist eine Universität, Makronisos ist das Grab des Kommunismus“ – Griechischer ‚nationaler Konsens‘ und Bürgerkrieg
Innerhalb Griechenlands war die Gewichtung eine andere, obgleich auch staatliche Stellen bis hin zum Königshaus kräftig an der Mauer des Schweigens bauten. Es soll ein kurzer Überblick über die Kräftekonstellation im griechischen Bürgerkrieg folgen. Er zögerte das Kriegsende bis 1949 hinaus. Das Land war schon ausgeplündert und verwüstet von den deutschen Besatzern zurückgelassen worden, als zwecks Staatskontinuität – und auf die Wiedereinführung der Monarchie dabei insistierte die ‚Schutzmacht‘ Großbritannien bzw. Churchill persönlich – auch die Eingliederung in den Westblock besiegelt werden sollte. Großbritannien hat beim Kampf gegen den EAM-Widerstand de facto nahtlos an den deutschen Besatzer angeknüpft. Eine Gelegenheit hierzu bot nach dessen Abzug die inkonsequente, zumal von Stalin preisgegebene Strategie der Linken insbesondere in Athen während der Dezemberkämpfe (Dekemvriana). Den liberalen Kräften erschien, im Vergleich zur in der fünfjährigen Metaxas-Diktatur [<<16||17>>] diskreditierten Monarchie, diese nun weniger gefährlich als die EAM, und sie widersetzten sich nicht weiter der Aufrüstung antikommunistischer Formationen. Diese bestanden u. a. aus den entsprechend nationalistisch ‚gesiebten‘ Exiltruppen, weiteren Anti-EAM-Widerstandsgruppen und den 1943/44 deutscherseits aufgestellten „Sicherheitsbataillonen“ und anderen Kollaborationsverbänden. In Reaktion auf den „weißen Terror“ riefen EAM und kleinere Linksgruppierungen zur Enthaltung bei den Wahlen von 1946 auf. Diese fatale Selbstisolierung der linken Kräfte forcierte die Restaurierung der Monarchie über das problematische Plebiszit am 1. September 1946. Ab 1947 übernahmen die USA infolge britischer Insolvenz die neue ‚Schutzmacht‘-Rolle im Rahmen der Truman-Doktrin. Der kommunistisch dominierte, antimonarchische EAM-Block wurde schließlich in einem regulären Krieg mit wechselnden Fronten geschlagen. Die unterlegenen Kräfte der „Demokratischen Armee“ („Banditen“, vormals ELAS) flüchteten über die albanische Grenze. Nach ihrer Flucht wurden sie ausgebürgert. Ihre im Lande verbliebenen Familien bzw. Anhänger wurden sozial blockiert bzw. stigmatisiert, politisch waren sie in der Nachbürgerkriegszeit chancenlos.
Schon seit 1945 verfolgten Staat und Parastaat die Linke diesseits der Front brutal.22 Sie bildeten die eine Seite der Gewalten, die das deutsche AA, wohlwissend, für brutaler als die nationalsozialistische bewertete. Bereits die deutschen Besatzer selbst hatten ja mit systematisierter Spaltpropaganda die Saat des Bürgerkriegs ausgelegt und landesweit begonnen, unter Einzug griechischer ‚Freiwilliger‘, das bereits unter dem Metaxas-Regime begonnene Konzentrationslager-System weiter auszubauen.23 Der gewaltige Ausbau der Lager folgte in der Bürgerkriegszeit. Nur so konnte die Massenverfolgung der Linken ‚organisatorisch‘ bewältigt werden.24 Neben Internierungen in KZ, auch auf abgelegenen oder unbewohnten Inseln, wurde die Linke in den Städten zum vogelfreien Gegner erklärt. Man setzte ‚Sondergerichte‘ ein, und die des Kommunismus Verdächtigten bzw. Denunzierte wurden in die Gefängnisse gesteckt, wo Folter und Erschießungen an der Tagesordnung bzw. ‚Umerziehung‘ deren Motto waren.25 Unter dem Vorzeichen der ‚kontrollierten Demokratie‘ sollten die („kommunistischen“) [<<17||18>>] Häftlinge abschwören – mit Unterschrift. Auf Seiten der Linken taten dazu analoge kommunistische ‚Volksgerichte‘ ihre ‚Arbeit‘. So wurde nach Beendigung der Kampfphase die Linke ‚wiedereingegliedert‘. Der bereits seit der Königsdiktatur 1936/41 bzw. im weiteren deutscherseits aufgebaute Polizeistaat („Parakratos“) blieb, mit Modifikationen, bis 1974 erhalten, also bis zum Ende der Obristendiktatur. Heute ist deswegen in den Geschichtsdebatten oft die Rede vom „Bürgerkrieg bis 1974“.
Das ‚nationale‘ griechische Gedächtnis der deutschen Okkupation im Wandel
Zentral für das Verständnis der griechischen Aufarbeitung der Okkupation ist der innergriechische Streit um den ‚nationalen Widerstand‘. Diesen geleistet zu haben machte im Nachkrieg, etwa für die Mitwirkung im öffentlichen Dienst, bei Eintritt in die Polizei oder Ansprüchen auf ‚Ehrenrenten‘, die siegreiche Rechte bis in die Reihen der Kollaborateure geltend. Die – reale und metaphorische – Ausgrenzung der „Banditen“, so die dem NS-Sprachgebrauch („Banden“) analoge Bezeichnung für die bekämpfte EAM, wurde nicht allein im Akt politischer Säuberung vollzogen. Der Widerstand, den die Mehrheit der politisch aktiven Bevölkerung bis 1944 getragen hatte, war nun als Verbrechen oder Verrat abgestempelt und entsprechend tabuisiert.
Die Grenzziehung zwischen anerkannt ‚nationalem‘ und verteufeltem ‚kommunistischen‘ Widerstand wurde erst 1982 von der Regierung Andreas Papandreou revidiert, die den EAM-Widerstand gleichfalls zum nationalen rehabilitierte. Mit Anerkennung der EAM als Widerstandspartei kreierte sich die PASOK die Legitimität ante ovum, eine Konstruktion rückwirkender Kontinuität seit dem Kampf gegen die deutsche Besatzung, und dabei als Opfer der Geschichte. Entsprechend wurde und wird die linke Bürgerkriegspartei beerbt, so als handele es sich nicht um die Arbeit für ein national integratives Geschichtsbewusstsein, sondern vielmehr um die Weltkulturerbe-Frage im Sinne der UNESCO.26 Im August 2003 veranstaltete das Orchester Mikis Theodorakis eine mehrtägige festliche Konzertaufführung im linken Galastil auf der ehemaligen Strafgefangeneninsel Makronisos vor den Toren Athens, während derer die neue politische Klasse zusammen mit dem Komponisten der Opfer dieses schwarzen Ortes gedachte.27 Im früheren, noch postdiktatorischen Kontext der Demokratisierung (Metapolitefsi) ist [<<18||19>>] das Konzept der Wanderausstellungen von 1986/87 in den Goethe-Instituten Griechenlands zu sehen: Thema sind die deutschen Überläufer der Wehrmacht auf die Seite des ELAS. Es visualierte quellenbasiert den innerhalb der deutschen Besatzungstruppen in Griechenland erfolgten Widerstand. Die griechische Öffentlichkeit hatte bis dahin weder den Tatbestand des innerdeutschen Widerstands verstanden noch die Bedeutung des Projekts für die deutsche Geschichte28 bzw. eine deutsch-griechische „Aufarbeitung der Vergangenheit“ (Adorno). Daß es eine tendenziell gemeinsame Widerstandserinnerung gab, zeigen die Desertionen von 999ern, unter anderem am Beispiel Wolfgang Abendroths, zum ELAS. In der westdeutschen Öffentlichkeit wurde auch dies noch in den 1980er Jahren, sogar von Jürgen Habermas, mit Hilfe des denunziatorisch neologischen Etiketts „Partisanenprofessor“ ins Zwielicht gezogen, was insbesondere Abendroths Lehrtätigkeit sowie Haltung nicht verdient haben. Umgekehrt machte die antifaschistisch konzentrierte Geschichtsforschung in der DDR diese Linie stark, nämlich als Teil des ‚eigenen Antifaschismus‘ in der Tradition des deutschen Exils in der Sowjetunion. Auf dieser Basis wurden auch die 1949 in die Ostblockländer vertriebenen ELAS-Kämpfer hier aufgenommen, und in der DDR entstanden in diesem Kontext Ansätze zeitgeschichtlicher Forschung über die Okkupation Griechenlands und zum griechischen Widerstand.29
Das gespaltene Gedächtnis sollte versöhnt werden. Für die Rechte und – teilweise auch – die Linke erfreulich, wurden 1989 die Archive der seit Metaxas existierenden Sicherheitspolizei vernichtet.30 Kollaboration nach verschiedenen Graden, vom griechischen Verwaltungsbeamten, der dem deutschen Militär unterstand, über den Denunzianten bis zum Legionär, blieb als hartes Tabu erhalten. Sie ist erst im letzten Jahrzehnt historisch detaillierter aufgearbeitet.31 Trotz Anerkennung des EAM-Widerstands bleibt das Gedächtnis weiter ein gespaltenes.
[<<19||20>>] Allein in der Krise und gegen die europäische Austeritätspolitik, in der breite Bevölkerungsgruppen sich gegen den quasi-steuerlichen Einbehalt von Lohn- und anderen Abgaben nicht wehren können, stellt sich eine Einheit des Gedächtnisses oberflächlich her. Medial und parteipolitisch erzeugt, steht sie im tagespolitischen Dienst. Die extreme Rechte (CA) und das Linksbündnis (SYRIZA) finden in den Reparationsforderungen gegenüber Deutschland zusammen. Die Gedächtnisse der Märtyrerdörfer werden instrumentalisiert, einschließlich der Distomo-Initiative, die als erste gegen das Schweigen der Politikerklasse beider Länder und Europas nach mehr als fünfzig Jahren auf das unter den Teppich gekehrte Unrecht aufmerksam machen konnte.32 Heutige medial in Griechenland griffige Ressentiments gegen das „Vierte Reich“ bzw. Deutschland – in der Tat ist die deutsche ‚neue Hegemonialrolle‘ in der EU kritisch zu diskutieren33 – setzen auf Nationalismen, die den in seiner Existenz angegriffenen einzelnen Bürger mit dem Krisenlösungsangebot der jeweiligen Partei ‚überzeugen‘ wollen. Und viele Griechen, die man im Gespräch nach ihrer Einstellung zur Wehrmachts-Okkupation und deutschen Reparationen fragt, sagen: So reden die Politiker, das hat mit meiner Sicht der Geschichte und den Deutschen heute nichts zu tun. Von einer griechischen, in breiteren Gesellschaftsschichten neu aufgenommenen Geschichtsarbeit oder gar von innergriechischer Aussöhnung ist die neue ‚Einheit‘ rechter und linker Erinnerung in diesem Punkt ansonsten weit entfernt. Das offizielle Athen, das abbröckelnde Zustimmungswerte zu verkraften hat, hüllt sich abwartend in geschichtspolitisch dezentes Schweigen. Zusammen mit der deutscherseits öffentlich noch unaufgearbeiteten Spezifik ‚Mauern und Schweigen‘ wirkt die instrumentalisierende Erinnerung nichtsdestotrotz mit ungebremster Kraft ‚national‘ – ein zueinander brandgefährliches Verhältnis.
Judenverfolgung im griechischen Gedächtnis
Mit den Beiträgen zur Deportation und Ermordung der griechischen Juden will unser Band einem im deutschen Shoah-Memorial bislang wenig beachteten Unterschied jüdischer Kultur Aufmerksamkeit schenken.34 In der Umfassenheit des deutschen [<<20||21>>] Holocaust-Gedenkens geht er unter, und das öffentliche Bewusstsein verbindet die Shoah auch kaum mit Griechenland. Außerdem fiel das wiedereinsetzende Wachsen jüdischer Gemeinden in Deutschland nach 1989, das meist durch den Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion erfolgte, mit der Aufgabe zusammen, im nun vereinten Deutschland das Gedächtnis des Zweiten Weltkriegs neu auszurichten. Entsprechend dem seit den 1950er Jahren gepflegten geschichtspolitischen ‚Vergessen‘ der Okkupation Griechenlands ist auch die Vielfalt der Kultur der griechischen Juden im deutschen Gedenken inexistent. Die Beiträge thematisieren das griechisch-jüdische Zusammenleben im Spiegel von griechischer Literatur, jüdischen Überlebensberichten sowie als Teil der Geschichtsschreibung.35 Über das Holocaust Memorial und die Mahnmale hinaus ist für Griechenland die Frage von Denkmalerhalt mit der von Repräsentanz früheren jüdischen Lebens im öffentlichen Raum Nordgriechenlands verbunden.36
Judenverfolgung und -vernichtung in der griechischen Literatur als Thema liegt einer Fülle von Werken zugrunde.37 Diachronisch gesehen, darf der ‚Dialog mit dem Anderen‘ als genuin griechische Erinnerungskultur gelten. Doch die Selbstbefragung nach dem Verlust im engeren Sinne setzt erst ab den 1960er Jahren ein. Aufgenommen wurde sie vor allem von Schriftstellern aus Thessaloniki. Die eigene Rolle als Trauma, von der Passivität bis hin zur Mitwirkung bei der Verschleppung jüdischer Bürger, wird jedoch erst von der Enkelgeneration literarisch gestaltet. Deren postmoderne Romane greifen die von den Vätern hinterlassene Schuld auf und erörtern etwa zum einen die bislang tabuisierte Beteiligung griechischer Kollaborateure an der Etablierung des Besatzungsregimes oder zum anderen die ökonomische Kollaboration in der bürgerlichen Honoratiorenschicht sowie im weiteren Kreis der Profiteure von Besatzung und Shoah (Davvetas, Nikolaïdou). Sie entwickeln Modelldiskurse aus einer ‚postmemorial‘ epistemologischen Position und kompensieren das Mitteilungsdefizit der [<<21||22>>] vorangegangenen Generationen mit dokumentarischem Material, durch Imagination oder auch mit Hilfe von Erinnerungen aus zweiter Hand.38
Besatzung und Bürgerkrieg im literarischen griechischen Gedächtnis
In der griechischen Literatur entstanden sofort nach Kriegsende Diskurse des Erinnerns an Okkupation und Widerstand. Selbst Kollaborations- und Mitschuld-Diskurse entwickelten sich in der frühen Nachkriegszeit und beeinflussten die kritische Geschichtsforschung. Während aber der griechisch-italienische Krieg 1940/41 als gerechter, antifaschistischer Kampf sofort, auf nationalem Konsens beruhend, offiziell gemacht und breit angenommen wurde, wirkte die Thematisierung des nachfolgenden Widerstands von Anfang an im Sinne ideologischer Spaltpraxis. Ähnlich wie in der politischen Kultur Griechenlands unterscheiden sich fiktionale Texte und Selbstzeugnisse zur Besatzung aus der Perspektive des Bürgerkriegs: Die literarische Repräsentation der Okkupation ist gleichfalls eine gespaltene. Dies lässt sich von 1946 an mit Dimitris Chatzis’ Das Feuer über die ambivalente „schwarze Literatur“ der 1950er bis hin zum Belagerungszustand von Alexandros Kotzias (1976, 3. Auflage) gut verfolgen. Fiktionale Besatzungs- und Bürgerkriegsszenarien sind mit Bildern des Widerstands, der Sabotage und der Kollaboration verknüpft. Sie erzählen die Geschichte der Okkupation als eine andauernde Konfrontation von Linken und Rechten, wobei beide Fronten in ihrem gewalttätigen bzw. verbrecherischen Vorgehen dargestellt werden. Das Bild des deutschen Besatzers tritt hinter das der Gewalt der Bürgerkriegsparteien zurück.
Noch deutlicher als in der unmittelbaren Nachkriegszeit wird das literarische und mediale Feindbild während der Nachbürgerkriegszeit den Anforderungen der Innen- und Außenpolitik Griechenlands angepasst. Wenn in der frühen Erzählprosa das Stereotyp des NS-Deutschen dominiert („Roboter“, „mordsüchtige Scheusale“, „wilde Bestien“, „Tod und nichts als Tod“), so wird dieses im Schatten des Bürgerkriegs allmählich entschärft („Was für ein idiotischer Krieg unter Europäern!“). Später aber im Zusammenhang der sogenannten Merten-Affäre, beim erneuten letzten Prozess gegen einen deutschen Kriegsverbrecher, wird es wieder dämonisiert, um sich schließlich angesichts der europäischen Integration zu verlieren („Wir sind willens, die Vergangenheit zugunsten der europäischen Solidarität zu vergessen“). Auch in den filmischen Darstellungen der Okkupation zeigen sich seit 1950 beachtliche Revisionen. Zwischen Neorealismus und Modernismus lenkt das griechische Kino die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche konfliktuöse Themen der Zeitgeschichte, stets durch das Prisma der jeweiligen politischen Konstellationen, so des Kalten Kriegs, der Diktatur bis hin dann zur Rehabilitierung des EAM-Widerstands.39
[<<22||23>>] Die in Italien vielfach öffentlich unterdrückte Aufarbeitung eigener Kriegsschuld betrifft auch insbesondere die italienische Besatzung Griechenlands. Geschönt ist sie im medialen späteren Selbstbild des ‚bravo Italiano‘ der Armee Mussolinis. Hingegen die im Embryonalstadium befindliche Aufarbeitung eigener Kriegsschuld gegenüber Griechenland in Bulgarien konzentriert sich auf eine Frage nach Mitschuld an den Deportationen der griechischen Juden, die über bulgarisches Staatsgebiet führten. Zur „Primärerfahrung“ des Geschehens in der bulgarischen Besatzungszone Ostmakedonien-Westthrakien, zu der griechische Arbeiten existieren und oft auf einzelne Orte fokussieren,40 scheint sich bislang – aus analogen Gründen wie in der deutschen Geschichtsschreibung? – zur Besatzerrolle des monarchischen Vorkriegsstaats gegenüber Griechenland eine Aufarbeitung noch kaum entwickelt zu haben. Interessanterweise kommt die italienische moderate mediale Erinnerung dem griechischen Gedächtnis nahe. Wegen des Siegs über die Italiener in Albanien 1940 fühlten sich die Griechen seitens der Deutschen sowieso zu Unrecht diesem besiegten Besatzer unterstellt, der weite Gebiete mit schwierig zu überwachenden Bergen ‚befrieden‘ sollte. Das stärkte den antifaschistischen Impuls der Gegenwehr. Wenn der griechische Bürgerkrieg über Jahrzehnte Widerstand, Kollaboration und Kriegsverbrechen im eigenen Bewusstsein überlagerte, so prägte insbesondere die italienische Kapitulation 1943 die öffentliche griechische Erinnerung nachträglich harmonisierend, rückblickend z. T. auch wegen des Schutzes für die Juden in den italienischen Besatzungzonen. Italien hatte sich in diesem Punkt den Forderungen nach Auslieferung an das Dritte Reich verweigert. So dominiert bis heute das italienische Narrativ des „wenig kriegerischen, menschenfreundlichen italienischen Soldaten“, das dem Bild der italienischen Besatzer in der griechischen Erinnerungskultur nahekommt. In Literatur und Film ist ‚der Italiener‘ menschlicher als der gefühllose deutsche Soldat und häufiger Opfer denn Täter. Auch wird die italienische Besatzung insgesamt als gemäßigter als die deutsche oder die bulgarische erinnert – selbst wenn realhistorisch im italienischen Einsatz gegen den griechischen Widerstand gleicherweise Kriegsverbrechen an griechischen Zivilisten und ganzen Gemeinden zu zählen sind.41
Das literarische deutsche Gedächtnis zwischen Verklären und Vergessen
Während in der griechischen Literatur sowohl international anerkannte Dichter der Zwischenkriegszeit (Giorgos Seferis, Odysseas Elytis, Jannis Ritsos) als auch ausgesprochen repräsentative Schriftsteller der fünfziger und sechziger Jahre (Dimitris Chatzis, Stratis Tsirkas, Alexandros Kotzias, Vassilis Vassilikos, Giorgos Ioannou u. a.) die [<<23||24>>] deutsche Besatzung aufgreifen, zeigt sich vergleichend bei den deutschen Autoren ein eher heterogenes Spektrum. Es ist zudem für die Hauptströmungen der „Literatur nach 1945“ nicht unbedingt repräsentativ. Autoren der DDR und der BRD sind hierbei zusammengefasst. Mit Franz Fühmann und Erwin Strittmatter sowie im anders gelagerten Fall von Erich Arendt, der bekanntlich Exilant und Spanienkämpfer war, zeigt sich die Literatur der DDR mit – aus unterschiedlichen Gründen – beachtlichen Vertretern. Die westdeutsche „Literatur nach 1945“, Österreich hinzugenommen, hingegen zeigt sich eher segmentiert. Doch es finden sich immerhin zaghafte Einsprüche gegen Mauern und Schweigen in den Folgejahrzehnten, ähnlich motiviert wie oben zu Ehrengard Schramm ausgeführt (Walter Höllerer, Klaus Modick).
Konnte für die griechischen Autoren davon ausgegangen werden, dass eine Kollektiverfahrung der deutschen Besatzung breit zum Ausdruck kommen musste, so konnte Analoges für die deutsche Literatur zunächst nur bei Autoren auftreten, die auch an der Besatzung Griechenlands beteiligt waren. Die in Griechenland eingesetzten Wehrmachtssoldaten, die später Schriftsteller wurden, bilden in unserem Band eine eigene Gruppe. Aus zeitlichem Abstand eine einschneidende Erfahrung wieder aufzunehmen, sollte man als für die Kriegsgeneration naheliegend unterstellen (Strittmatter, Fühmann, Guttenbrunner). Doch Aussagekräftiges wurde bereits in der Kriegszeit selbst produziert (Erhart Kästner, Guttenbrunner, Höllerer). Bei den genannten Schriftstellern ist ein literarischer Diskurs ‚Krieg in Griechenland‘ nach unterschiedlichen Graden von Deutlichkeit geführt, und schon das macht es zum Teil fraglich, ob von „Aufarbeitung“ der eigenen Besatzerrolle überhaupt gesprochen werden kann. Inwiefern die Texte das Thema auf die Ebene einer explizit thematisierten eigenen Täterschaft bringen, inwiefern sie deutsches Handeln in diesem Krieg damit erörtern oder gar nach Schuld fragen, das lässt sich oft nur über akribisches Lesen und Gegenlesen annäherungsweise eruieren.42
Erhart Kästner und Erwin Strittmatter verfolgen aus verschiedenen Gründen in der Nachkriegszeit polar zueinander verlaufende Absichten, ihre Nachkriegsprosa gegen authentische Haltungen während der Besatzung Griechenlands abzudichten. Begrifflich lässt sich von Klassizismus bzw. Philhellenismus im einen, von (trivialem) Folklorismus im anderen Fall sprechen. Zu Kästner schreibt seine Biographin und Editorin: „Es ist dargestellt worden, dass nach wie vor die deutsche Okkupation in Kästners Griechenlandbild zu positiv erscheint, und zwar deswegen, weil sie eben gar keine Rolle spielt. Kästners Bild von Griechenland ist kein realistisches und es war auch nie so beabsichtigt. Griechenland ist eine geistige Landschaft, die Impulse gibt für die Auseinandersetzung mit Grundfragen der menschlichen Existenz.“43 Diese Bemerkung ist berechtigt. [<<24||25>>] Sie trifft jedoch als authentischer Erfahrungswert für fast alle genannten Autoren zu: Griechenland ist die Begegnung mit einer europäischen Bildungslandschaft (und sehr bedauerlich ist das rapide Versinken dieses geistigen Horizonts in den letzten Jahrzehnten, weltweit), und nun steht der einzelne darin mitten im Krieg. Jeder allerdings der Erwähnten ist mit diesem eigenen Griechenlandbild textuell anders umgegangen. Und dies, der Beitrag zur Formation einer deutschen literarischen Erinnerungskultur, sollte im Zentrum stehen. Gab es Widerspruch gegen das dominante ‚offizielle‘ Stummsein? Ist er als Zeugenschaft eines Werks im Sinne Walter Benjamins zu bewerten? Oder dient die Erwähnung nur der Selbstrechtfertigung? Zeugenschaft oder Schweigen, daran bemisst sich u. a. die intellektuelle Verantwortung des Schriftstellers.
Die von Jannis Ritsos im Krieg verfasste Lyrik, die ins Deutsche übersetzt wurde, haben wir in die Rubrik ‚deutsches Gedächtnis‘ genommen. Die Übersetzungen nämlich sind repräsentativ für „1968“ und das ‚junge, andersdenkende Deutschland‘ vor allem während der Zeit der Willy-Brandt-Ära. Bereits die Frankfurter Auschwitz-Prozesse 1962 ff. leiteten eine für die eigentliche öffentliche „Aufarbeitung der Vergangenheit“ sehr förderliche Periode in der BRD ein. Man denke etwa an Peter Weiss Die Ermittlung und seinen anschließenden Bericht Meine Ortschaft, geschrieben nach seinem Auschwitz-Besuch – doch vorerst ausgeschlossen von analogen Spurensuchen etwaiger Untaten der „Väter“ im Zweiten Weltkrieg blieb Griechenland.44
Die 68er-Kreise in der BRD sowie die wichtigen, meist etwas älteren Fachvertreter der Neogräzistik beider Deutschlands sahen sich vor der Notwendigkeit, die griechenlandverträumte deutsche Leserschaft über den Staatsterror der Junta aufzuklären. An einer Reihe damals erschienener Bücher lässt sich das illustrieren.45 Im Falle Ritsos [<<25||26>>] und der deutschen Neogräzistik nun zeigt sich das interessante Phänomen einer Praxis historischer Entkernung: Herausgeber und Übersetzer aktualisierten die literarischen Texte auf die politischen Vorgänge in Griechenland seit 1967 hin. Modifiziert führt dies der Roman von Erasmus Schöfer fort, auch mit Hilfe von Ritsos. Erst die Auseinandersetzung zweier Erzähler mit der Erinnerungskultur nach 1989, also der Berliner Republik, und der dann generierten Welle des postmodernen deutschen Familienromans lässt die deutsche Okkupation Griechenlands als literarisch spannenden Geschichtsstoff entdecken.46 Die Schwerpunkte über die griechische und die deutsche Literatur machen die Asymmetrie des Geschichtsgeschehens als auch der Geschichtspolitiken eklatant greifbar. Erkennbar ist auch der unterschiedliche Eindringlichkeitsgrad beider literarischer Geschichtsarbeiten.
Herbst 2014
Einleitend war erläutert, wieso Vergessen, oder stärker noch: Verdrängen, der deutschen Okkupation Griechenlands in der deutschen Erinnerung bis heute erst gewollt war und mittlerweile ein ausgewachsenes ‚Gedächtnis der Ignoranz‘ ist. Letzteres bestimmt noch immer den geschichtspolitisch derzeit offiziellen Berliner Grundsatz. Die Regierenden, allen voran der Bundeswirtschaftsminister und neben ihm die Kanzlerin, haben ihn mehrfach in den letzten Jahren betont: „[E]s ist alles beglichen … Das Thema ist obsolet.“ Auch in den Monaten nach des Bundespräsidenten Reden in Athen und Lyngiades (März 2014) gab es seitens der genannten Aktivrepräsentanten im Namen der deutschen Gesellschaft kein anderes Wort. Der Bundespräsident hat im Vergleich zu seinen Vorgängern von Weizsäcker und Rau etwas Neues auf den Weg gebracht: Er hat erstmals Griechenland um „Verzeihung“ gebeten, im Sinne einer Bitte, für die im Namen Deutschlands begangenen Verbrechen an der griechischen Bevölkerung. Die Untaten der Vorfahren sind damit im vereinten Deutschland offiziell benannt worden. Wartet auf die ‚junge Generation‘ nun eine weitere Geschichtslast?
Man stelle sich vor, heutige politikinteressierte Schüler, sogar auf den wenigen verbliebenen humanistischen Gymnasien, breiten im Fach Politik oder in den Europa-Projekten die aufgeschnappten ‚Kenntnisse‘ über die europäische Finanzkrise aus.47 Die auf neu polierten NS-Feindstereotypen über ‚die (faulen) Griechen‘, „Pleitegriechen“, „Betrüger in der Eurofamilie“ oder sonstige sind einfach gängiges Bewusstsein. Selbst hochprofessionelle Medienarbeiter stellen am Rande eigener Veranstaltungen von [<<26||27>>] ‚Solidarität mit Griechenland in der Krise‘ die Frage: „Müssen wir nun auch deshalb ein schlechtes Gewissen haben?“ Das große Verkennen der Millionen von deutschen Griechenlandtouristen, das einleitend erwähnt war, hat mittlerweile dieses Gesicht. Die Glaubwürdigkeit etwa schon der politischen Bildung verlangt es, dem vorhandenen Nichts gegenzusteuern. Podiumsdiskussionen allein werden da keine nachhaltigen Änderungen herbeiführen. Vom schulischen Geschichtsunterricht an, und mit der Lehrerausbildung vorab, ist ein neuer Zuschnitt von Geschichtsarbeit zum Zweiten Weltkrieg nötig. Etwa auch im Kontext der begonnenen Debatte „Deutschland als europäische Hegemonialmacht“.48
Die tagespolitische Funktionalisierung von Entschädigung durch die Parteien und in der griechischen Medienöffentlichkeit,49 die plötzliche scheinbare Einheit des gespaltenen Geschichtsgedächtnisses im erstmals unproblematischen Überspringen des „Bürgerkriegs bis 1974“ zeigen auf ihre Weisen, wie wenig eine die Gesellschaft versöhnende Version der Okkupation und ihrer Folgen in Griechenland selbst vorangeschritten ist. Eine geschichtspolitisch wegweisende wissenschaftliche Arbeit, analog zu der in Deutschland erst zu erbringenden, ist schon allein zur Korrektur vorschneller parteipolitischer Instrumentalisierung von Geschichtsnarrativen notwendig. Kann dies eine gemeinsame Historiker-Kommission voranbringen? Eine solche immerhin bildet ein Gegengewicht zu wechselnden Staatsregierungen. Auch an die Perspektiven des europäischen Projekts ist zu denken. Wie können Griechenland und Bulgarien unvorbelastete EU-Partner sein, wenn die Beziehungen mit dem Nachbarstaat, mit dem man eine Landgrenze von etlichen hundert Kilometern teilt, auf dem Schweigen über die Okkupation – im Falle Bulgariens war eine Annexion auf Dauer beabsichtigt – aufgebaut werden? Für Italien gilt Ähnliches. Fundierte Kenntnisvermittlung und, notwendigerweise verspätete, Aussöhnung haben eine europäische Perspektive.
[<<27||28>>] Abschließend gilt es Dank zu sagen: der Fritz Thyssen Stiftung, Köln. Sie hat zuerst die Tagung und dann die Publikation des Buches großzügig gefördert. Erneut sei den Autoren für ihre große, engagierte Arbeit gedankt. Zuerst gelang zusammen eine lebendige, gut besuchte Tagung. Nun gelingt endlich der Abschluss des Bandes, der die Ausarbeitungen zu einem Buch macht. Hagen Fleischer muß an dieser Stelle namentlich erwähnt sein, er weiß warum. Ununterbrochen hat er uns stützend zur Seite gestanden, in einer Zeitspanne, die plötzlich ungeheuer aktuell in Fragen der Aufarbeitung der Geschichte wurde und in der er von allen nur möglichen Seiten angegangen worden ist. Ganz herzlich bedanken wir uns bei Andrea Schellinger und Ulf D. Klemm für ihre exzellente Übersetzerarbeit. Beide haben sie selbstlos und voll engagierter Liebe – zur Sache und zum Wort – auf sich genommen. Und dem Böhlau Verlag, insbesondere Frau Rheker-Wunsch, danken wir für ihr großes Interesse, auch für die angenehme Begleitung über die Zeit der Produktion dieses Buches hin.
Chryssoula Kambas und Marilisa Mitsou, im September 2014[<<28||29>>]
1Hellas verstehen. Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Hg. von Chryssoula Kambas und Marilisa Mitsou. Köln: Böhlau, 2010.
2Die vergleichenden historischen Übersichten finden sich im Beitrag von Hagen Fleischer.
3Loukia Droulia, Hagen Fleischer (Hg.): Von Lidice bis Kalavryta. Widerstand und Besatzungsterror. Studien zur Repressalienpraxis im Zweiten Weltkrieg. Berlin: Metropol, 1999; Hermann Frank Meyer: Von Wien nach Kalavryta. Die blutige Spur der 117. Jäger-Division durch Serbien und Griechenland. Mannheim: Bibliopolis, 2002; ders.: Blutiges Edelweiß. Die erste Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg. Berlin: Links, 2007; Vaios Kalogrias: Makedonien 1941–1944. Okkupation Widerstand Kollaboration. Mainz/Ruhpolding: Philipp Rutzen, 2008; Christoph U. Schminck-Gustavus: Winter in Griechenland. Krieg Besatzung Shoah 1940–1944. Göttingen: Wallstein, 2010; Heinz A. Richter: Griechenland 1940–1950. Die Zeit der Bürgerkriege. Mainz/Ruhpolding: Philipp Rutzen, 2011. Der gut 500 Seiten starke Band behandelt die Okkupationszeit selbst auf kaum mehr als 50 Seiten sehr summarisch. Zu diesen direkt Eberhard Rondholz: Okkupation und Bürgerkrieg in Griechenland – ein Krieg der Erinnerung. In: exantas, Berlin. Heft 17 (Dezember 2012), S. 102–104.
4„Griechenlands finsteres Jahrzehnt (1940–1950). Krieg, Okkupation und Bürgerkrieg“, veranstaltet u. a. von der Arbeitsstelle Griechenland, Universität Münster, 5.–6. März 2011; „70 Jahre danach. Die deutsche Besatzungszeit in Griechenland“, veranstaltet vom Lehrstuhl Neogräzistik der FU Berlin, zus. mit exantas, am 15. April 2011 in der Berliner Informations- und Gedenkstätte „Topographie des Terrors“; eine weitere internationale Tagung zum Thema „1000 unbekannte Lidices. Geiselerschießungen in Kalavryta und anderswo durch die Wehrmacht“ fand im Dezember 2013 an der Diplomatischen Akademie Wien statt. Schwerpunkte der erwähnten Tagungen bildete auch hier vorrangig das primäre Geschehen der Besatzungsjahre selbst.
5Hagen Fleischer: Im Kreuzschatten der Mächte. Griechenland 1941–1944 (Okkupation –Résistance –Kollaboration). 2 Bde. Frankfurt/M. u. a.: Lang, 1986; Heinz Richter: Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936–1946). Frankfurt/M.: EVA, 1973. Weitere Griechenlandhistoriker siehe Anm. 3.
6Hagen Fleischer: Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden der deutschen Diplomatie. In: Hellas verstehen (wie Anm. 1), S. 205–240.
7Sigrid Skarpelis-Sperk: Last – Verantwortung – Versöhnung. Politische Perspektiven für das zukünftige Verhältnis Deutschlands zu Griechenland. In: Peleus, Bd. 8, Versöhnung ohne Wahrheit? Deutsche Kriegsverbrechen in Griechenland im Zweiten Weltkrieg. Hg. von Karl Giebeler u. a., Mannheim: Bibliopolis, 2001, S. 89.
8Selbst innerhalb der Wehrmacht wurde diese Praxis der Kriegsverbrechen – im übrigen ab Sommer/Herbst 1941 (Kandanos, Kerdyllia etc.) bereits – nicht offiziell auf die Kappe eines Befehlshabers genommen. Sie wurde, harsch oder halbherzig, von einzelnen verurteilt, andererseits aber geradezu als alltägliche Paralegalität nicht intern verfolgt, vielmehr war per Befehl bei Zuwiderhandeln angedroht, ‚Weichheit‘ nach dem Maßstab der Eigensabotage zu bestrafen. Der OKW-Befehl (Felmy, 1.7.1943), der später als Rechtfertigung für jede brutale Handlungsfreiheit diente, enthielt u. a. diese beiden Punkte: „b) gegen die Familienangehörigen [der überführten –!– Partisanen, Verf.] ist mit rücksichtsloser Strenge vorzugehen. Gegebenenfalls sind sämtliche männliche Familienmitglieder auszurotten. c) Ortschaften, die Banden als Zuflucht dienen können [!], sind zu zerstören. Die männliche Bevölkerung ist, soweit sie nicht wegen Teilnahme oder Unterstützung der Bandentätigkeit erschossen wird, geschlossen zu erfassen und dem Arbeitsdienst zuzuführen. […] Jede Weichheit wird als Schwäche ausgelegt und kostet deutsches Blut.“ Zit. nach Hagen Fleischer: Deutsche ‚Ordnung‘ in Griechenland 1941–1944, S. 181, in: Droulia, Fleischer (Hg.), wie in Anm. 3.
9Hagen Fleischer: „Endlösung“ der Kriegsverbrecherfrage. Die verhinderte Ahndung deutscher Kriegsverbrechen in Griechenland, in: Norbert Frei (Hg.), Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Göttingen: Wallstein, 2006, S. 478.
10Hagen Fleischer, wie in Anm. 6, S. 217. Zitiert aus dem Vorbereitungspapier für Bundespräsident Heuss vor seinem Griechenland-Besuch 1956.
11Gegründet 1958 von Franz von Hammerstein (1921–2011) und Lothar Kreyssig (Kirchenjurist in Magdeburg, 1898–1986). Vgl. im vorliegenden Band Beitrag Kambas, S. 329.
12Ehrengard Schramm: Ein Hilfswerk für Griechenland. Begegnungen und Erfahrungen mit Hinterbliebenen deutscher Gewalttaten der Jahre 1941–1944. Hg. von Gottfried Schramm und Irene Vasos. Göttingen: V&R, 2003, S. 112. Trotz der absoluten Eigenständigkeit ihrer – auch wissenschaftlichen – Aufarbeitungen zum Zweiten Weltkrieg in Griechenland ist zu erwähnen, dass sie verheiratet war mit dem Mittelalterhistoriker Percy Ernst Schramm, Universität Göttingen, der sog. George-Schule verbunden. P. E. Schramm arbeitete seit 1943 für den Obersten Heeresstab und die Propaganda des OKW. Er hat im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess als Zeuge der Anklage gewirkt.
13E. Schramm, Ein Hilfswerk für Griechenland, S. 120.
14So Botschafter Theo Kordt gegenüber E. Schramm. Ebd., S. 61.
15Wie Anm. 12, S. 53.
16Die Königin soll den Scheck erst achtlos auf einen Konzertflügel gelegt, und dann ‚allzu gut‘ in einer ihrer Schubladen verwahrt haben. Friederike von Griechenland (1917–1981), BDM-Mädel als Heranwachsende, war Prinzessin von Hannover und Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. Während der Nachbürgerkriegszeit wurde ihr propagandistisches Wirken im Bürgerkrieg (Besuche in den Konzentrationslagern, Errichtung von Kinderheimen zur „Umerziehung“) anschließend im Sinne staatsoffizieller Lesart als ‚humanitär‘ und sozial ‚verdienstvoll‘ gepriesen. (Das Haus Hannover führt die Euphemismen auf seiner Internethomepage heute, 2014, weiter.) Sie zog u. a. die Fäden zum Polizeistaat und intervenierte damit in die Regierungen hinein. Bei den verschiedenen Regierungsrücktritten in den 1960er Jahren wurde ihr von Beginn an umstrittenes ‚Wirken‘ öffentlich debattiert.
17Es waren gerade für Partisanenkinder Königin Friederikes Waisenhäuser zuständig, sie wollten für „Umerziehung“ sorgen (s. w. u.).
18Wie Anm. 12, S. 41.
19Einen Beitrag auf unserer Münchener Tagung dazu hielt Christoph Schminck-Gustavus über Lyngiades. Dazu sein Buch: Feuerrauch. Die Vernichtung des griechischen Dorfes Lyngiádes am 3. Oktober 1943. Bonn: Dietz, 2013.
20So die Position des seit Jahrzehnten aktiven Arbeitskreises Distomo (Köln und Hamburg), insbesondere in Reaktion auf das Haager Urteil.
21Dazu die Beiträge von Constantin Goschler und Anna Maria Droumpouki.
22Dies als literarischer Stoff ist erörtert in den Beiträgen von Ulrich Moennig und Athanasios Anastasiadis. Die internationale Literatur zum historischen Vorgang ist zahlreich. Auf Deutsch dazu Heinz Richter, wie in Anm. 3.
23Stratos Dordanas, Vaios Kalogrias: Das nationalsozialistische Polizeihaftlager ‚Pavlos Melas‘ in Thessaloniki – Geschichte und Wahrnehmung. In: Alexandra Klei u. a. (Hg.): Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte nationalsozialistischer Verbrechen. Bielefeld: transcript, 2011, S. 289–308.
24Polymeris Voglis: Becoming a subject. Political Prisoners during the Greek Civil War. New York: Berghahn, 2002.
25Vgl. Anm. 17. Noch 1952 wurden die Mitglieder des KKE Nikos Belogiannis und Dimitris Batsis, 1954 Nikos Ploumbidis als Spione der Sowjetunion hingerichtet, während seit 1947 kein deutscher Kriegsverbrecher in Griechenland mehr zum Tod verurteilt worden ist. Über die unvorstellbaren Praktiken des weißen Terrors in den Lagern schreibt Mikis Theodorakis in Die Wege des Erzengels, Bd. 3, Athen 1987. Auszug in: die horen. Heft 249, 2013. „Auf der Suche nach dem (verlorenen) Griechenland“, hg. von Asteris und Ina Kutulas, S. 138–141.
26Im Sinne des „nie wieder“ der restaurierten Lagerruinen von Auschwitz oder Dachau wird bis heute an die UNESCO zur Statusvergabe an Makronisos appelliert. Th. K. Kappou: Η ιστορική μνήμη και η Μακρόνησος (Das historische Gedächtnis und Makronisos). In: I Efimerida ton syntakton, 21.08.2014, S. 12. Referenzlegitimität bilden der Widerstand gegen die Diktatur 1967/74 und Melina Merkouri.
27Siehe Youtube. Die geschmackliche Grenzwertigkeit solcher aufwendig begangenen Kulturevents hat den Verlust an Glaubwürdigkeit der PASOK in Intellektuellenkreisen befördert.
28Grigoris Psallidas: Die Rezeption des deutschen Widerstands gegen Hitler in Griechenland. In: Gerd Überschär (Hg.), Der deutsche Widerstand gegen Hitler. Wahrnehmung und Wertung in Europa und den USA. Darmstadt: WBG, 2002, S. 80–91.
29Dazu die Beiträge von Andrea Schellinger, Gregor Kritidis und Eberhard Rondholz. Zu den in der SBZ/DDR aufgenommenen griechischen Kindern vgl. auch Hellas verstehen, wie in Anm. 1, S. 191 ff., den Aufsatz von Emilia Rofousou.
30Es waren 17 Mio. Dossiers. Vgl. Fleischers Beitrag in diesem Band und Hagen Fleischer: Authoritarian Rule in Greece (1936–1974) and its Heritage. In: Jerzy W. Borejza, Klaus Ziemer (Hg.), Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. New York et.al.: Berghahn, S. 237–275, insbes. S. 258; zum Protest vereinzelter Intellektueller dagegen, siehe Lothar Baier: Kein Gauck für Hellas. Eine europäische Fußnote. (1993) In: Lothar Baier, Die verleugnete Utopie. Zeitkritische Texte. Berlin: Aufbau, 1993, S. 188–191. Hierzu auch den Beitrag von Polymeris Voglis in diesem Buch.
31Dazu Dimitris Kousouris in diesem Band. Zum Kollaborationsspektrum Kalogrias, Makedonien 1941–1944, wie in Anm. 3, S. 47, 74 und passim sowie 239 ff. Zu erwähnen ist weiter das allein auf griechisch publizierte Buch von Stratos Dordanas: Ελληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Εαγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941–1944 (Griechen gegen Griechen. Die Welt der Sicherheitsbataillone im besetzten Thessaloniki 1941–1944). Thessaloniki: Epikentro, 2006.
32Dazu den Beitrag von Constantin Goschler in diesem Band.
33Die wissenschaftlich argumentierende Diskussion dazu ist u. a. von Timothy GartonAsh und Ulrich Beck, Das deutsche Europa (2012) angestoßen. Vgl. ad Griechenland Chryssoula Kambas: Vom Memorandum zu Memoria. Deutsche Gedächtnisausfälle zum Zweiten Weltkrieg und Deutschlandbild in der griechischen Krise. In: Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 20/2013, S. 174/75. Dass. in exantas, Nr. 20, Juni 2014, S. 24–31.
34Im Rahmen der Kulturgeschichte der Juden findet sich ansonsten schon das Kapitel der Sepharden speziell auf dem Balkan, und mit der jüdischen Gemeinde Thessaloniki waren etwa 80% der griechischen Juden Sepharden. Dazu u. a. Esther Benbassa, Aron Rodrigue: Die Geschichte der sephardischen Juden. Von Toledo bis Saloniki. Bochum: Winkler, 2005.
35Überlebensberichte und Geschichtsschreibung sind nicht durchweg auf Griechisch in den Originalfassungen, u. a., weil die moderne Literatursprache der Spaniolisch sprechenden Sepharden meist Französisch war. Vgl. die Beiträge im vorliegenden Band von Fragiski Abatzopoulou, Odette Varon, Michalis Lychounas.
36Wir danken an dieser Stelle dem Jüdischen Museum Thessaloniki, Michalis Lychounas und Maria Zafon, die zur Münchener Tagung drei Schaurollen in deutscher Sprache eigens anfertigten. So ließ sich während des Symposiums eine kleine Begleitausstellung zeigen, mit reichlich ausgestatteten Buchvitrinen, der Inhalt ein Geschenk des Jüdischen Museums Athen an die Institutsbibliothek in München. Wir danken beiden Jüdischen Museen an dieser Stelle sehr herzlich für die wunderbaren Gaben. Die Osnabrücker Forschungsstelle Literarischer Transfer ergänzte in den Folgemonaten die Rolltafeln aus Thessaloniki um weitere neu erarbeitete 10 Schautafeln zur Geschichte der sephardischen Juden Thessalonikis. „Madre d’Israel“, so der Titel dieser größeren Ausstellung, wurde ab April 2013 zuerst in der UB Osnabrück, dann der UB Oldenburg, zuletzt ab Mai 2014 in der UB der FU Berlin gezeigt.
37Übersicht und Lektüreangebot auf Deutsch bietet die schöne Anthologie, besorgt von Niki Eideneier (Hg.): Die Sonnenblumen der Juden. Die Juden in der neugriechischen Literatur. Köln: Romiosini, 2006.
38Dazu der Beitrag von Athanasios Anastasiadis.
39Beiträge von Athanasios Anastasiadis, Ulrich Moennig, Angela Kastrinaki und Panayiota Mini.
40Siehe z. B. Η Βουλγαρική κατοχή στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 1941–1944. Καθεστώς, παράμετροι, συνέπειες (Die bulgarische Besatzung Ost-Makedoniens und Thrakiens 1941–1944. Status, Faktoren, Folgen). Hg. von Xanthippi Kotzageorgi-Zymary. Thessaloniki: Epikentro, 2007.
41Dazu die Beiträge von Focardi und Klinkhammer, Angela Kastrinaki und Nadia Danova.
42Dazu die Beiträge von Volker Riedel, Werner Liersch, Helga Karrenbrock, Nafsika Mylona, Chryssoula Kambas (Lyrik).
43Julia Freifrau HillervonGärtringen: „Meine Liebe zu Griechenland stammt aus dem Krieg.“ Studien zum literarischen Werk Erhart Kästners. Wiesbaden: Harassowitz, 1994, S. 340. S. 341 ist sein Artikel „Enttäuschte Liebe zu den Deutschen“ (Schwäbische Landeszeitung vom 31.5.1952) mit Hintergrund-Notizen referiert, wo es heißt, „dass ‚die Geiselerschießungen und Dorfverbrennungen, die die Deutschen vornahmen, einen viel tieferen Eindruck beim Volk hinterließen als alles andere in den letzten zehn Jahren Erlittene, sogar als der furchtbare Hungerwinter des Jahres 41 auf 42‘.“ Diese publizistische Ausnahmestelle ist zuletzt, auch den weiteren Erläuterungen der Verfasserin nach, ausgesprochen konform mit der offiziellen „Endlösung der Kriegsverbrecherfrage“.
44Als Beispiel sei nur auf den Dokumentar- und Kulturfilm „Traumland der Sehnsucht“ verwiesen, dessen Kamera der Regisseur Fassbinders, Michael Ballhaus, führte und der 1961 einen Preis bei den Berliner Filmfestspielen gewann. (R: W. Müller-Sehn). Vgl. de.fulltv.tv/traumland-der-sehnsucht.html, abgerufen am 03.09.14. DVD wird derzeit neu erstellt.
45Es beteiligten sich die aktuellen Reihen der Verlage so etwa Kiepenheuer & Witsch (Ansgar Skriver, 1968), Wagenbach mit seiner Nr. 1 der Reihe Rotbuch (Jean Meynaud, 1969), Rowohlt mit einer Übersetzung des Livre noir de la dictature en Grèce (1970) oder auch die Zeitschrift „Das Argument“ mit der Nr. 57 „Revolution und Konterrevolution in Griechenland“ (1970); dieses Heft enthält u. a. einen Beitrag von Eberhard Rondholz. Kaum zweifelhaft, dass von diesem Impuls getragen auch die historische Forschung begonnen hat, die aber erst einige Jahre später Buchgestalt annahm. Vgl. etwa die Titelformulierung des Buches von Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936–1946), wie in Anm. 5.
46Dazu die Beiträge von Maria Biza, Miltos Pechlivanos, Walter Fähnders, Chryssoula Kambas (Roman).
47Dem hier resümierten Bewusstseinszustand von deutschen Gymnasiasten liegt als Erfahrungshintergrund ein ausführliches Gespräch mit einem mit den Verhältnissen landesweit vertrauten Latein- und Griechischlehrer des Osnabrücker Ratsgymnasiums zum Thema „Griechenlandbild aktuell bei Eltern und Schülern“ zugrunde.
48Trotz seiner für eine deutsch-griechische Erinnerungsarbeit geschichtspolitisch wichtigen Reden auf der Griechenlandreise müssen in dieser Frage nicht unbedingt die von Bundespräsident Joachim Gauck zuletzt in diese andere Debatte geworfenen Gesichtspunkte („mehr Verantwortung“) als richtungweisend aufgenommen werden. Jedenfalls distanzieren sich die Herausgeberinnen vom Tenor „mehr militärischer Mut ist gefragt…“.
49Es hat auch hier einsichtige Positionswarnungen etwa in der Kathimerini vor der Reduktion der eigenen Geschichte während der Okkupation auf die Frage einer Ablasssumme gegeben. Die Zeitung sah damit die Glaubwürdigkeit der griechischen Seite zweifelhaft werden. Das war zu denen gesagt, die immer lauter das Ungenügen an Gaucks ‚schönen Worten und nicht mehr‘ einstimmten. Umgekehrt dazu positionierte sich die ‚deutsche Schwester‘ FAZ: Mauern und Schweigen bleibt hier die Devise. Als einzige der großen deutschen Zeitungen beschränkte sie sich beim Gauck-Besuch auf den dpa-Pflicht- und obligatorischen Auslandskorrespondentenartikel, kombiniert mit der meinungsbildenden Glosse, „dass ein Staat nicht auf alle Ewigkeit für die Schuld(en) aufkommen kann, die zu Lasten früherer Regime gehen. Denn wo wäre da die Grenze nach hinten zu ziehen?“ (FAZ, 8.3.2014, S. 8) Sie argumentiert damit auf derselben Ebene wie das polare griechische Parteienspektrum. Die Dringlichkeit von Erinnerungsarbeit und tatsächlicher Aussöhnung hatten die FAZ-Redaktionen offenbar nicht so recht begriffen.
Gespaltene Erinnerungen[<<29||31>>]
Hagen Fleischer
Vergangenheitspolitik und Erinnerung
Die deutsche Okkupation Griechenlands im Gedächtnis beider Länder
Am Anfang unseres Jahrtausends entfachte der linksliberale Doyen der Presseszene Antonis Karkagiannis einen Sturm der Entrüstung im geschichtskulturellen Wasserglas Griechenlands, als er die versuchte Beschlagnahmung der deutschen Kulturinstitute in Athen – zur Entschädigung für das Massaker in Distomo – als griechischen Talibanismus kritisierte: „60 Jahre danach“ sei auch für die Griechen die Zeit gekommen, sich freizumachen vom Schatten der Besatzungszeit, deren Terminologie und Stereotypen sowie deren weiterhin memoirenhaften Erinnerungskultur.1 Er erlebte es nicht mehr, wie zwischenzeitliche Fortschritte in dieser Richtung hinfällig wurden – infolge der eskalierenden deutsch-griechischen Krise im Gefolge der großen Rezession.
Eben deswegen war die Münchener Konferenz so wichtig – mehr noch als es im Planungsstadium schien. Doch bereits im Frühjahr 2010, als das Ergebnis der ersten diesbezüglichen Initiative von Chryssoula Kambas und Marilisa Mitsou angekündigt wurde – der Sammelband mit dem (zu?) optimistischen Titel Hellas verstehen –, hatten sich deutsche Journalisten erwartungsfroh an den Verlag bzw. die Herausgeberinnen gewandt: Ob der Band Antworten gebe auf die wirtschaftliche und soziale Krise der Hellenen? Was sie zum Inhalt erfuhren – Kulturauftrag, Kulturpolitik, Kulturtransfer – war den meisten zu tiefschürfend, zu wenig tagesaktuell.
Als die Krise wie ein Steppenbrand ausbrach, erkannten nur wenige Einsichtige deren diachronische Aktualität, die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der gegenseitigen Wahrnehmung sowie der Verständnisdefizite, nachdem politische Opportunität allzulange das Bild geschönt hatte. Auch seriöse Medien sahen und analysierten die Geschehnisse weiterhin eindimensional. Eine Berliner Zeitung witzelte damals, glücklicherweise besäßen Hellas und Deutschland keine gemeinsame Grenze, sonst wären beiderseits bereits Panzerbrigaden vorgefahren.2 Besagter Journalist ergötzte sich an seinem martialischen Gedankenspiel, war aber weder ehrlich noch informiert genug, es weiter zu verfolgen. Zunächst fehlte der Hinweis für den einheimischen Leser, dass 70 Jahre zuvor tatsächlich deutsche Panzer3 in Griechenland eingefallen waren – auch [<<31||32>>] ohne gemeinsame Grenze. Zum zweiten, im hypothetischen Fall, wäre zumindest Bayern längst von der griechischen Armee besetzt, denn letztere besitzt die gleichen guten Leopard-Panzer wie die Bundeswehr, aber doppelt so viele – dank der tüchtigen deutschen Rüstungslobby.4
Zugegebenermaßen erreicht der antideutsche Aufschrei mancher griechischer Medien und Politiker die Ausmaβe nationaler Hysterie. Doch in der Richtpflöcke setzenden Anfangsphase galten die germanophoben Reaktionen kaum mangelnder Zahlbereitschaft von Merkel & Co. Viele Griechen hatten sogar Verständnis für der Kanzlerin wahlbedingtes Lavieren, obwohl dadurch beiden Seiten die letztlich erwiesene „Solidarität“ erheblich verteuert wurde. Nur wenige bestreiten nämlich die Verantwortung der Athener Regierungen und ihrer Klientelen an jahrzehntelanger Misswirtschaft.
Erbitterung provozierte hingegen das Zerr-BILD, die simplifizierende Häme, die sich kübelweise auf die opportune Zielscheibe der angeblich schmarotzenden „Pleite-Griechen“ ergoss. Die Schmähung des „Volks der Faulenzer und Betrüger“ in der „Euro-Familie“ wurde zum Volkssport: Karikaturen, Schlagzeilen und Kommentare wetteiferten in boshaften Superlativen, auch in „seriösen“ deutschen Medien. Ohnehin werden solche elitären Unterscheidungskriterien anfechtbar in einer Zeit, da der langjährige BILD-Vize Nikolaus Blome – als Hauptverantwortlicher für üble Kampagnen wie die gegen die ‚Pleite-Griechen‘ Ende 2011 vom Verein Europa-Union mit der „Europäischen Distel“ für den „größten europapolitischen Fehltritt des Jahres“ abgestraft – beim SPIEGEL de facto nahezu die gleiche Position übernahm.5 Dieses „Griechen-Bashing“, die oft sadistische Griechenschelte, warf die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur um Jahrzehnte zurück. Die rassistisch anmutende Arroganz weckte in Griechenland traumatische Erinnerungen an die Okkupation 1941–44, als gleichlautende Stereotype die Besatzungspolitik des selbsternannten Herrenvolks weiter brutalisierten. General von LeSuire etwa, der 1943 Kalavryta und die Nachbardörfer zerstören und 700 Männer exekutieren ließ, schmähte die Griechen als „Sauvolk“ der „Nichtstuer, Schieber und Korrupteure“.6
Als sich die Griechen daraufhin der ungezahlten Kriegsentschädigungen entsannen, beklagten deutsche Medien die Instrumentalisierung der „Nazi-Keule“. Im Gegensatz zur aus prominentem Mund (Martin Walser) gehörten „Auschwitz-Keule“ störte sich diesmal niemand. Auch Josef Joffe, Herausgeber der ZEIT identifizierte sich mit der ignoranten These: „Weil Deutschland sich mit Hilfen an Griechenland zurückhält, schwingen die Griechen die Nazi-Keule. Sind nur zahlende Deutsche gute Deutsche?”7 Jede griechische Erwähnung historischer Verpflichtungen erscheint deutschen [<<32||33>>] Journalisten und Politikern bestenfalls anachronistisch, zumeist aber lächerlich, händlerisch und unberechtigt.
Die von Karkagiannis angesprochene Verspätung der Historisierung, festzustellen in der public history der griechischen Medien, resultiert aus der Verspätung der Historiographie. In diesem Zusammenhang ist ein historischer Abriss unerlässlich: Die Griechen datieren den Beginn ihres Widerstandes auf den 28. Oktober 1940 mit der Ablehnung von Mussolinis Ultimatum – die unter Verletzung der griechischen Neutralität eindringenden italienischen Truppen wurden binnen weniger Wochen weit auf albanisches Gebiet zurückgeworfen. Die griechischen Siege zu einem Zeitpunkt, da Frankreich besiegt und die Supermächte USA und UdSSR noch im Zwielicht der Neutralität verharrten, erschüttern den Nimbus von der Unbesiegbarkeit der faschistischen ‘Achse‘; weltweit werden Parallelen zum hellenischen Sieg bei Marathon bzw. zum glorreichen Opfergang an den Thermopylen gezogen. In Erinnerung daran wird 1945 der 28. Oktober – als „Tag des Neins“ (Ochi) – zweiter Nationalfeiertag. Schon damals spöttelte die britische Botschaft in Athen, die meisten Griechen glaubten, ihr Widerstand 1940/41 habe letztlich den Weltkrieg für die Alliierten gewonnen;8 zahllose Bücher und Gedenkredner insistierten bis heute in diesem Sinne,9 so etwa das Geschichtsbuch der letzten Volksschulklasse: „Als, am 28. Oktober 1940, die Mächtigen der Erde uns die Freiheit rauben wollten, antwortete die ganze Nation wie ein Mensch mit dem stolzen NEIN – wie einst Leonidas den Persern (480 v. C.) und Konstantin Palaiologos dem Mohammed II. (1453 n. C.). So wurde die Neueste griechische Geschichte geschaffen, die der ganzen Welt offenbart: Hellas stirbt nie! Es lebt und wird immer leben – voll Ruhm und Ehre!“10 Der Mut zum „Nein“ wird oft als diachronische Identitätskomponente der Hellenen gepriesen: von den Perser- und Türkenkriegen bis zur Abwehr jeweils aktueller Pressionen,11 derzeit der Gläubiger-Troika, die in Karikaturen oft als – bekanntlich dreiköpfiger – Höllenhund Zerberus dargestellt wird.
Im April 1941 war die technologisch weit überlegene Wehrmacht dem gedemütigten Achsenpartner zu Hilfe geeilt, und hatte die abgekämpften Griechen in einem weiteren Blitzfeldzug niedergeworfen. Den größten Teil des Landes überließ Hitler den verbündeten Italienern und Bulgaren zur Besatzung bzw. Annexion, die Wehrmacht sicherte sich strategische Schlüsselpositionen. Bereits in den Weltmacht-Träumen der [<<33||34>>] Nazis begegnen wir deutschen Gelüsten nach griechischen Inseln – 70 Jahre später von diversen deutschen Presseorganen, Blogs und Politikern offen zur Schau getragen. Namentlich die Marine-Führung fordert, das unter großen Verlusten eroberte Kreta müsse nach gewonnenem Krieg „fest in deutscher Hand bleiben“.12
Der spontane Widerstand organisiert sich, denn die meisten Griechen fühlen sich nicht besiegt,13 jedenfalls nicht von den Italienern – „Primatmacht“ von deutschen Gnaden. Wichtigste Organisation ist die mit kommunistischer Initiative gegründete Nationale Befreiungsfront EAM, die neben dem Befreiungskampf den Kampf um das physische Überleben auf ihr Banner schreibt. Tatsächlich ist die epidemische Hungersnot die erste traumatische Erfahrung der Okkupation, deren Erinnerung zudem nicht tabuisiert und unterdrückt wird, da sie kein Rechts-Links-Schisma birgt.14 Die Toten bleiben dennoch bis heute ungezählt: mindestens 100.000.15
Hingegen entzündet sich ein endloser Erinnerungskrieg am bewaffneten Arm der EAM, dem „Volksbefreiungsheer“ ELAS. Streitpunkte betreffen insbesondere Intention und „Rentabilität“ des bewaffneten Widerstands (Andartiko). Nach der italienischen Kapitulation im September 1943 und in Erwartung des deutschen Abzugs brechen bürgerkriegsähnliche Kämpfe aus, namentlich zwischen EAM/ELAS und der stärksten nationalistischen Organisation EDES, wobei letztere ein „gentlemen’s agreement“ mit der Wehrmacht schließt, um gegen den inneren Gegner den Rücken freizuhalten. Die Besatzungsmacht betreibt gezielte Spaltpropaganda – auch mittels der Schaffung der kollaborierenden Sicherheitsbataillone, zumal diese vielen konservativen Griechen als kleinere (da temporäre) Gefahr gegenüber der „umstürzlerischen“ EAM erscheinen.16





























