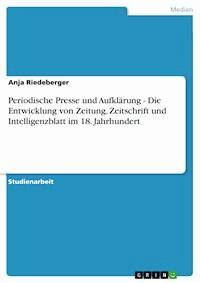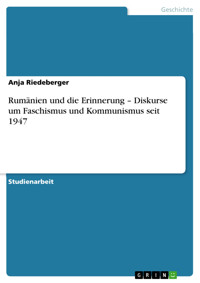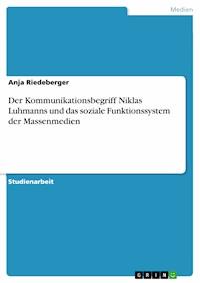15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Kunst - Architektur, Baugeschichte, Denkmalpflege, Note: 1,4, Universität Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Königspfalz bildete im Mittelalter eine wichtige Grundlage für die Verwaltung des Reiches und die Herrschaftssicherung. Bereits zu den Zeiten der Merowinger gab es sie, meist in Form von größeren Gutshöfen, über das ganze Frankenreich verteilt. So war es dem König möglich, mit Gefolge in die verschiedenen Regionen seines Reiches zu reisen und eine seinen Ansprüchen angemessene Unterkunft vorzufinden. Traditionell verbrachte der König die Sommermonate im Zeltlager bei seinem Heer und überwinterte in einer der Pfalzen seines Reiches, ohne sich zu weit vom Kriegsschauplatz entfernen zu müssen. Unter Karl dem Großen wandelte sich die Gestalt der Königspfalz. Die einfachen Gutshöfe wurden zu ausgebauten Pfalzanlagen, die repräsentativen Anlässen gerecht werden konnten. Zentral wichtige Pfalzen bildeten sich heraus. Auf Karl den Großen gehen unter anderem Pfalzbauten in Ingelheim, Nimwegen, Aachen, Frankfurt am Main und Paderborn zurück. Die Aachener Pfalzanlage nimmt dabei eine Sonderstellung ein. Sie wurde ab 794 zum festen Sitz des Hofes und zu Karls Residenz, die er ab dem Jahr 806 bis zu seinem Tod 814 kaum noch verließ. Mit ihr begann die Entwicklung vom wandernden Königtum zum Monarchen mit festem Herrschersitz. Ungewöhnlich war nicht nur die monumentale Größe der Anlage und die überwiegende Errichtung der Gebäude aus Stein, sondern auch die verwendeten Bauformen. Statt im in der fränkischen Bautradition weit verbreiteten Typ der Saalkirche wurde die Pfalzkapelle in Form eines überkuppelten Zentralbaus errichtet, der in seiner Größe alle bisherigen Kirchenbauten im Frankenreich übertraf. „Dieser Bau lässt sich aus keiner vorhandenen fränkischen Bautradition ableiten.“, schreibt dazu Werner Jacobsen (Jacobsen 1994, S. 38). Gegenstand der vorliegenden Arbeit wird die Frage sein, in welches geschichtliche Umfeld der Bau der Aachener Pfalzkapelle einzuordnen ist, wie sich die gewählte Bauform erklärt, an welchen Vorbildern sie sich orientiert und welche machtpolitischen Intentionen sie zum Ausdruck bringt. Die Literatur zu diesem Thema ist umfangreich und widersprüchlich. Dies ist auch auf die lückenhafte Quellenlage zur Geschichte und Kunstgeschichte der Karolinger zurückzuführen, was Raum für viele Meinungen lässt. Diese Arbeit stützt sich auf die im Literaturverzeichnis aufgeführte Literatur, dabei hauptsächlich auf die Publikationen von Günther Binding und Matthias Untermann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Geschichtlicher Hintergrund
2.1 Aufstieg der Karolinger
2.2 Die Zeit Karls des Großen
2.3 Hofgelehrte und Berater
3. Karolingische Renaissance
4. Baugeschichte
4.1 Die Besiedlung des Gebiets bis zum Baubeginn der Pfalz
4.2 Entstehung der Pfalzkapelle und spätere Umbauten
4.3 Baumeister
5. Baubeschreibung
5.1 Gesamte Pfalzanlage
5.2 Pfalzkapelle
5.2.1 Allgemein
5.2.2 Außenbau
5.2.3 Innenbau
6. Organisation der Pfalz
7. Ausstattung des Baus
8. Funktion und Interpretation des Baus
8.1 Funktion des Baus
8.2 Vorbilder und Intention des Baus
9. Zusammenfassung
10. Literatur:
1. Einleitung
Die Königspfalz bildete im Mittelalter eine wichtige Grundlage für die Verwaltung des Reiches und die Herrschaftssicherung. Bereits zu den Zeiten der Merowinger gab es sie, meist in Form von größeren Gutshöfen, über das ganze Frankenreich verteilt. So war es dem König möglich, mit Gefolge in die verschiedenen Regionen seines Reiches zu reisen und eine seinen Ansprüchen angemessene Unterkunft vorzufinden. Traditionell verbrachte der König die Sommermonate im Zeltlager bei seinem Heer und überwinterte in einer der Pfalzen seines Reiches, ohne sich zu weit vom Kriegsschauplatz entfernen zu müssen.
Unter Karl dem Großen wandelte sich die Gestalt der Königspfalz. Die einfachen Gutshöfe wurden zu ausgebauten Pfalzanlagen, die repräsentativen Anlässen gerecht werden konnten. Zentral wichtige Pfalzen bildeten sich heraus. Auf Karl den Großen gehen unter anderem Pfalzbauten in Ingelheim, Nimwegen, Aachen, Frankfurt am Main und Paderborn zurück.
Die Aachener Pfalzanlage nimmt dabei eine Sonderstellung ein. Sie wurde ab 794 zum festen Sitz des Hofes und zu Karls Residenz, die er ab dem Jahr 806 bis zu seinem Tod 814 kaum noch verließ. Mit ihr begann die Entwicklung vom wandernden Königtum zum Monarchen mit festem Herrschersitz. Ungewöhnlich war nicht nur die monumentale Größe der Anlage und die überwiegende Errichtung der Gebäude aus Stein, sondern auch die verwendeten Bauformen. Statt im in der fränkischen Bautradition weit verbreiteten Typ der Saalkirche wurde die Pfalzkapelle in Form eines überkuppelten Zentralbaus errichtet, der in seiner Größe alle bisherigen Kirchenbauten im Frankenreich übertraf. „Dieser Bau lässt sich aus keiner vorhandenen fränkischen Bautradition ableiten.“ (Jacobsen, Werner:Die Pfalzkonzeptionen Karls des Großen. In: Karl der Große als vielberufener Vorfahr. Hg. L. Saurma-Jeltsch. Sigmaringen 1994. S.38).
Gegenstand dieser Hausarbeit wird die Frage sein, in welches geschichtliche Umfeld der Bau der Aachener Pfalzkapelle einzuordnen ist, wie sich die gewählte Bauform erklärt, an welchen Vorbildern sie sich orientiert und welche machtpolitischen Intentionen sie zum Ausdruck bringt.
2. Geschichtlicher Hintergrund
2.1 Aufstieg der Karolinger
Die Franken, ein im 3. Jahrhundert vom Norden nach Europa eingewanderter Germanenstamm, wurden seit dem 5. Jahrhundert von dem Geschlecht der Merowinger beherrscht. Dem Merowinger-König Chlodwig I. gelang es, die Frankenstämme in einem Reich zu vereinen. Als einer der ersten Germanen-Herrscher bekannte er sich zum Christentum und ließ sich zwischen 496 und 506 taufen. Diese Entscheidung spielte eine wichtige Rolle in der weiteren Entwicklung der Franken.