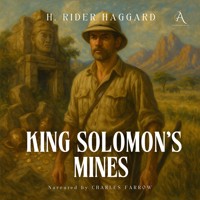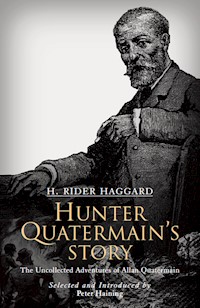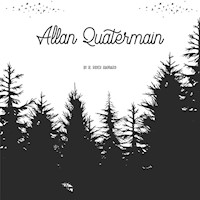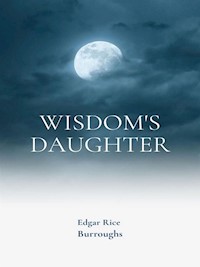1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Die Phantomkönige' von H. Rider Haggard entfaltet sich ein fesselndes Abenteuer, das die meisterhafte Kunst der erzählenden Literatur mit einer tiefgründigen Erkundung der Menschennatur verbindet. Der Roman, der in einer Welt zwischen Realität und Fantasie spielt, nimmt den Leser mit auf eine epische Reise, in der verlorene Königreiche und mächtige Geisterreiche lebendig werden. Haggards charakteristischer Stil, geprägt von präziser Erzählkunst und einer Vorliebe für das Abenteuerliche, zieht den Leser sofort in seinen Bann. Geschrieben in einer Zeit, die vom Kolonialismus und seinen politischen Implikationen geprägt war, reflektiert das Werk subtile soziokulturelle Beobachtungen und bietet zugleich eine spannende Narrative, die den Leser bis zur letzten Seite nicht loslässt. Henry Rider Haggard, geboren 1856 in der viktorianischen Ära, war ein visionärer Autor, dessen Reisen und Erfahrungen in Afrika sein Schreiben maßgeblich beeinflussten. Seine Faszination für das Unbekannte und verlorene Kulturen spiegeln sich in 'Die Phantomkönige' wider, wo er eine Welt erschafft, die sowohl exotisch als auch faszinierend ist. Besondere Einflüsse auf Haggards Werk waren seine juristischen Erfahrungen sowie seine Tätigkeit als Kolonialbeamter, die ihm ein tiefes Verständnis für die Dynamiken zwischen den Kulturen, die Themen von Macht und Mystik gaben ihm Impulse für seine mutigen Helden und komplexen Antagonisten. Dieses Buch bietet nicht nur ein spektakuläres Abenteuer, sondern lädt auch dazu ein, soziokulturelle Themen und historische Parallelen zu erkunden. 'Die Phantomkönige' ist ein Muss für alle Liebhaber klassischer Abenteuerliteratur und für jene, die sich für eine spannende Reise in das Unbekannte interessieren. Haggards Fähigkeit, detailgetreue Umgebungen und vielschichtige Charaktere zu kreieren, macht dieses Werk zu einem zeitlosen Klassiker, der nicht nur unterhalten, sondern auch tiefgründig zum Nachdenken anregen kann. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Phantomkönige
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I DAS MÄDCHEN
Der Nachmittag war mega heiß. Von der Anhöhe aus, wo sie ihr Lager oberhalb des Flusses aufgeschlagen hatten, sah das Meer, das ein paar Kilometer rechts von ihr lag – denn dies war die Küste von Pondo-Land –, für die kleine Rachel Dove, die es mit traurigen Augen anstarrte, wie eine unendliche Fläche aus stehendem Öl aus. Doch es gab keine Sonne, denn ein grauer Schleier hing wie ein Tuch unter dem Himmelsgewölbe, so dicht und dick, dass seine Strahlen von der Erde abgehalten wurden, die still und erstickt darunter lag. Tom, der Kaffernfahrer, hatte ihr erzählt, dass ein Sturm aufziehen würde, ein Sturmvater, der die große Dürre beenden würde. Deshalb war er zu einer Schlucht in den Bergen gegangen, wo die Ochsen von den beiden anderen einheimischen Jungen gehütet wurden – denn auf diesem Hochland gab es keine Weide, um sie zum Wagen zurückzutreiben. Denn, wie er ihr erklärte, bei solchen Stürmen neigen Rinder dazu, sich zu erschrecken und kilometerweit davonzulaufen, und ohne Rinder wäre ihre Lage noch schlimmer als sie ohnehin schon war.
Zumindest war das, was Tom sagte, aber Rachel, die unter Einheimischen aufgewachsen war und ihre Denkweise verstand, wusste, dass sein wirklicher Grund darin bestand, dass er nicht dabei sein wollte, wenn das Baby beerdigt wurde. Kaffern mögen den Tod nicht, es sei denn, er kommt durch den Speer im Krieg, und Tom, ein guter Mensch, hatte das Baby während seines kurzen Lebens sehr gemocht. Nun war es begraben; er hatte seine letzte Ruhestätte in der harten Erde ausgehoben, bevor er gegangen war. Rachel, das arme Kind, denn sie war erst fünfzehn, hatte es zu seiner letzten Ruhestätte getragen, und ihr Vater hatte seine Messgewänder aus einer Kiste geholt, sie angezogen und die Begräbniszeremonie über dem Grab gelesen. Danach hatten sie gemeinsam die trockene, rote Erde aufgefüllt und Steine darauf gerollt, und da es zu dieser Jahreszeit nur wenige Blumen gab, legten sie ein oder zwei vertrocknete Zweige Mimose auf die Steine – das Beste, was sie zu bieten hatten.
Rachel und ihr Vater waren die einzigen Trauergäste bei dieser Beerdigung, wenn wir zwei Felshasen, die auf einem Felsvorsprung in einer benachbarten Klippe saßen, und einen alten Pavian, der diese seltsamen Vorgänge von seinem Kamm aus beobachtete und schließlich einen Felsbrocken herunterstieß, bevor er empört bellend davonlief, außer Acht lassen. Ihre Mutter konnte nicht kommen, weil sie vor Kummer und Fieber krank in einem kleinen Zelt neben dem Wagen lag. Als alles vorbei war, kehrten sie zu ihr zurück, und es kam zu einer schmerzhaften Szene.
Mrs. Dove lag auf einem Bett aus dem Kartell, einem mit grünen Lederstreifen bespannten Rahmen, der aus dem Wagen entfernt worden war, eine hübsche, blasse Frau mit üppigem blondem Haar. Rachel erinnerte sich immer an diese Szene. Das heiße Zelt mit hochgeklappten Seitenwänden, um etwas Luft hereinzulassen. Ihre Mutter in einem blauen Morgenmantel, abgenutzt und verschmutzt von der Reise, an dem eine der Schleifen nur noch an einem Faden hing, das Gesicht zur Zeltwand gewandt und still weinend. Die hagere Gestalt ihres Vaters mit seinem fanatischen, heiligenhaften Gesicht, blass unter seiner Bräune, seiner hohen Stirn, über die eine graue Strähne fiel, seinen dünnen, festen Lippen und weit entfernten grauen Augen, der sein Chorhemd auszog und es mit schnellen Bewegungen seiner nervösen Hände zusammenfaltete, und sie selbst, ein verängstigtes, staunendes Kind, das die beiden beobachtete und sich danach sehnte, sich davonzuschleichen, um ihrer Trauer in Einsamkeit zu frönen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis das Messgewand gefaltet, in einen Leinenbeutel gesteckt war, in dem in ihrem alten Zuhause früher schmutzige Kleidung aufbewahrt wurde, und schließlich in einer Holzkiste mit einem kaputten Scharnier verstaut war. Endlich war es geschafft, und ihr Vater richtete sich mit einem Seufzer auf und sagte mit einer Stimme, die fröhlich klingen wollte:
„Weine nicht, Janey. Denk daran, dass dies alles zum Besten ist. Der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn.“
Ihre Mutter setzte sich auf, sah ihn mit ihren blauen Augen vorwurfsvoll an und antwortete mit ihrem sanften schottischen Akzent:
„Das hast du mir schon einmal gesagt, John, als das andere Kind gestorben ist, unten in Grahamstown, und ich bin es leid, das zu hören. Verlang nicht von mir, den Herrn zu preisen, wenn er mir meine Kinder nimmt, nein, das kann keine Mutter, Er, der sie verschonen könnte, wenn Er wollte. Warum sollte der Herr mir Fieber geben, sodass ich es nicht pflegen konnte, und eine Schlange die Kuh beißen lassen, sodass sie starb? Wenn die Wege des Herrn so sind, dann sind die der Wilden barmherziger.“
„Janey, Janey, läster nicht“, hatte ihr Vater ausgerufen. „Du solltest dich freuen, dass das Kind im Himmel ist.“
„Dann freue du dich und lass mich trauern. Von heute an habe ich nur noch ein Gebet, dass ich nie wieder ein Kind haben möge. John“, fügte sie mit einem plötzlichen Ausbruch hinzu, „es ist deine Schuld. Du weißt genau, dass ich dir gesagt habe, wie es kommen würde. Ich habe dir gesagt, dass das Kind sterben würde, wenn du diese verrückte Reise antrittst, ja, und ich sage dir“ – hier sank ihre Stimme zu einer Art klagendem Flüstern – „bevor die Geschichte zu Ende ist, werden auch andere sterben, wir alle, außer Rachel dort, die geboren wurde, um ihr Leben zu leben. Nun, was mich betrifft, je früher desto besser, denn ich möchte mit meinen Kindern einschlafen.“
„Das ist böse“, unterbrach sie ihr Mann, „böse und rebellisch ...“
„Dann soll es böse und rebellisch sein, John. Aber warum bin ich böse, wenn ich wie meine Mutter vor mir die Gabe der Hellseherei habe? Oh! Sie hat mich gewarnt, was passieren würde, wenn ich dich heirate, und ich habe nicht auf sie gehört; jetzt warne ich dich, und du hörst nicht auf mich. Nun gut, so sei es, wir müssen unser eigenes Schicksal ertragen, jeder von uns, ein kurzes; alle außer Rachel, die geboren wurde, um ihr Leben zu leben. Mann, ich sage dir, der Geist treibt dich dazu, die Heiden zu bekehren, nur aus einem Grund: damit die Heiden dich zum Märtyrer machen können.“
„Dann sollen sie es tun“, antwortete ihr Vater stolz. „Ich wünsche mir kein besseres Ende.“
„Ja“, stöhnte sie und sank zurück auf das Kartell, „soll es doch so sein, aber mein Baby, mein armes Baby! Warum sollte mein Baby sterben, weil zu viel Religion dich verrückt gemacht hat, um die Märtyrerkrone zu gewinnen? Märtyrer sollten nicht heiraten und Kinder haben, John.“
Dann, unfähig, es länger zu ertragen, war Rachel aus dem Zelt geflohen und hatte sich in einiger Entfernung hingesetzt, um das ölige Meer zu beobachten.
Man sagt, Rachel sei erst fünfzehn gewesen, aber in Südafrika werden Mädchen schnell erwachsen; außerdem hatten ihre Erfahrungen ihre Intelligenz reifen lassen. So war sie durchaus in der Lage, sich ein Urteil über ihre Eltern, ihre Tugenden und ihre Schwächen zu bilden. Rachel war in England geboren, hatte aber keine Erinnerung an England, da sie im Alter von vier Jahren nach Südafrika gekommen war. Kurz nach ihrer Geburt hatte ihr Vater infolge einiger Treffen, an denen er in London teilgenommen hatte, von einer missionarischen Leidenschaft gepackt worden. Er war damals Pfarrer in einer ruhigen Gemeinde in Hertfordshire, hatte ein gutes Einkommen und ein paar private Mittel, aber nichts konnte ihn davon abhalten, all seine Pläne aufzugeben und nach Südafrika zu segeln, um seiner „Berufung” zu folgen. Rachel wusste das alles, weil ihre Mutter es ihr oft erzählt hatte und noch dazu, dass sie und ihre Familie, die aus einer guten schottischen Familie stammten, gegen diesen Südafrika-Plan gekämpft hatten, bis es fast zu einem offenen Streit kam.
Schließlich kam es tatsächlich zu einer Entscheidung zwischen Unterwerfung und Trennung. Mr. Dove hatte erklärt, dass er selbst um ihretwillen nicht „gegen den Geist sündigen” würde, der ihn auserwählt hatte, denen Licht zu bringen, die in Finsternis saßen – nämlich den Kaffern und insbesondere dem Teil von ihnen, der in Knechtschaft unter den Buren stand. Denn zu dieser Zeit gab es in England eine Bewegung, die schließlich zur Befreiung der Sklaven der Kap-Holländer und danach zu deren Auszug in die Wildnis und zu den meisten der Kriege führte, die unserer Generation bekannt sind. Da sie ihrem Mann, der abgesehen von seiner religiösen Begeisterung oder vielmehr Besessenheit in Wahrheit ein sehr liebenswerter Mann war, sehr zugetan war, gab sie nach und kam mit. Bevor sie jedoch in See stachen, wurde die allgemeine düstere Stimmung noch getrübt, als Mrs. Dove verkündete, dass ihr Herz ihr sagte, dass keiner von ihnen jemals wieder nach Hause zurückkehren würde, da sie dazu verdammt seien, durch die Hand von Wilden zu sterben.
Was auch immer der Grund oder die Erklärung dafür war, so wissenschaftlich unmöglich diese Tatsache auch sein mochte, es blieb eine Tatsache, dass Janey Dove, wie ihre Mutter und mehrere ihrer schottischen Vorfahren, hellsichtig war, oder zumindest glaubten das ihre Verwandten und Freunde. Als sie ihnen also ihre Überzeugung mitteilte, als wäre es eine alltägliche Information, zweifelten sie keine Sekunde an deren Richtigkeit, sondern verdoppelten nur ihre Bemühungen, sie davon abzuhalten, nach Afrika zu gehen. Selbst ihr Mann zweifelte nicht daran, sondern bemerkte gereizt, dass es schade sei, dass sie nicht auch manchmal in Bezug auf angenehme zukünftige Ereignisse vorausschauend sein könne, da er seinerseits durchaus bereit sei, auf unangenehme Ereignisse zu warten, bis sie eintreten würden. Nicht, dass er persönlich vor der Aussicht auf das Martyrium zurückschreckte; darüber konnte er mit Selbstzufriedenheit und sogar Begeisterung nachdenken, aber so fanatisch er auch war, schreckte er doch vor dem Gedanken zurück, dass seine schöne und zarte Frau aufgefordert werden könnte, den Ruhm dieser Krone zu teilen. Da sein eigener Entschluss unumstößlich war, schlug er nun selbst vor, dass er allein aufbrechen sollte, um ihn zu suchen.
Da zeigte seine Frau eine ungeahnte Charakterstärke. Sie sagte, sie habe ihn gegen den Willen ihrer Familie in guten wie in schlechten Zeiten geheiratet, sie liebe und respektiere ihn und würde lieber zu gegebener Zeit von den Kaffern ermordet werden, als eine Trennung zu ertragen, die möglicherweise ein Leben lang dauern würde. So brachen die beiden schließlich mit ihrer kleinen Tochter Rachel auf einem Segelschiff auf, und ihre Freunde und Verwandten sahen sie nie wieder.
Ihre weitere Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Erzählung einsetzt, lässt sich mit wenigen Worten schildern. Als Missionar war der ehrwürdige John Dove kein Erfolg. Die Buren im Osten der Kapkolonie, wo er wirkte, wussten seine Bemühungen, ihre Sklaven zu christianisieren, nicht zu schätzen. Die Sklaven ebenfalls nicht, denn so heilig er auch sein mochte, es fehlte ihm gänzlich an dem mitfühlenden Einblick, der ihn hätte erkennen lassen, dass ein Eingeborener mit tausenden Generationen von Wildheit im Rücken ein anderes Wesen ist als ein hochgebildeter Christ – und nach einem anderen Maßstab beurteilt werden sollte. Ihre Sünden, unter denen er auch all ihre liebsten überlieferten Bräuche zählte, entsetzten ihn, wie er unablässig von den Dächern herab verkündete. Zudem kam es vor, dass er gelegentlich eine „Brandmarke aus dem Feuer riss“, wie er es nannte – und wenn sich dann herausstellte, dass diese noch immer loderte oder, schlimmer noch, ihre ursprünglichen Verfehlungen durch die des weißen Mannes ersetzt hatte, etwa Trunksucht, Diebstahl und Lüge, von denen sie zuvor frei gewesen war, so verdammte er sie offen zur ewigen Verdammnis. Ferner war er zu aufsässig – oder, wie er es nannte, zu ehrlich –, um sich der Autorität seiner kirchlichen Vorgesetzten vor Ort zu unterwerfen, und arbeitete daher nur auf eigene Faust. Schließlich brachte er, wie er es ausdrückte, „seinen Becher zum Überlaufen“ – oder, in schlichter Sprache, machte das Land so heiß für sich, dass es ihn nicht mehr halten konnte –, indem er sich in einen erbitterten Streit mit den Buren verwickelte. Über diese im Großen und Ganzen achtbaren Leute bildete er sich die schlechteste und im Wesentlichen sehr ungerechte Meinung, die er nach England sandte, um sie in kirchlichen Blättern abdrucken zu lassen oder der Heimatregierung zur Veröffentlichung in offiziellen Berichten vorzulegen. Diese Schriften gelangten schließlich wieder nach Südafrika, wurden dort ins Niederländische übersetzt und wurden beiläufig zu einem der Anlässe für den Großen Treck.
Die Buren waren wütend und drohten, ihn als Verleumder zu erschießen. Auch die englischen Behörden waren wütend und forderten ihn auf, die Kontroverse zu beenden oder das Land zu verlassen. Schließlich erwiesen sich die Umstände als zu viel für ihn, so stur er auch sein mochte, und da sein Gewissen ihm kein Schweigen erlaubte, entschied sich Mr. Dove für die zweite Alternative. Die einzige Frage war, wohin er gehen sollte. Da er wohlhabend war und zusätzlich zu dem, was er vor seiner Abreise aus England besaß, ein kleines Vermögen geerbt hatte, bat ihn seine arme Frau, nach Hause zurückzukehren, mit dem Hinweis, dass er dort seinen Fall der britischen Öffentlichkeit darlegen könne. Diese Möglichkeit hatte für ihn ihren Reiz, aber nach einer Nacht des Nachdenkens und Betens lehnte er sie als eine trügerische Versuchung Satans ab.
Was, so argumentierte er, sollte er zurückkehren, um in England in Luxus zu leben, nicht nur ohne Märtyrertod, sondern als offensichtlicher Versager, dessen Mission völlig unerfüllt geblieben war? Seine Frau könne gehen, wenn sie wolle, und ihre überlebenden Kinder, Rachel und den neugeborenen Jungen, mitnehmen (sie hatten zwei andere kleine Mädchen begraben), aber er würde an seinem Posten und seiner Pflicht festhalten. Er hatte einige Engländer getroffen, die das Land namens Natal besucht hatten, wo sich weiße Menschen niederzulassen begannen. In diesem Land schien es keine Sklaven treibenden Buren zu geben, und die Einheimischen brauchten allem Anschein nach dringend die Führung des Evangeliums, insbesondere ein bestimmter König des Volkes namens Zulus, der Chaka oder Dingaan hieß, er war sich nicht sicher, welcher Name der richtige war. Er wollte unbedingt diesem wilden Typen begegnen, weil er fast sicher war, dass er ihm ohne die verderblichen Buren klarmachen könnte, dass er auf dem falschen Weg war, und ihn dazu bringen könnte, die nationalen Bräuche zu ändern, vor allem das Kämpfen und, noch schlimmer, die Polygamie.
Seine unglückliche Frau hörte zu und weinte, denn nun schien die Märtyrerkrone, die sie immer vorausgesehen hatte, unangenehm nah zu sein, ja, sie leuchtete blutrot in Reichweite ihrer Hand. Außerdem glaubte sie in ihrem Herzen nicht, dass die Kaffern bekehrt werden könnten, zumindest nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Sie waren kämpferische Männer, wie es ihre Vorfahren aus den Highlands gewesen waren, und ihr schottisches Blut konnte diese Schwäche nachvollziehen, während sie hinsichtlich der Polygamie längst insgeheim zu dem Schluss gekommen war, dass diese Praxis sehr gut zu ihnen passte, so wie sie zu David und Salomon und sogar zu Abraham gepasst hatte. Aber trotz alledem, obwohl sie auf ihre unheimliche Art sicher war, dass der Tod ihres Babys durch ihren Verbleib verursacht werden würde, weigerte sie sich, ihren Mann zu verlassen, so wie sie es sich elf Jahre zuvor auch geweigert hatte.
Zweifellos lag Zuneigung dahinter, denn Janey Dove war eine sehr treue Frau; aber es gab auch andere Gründe – ihr Fatalismus und, noch stärker, ihre Müdigkeit. Sie glaubte, dass sie dem Untergang geweiht waren. Nun, dann sollte das Schicksal sie ereilen; sie hatte keine Angst vor dem Jenseits. Im besten Fall würde es glücklich sein, im schlimmsten Fall würde es tiefe, ewige Ruhe und Frieden bringen, und sie hatte das Gefühl, dass sie Tausende von Jahren der Ruhe und des Friedens brauchte. Außerdem war sie sich sicher, dass Rachel, ihrem Augapfel, nichts zustoßen würde, dass sie dazu bestimmt war, zu leben und sogar in diesem wilden Land ihr Glück zu finden. So kam es, dass sie das Angebot ihres Mannes ablehnte, nach Hause zurückzukehren, wo sie keine Bindungen mehr hatte, und sich zum vielleicht zwanzigsten Mal auf eine Reise vorbereitete, deren Ziel sie nicht kannte.
Rachel saß dort in der sonnenlosen, drückenden Hitze und dachte über diese Dinge nach. Natürlich kannte sie nicht die ganze Geschichte, aber das meiste davon hatte sie auf die eine oder andere Weise mitbekommen, und da sie von Natur aus klug war, konnte sie den Rest erraten, denn als Einzelgängerin hatte sie viel Zeit zum Nachdenken und Rätseln. Sie sympathisierte mit den Ideen ihres Vaters und verstand vage, dass sie etwas Großes und Edles an sich hatten, aber im Großen und Ganzen war sie mit Körper und Geist das Kind ihrer Mutter. Sie hatte schon die verträumte Schönheit ihrer Mutter, dazu die geraden Gesichtszüge und klaren grauen Augen ihres Vaters und würde wohl auch seine Größe haben. Aber von seinem Charakter hatte sie wenig, abgesehen von dem Mut und der Zielstrebigkeit, die beide auszeichneten.
Ansonsten war sie weit weg oder vorausschauend wie ihre Mutter und ahnte durch einen seltsamen Instinkt das Ende der Dinge; außerdem war sie sehr treu.
Rachel war unglücklich. Die Strapazen und die Hitze machten ihr nichts aus, denn sie war an beides gewöhnt, und ihre Gesundheit war so gut, dass es schon viel Schlimmeres gebraucht hätte, um sie zu beeinträchtigen. Aber sie liebte das Baby, das fort war, und fragte sich, ob sie es jemals wiedersehen würde. Im Großen und Ganzen glaubte sie daran, denn hier kam ihre Intuition ins Spiel, aber selbst im besten Fall war sie sich sicher, dass sie lange warten müsste. Sie liebte auch ihre Mutter und trauerte mehr um sie als um sich selbst, besonders jetzt, wo sie so krank war. Außerdem wusste sie, wie ihre Mutter dachte, und teilte ihre Meinung. Diese Reise hielt sie für eine Dummheit; ihr Vater war ein Mann, der „von einem Stern geleitet“ wurde, wie die Einheimischen sagten, und würde ihm bis ans Ende der Welt folgen, ohne seinem Ziel näher zu kommen. Er war nicht geeignet, sich um ihre Mutter zu kümmern.
An sich selbst dachte sie nicht so viel. Dennoch hatte sie in Grahamstown etwa ein Jahr lang andere Kinder als Spielkameraden gehabt, die meisten von ihnen waren zwar Niederländer und alle grob in ihren Gedanken und Manieren. Aber sie waren weiß und menschlich. Wenn sie mit ihnen spielte, konnte sie vergessen, dass sie so viel mehr wusste als sie; dass sie zum Beispiel die Evangelien auf Griechisch lesen konnte – was ihr Vater ihr seit ihrer Kindheit beigebracht hatte –, während sie sie kaum in Taal, dem Buren-Dialekt, buchstabieren konnten und noch nie von Wilhelm dem Eroberer gehört hatten. Griechisch und Wilhelm der Eroberer waren ihr nicht besonders wichtig, aber ihre Freunde waren ihr wichtig, und jetzt waren sie alle weg, weg wie das Baby, so weit weg wie Wilhelm der Eroberer. Und sie war allein in der Wildnis mit einem Vater, der den ganzen Tag über den Himmel redete und nachdachte, und einer Mutter, die in Erinnerungen lebte und im Schatten des Untergangs wandelte, und oh! Sie war unglücklich.
Ihre grauen Augen füllten sich mit Tränen, sodass sie den endlosen Ozean nicht mehr sehen konnte, was ihr aber nichts ausmachte, da er sie ermüdete. Sie wischte sie mit dem Handrücken ab, der von der Sonne ganz braun gebrannt war, und wandte sich ungeduldig ab, um zwei dieser seltsamen Insekten zu beobachten, die als Gottesanbeterinnen bekannt sind oder in Südafrika oft als Hottentottengötter bezeichnet werden und die nach einer Reihe von Kniefällen nun verzweifelt zwischen den toten Grashalmen zu ihren Füßen kämpften. Menschen könnten nicht grausamer sein, dachte sie, denn ihre Wildheit war wirklich abscheulich. Dann fiel eine große Träne auf den Kopf eines der beiden, und erstaunt über dieses Phänomen oder vielleicht denkend, es hätte zu regnen begonnen, rannte es davon und versteckte sich, während sein Gegner sich aufrichtete und triumphierend um sich blickte, um sich selbst alle Ehre für den Sieg zuzuschreiben.
Sie hörte Schritte hinter sich und wischte sich heimlich mit der Hand, dem einzigen Taschentuch, das sie hatte, die Augen ab. Dann drehte sie sich um und sah ihren Vater auf sich zukommen.
„Warum weinst du, Rachel?“, fragte er mit gereizter Stimme. „Es ist falsch zu weinen, weil dein kleiner Bruder in die Herrlichkeit aufgenommen wurde.“
„Jesus hat um Lazarus geweint, und der war nicht mal sein Bruder“, antwortete sie nachdenklich und fügte dann, um sich zu verteidigen, zusammenhanglos hinzu: „Ich habe zwei Hottentottengötter kämpfen sehen.“
Da Mr. Dove keine Antwort auf ihr sehr endgültiges biblisches Beispiel finden konnte, griff er sie wegen des letzteren Punktes an.
„Eine grausame Unterhaltung“, sagte er, „vor allem, weil ich gehört habe, dass Jungen, ja sogar Männer, diese armen Insekten gegeneinander antreten lassen und Wetten darauf abschließen.“
„Die Natur ist grausam, nicht ich, Vater. Die Natur ist immer grausam“, sagte sie und blickte zu dem kleinen Grab unter dem Felsen. Dann, während ihr Vater zum zweiten Mal zögerte und nicht wusste, was er antworten sollte, fügte sie schnell hinzu: „Geht es Mutter jetzt besser?“
„Nein“, sagte er, „schlechter, glaube ich, sehr hysterisch und völlig unfähig, die Dinge in ihrem wahren Licht zu sehen.“
Sie stand auf und stellte sich ihm gegenüber, denn sie war ein mutiges Kind, und fragte dann:
„Vater, warum nimmst du sie nicht mit zurück? Sie ist nicht in der Lage, weiterzumachen. Es ist falsch, sie in diese Wildnis zu schleppen.“
Bei dieser Frage wurde er sehr wütend und fing an, sie zu schelten und davon zu reden, wie schlimm es sei, seine „Berufung“ aufzugeben.
„Aber Mutter hat keine ‚Berufung‘“, warf sie ein.
Als er zum dritten Mal keine Antwort fand, sagte er wütend, dass sie beide gegen ihn zusammenarbeiten würden, dass sie Werkzeuge des Bösen seien, die ihn von seiner Pflicht abbringen wollten, indem sie seine natürlichen Ängste und Zuneigungen ausnutzen würden und so weiter.
Das Kind beobachtete ihn mit ihren klaren grauen Augen und sagte nichts mehr, bis er sich schließlich beruhigte und inne hielt.
„Wir sind alle sehr aufgeregt“, fuhr er fort und rieb sich mit seiner dünnen Hand die hohe Stirn. „Ich nehme an, es ist die Hitze und diese – diese – Prüfung unseres Glaubens. Worüber wollte ich mit dir sprechen? Oh! Ich erinnere mich: Deine Mutter will nichts essen und verlangt ständig nach Obst. Weißt du, wo es Obst gibt?“
„Hier wächst kein Obst, Vater.“ Dann hellte sich ihr Gesicht auf und sie fügte hinzu: „Doch, doch, das tut es doch. An dem Tag, als wir in diesem Lager Halt machten, gingen Mutter und ich zum Fluss hinunter und liefen zu dieser Art Insel hinter dem trockenen Donga, um einige Blumen zu pflücken, die auf dem feuchten Boden wachsen. Ich sah dort viele Kapstachelbeeren, die alle ziemlich reif waren.“
„Dann geh und hol welche, Liebes. Du hast genug Zeit, bevor es dunkel wird.“
Sie sprang auf, als wolle sie gehorchen, hielt sich dann aber zurück und sagte:
„Mutter hat mir gesagt, ich solle nicht alleine zum Fluss gehen, weil wir Spuren von Löwen und Krokodilen im Schlamm gesehen haben.“
„Gott wird dich vor den Löwen und Krokodilen beschützen, falls es welche gibt“, antwortete er hartnäckig, denn war dies nicht eine Gelegenheit, seinen Glauben zu zeigen? „Du hast doch keine Angst, oder?“
„Nein, Vater. Ich habe vor nichts Angst, vielleicht weil es mir egal ist, was passiert. Ich hole den Korb und gehe sofort.“
Eine Minute später ging sie schnell zum Fluss, eine einsame kleine Gestalt an diesem großen Ort. Mr. Dove beobachtete sie unruhig, bis sie im Dunst verschwand, denn sein Verstand sagte ihm, dass dies eine dumme Reise war.
„Der Herr wird seine Engel schicken, um sie zu beschützen“, murmelte er vor sich hin. „Oh, wenn ich nur mehr Glauben hätte! All diese Probleme kommen über mich, weil mir der Glaube fehlt, und dadurch werde ich ständig in Versuchung geführt. Ich glaube, ich werde ihr nachlaufen und auch gehen. Nein, Janey ruft mich, ich kann sie nicht allein lassen. Der Herr wird sie beschützen, aber ich muss Janey nicht sagen, dass sie weg ist, es sei denn, sie fragt mich direkt danach. Sie wird in Sicherheit sein, der Sturm wird heute Nacht nicht losbrechen.“
KAPITEL II DER JUNGE
Der Fluss, zu dem Rachel unterwegs war, eine der Mündungen des Umtavuna, war viel weiter weg, als es aussah; er war tatsächlich nicht weniger als eineinhalb Meilen entfernt. Sie hatte gesagt, dass sie nichts fürchtete, und das stimmte auch, denn außergewöhnlicher Mut war eine der Eigenschaften dieses Kindes. Sie konnte sich kaum daran erinnern, jemals Angst gehabt zu haben – außer manchmal vor ihrem Vater, wenn er wütend wurde – oder war es eher rasend? – und sie anschrie und ihr mit Strafe in einer anderen Welt drohte, als Vergeltung für ihre kindlichen Sünden. Aber selbst dann hielt dieses Gefühl nicht lange an, weil sie nicht an diese Strafe glauben konnte, die er sich so lebhaft vorstellte. So kam es, dass sie jetzt keine Angst hatte, obwohl es so viele Gründe dafür gab.
Denn dieser Ort war einsam; kein Lebewesen war zu sehen. Außerdem lag eine schreckliche Stille über der Erde und am Himmel; nur weit weg über den Bergen blitzte es unaufhörlich, als würde ein Monster am Himmel mit tausend Feuerzungen die Abgründe und Gipfel lecken. Nichts regte sich, nicht einmal ein Insekt; jedes Lebewesen, das atmete, hatte sich versteckt, bis der kommende Schrecken vorüber war.
Die Atmosphäre war voller Elektrizität, die sich zu befreien versuchte. Obwohl sie nicht wusste, was es war, spürte Rachel es in ihrem Blut und ihrem Gehirn. Auf seltsame Weise beeinflusste es ihren Geist und öffnete dort Fenster, durch die die Augen ihrer Seele hinausblickten. Sie wurde sich eines neuen Einflusses bewusst, der sich ihrem Leben näherte; plötzlich brach ihre aufkeimende Weiblichkeit in ihrer Brust auf, beleuchtet von einer unsichtbaren Sonne; sie war kein Kind mehr. Ihr Wesen wurde belebt und erkannte die Verbundenheit aller Dinge, die existieren. Dieser grüblerische, von Flammen durchzogene Himmel – sie war ein Teil davon, die Erde, auf der sie ging, war ein Teil von ihr; der Geist, der die Sterne rollen ließ und sie leben ließ, wohnte in ihrem Herzen, und wie ein Kind schmiegte sie sich in den Arm seines allmächtigen Willens.
Nun stieg Rachel wie in einem Traum die steilen, mit Felsen übersäten Ufer des ausgetrockneten Flussbettes hinab, bahnte sich ihren Weg zwischen den Felsbrocken und bemerkte, dass verrottetes Unkraut und abgeblättertes Reisig an den Stämmen der Mimosensträucher lag, die dort wuchsen – Zeichen, die ihr verrieten, dass hier in Zeiten der Flut das Wasser floss. Nun, jetzt war nur noch wenig davon übrig, nur ein oder zwei Tümpel, die den Blitz wie einen Spiegel reflektierten. Vor ihr lag die Insel, auf der die Kapstachelbeeren wuchsen, oder Winterkirschen, wie sie manchmal genannt werden, die sie suchte. Es war ein flaches Stück Land, vielleicht eine Viertelmeile lang, aber in der Mitte befanden sich einige große Felsen, zwischen denen Bäume wuchsen, von denen einer höher war als die anderen. Dahinter floss der echte Fluss, der selbst jetzt, am Ende der Trockenzeit, noch drei- oder vierhundert Meter breit war, aber so flach, dass man ihn mit einem Ochsenkarren durchqueren konnte.
Es regnete auf den Bergen dort drüben, es regnete in Strömen aus diesen pechschwarzen Wolken, wie es schon seit vierundzwanzig Stunden immer wieder der Fall war, und über ihrem feuergesäumten Schoß schwebten herrlich gefärbte Massen von nebligem Dunst, der von den Strahlen der untergehenden Sonne in tausend Farben entflammt wurde. Über ihr war jedoch keine Sonne zu sehen, nur ein Vorhang aus Wolken, der sich allmählich von grau zu schwarz verfärbte und sich von Minute zu Minute näher an die Erde senkte.
Rachel ging durch das trockene Flussbett und erreichte die Insel, die die letzte und höchste einer Reihe ähnlicher Inseln war, die durch schmale Wasserstreifen voneinander getrennt wie eine Kette zwischen dem trockenen Donga und dem Fluss lagen. Hier fing sie an, ihre Stachelbeeren zu pflücken, indem sie die silbernen, achteckigen Schoten von den grünen Stielen, an denen sie wuchsen, abnahm. Zuerst öffnete sie diese Schoten und entfernte aus jeder die gelbe, leicht saure Beere, weil sie dachte, dass ihr Korb so mehr fassen würde, aber bald gab sie diesen Plan auf, weil es zu viel Zeit kostete. Auch wenn die Pflanzen reichlich vorhanden waren, war es in diesem schwachen und seltsamen Licht nicht leicht, sie zwischen dem dichten Schilfgewächs zu erkennen.
Während sie damit beschäftigt war, bemerkte sie ein leises Stöhnen und eine Bewegung in der Luft um sie herum, die die Blätter und Gräser zum Zittern brachte, ohne dass sie sich bogen. Dann folgte ein eiskalter Wind, der an Stärke zunahm, bis er scharf und hart wehte und die Oberfläche der sumpfigen Tümpel kräuselte. Rachel machte trotzdem weiter, denn ihr Korb war noch nicht mal halb voll, bis plötzlich der Himmel über ihr zu grollen und zu stöhnen begann und Regentropfen so groß wie Schillinge auf ihren Rücken und ihre Hände fielen. Jetzt wusste sie, dass es Zeit war zu gehen, und machte sich auf den Weg über die Insel – denn sie war gerade auf der anderen Seite – um das tiefe, felsige Flussbett oder Donga zu erreichen.
Noch bevor sie dort ankam, brach mit schrecklicher Plötzlichkeit und unvorstellbarer Wucht der Sturm los. Ein Orkan fegte das Tal hinunter zum Meer, und für ein paar Minuten wurde die Dunkelheit so dicht, dass sie kaum noch vorwärts stolpern konnte. Dann gab es Licht, ein schreckliches Licht; der ganze Himmel schien in Flammen zu stehen, ja, und die Erde auch; es war, als wäre die letzte schreckliche Katastrophe über die Welt hereingebrochen.
Geschüttelt und außer Atem erreichte Rachel endlich den Rand des tiefen Flussbetts, das vielleicht fünfzig Meter breit war, und wollte gerade hineingehen, als ihr zwei Dinge auffielen. Das erste war ein brodelndes, dröhnendes Geräusch, das so laut war, dass es sogar das Donnern des Gewitters zu übertönen schien, und das zweite, mal sichtbar, mal unsichtbar, wenn der Blitz aufleuchtete und wieder erlosch, war die Gestalt eines jungen Mannes, eines weißen jungen Mannes, der von einem Pferd abgestiegen war, das in seiner Nähe, aber oberhalb von ihm stehen geblieben war, und mit einem Gewehr in der Hand auf einem Felsen am anderen Ufer der Schlucht stand.
Er hatte sie auch gesehen und rief ihr zu, da war sie sich sicher, denn obwohl seine Stimme im Getöse unterging, konnte sie seine Gesten sehen, wenn der Blitz aufleuchtete, und sogar die Bewegung seiner Lippen.
Vage darüber rätselnd, was ein weißer Junge an einem solchen Ort zu suchen habe, und sehr erfreut über die Aussicht auf seine Gesellschaft, begann Rachel, sich ihm in kurzen Sätzen zu nähern, immer dann, wenn der Blitz ihr zeigte, wohin sie ihre Füße setzen konnte. Zwei dieser Sätze hatte sie bereits gemacht, als sie schließlich, aus der Heftigkeit und Art seiner Bewegungen, begriff, dass er versuchte, sie am Weitergehen zu hindern, und verwirrt stehenblieb.
Einen Augenblick später wusste sie auch warum. Einige hundert Meter oberhalb von ihr machte das Flussbett eine Biegung, und plötzlich tauchte hinter dieser Biegung eine mit Schaum gekrönte Wasserwand auf, in der Bäume und Tierkadaver wie Strohhalme herumwirbelten. Die Flut war aus den Bergen heruntergekommen und näherte sich ihr schneller, als ein Pferd galoppieren konnte. Rachel rannte ein Stück vorwärts, dann begriff sie, dass sie keine Zeit mehr hatte, um überzusetzen, und stand verwirrt da, denn das furchtbare Tosen der Elemente und das schreckliche Brüllen der heranrollenden Schaumwand überwältigten ihre Sinne. Die Blitze erloschen für einen Moment, dann fingen sie wieder an, mit zehnfacher Häufigkeit und Kraft zu spielen. Sie schlugen auf den nahenden Strom ein, sie schlugen in das trockene Bett vor ihm ein und sprangen von der Erde nach oben, als würden Titanen und Götter Speere aufeinander werfen.
Im grellen Schein der Blitze sah sie, wie der Junge von seinem Felsen sprang und auf sie zustürmte. Ein Blitz schlug ein und spaltete einen Felsbrocken keine dreißig Schritte von ihm entfernt, wodurch er ins Straucheln geriet, aber er fasste sich wieder und rannte weiter. Jetzt war er ganz in der Nähe, aber das Wasser war noch näher. Es kam in Stufen oder Felsvorsprüngen, eine dünne Schaumschicht vorne, dann weitere Schichten darüber, jede wenige Meter hinter der anderen. Auf der obersten Stufe, ganz oben, lag ein Büffel, tot, aber mit gesenktem Kopf, als würde er angreifen, und Rachel dachte vage, dass seine Hörner sie in wenigen Augenblicken treffen würden, so wie sie aus der Richtung kamen, aus der er gekommen war. Eine Sekunde später umfasste ein Arm ihre Taille – sie bemerkte, wie weiß er dort war, wo der Ärmel hochgekrempelt war, leichenblass im Blitzlicht – und sie wurde zu dem Ufer gezogen, das sie verlassen hatte. Die erste Wasserwelle traf sie und hätte sie fast von den Füßen gerissen, aber sie war stark und aktiv, und die Berührung dieses Arms schien ihr ihre Geistesgegenwart zurückgegeben zu haben, sodass sie wieder Halt fand und vorwärts spritzte. Nun reichte die nächste Welle beiden bis über die Knie, wurde aber für einen Moment flacher, sodass sie nicht fielen. Das hohe Ufer war kaum fünf Meter entfernt, und die Wasserwand vielleicht zwanzig.
„Zusammen durch Leben und Tod!“, sagte eine englische Stimme in ihrem Ohr, und der Ruf erreichte sie nur als Flüstern.
Der Junge und das Mädchen sprangen wie Rehe vorwärts. Sie erreichten das Ufer und kletterten mühsam hinauf. Das hungrige Wasser sprang sie an wie ein lebendes Wesen und packte ihre Füße und Beine, als hätte es Hände; ein herumwirbelnder Ast traf den Jungen an der Schulter, und an der Stelle, wo er ihn traf, wurde seine Kleidung zerrissen und rotes Blut trat hervor. Er wäre fast gefallen, aber diesmal war es Rachel, die ihn stützte. Dann noch eine letzte Anstrengung, und sie rollten erschöpft auf den Boden, knapp außerhalb der Flutwelle.
So kam Richard Darrien durch den Sturm, bedroht von den tödlichen Fluten, aus denen er sie gerettet hatte, und begleitet von den Blitzen des Himmels, in das Leben von Rachel Dove.
Nachdem sie wieder zu Atem gekommen waren, setzten sie sich auf und sahen sich im Licht der Blitze an, das alles war, was sie hatten. Er war ein gutaussehender Junge von etwa siebzehn Jahren, wenn auch für sein Alter eher klein; kräftig gebaut, sehr hellhäutig und seltsamerweise Rachel auffallend ähnlich, nur dass sein Haar ein paar Nuancen dunkler war als ihres. Sie hatten die gleichen klaren grauen Augen und die gleichen wohlgeformten Gesichtszüge; wenn man sie zusammen sah, hätten die meisten Leute sie für Bruder und Schwester gehalten und ihre Familienähnlichkeit bemerkt. Rachel sprach als Erste.
„Wer bist du?“, rief sie ihm in einer der Dunkelphasen ins Ohr, „und warum bist du hierher gekommen?“
„Mein Name ist Richard Darrien“, antwortete er mit lauter Stimme, „und ich weiß nicht, warum ich gekommen bin. Ich vermute, etwas hat mich geschickt, um dich zu retten.“
„Ja“, antwortete sie überzeugt, „etwas hat dich geschickt. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich jetzt tot, oder? In Ruhm, wie mein Vater sagt.“
„Ich weiß nichts über Ruhm oder was das ist“, meinte er, nachdem er über diesen Satz nachgedacht hatte, „aber du wärst in den Fluten ins Meer getrieben worden, wie dieser Büffel, ohne einen einzigen Knochen im Leib, und das ist nicht meine Vorstellung von Ruhm.“
„Das liegt daran, dass dein Vater kein Missionar ist“, sagte Rachel.
„Nein, er ist Offizier, Marineoffizier, oder zumindest war er das, jetzt handelt er und jagt. Wir kommen aus Natal. Aber wie heißt du?“
„Rachel Dove.“
„Nun, Rachel Dove – das ist ein sehr hübscher Name, Rachel Dove, so wie du auch hübsch wärst, wenn du sauberer wärst – es wird gleich regnen. Gibt es hier irgendwo einen Ort, an dem wir Schutz finden können?“
„Ich bin genauso sauber wie du“, antwortete sie empört. „Der Fluss hat mich nur schmutzig gemacht, das ist alles. Du kannst dich unterstellen, ich bleibe hier und lasse mich vom Regen waschen.“
„Und an Unterkühlung sterben oder vom Blitz getroffen werden. Natürlich wusste ich, dass du nicht wirklich schmutzig bist. Gibt es irgendwo einen Ort?“
Sie nickte versöhnlich.
„Ich glaube, ich kenne einen. Komm“, sagte sie und streckte ihm ihre Hand entgegen.
Er nahm sie, und so gingen sie Hand in Hand zum höchsten Punkt der Insel, wo die Bäume wuchsen, denn hier bildeten die aufgeschichteten Felsen eine Art Höhle, in der Rachel und ihre Mutter eine Weile gesessen hatten, als sie diesen Ort besucht hatten. Als sie sich dorthin tasteten, blitzte es auf und sie sahen, wie ein großer, gezackter Blitz in den höchsten Baum einschlug und ihn zerbrach, woraufhin ein wildes Tier, das dort Schutz gesucht hatte, schnaufend an ihnen vorbeirannte.
„Das sieht nicht sehr sicher aus“, sagte Richard und blieb stehen, „aber komm schon, es ist unwahrscheinlich, dass es zweimal an derselben Stelle einschlägt.“
„Solltest du nicht besser dein Gewehr zurücklassen?“, schlug sie vor, denn die ganze Zeit über hatte er die Waffe auf dem Rücken getragen, und sie wusste, dass Blitze eine Vorliebe für Eisen haben.
„Auf keinen Fall“, antwortete er, „es ist eine neue, die mir mein Vater geschenkt hat, und ich werde mich nicht davon trennen.“
Dann gingen sie weiter und erreichten die kleine Höhle, gerade als der Regen richtig losbrach. Zufällig war der Ort trocken, da er so gelegen war, dass das Wasser von ihm abfloss. Sie kauerten zitternd darin und versuchten, sich mit toten Ästen und Reisig zu bedecken, das sich hier in der Regenzeit angesammelt hatte, als die ganze Insel unter Wasser stand.
„Es wäre schön, wenn wir nur ein Feuer hätten“, sagte Rachel, während ihre Zähne klapperten.
Der Junge Richard dachte eine Weile nach. Dann öffnete er ein Lederetui, das an seinem Gewehrriemen hing, und holte daraus eine Pulverflasche, Feuerstein und Stahl sowie etwas Zunder hervor. Er schüttete ein wenig Pulver auf den feuchten Zunder und schlug mit dem Feuerstein darauf, bis endlich ein Funke sprang und das Pulver entzündete. Der Zunder fing ebenfalls Feuer, wenn auch nur zögerlich, und während Rachel darauf blies, suchte er nach toten Blättern und kleinen Ästen, von denen einige zum Brennen gebracht werden konnten.
Danach war es einfach, da es reichlich Brennstoff gab, sodass sie bald ein prächtiges Feuer in der Höhle entfachen konnten, aus der der Rauch entwich. Jetzt konnten sie sich wärmen und trocknen, und als die Wärme in ihre ausgekühlten Körper eindrang, stieg ihre Stimmung. Tatsächlich trug der Kontrast zwischen diesem gemütlichen Versteck und dem lodernden Feuer aus Treibholz und dem tobenden Sturm draußen zur Fröhlichkeit der jungen Leute bei, die gerade noch dem Ertrinken entkommen waren.
„Ich bin so hungrig“, sagte Rachel nach einer Weile.
Wieder begann Richard zu suchen und holte diesmal einen langen, dicken Streifen sonnengetrockneten Fleisches aus seiner Manteltasche.
„Magst du Biltong?“, fragte er.
„Natürlich“, antwortete sie eifrig.
„Dann musst du es schneiden“, sagte er und reichte ihr das Fleisch und sein Messer. „Mein Arm tut weh, ich kann es nicht.“
„Oh!“, rief sie aus, „wie egoistisch von mir. Ich habe ganz vergessen, dass dich dieser Stock getroffen hat. Zeig mir die Stelle.“
Er zog seinen Mantel aus und kniete sich hin, während sie über ihm stand und seine Wunde im Schein des Feuers untersuchte. Sie stellte fest, dass sein linker Oberarm geprellt und aufgerissen war und blutete. Da Rachel, wie man sich erinnern wird, kein Taschentuch hatte, bat sie Richard um seines, das sie in einer Regenwasserpfütze direkt vor der Höhle nass machte. Dann wusch sie die Wunde gründlich aus, verband seinen Arm mit dem Taschentuch und bat ihn, seinen Mantel wieder anzuziehen, wobei sie zuversichtlich sagte, dass er in ein paar Tagen wieder gesund sein würde.
„Du bist clever“, sagte er voller Bewunderung. „Wer hat dir beigebracht, Wunden zu verbinden?“
„Mein Vater behandelt immer die Kaffern, und ich helfe ihm dabei“, antwortete Rachel, während sie ihre Hände in den strömenden Regen hielt, um sie zu waschen, dann das Biltong nahm und begann, es in dünne Scheiben zu schneiden.
Sie ließ ihn essen, bevor sie selbst etwas anrührte, denn sie sah, dass der Blutverlust ihn geschwächt hatte. Tatsächlich war ihre eigene Mahlzeit nur eine leichte, da die Hälfte des Fleischstreifens, wie sie erklärte, beiseite gelegt werden musste, für den Fall, dass sie die Insel nicht verlassen könnten. Da verstand er, warum sie ihn zuerst essen ließ, und war sehr wütend auf sich selbst und auf sie, aber sie lachte ihn nur aus und antwortete, sie habe von den Kaffern gelernt, dass Männer vor Frauen essen müssten, da sie in der Welt wichtiger seien.
„Du meinst, egoistischer“, antwortete er und betrachtete diese kluge kleine Magd und ihre winzige Portion Biltong, die sie sehr langsam hinunterschluckte, vielleicht um vorzutäuschen, dass ihr Appetit mit dieser Überfülle bereits gestillt sei. Dann flehte er sie an, den Rest zu nehmen, und sagte, dass er am Morgen etwas Wild schießen könne, aber sie schüttelte nur ihren kleinen Kopf und presste hartnäckig die Lippen zusammen.
„Bist du ein Jäger?“, fragte sie, um das Thema zu wechseln.
„Ja“, antwortete er stolz, „das heißt, fast. Jedenfalls habe ich schon Eland und einen Elefanten geschossen, aber noch keine Löwen. Ich bin gerade einer Löwenspur gefolgt, aber er ist zwischen den Felsen verschwunden und davongelaufen, bevor ich schießen konnte. Ich glaube, er muss hinter dir her gewesen sein.“
„Vielleicht“, sagte Rachel. „Hier gibt es einige; ich habe sie nachts brüllen hören.“
„Als ich dich dann über diese Insel rennen sah, hörte ich das Rauschen des Wassers und sah, wie es den Donga hinunterströmte, und mir wurde klar, dass du ertrinken musstest, und – den Rest kennst du ja.“
„Ja, ich weiß, wie es weiterging“, sagte sie und sah ihn mit leuchtenden Augen an. „Du hast dein Leben riskiert, um meins zu retten, und deshalb“, fügte sie mit ruhiger Überzeugung hinzu, „gehört es dir.“
Er starrte sie an und sagte nur:
„Ich wünschte, das wäre so. Heute Morgen wollte ich mit meinem neuen Gewehr einen Löwen erlegen“, und er zeigte auf das schwere Gewehr an seiner Seite, „mehr als alles andere, aber heute Abend wünsche ich mir, dass dein Leben mir gehört – mehr als alles andere.“
Ihre Blicke trafen sich, und obwohl Rachel noch ein Kind war, sah sie etwas in Richards Augen, das sie dazu veranlasste, den Kopf abzuwenden.
„Wohin gehst du?“, fragte sie schnell.
„Zurück zur Farm meines Vaters in Graaf-Reinet, um das Elfenbein zu verkaufen. Außer meinem Vater sind noch drei andere dabei, zwei Buren und ein Engländer.“
„Und ich gehe nach Natal, wo du herkommst“, antwortete sie, „also nehme ich an, dass wir uns nach heute Nacht nie wieder sehen werden, obwohl mein Leben dir gehört – das heißt, wenn wir entkommen.“
In diesem Moment brach der Sturm, der sich etwas gelegt hatte, erneut mit voller Wucht herein, begleitet von einem Orkan und sintflutartigen Regenfällen, durch die unaufhörlich Blitze zuckten. Auch die Donnerschläge waren so laut und heftig, dass Richard und Rachel sich gegenseitig nicht mehr verstehen konnten. Also mussten sie zwangsläufig schweigen. Nur Richard stand auf und schaute aus der Höhle hinaus, dann drehte er sich um und winkte seine Begleiterin zu sich. Sie kam zu ihm und schaute mit ihm, bis plötzlich eine blendende Flammenwand die ganze Landschaft erhellte. Da sah sie, was er beobachtete, denn nun stand fast die ganze Insel, bis auf den hohen Teil, auf dem sie standen, unter Wasser, verdeckt von einer braunen, brodelnden Flut, die an ihnen vorbei ins Meer rauschte.
„Wenn es noch viel höher steigt, werden wir ertrinken“, schrie er ihr ins Ohr.
Sie nickte und rief zurück:
„Lass uns beten und uns bereit machen“, denn Rachel hatte das Gefühl, dass die „Herrlichkeit“, von der ihr Vater so oft sprach, ihnen näher war als je zuvor.
Dann zog sie ihn zurück in die Höhle und bedeutete ihm, sich neben sie zu knien, was er schüchtern tat, und eine Weile blieben die beiden Kinder, denn sie waren kaum mehr als das, so mit gefalteten Händen und bewegten Lippen sitzen. Bald ließ der Donner etwas nach, sodass sie sich wieder unterhalten konnten.
„Wofür hast du gebetet?“, fragte er, als sie sich wieder aufrichteten.
„Ich habe gebetet, dass du entkommen mögest und dass meine Mutter nicht zu sehr um mich trauert“, antwortete sie schlicht. „Und du?“
„Ich? Oh, dasselbe – dass du entkommen mögest. Ich habe nicht für meine Mutter gebetet, da sie tot ist, und meinen Vater habe ich vergessen.“
„Schau, schau!“, rief Rachel und zeigte auf den Eingang der Höhle.
Er starrte in die Dunkelheit und sah dort, durch die schwachen Flammen des Feuers hindurch, zwei große gelbe Gestalten, die auf und ab zu gehen schienen und in die Höhle starrten.
„Löwen“, keuchte er und griff nach seinem Gewehr.
„Nicht schießen“, rief sie, „du könntest sie verärgern. Vielleicht wollen sie nur wie wir Zuflucht suchen. Das Feuer wird sie fernhalten.“
Er nickte, erinnerte sich dann aber daran, dass die Ladung und die Zündung seines Steinschlossgewehrs feucht sein mussten, und machte sich mit Rachels Hilfe eilig daran, es mit der Schraube am Ende seines Ladestockes zu reinigen und anschließend mit etwas Pulver nachzuladen, das er bereits zum Trocknen auf einen flachen Stein in der Nähe des Feuers gelegt hatte. Dieser Vorgang dauerte fünf Minuten oder länger. Als er endlich fertig war und das Schloss mit dem trockenen Pulver neu geladen hatte, schlichen die beiden, Richard mit dem Gewehr in der Hand, zur Höhlenöffnung und schauten wieder hinaus.
Der große Sturm ging jetzt vorbei, und der Regen wurde schwächer, aber von Zeit zu Zeit blitzte es, nicht mehr in Form von Gabeln oder Ketten, sondern in breiten Flächen. In diesem gespenstischen Licht sahen sie einen seltsamen Anblick. Dort oben auf der Insel marschierten die beiden Löwen hin und her, als wären sie in einem Käfig, und machten dabei eine Art winselndes Geräusch, während sie sich unruhig umschauten. Außerdem waren sie nicht allein, denn dort hatten sich verschiedene andere Tiere versammelt, die von der Flut von den Inseln oberhalb von ihnen heruntergetrieben worden waren, Schilf- und Wasserböcke und ein großes Eland. Zwischen ihnen liefen die Löwen umher, ohne auch nur den geringsten Versuch zu machen, sie anzugreifen, und auch die Antilopen, die da standen, schnüffelten und starrten auf den Strom, nahmen keine Notiz von den Löwen und versuchten auch nicht zu fliehen.
„Du hast Recht“, sagte Richard, „sie haben alle Angst und werden uns nichts tun, es sei denn, das Wasser steigt weiter und sie stürmen in die Höhle. Komm, mach das Feuer an.“
Das taten sie und setzten sich auf die andere Seite des Feuers, um zu beobachten, bis, da nichts passierte, ihre Angst vor den Löwen verflog und sie wieder anfingen zu reden und sich gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben erzählten.
Richard Darrien war offenbar seit etwa fünf Jahren in Afrika, da sein Vater nach dem Tod seiner Mutter dorthin ausgewandert war, da er nur die halbe Rente eines pensionierten Marinekapitäns hatte und hoffte, in einem neuen Land sein Glück zu verbessern. Er hatte eine Farm im Bezirk Graaf-Reinet bekommen, aber wie viele andere der frühen Siedler hatte er Unglück gehabt. Um Geld zu verdienen, hatte er sich nun der Elefantenjagd zugewandt und kehrte gerade mit seinen Partnern von einer sehr erfolgreichen Expedition in die Küstengebiete von Natal zurück, die zu dieser Zeit noch fast unerforscht waren. Sein Vater hatte Richard erlaubt, die Gruppe zu begleiten, aber als sie zurückkamen, fügte der Junge traurig hinzu, sollte er für zwei oder drei Jahre auf das College in Kapstadt geschickt werden, da sein Vater sich bis dahin den Luxus einer Ausbildung nicht leisten konnte. Danach wollte er, dass er einen Beruf ergriff, aber in diesem Punkt hatte er – Richard – sich schon entschieden, auch wenn er im Moment noch nicht viel darüber sagte. Er würde Jäger werden und nichts anderes, bis er zu alt zum Jagen wäre, dann wollte er sich der Landwirtschaft widmen.
Nachdem er seine Geschichte erzählt hatte, erzählte Rachel ihm ihre, der er gespannt zuhörte.
„Ist dein Vater verrückt?”, fragte er, als sie fertig war.
„Nein“, antwortete sie. „Wie kannst du es wagen, so was zu sagen? Er ist nur sehr gut, viel besser als alle anderen.“
„Nun, das kommt doch auf dasselbe hinaus, oder?“, sagte Richard, „denn sonst hätte er dich nicht hierher geschickt, um Stachelbeeren zu pflücken, obwohl ein solcher Sturm aufzieht.“
„Warum hat dein Vater dich dann bei einem solchen Sturm auf die Jagd nach Löwen geschickt?“, fragte sie.
„Er hat mich nicht geschickt. Ich bin von selbst gekommen; ich sagte, ich wolle einen Bock schießen, und als ich die Spuren eines Löwen fand, folgte ich ihnen. Die Wagen müssen jetzt schon weit voraus sein, denn als ich sie verließ, kehrte ich zu der Schlucht zurück, wo ich den Bock gesehen hatte. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder einholen soll, und sicher wird niemand auf die Idee kommen, hier nach mir zu suchen, da sie nach diesem Regen die Spuren des Pferdes nicht mehr finden können.“
„Angenommen, du findest es – ich meine dein Pferd – morgen nicht, was wirst du dann tun?“, fragte Rachel. „Wir haben keines, das wir dir leihen könnten.“
„Ich werde zu Fuß gehen und versuchen, sie einzuholen“, antwortete er.
„Und wenn du sie nicht einholen kannst?“
„Dann komme ich zu dir zurück, denn die wilden Kaffern vor mir würden mich töten, wenn ich alleine weiterginge.“
„Oh! Aber was würde dein Vater denken?“
„Er würde denken, dass ein Junge weniger da ist, das ist alles, und eine Weile traurig sein. In Afrika, wo es so viele Löwen und Wilde gibt, verschwinden oft Menschen.“
Rachel dachte eine Weile nach, fand das Thema dann aber schwierig und schlug vor, dass er herausfinden sollte, was ihre eigenen Löwen machten. Also ging Richard nachsehen und berichtete, dass der Sturm aufgehört hatte und er im Mondlicht keine Löwen oder andere Tiere sehen konnte, sodass er dachte, dass sie irgendwohin verschwunden sein mussten. Auch das Hochwasser schien zurückzugehen. Beruhigt durch diese Nachricht, schüttete Rachel fast das gesamte übrig gebliebene Holz ins Feuer. Dann setzten sie sich wieder nebeneinander und versuchten, ihr Gespräch fortzusetzen. Nach und nach verstummten sie jedoch, und am Ende schliefen die beiden bald tief und fest in den Armen des anderen.
KAPITEL III AUF WIEDERSEHEN
Rachel wachte als Erste auf, weil ihr kalt war, da das Feuer fast erloschen war. Sie stand auf und verließ die Höhle. Die Morgendämmerung brach ruhig an, denn jetzt wehte kein Wind und es regnete nicht. Der Nebel, der vom Fluss und dem durchnässten Land aufstieg, war jedoch so dicht, dass sie keine zwei Meter vor sich sehen konnte, und aus Angst, über Löwen oder andere Tiere zu stolpern, wagte sie sich nicht weit von der Höhlenöffnung entfernt. In der Nähe befand sich ein großer, hohler Felsen, der jetzt mit Wasser gefüllt war wie eine Badewanne. Daraus trank sie, wusch sich und machte sich so gut es ging zurecht, ohne Seife, Kamm oder Handtücher. Dann kehrte sie zur Höhle zurück.
Da Richard noch schlief, legte sie ganz leise etwas mehr Holz auf die Glut, um ihn warm zu halten, setzte sich dann neben ihn und beobachtete ihn, denn nun drang das graue Licht der Morgendämmerung in ihre Zuflucht. Für sie sah dieser schlafende Junge wunderschön aus, und während sie ihn betrachtete, erfüllte sich ihr kindliches Herz mit einer seltsamen, neuen Zärtlichkeit, wie sie sie noch nie zuvor empfunden hatte. Irgendwie war er ihr ans Herz gewachsen, und Rachel wusste, dass sie ihn ihr Leben lang nicht vergessen würde. Doch auf diese Welle der Zuneigung folgte ein scharfer, plötzlicher Schmerz, denn sie erinnerte sich daran, dass sie sich bald trennen und nie wieder sehen würden. Zumindest schien das sicher zu sein, denn wie sollten sie sich sehen, wenn er zum Kap und sie nach Natal reisen würde?
Und doch, und doch sagte ihr eine seltsame Überzeugung etwas anderes. Die Kraft der Vorahnung, die sie von ihrer Mutter und ihren Vorfahren aus den Highlands geerbt hatte, erwachte in ihr, und sie wusste, dass ihr Leben und das Leben dieses Jungen miteinander verwoben waren. Vielleicht schlief sie wieder ein, während sie dort am Feuer saß. Jedenfalls schien es ihr, als träumte sie und sah Dinge in ihrem Traum. Wilde, turbulente Szenen eröffneten sich ihr in einer Vision; Szenen voller Blut und Schrecken, dazu Geräusche von Stimmen, die Krieg riefen. Es kam ihr vor, als wäre sie verrückt, und doch regierte sie wie eine Königin, der Tod kam ihr zwanzig Mal nahe, floh aber immer auf ihren Befehl hin. Jetzt war Richard Darrien bei ihr, und wie sie ihn verloren hatte und suchte – ach, wie sie suchte in dunklen Orten des Untergangs und in unnatürlicher Nacht. Es war, als wäre er tot und sie noch am Leben, und sie suchte ihn unter den Wohnstätten der Toten. Sie fand ihn auch und zog ihn zu sich heran. Wie, wusste sie nicht.
Dann gab es eine Szene, eine letzte Szene, die ihr im Gedächtnis blieb, nachdem alles andere verblasst war. Sie sah die riesigen Stämme der Waldbäume, gewaltige, hoch aufragende Bäume, düstere Bäume, unter denen man die Dunkelheit spüren konnte. Durch ihre Alleen schossen die flachen Pfeile der Morgendämmerung. Sie fielen auf sie, Rachel, gekleidet in Gewänder aus weißer Haut, die ihr langes, ausgebreitetes Haar in Gold verwandelten. Sie fielen auf kleine Menschen mit düster blassen Gesichtern, von denen einer an einen Baumstamm gekauert war, ein verschrumpelter, affenähnlicher Mann, der in dieser Weite klein wirkte. Sie fielen auf einen anderen Mann, weißhäutig, halbnackt, mit einem gelben Bart, der mit Lederriemen an einen zweiten Baum gefesselt war. Es war Richard Darrien, der älter geworden war, und zu seinen Füßen lag ein Speer mit breiter Klinge!
Die Vision verschwand, oder sie wurde aus ihrem Schlaf geweckt, wie auch immer, durch die angenehme Stimme desselben Richard, der gähnend vor ihr stand und sagte:
„Es ist Zeit aufzustehen. Sag mal, warum siehst du so komisch aus? Bist du krank?“
„Ich bin schon lange wach“, antwortete sie und rappelte sich mühsam auf. „Was meinst du?“
„Nichts, außer dass du vor einer Minute wie ein Geist aussahst. Jetzt bist du wieder ein Mädchen, es muss am Licht gelegen haben.“
„Wirklich? Nun, ich habe von Geistern geträumt, oder so etwas in der Art“, und sie erzählte ihm von der Vision der Bäume, obwohl sie sich an den Rest kaum erinnern konnte.
„Das ist eine seltsame Geschichte“, sagte er, als sie fertig war. „Ich wünschte, du hättest sie zu Ende geträumt, ich würde gerne wissen, wie es weiterging.“
„Eines Tages werden wir es herausfinden“, antwortete sie feierlich.
„Willst du damit sagen, dass du glaubst, dass es wahr ist, Rachel?“
„Ja, Richard, eines Tages werde ich dich an diesen Baum gefesselt sehen.“
„Dann hoffe ich, dass du mich losbindest, das ist alles. Was bist du doch für ein komisches Mädchen“, fügte er zweifelnd hinzu. „Ich weiß, was es ist, du willst etwas zu essen. Iss den Rest von diesem Biltong.“
„Nein“, antwortete sie. „Ich könnte es nicht anrühren. Da draußen ist eine Wasserstelle, geh und wasch deinen Arm, dann werde ich ihn wieder verbinden.“
Er ging, immer noch verwundert, und kam ein paar Minuten später mit tropfendem Gesicht und Kopf zurück und flüsterte:
„Gib mir das Gewehr. Da steht ein Reebock in der Nähe. Ich habe ihn durch den Nebel gesehen; wir werden ein leckeres Frühstück mit ihm haben.“
Sie reichte ihm das Gewehr und schlich hinter ihm aus der Höhle. Etwa dreißig Meter entfernt auf der rechten Seite stand der dicke Rehbock, der durch den dichten Nebel sehr groß wirkte. Richard schlitterte auf ihn zu, weil er sichergehen wollte, dass er ihn treffen würde, während Rachel sich hinter einem Stein duckte. Der Bock wurde alarmiert, drehte den Kopf und begann, in der Luft zu schnüffeln. Da hob Richard das Gewehr und schoss, gerade als der Bock wegspringen wollte. Es fiel tot um, woraufhin Richard, der sich wie jeder andere junge Jäger, der nicht an das wunderbare und glückliche Leben denkt, das er zerstört hat, über seinen Triumph freute, triumphierend auf es zusprang und dabei sein Messer zog, während Rachel, die vor solchen Anblicken immer zurückschreckte, sich in die Höhle zurückzog. Eine halbe Stunde später jedoch, da sie gesund und hungrig war, hatte sie nichts dagegen, Wildbret zu essen, das auf Stöcken über der roten Glut ihres Feuers geröstet worden war.
Nachdem sie endlich mit dem Essen fertig waren, luden sie das Gewehr wieder und machten sich, obwohl der Nebel immer noch sehr dicht war, auf zu einer Erkundungstour, da die Sonne inzwischen hell über dem Vorhang aus tief hängendem Dunst schien. Als sie über die Felsen stolperten, stellten sie fest, dass das Wasser fast so schnell gesunken war, wie es in der vergangenen Nacht gestiegen war. Die Insel war jedoch mit Baumstämmen und anderen Trümmern übersät, die das Wasser mitgerissen hatte, darunter die Kadaver von Hirschen und kleineren Tieren sowie eine Reihe ertrunkener Schlangen. Die beiden Löwen schienen jedoch durch Schwimmen entkommen zu sein, zumindest sahen sie nichts von ihnen. Vorsichtig gingen sie weiter, bis sie den Rand der Donga erreichten, und setzten sich auf einen Stein, da sie noch nicht sehen konnten, wie breit und tief das Wasser war.
Während sie so dasaßen, hörten sie plötzlich durch den Nebel eine Stimme von der anderen Seite der Donga rufen.
„Missie“, rief die Stimme auf Niederländisch, „bist du da, Missie?“
„Das ist Tom, unser Fahrer“, sagte sie, „der mich suchen kommt. Antworte für mich, Richard.“
Also brüllte der Junge, der eine sehr gute Stimme hatte, als Antwort:
„Ja, ich bin hier, in Sicherheit, und warte darauf, dass sich der Nebel lichtet und das Wasser abfließt.“
„Gott sei Dank“, schrie der entfernte Tom. „Wir dachten schon, du wärst sicher ertrunken. Aber warum hat sich deine Stimme verändert?“
„Weil ein englischer Herr bei mir ist“, rief Rachel. „Geh und such sein Pferd und bring ein Seil mit, dann warte, bis der Nebel aufzieht. Sag auch dem Pastor und meiner Mutter, dass ich in Sicherheit bin.“
„Ich bin hier, Rachel“, rief eine andere Stimme, die ihres Vaters. „Ich habe die ganze Nacht nach dir gesucht, und wir haben das Pferd des Engländers gefunden. Komm noch nicht ins Wasser. Warte, bis wir etwas sehen können.“
„Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten“, sagte Richard, „auch wenn ich schnell reiten muss, um die Wagen einzuholen.“
Rachels Gesicht verfinsterte sich.
„Ja“, sagte sie, „sehr gute Neuigkeiten.“
„Bist du dann froh, dass ich gehe?“, fragte er beleidigt.
„Du hast gesagt, die Neuigkeiten seien gut“, antwortete sie sanft.
„Ich meinte, ich sei froh, dass sie mein Pferd eingefangen haben, nicht dass ich damit wegreiten muss. Tut es dir dann leid?“, fragte er und sah sie besorgt an.
„Ja, es tut mir leid, denn wir sind Freunde geworden, nicht wahr? Dir wird es egal sein, denn du wirst dort unten am Kap viele Leute finden, aber wenn du weg bist, werde ich keinen Freund mehr in dieser Wildnis haben, oder?“
Richard sah sie erneut an und bemerkte, dass ihre süßen grauen Augen voller Tränen waren. Da stieg in der Brust dieses Jungen, der, wie man sich erinnern sollte, kurz vor dem Erwachsenwerden stand, ein Gefühl auf, das, hätte er es gewusst, seltsam ähnlich war zu dem, das das Kind an seiner Seite ein oder zwei Stunden zuvor empfunden hatte, als es ihn in der Höhle schlafen sah. Er hatte das Gefühl, als würden diese tränenreichen grauen Augen sein Herz anziehen wie ein Magnet Eisen. Von Liebe wusste er nichts, für ihn war es nur ein Begriff, aber dieses Gefühl war zweifellos sehr neu und seltsam.
„Was hast du mit mir gemacht?“, fragte er schroff. „Ich will überhaupt nicht von dir weggehen, was seltsam ist, da ich Mädchen nie besonders gemocht habe. Ich sage dir“, fuhr er mit zunehmender Vehemenz fort, „wenn es nicht gemein wäre, meinem Vater einen solchen Streich zu spielen, würde ich nicht gehen. Ich würde mit dir kommen oder dir folgen – mein ganzes Leben lang. Sag mir – was hast du getan?“