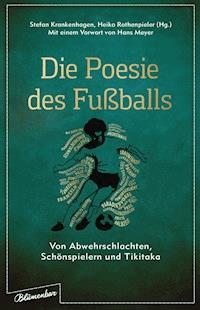
Die Poesie des Fußballs E-Book
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Poesie ist, wo gefranzelt wird. Kaum ein Sport hat soviel neudeutsche Poesie erzeugt wie der Fußball. Nirgends sonst treffen sich Stehgeiger, Schwalbenkönige, Kopfballungeheuer, Flankengötter und Paradiesvögel, um mit der Pille den Okocha zu machen und die Abwehrschlacht zu gewinnen, damit sie nicht als Fahrstuhlmannschaft enden. 30 der besten Autoren und Sportjournalisten erläutern mit viel Humor und pikanten Details die Entstehung, Umstände und Urszenen der bekanntesten Begriffe deutscher Fußballpoesie. Frank Goosen Moritz Rinke Birgit Schönau Stephan Reich Holger Gertz Philipp Winkler Doris Akrap Manni Breuckmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Stefan Krankenhagen und Heiko Rothenpieler
Stefan Krankenhagen ist Professor für Kulturwissenschaft und Populäre Kultur an der Universität Hildesheim und zu einer Zeit groß geworden, die sowohl Schönspieler als auch Wadenbeißer hervor gebracht hat. Er forscht und publiziert zu Sport- und Fankulturen und ist Mitbegründer des Internationalen Fußballfilmfestivals 11mm.
Heiko Rothenpieler studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Neben seinem Masterstudiengang Inszenierung der Künste und der Medien arbeitet er als Journalist und bloggt seit 2005 als »Die Schottische Furche«. Neben seiner Bachelorarbeit über »Groundhopping« gehören im Fußball auch Verbandspolitik und Fankultur zu seinen Arbeitsfeldern.
Informationen zum Buch
Poesie ist, wo gefranzelt wird.
Kaum ein Sport hat soviel neudeutsche Poesie erzeugt wie der Fußball. Nirgends sonst treffen sich Stehgeiger, Schwalbenkönige, Kopfballungeheuer, Wadenbeißer und Paradiesvögel, um mit der Pille den Okocha zu machen und die Abwehrschlacht zu gewinnen, damit sie nicht als Fahrstuhlmannschaft enden.
31 der besten Autoren und Sportjournalisten erläutern mit viel Humor und pikanten Details die Entstehung, Umstände und Urszenen der bekanntesten Begriffe deutscher Fußballpoesie.
Frank Goosen
Moritz Rinke
Birgit Schönau
Boris Herrmann
Holger Gertz
Philipp Winkler
Doris Akrap
Manni Breuckmann.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefan Krankenhagen, Heiko Rothenpieler (Hg.)
Die Poesie des Fußballs
Von Abwehrschlachten, Schönspielern und Tikitaka
Mit einem Vorwort von Hans Meyer
Illustrationen von Julian Hennemann
Inhaltsübersicht
Über Stefan Krankenhagen und Heiko Rothenpieler
Informationen zum Buch
Newsletter
Hans Meyer Über Fußball sprechen
Auf der Kampfbahn
Boris Herrmann Hexenkessel
Nils Havemann Abwehrschlacht
Wolfgang Kaschuba Knipser
Rolf Parr Ehrentreffer
Ron Ulrich Brechstange
Hans-Otto Hügel Schiri, Telefon!
Heiko Rothenpieler Lufthoheit
Das schöne Spiel
Marvin Bergs Tödlicher Pass
Frank Willmann Wir gegen uns
Moritz Rinke Schönspieler
Manni Breuckmann Flankengott
Jenni Wulfhekel Pille
Stephan Reich Stehgeiger
Jana Wiske Diva
Die Rumpelfüßler
Frank Goosen Fahrstuhlmannschaft
Benjamin Quaderer Ergebniskosmetik
Philipp Winkler Dritte Halbzeit
Stefan Vidović Paradiesvogel
Stefan Krankenhagen Kopfballungeheuer
Birgit Schönau Schwalbenkönig
Heiko Rothenpieler Traumtänzer
Simon Pearce Den Okocha machen
Rasenschach
Doris Akrap Tikitaka
Malte Oberschelp Taktiktafel
Norbert Windeck Schnittstelle
Jan Mönch Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt
Andreas Rüttenauer Sommermärchen
Hannes Schammann Multikulti-Truppe
Holger Gertz franzeln
Thomas Klupp Packing
Stefan Krankenhagen und Heiko Rothenpieler Zu diesem Buch
Autorinnen und Autoren
Anmerkungen
Impressum
Hans Meyer Über Fußball sprechen
Natürlich fühlte ich mich geehrt, als man mich fragte, ob ich bereit sei, für dieses hier vorliegende Buch ein Vorwort zu schreiben. Trotzdem drängte sich mir sofort die Frage auf, warum ausgerechnet ich darum gebeten wurde. Vielleicht spielte mein »biblisches Alter« eine primäre Rolle. Rentner haben Zeit und sind, wenn der Kopf noch mitspielt, brauchbare Zeitzeugen. Ich fürchte allerdings eher, dass meine Phrasenschwein füllenden Auftritte im Kult-Talk Doppelpass den Eindruck erweckt haben, ich sei ein besonders begnadeter Jongleur leerer Worte. Im Doppelpass haben die Phrasen der Experten und Fußballjournalisten – es gibt ja leider weiterhin wenige Frauen in diesen Berufen und entsprechend auch in diesem Buch – Gestalt angenommen: Jenes oben erwähnte berühmte, debil grinsende rosafarbene Ferkel nämlich, das stoisch Sendung für Sendung auf dem Tisch sitzt und gefüttert werden will, sobald in der Runde eine besonders »abgegriffene, nichtssagende Redensart« (der Duden) stammtischmäßig in die Welt hinausposaunt wird. Das mag man lustig, blöd, ironisch oder alles zusammen finden – man kommt doch nicht umhin zu bemerken, dass diese kleine Sau mit ihrem Namen sehr bildhaft für eine eigenständige Poesie des Fußballs steht. Das Phrasenschwein führt als Begriff inzwischen ein Eigenleben, das sich längst weit über seinen sonntäglichen Auftritt hinaus verselbständigt hat. Dass ich selber aber abgegriffene und nichtssagende Redensarten besonders oft benutzt haben soll, würde mich nicht nur in meiner Eitelkeit tief treffen, es würde auch dem Inhalt dieses Buches überhaupt nicht gerecht.
Denn gehen Sie davon aus, dass ich, obwohl ich nie ein Konzepttrainer war, trotzdem immer auf Augenhöhe der Zeit die Schnittstellen erkannt habe, um zum psychologisch günstigen Zeitpunkt dahin zu grätschen, wo es wehtut. Und nun, in der dritten Halbzeit meiner Karriere, betreibe ich bei dem einen oder anderen Pausentee, mit Kolumnen und Vorworten wie diesem, biografische Ergebniskosmetik als Paradiesvogel und verlängerter Arm der intellektuellen Fußballliebhaber, die sich gerne von Wasserträgern wie mir die Stadionwurst reichen lassen. Denn da ich nie ein Traumtänzer war, ist mir bewusst, dass es in meiner Karriere hauptsächlich Übergangssaisons gab. Meine Mannschaften bestanden selten aus Kopfballungeheuern, Flankengöttern und Ausnahmetalenten, aber auch mit Ausputzern, die mit der Brechstange agieren und Wadenbeißern, welche häufig kaum zwei Köpfe größer sind als ein Schwein, sowie dem einen oder anderen Musterprofi kann man im Fußball Sahnetage erleben. Denn Fußball ist Ergebnissport, alleine mit Schönspielern und Diven wird man keine Sommermärchen erleben, geschweige denn unabsteigbar sein.
Oder um es anders zu formulieren: Aus meinem Wortschatz als Fußballtrainer ist ein Großteil der in diesem Buch behandelten Begriffe nicht wegzudenken. In der Masse erscheinen sie als nichtssagende Phrasen, dabei sind es viel mehr Schlagworte, die helfen, einen Zusammenhang prägnant und kurz zu beschreiben, ohne zu stundenlangen Erklärungen ansetzen zu müssen. Jeder Fußballinteressierte weiß sofort, was gemeint ist, wenn ich etwa sage, das Spiel war eine reine Abwehrschlacht. Ich erspare mir also die Erklärung, dass meine Mannschaft kaum etwas für die Offensive tun konnte, weil die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Mannschaften zu einseitig ausgelegt waren. Die meisten Begriffe sind übrigens grenzüberschreitend natürlich auch in der DDR gebraucht worden, die Abwehrschlacht allerdings umschrieben wir mit dem Begriff »mauern«. Ob das eine Anweisung aus dem Politbüro oder nur vorauseilender Gehorsam der Protagonisten war, wäre in einem eigenen Buch zu klären. Jedenfalls scheint mir der Begriff nur noch bei alten Ost-Fußballern jenseits der Siebzig in Gebrauch zu sein.
Es erfindet zwar nicht jede Generation den Fußball neu, doch jede neue Generation variiert das Sprechen darüber. Meine Lieblingsphrase der letzten Jahre ist das Gegen-Pressing. Es kann an meinem fortgeschrittenen Alter liegen – ich arbeitete noch mit dem anscheinend altmodischen Begriff Forechecking – aber das heute gebräuchliche Gegen-Pressing ist meiner Meinung nach ein schwarzer Rappe, denn pressen tut man immer gegen etwas. Es beschleicht mich schon manchmal das Gefühl, die jungen Berichterstatter fallen hier auf des Kaisers neue Kleider (Achtung, Phrase!) herein und ich möchte ihnen mit dem Fußballspruch des Jahres 2007 antworten: »In schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche«. Jenseits meiner altklugen Grantelei allerdings ist es sicher sinnvoll, Phrasen und Schlagworte auch immer wieder darauf zu überprüfen, ob der zu benennende Gegenstand anders vielleicht besser zu beschreiben wäre, oder der Begriff dem sich verändernden Sprachgebrauch angepasst werden sollte. Denn was die hier versammelten Begriffe ja letztlich zeigen ist dies: Die Poesie des Fußballs ist in erster Linie Teil der Fußballgeschichte, der Begriff »Multikulti-Truppe« etwa konnte erst durch die Transfermöglichkeiten im System entstehen und selbst die große Weltgeschichte spielt, etwa beim »Hexenkessel«, mit rein. So kommt es zu der sehr merkwürdigen Situation, dass gerade scheinbar nichtssagende Redensarten auf besondere Weise etwas aussagen.
Das in den letzten Jahrzehnten stark gestiegene Interesse einer intellektuellen Schicht am ehemaligen Proletensport trägt sicher seinen Teil dazu bei, die Sprache des Fußballs kulturell aufzuwerten. Ich weiß nicht, ob ich meine Beobachtung zeitlich richtig einordne, aber mir scheint, seit der Weltmeisterschaft 2006 gibt es immer mehr Versuche, eine Brücke zwischen Fußball und Kunst beziehungsweise Literatur zu schlagen. Das hat neben vielen schönen Projekten zum Teil für meinen Geschmack verrückte Blüten getrieben. Das hier vorliegende Buch aber hält für Fußballprofis genauso wie Fußballliebhaber und Fußballliebhaberinnen Erhellendes, Lustiges und Überraschendes bereit. Weit über die rein inhaltliche Beschreibung der jeweiligen Begriffe erfährt man viel über Zeitpolitik, gesellschaftliche Entwicklungen, Kunst und Literatur. Und nicht zuletzt: über Fußball.
Einige der Autorinnen und Autoren kenne ich übrigens persönlich. Den einen oder anderen durfte ich sogar kurzzeitig als Trainer der Autoren-Nationalmannschaft trainieren, bevor sich unsere Wege wegen meiner anhaltenden Erfolglosigkeit wieder trennten und ich somit gezwungen war, mein Glück erneut in der Bundesliga zu suchen. Diesem Buch wünsche ich einen beständigeren Erfolg, als er Trainern im Fußball in der Regel beschieden ist.
Auf der Kampfbahn
War früher alles besser? Oder war früher einfach alles nur früher?
Aufgrund der Kriegsverbrechen war der deutsche Fußball von der Weltmeisterschaft 1950 ausgeschlossen, beziehungsweise noch nicht wieder in die FIFA aufgenommen worden. Der Verband, wie das Land, befand sich im Wiederaufbau. An der Spitze der Nationalmannschaft stand der ehemalige Reichstrainer Sepp Herberger. Auf Vereinsebene wurde das von den Nationalsozialisten propagierte Verbot des Berufsfußballs fortgesetzt; ein Fußballspieler musste einen anständigen Beruf erlernen und sein Monatsgehalt durfte nicht mehr als 320 DM betragen. Die Meisterschaften spielte man in vier Oberligen im Westen und einer Oberliga im Osten Deutschlands aus: In den fünfziger Jahren finden sich Vereine wie Westfalia Herne, Kickers Offenbach und Tasmania Berlin unter den Meistern der jeweiligen Ligen. Lang lebe die föderale Vielfalt! (Die allerding schon damals Serienmeisterschaften wie die des HSV zwischen 1955 und 1963 nicht verhindern konnte.)
Denn die Angst war groß, dass sich sportlich fairer Wettkampf und Kommerzialisierung gegenseitig ausschließen würden (und noch hier klingt das Erbe des Nationalsozialismus durch, in dem überall vor »jüdischem Kapital« gewarnt wurde). So kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Verlängerung der Vorkriegsstrukturen, in denen die engen Verbindungen von Arbeitsplatz, Fußballverein und Alltag historisch bereits etabliert waren. Die Spieler spielten, wo und mit wem sie arbeiteten. Und sie lebten, wo und mit wem sie spielten. Der verklärende Blick, der heute dem sogenannten ehrlichen Fußball von damals – vor allem im Ruhrgebiet mit seinen Zechenlandschaften – entgegengebracht wird, hat viel damit zu tun, dass sich der Fußball in den fünfziger und sechziger Jahren als eine Einheit von Wohnort, Freizeit und Beruf präsentierte. Und wen das große Geld aus ausländischen Ligen wie Spanien oder Italien lockte, wie Fritz Walter 1951, dem wurde schnell noch eine Totostelle oder eine Wäscherei zugeschustert. Auch diese hatten schließlich mit Fußball zu tun, passten aber besser zu den halbprofessionellen Strukturen in Deutschland als die gut 200000 DM, die ihm Atlético Madrid für seine Dienste zahlen wollte.
Entsprechend ist es nur konsequent, dass die Tugenden der Arbeit und des Wiederaufbaus auch zu den Tugenden des deutschen Sports wurden. Mannschaftsgeist, Solidarität und Durchhaltevermögen waren Forderungen, die immer an Gesellschaft und Fußball zugleich gerichtet waren. Es sind diese Begriffe, die bis heute als deutsche Tugenden durch die Sprache des Fußballs geistern. Aber nicht zu Unrecht. Denn der Führungsspieler wurde nicht von Stefan Effenberg und »Die Mannschaft« nicht von der DFB-Marketingabteilung erfunden. Stattdessen entstanden sie als sprachliche Bilder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als spezifisch deutscher Sonderweg einer föderal organisierten und auf das Amateurwesen abgestellten Sportpolitik, die über eine lange Zeit mit dem Fußball fremdelte. Denn die »englische Krankheit«, wie sie der Turnlehrer Karl Planck 1898 nannte, bedrohte das Turnen als die wichtigste nationale – und nationalistische – Sportkultur in Deutschland. Erst die Einbettung des Spiels in die Ausbildungspläne des Militärs in den Zehner und Zwanziger Jahren brachte einen partiellen Durchbruch. Nicht nur die Turner, auch die Fußballer galten nun als Prototypen des modernen Soldaten. »Die Kampfbahn« ist in diesem Sinne der symbolische wie der architektonische Kompromiss der damals dominierenden Sportkulturen: Sie ist Leichtathletik- und Fußballstadion in einem. Noch die Stadionneubauten zur WM 1974 halten an dieser problematischen Symbiose fest; erst zur Jahrtausendwende werden in Deutschland vermehrt die sogenannten reinen Fußballstadien gebaut.
Gleichzeitig schien in den sechziger Jahren doch so vieles in Ordnung, zumindest im Westen des Landes: frisches Geld, frische Allianzen, frische Wäsche. Das Wirtschaftswunder zog durch Deutschland und hinterließ mal keine Zerstörung, sondern gefüllte Regale und neue Träume in einer oft als bieder verspotteten Zeit. So schreibt der Sportphilosoph Gunter Gebauer, dass Nachkriegsdeutschland »ein Land der kleinen Leute« war. Das ist jedoch nicht despektierlich gemeint, sondern erzählt davon, wie einfache Bürger im Wiederaufbau eine große Rolle gefunden haben. Durch den Sieg bei der Weltmeisterschaft 1954 wurden jene kleinen Leute – zu denen eben auch der Mechaniker Max Morlock, der Bäcker Toni Turek oder der Bankkaufmann Fritz Walter zählten – zu Helden des Neuanfangs. »Sie haben wieder ein Gesicht erhalten«, schreibt Gebauer, »sie sind immer noch die Fleißigen, die Harten, Zähen, aber diese Eigenschaften sind jetzt in zivile umgeformt worden und werden für friedliche Zwecke eingesetzt«. Die fünfziger und sechziger Jahre bespielen Kontinuität und Neubeginn in einem.
Trotz aller Nachkriegserfolge – politisch, ökonomisch, sportlich – zeigt sich gerade am Fußball der lange Atem des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die immer wieder verzögerte Etablierung des Fußballs in Deutschland zieht sich bis in die sechziger Jahre hinein. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die großen Emotionen auf der Kampfbahn der Nachkriegsgesellschaft oft fehlen – oder, sollten sie sich einmal Bahn brechen, misstrauisch zurückgepfiffen wurden. Der »Teufelskerl« und »Fußballgott«, der Toni Turek im Endspiel 1954 in einem Atemzug gewesen sein soll, rief die Kirche auf den Plan und zwang Herbert Zimmermann zu einer öffentlichen Entschuldigung. Und die Heimspielatmosphäre beim WM-Spiel Schweden gegen Deutschland 1958 wurde in der deutschen Berichterstattung zum »Hexenkessel« von Göteborg. So changiert die Sprache des Fußballs in dieser Zeit zwischen militärischem Vokabular, in dem die »Lufthoheit« mit Hilfe von »Ausputzern« und »Brechstangen« gewonnen werden soll und einem unschuldigen Sonntagsvergnügen, in dem der Schiedsrichter höchstens mal »ans Telefon« gerufen wird, weil der gemeinsame »Pausentee« an so einem »Sahnetag« schon wartete. Und auch die Helden von Bern waren beides: eine siegreiche Armee und unschuldige elf Freunde. Für ihren Endspielsieg bekamen sie 1000 DM, einen Fernseher, einen Lederkoffer und einen Motorroller.
Boris Herrmann Hexenkessel
Göteborg, 24. Juni 1958. Beim WM-Halbfinale zwischen Gastgeber Schweden und Deutschland herrscht eine Stimmung, die der deutsche Nationalspieler Georg Stollenwerk noch Jahrzehnte später so beschrieb: »Es war ein richtiger Hexenkessel, der nicht schlimmer hätte sein können. Es war schwer, unter diesen Bedingungen zu spielen.« Zu schwer offenbar. 1:3 verlieren die Deutschen an diesem Tag. Wenn man den Augenzeugen- und Presseberichten von damals glaubt, dann kann es keinen Zweifel geben, dass der amtierende Weltmeister nicht gegen die schwedische Elf, sondern gegen das schwedische Publikum ausgeschieden ist.
Die Aufnahme des Hexenkessels in das deutschsprachige Fußballvokabular ist untrennbar mit diesem Spiel verbunden. Es brodelte und kochte im Ullevi-Stadion von Göteborg. Am Spielfeldrand wurden riesige Schwedenfahnen geschwenkt. Ein Einpeitscher mit Megaphon gab den Schlachtruf vor: »Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör, Sverige, Sverige, Sverige.« Das könnte man etwa so übersetzen: Auf geht’s, Schweden, mit frischem Mut immer voran, Schweden, Schweden, Schweden. Im kollektiven Fußballgedächtnis blieb davon vor allem ein stakkatoartiges Heja, Heja, Heja, Heja hängen.
Aus heutiger Sicht würde man das als beste Heimspielatmosphäre bezeichnen. Der Einpeitscher heißt inzwischen Capo und die lautesten Stimmen im Fanblock sind die Ultras. Ein richtig schöner Hexenkessel eben. Das Wort ist unter Fußballfans heute positiv besetzt. Da schwingt auch die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten mit, als das Stadion noch Stadion hieß. Und nicht SchücoArena. Oder Signal Iduna Park. Im Juni 1958 aber, als diese alten Zeiten noch ganz junge Zeiten waren, lösten die Heja, Heja-Rufe eine diplomatische Krise aus.
»Das hatte mit Neutralität bei einer WM nichts mehr zu tun«, beklagte sich die stets neutrale Bild-Zeitung damals. Die Annahme, dass ein Heimspielpublikum sich so unparteiisch zu verhalten habe wie das Schiedsrichtergespann, mag für Zeitgenossen bizarr klingen. In den fünfziger Jahren war das aber noch ein Teil des Fair-Play-Gedankens. Lautes Anfeuern von den Rängen, zumal von einem Vorsänger animiert, galt als respektlos. Zumindest im deutschen Fußball gab es bis dahin keine Hexenkessel. Deshalb war die Elf von Sepp Herberger wohl auch so irritiert, als sie in Göteborg ihr blau-gelbes Wunder erlebte.
Auch der deutsche Radiojournalist Herbert Zimmermann, der 1954 in Bern noch die Fußballreportage des Jahrhunderts abgeliefert hat, ist in Göteborg offenbar so verwirrt wie die deutschen Spieler. »Das wird ja ein Cannae hier!«, ruft er nach einem Foul am 38-jährigen Fritz Walter in sein Mikrofon. Bei der sogenannten Kesselschlacht von Cannae (216 v.Chr.) vernichtete Hannibal mit seinen Karthagern sechzehn römische Legionen. Das Kessel-Motiv (sei es nun der Hexen- oder der Hannibalkessel) klingt also auch hier zwischen den Zeilen durch. Bei Zimmermann steht es aber noch nicht für gute Laune und brodelnde Stimmung, sondern für Bedrängung, Gefahr und Zerstörung. Für den Untergang der Eingekesselten.
Das Spiel in Göteborg entgleitet der deutschen Mannschaft, als in der 58. Minute Verteidiger Erich Juskowiak die Nerven verliert. Oder, wie es das Hamburger Abendblatt formuliert, als ihm »der geistige Schnürsenkel reißt, der die sportliche Ordnung zusammenhält«. Schwer zu sagen, ob es die fein dosierten Provokationen von Schwedens Stürmer Kurt Hamrin waren, das Geschrei des Publikums oder beides zusammen – Juskowiak jedenfalls versetzt Hamrin einen Tritt und fliegt folgerichtig vom Platz. »Heja, Heja«, rufen die Schweden.
Sicherlich, schwedische Zeitungen haben die Stimmung vor dem Anpfiff auch mit schiefen Nazi-Vergleichen künstlich aufgeheizt. Nach dem Abpfiff ist es allerdings die deutsche Presse, die vor Kriegsmetaphorik überquillt, mit den Germanen in der Opferrolle. »Das Inferno mit dem Sirenengeheul und die Front mit anderen Unfreundlichkeiten« waren aus Sicht des Hamburger Abendblattes »nichts gegen die Organisation der schwedischen Lärmkonstrukteure.« Der Kicker zieht gar eine Parallele zum »Einpeitscher Goebbels im Berliner Sportpalast«. Und die Saar-Zeitung schreibt: »Das offizielle Schweden hat hämisch genießend zugelassen, dass rund 40000 Repräsentanten dieses mittelmäßigen Volkes, das sich nie über nationale oder völkische Durchschnittsleistungen erhoben hat, den Hass über uns auskübelte, der nur aus Minderwertigkeitskomplexen kommt. Es ist der Hass eines Volkes, dem man das Schnapstrinken verbieten muss.«
Die DFB-Delegation setzt sich gewissermaßen selbst auf Entzug und schwänzt das traditionelle Abschlussbankett. Als im Finale ein 17-jähriger Brasilianer namens Pelé beim 5:2 gegen Schweden die Welt verzückt, sind die deutschen Spieler bereits schmollend auf dem Heimweg. Sie kommen in ein Land, das seine Grenzerfahrung vom Göteborger Hexenkessel mit Revanchismus verarbeitet. Bei der Kieler Woche wird ein schwedischer Kinderchor ausgebuht. Auf der Hamburger Reeperbahn wirbt eine Kneipe mit dem Spruch: »Für Deutsche ein Bier eine Mark, für Schweden fünf Mark.« Einige Restaurants streichen demonstrativ die allseits beliebte Schwedenplatte von der Speisekarte.
Nochmal, zur Erinnerung: All das waren Reaktionen auf das koordiniert vorgetragene Lied »Auf geht’s, Schweden« während eines Fußballspiels.
Die Schweden gehören zweifellos zu den Pionieren dessen, was man heute Fankultur nennt. Im Lauf der Jahrzehnte hat dann zum Glück auch das deutsche Sportpublikum seine Liebe zum Hexenkessel entdeckt. Die schwarz-gelbe Wand der Dortmunder Südtribüne (wenn sie nicht gerade gegen Leipziger ausfällig wird), die Alte Försterei von Union Berlin, die Bielefelder Alm, der Bieberer Berg in Offenbach oder auch der ehemalige Betzenberg von Kaiserslautern werden heute unabhängig von der Vereinszugehörigkeit als Kultstätten der hiesigen Fußballtradition verehrt. Und zwar nicht deshalb, weil es dort so neutral zugeht, sondern weil den Gegnern schon beim ersten Schritt auf den Rasen die Knie zittern. Zumindest der Legende nach. Heute ist jedenfalls kein beleidigter Unterton mehr dabei, wenn der Trainer einer Auswärtsmannschaft sagt: »Das Stadion hat sich in einen Hexenkessel verwandelt.« Meistens ist das anerkennend gemeint, manchmal klingt etwas Neid durch.
In seiner ursprünglichen Bedeutung ist das Wort auch keineswegs negativ besetzt. Der Kessel ist ein klassisches Fruchtbarkeitssymbol. Er steht eigentlich für den lebensspendenden Uterus, nicht für den Untergang. Seine Bezüge zur Magie, den bösen Hexen wie den guten Geistern, reichen von der christlichen Gralslegende bis hin zum Zaubertrank von Asterix und Obelix. In einer etwas profaneren Form steht er als Bierstiefel in jedem gut geführten Kreisliga-Klubhaus.
Shakespeare hat ihn zum literarischen Motiv gemacht. Im vierten Akt von Macbeth tanzen drei Hexen um einen Hexenkessel herum, in dem sie Froschzehen, Otterzungen, Eidechsenbeine, Fledermaushaare, Wolfszähne und Schierlingswurzeln kochen. Im Original beginnt die Szene so: »Round about the cauldron go …« Auch die Briten haben dieses Bild übernommen, um ihre Ehrfurcht vor einem brodelnden Fußballstadion zu beschreiben. Die Anfield Road in Liverpool, wo 50000 Zuschauer gemeinsam »You’ll never walk alone« anstimmen, heißt auch The Red Cauldron, frei nach Shakespeare: der rote Hexenkessel.
Die siebziger und achtziger Jahre kann man vielleicht als die Goldene Ära des Hexenkessels bezeichnen. Als Bengalos und Stehplätze noch selbstverständlich zum Fußball dazugehörten, bevor das Zeitalter der Einheits-Event-Arenen begann. Das Toumba-Stadion, die »schwarze Hölle von Saloniki«, der Glasgower Hampden Park, La Bombonera in Buenos Aires, San Siro in Mailand, das Rajko Mitić-Stadion von Roter Stern Belgrad, das Vicente Calderón von Atlético Madrid, das Istanbuler Inönü-Stadion, wo Besiktas spielt, aber auch der alte Tivoli in Aachen oder das Stadion an der Hafenstraße von Rot-Weiß Essen – nicht immer ging es an diesen Orten gesittet zu. Aber hier entstanden die Mythen, von denen der Fußball lebt.
Das Halbfinale von Göteborg aber, die Geburtsstunde des Hexenkessels, wird in Deutschland weiterhin als der Triumph schwedischer Problemfans dargestellt. Der WDR präsentierte es im Jahr 2010 in seiner Top Ten der größten WM-Skandale. Günter Netzer sprach in dem Beitrag von »einer Schweinerei ersten Ranges«, obwohl er gewiss nicht dabei war 1958.
Einer der Augenzeugen, der damalige DFB-Präsident Peco Bauwens, hatte im Eifer des Gefechts getönt: »Was hier passiert ist, grenzt an Volksverhetzung. Nie mehr werden wir dieses Land betreten. Nie mehr werden wir gegen Schweden spielen!« Es dauerte dann immerhin bis 1963, bis sich eine deutsche Elf wieder zu einem Freundschaftsspiel in einen schwedischen Hexenkessel wagte.
Nils Havemann Abwehrschlacht
Selbst dem Laien wird kaum entgangen sein, dass die Fußballsprache durchsetzt ist mit militärischen Begriffen, die in der durchpazifizierten deutschen Gesellschaft bisweilen anachronistisch anmuten. In Live-Reportagen aus den Stadien, Berichten über den Bundesligaspieltag und Interviews mit den Stars wimmelt es derart von Stürmern, Schüssen, Flanken oder Balleroberungen, dass man glauben muss, bei dem Spiel mit dem runden Leder gehe es um eine Frage von Leben und Tod. Dieser Ansicht war jedenfalls der berühmte schottische Fußballtrainer Bill Shankly. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich im Fußballjargon neben den Bombern, Sturmtanks und Granaten auch der Begriff der Abwehrschlacht fest etabliert hat. Sie erscheint in dem Wortfeuerwerk rund um das Geschehen auf dem Rasen als legitimes Gegenstück zu den Angriffswellen, denen sich ein vermeintlich hilfloser Gegner ausgesetzt sieht.
Obwohl die Abwehrschlacht – wie alle militärischen Begriffe im Fußball – bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum festen Vokabular der Fans (damals noch Schlachtenbummler) zählte, gibt es aus jener Zeit keine bestimmte Partie im kollektiven Gedächtnis, aus der dieser Begriff direkt hervorging. Dabei gab es auch damals viele Begegnungen, in denen elf Spieler den eigenen Strafraum zu verriegeln und mit Befreiungsschlägen oder Blutgrätschen den Torerfolg des Gegners zu verhindern versuchten. Doch da die Medialisierung des Sports vor dem Krieg noch nicht so weit vorangeschritten war, sind die genauen Verläufe der allermeisten Spiele aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Vergessenheit anheimgefallen.
So wurde das Weltmeisterschaftsendspiel von 1954 zwischen der Bundesrepublik und Ungarn für die deutschen Anhänger gleichsam zur Mutter aller Abwehrschlachten. Fans, die das Spiel damals vor Ort erlebten, erinnerten sich noch viele Jahre später daran, wie sich Toni Turek, Werner Liebrich, Jupp Posipal oder Werner Kohlmeyer den stürmenden Magyaren entgegenwarfen. Dass sich vor allem dieses Spiel auch im Bewusstsein vieler Deutscher fest verankert hat, die mit dem Fußball eher fremdeln, lag an Radioreporter Herbert Zimmermann. Seine Live-Reportage aus dem Berner Wankdorfstadion vermag es noch mehr als sechzig Jahre später, dem Zuhörer die Tränen in die Augen zu treiben. Sie vermittelte nicht nur einen lebhaften Eindruck davon, wie die Deutschen dieses Wunder vollbrachten. Ihr gelang es auch, vor allem nach der 3:2-Führung in der 84. Minute, als die Ungarn – »wie von der Tarantel gestochen« – noch einmal alles nach vorne warfen, mit knappen Worten zu beschreiben, wie eine Abwehrschlacht im klassischen Sinne aussieht. Wenige Minuten vor dem Abpfiff kommentierte Zimmermann: »Acht Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg, und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen: ›Jetzt Nerven behalten!‹ Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter.«
Fußballästheten verabscheuen Abwehrschlachten zutiefst. In ihren Augen sind sie das armselige Mittel einer spielerisch hoffnungslos unterlegenen Mannschaft gegen einen übermächtigen Gegner, der mit fußballerischer Kunstfertigkeit das Geschehen auf dem Feld beinah nach Belieben dominiert. Sympathien vermögen sie allenfalls in den typischen David-gegen-Goliath-Konstellationen hervorzurufen, wenn beispielsweise ein Team aus der vierten Liga in einem Pokalspiel gegen einen Bundesligisten mit Ballwegschlagen, Fouls und Zeitschindereien eine Sensation herbeizuführen versucht.





























