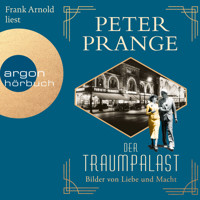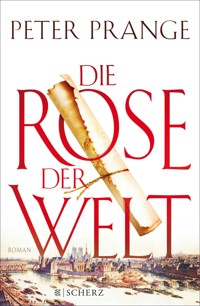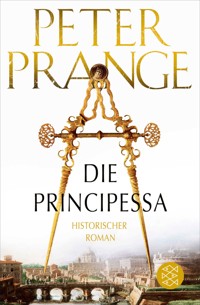
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Bestseller von Erfolgsautor Peter Prange Rom, 1623: in der Stadt der Kardinäle und Kurtisanen gerät die junge Clarissa in den Bann der Kunst. Sie begegnet den beiden berühmtesten Architekten ihrer Zeit: Lorenzo Bernini, Liebling der Frauen und des Papstes, und Francesco Borromini, ein Getriebener auf der Suche nach Vollkommenheit. Die schicksalhafte Liebe zu Clarissa verwandelt die zwei Freunde in erbitterte Feinde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PETERPRANGE
Die Principessa
Historischer Roman
Über dieses Buch
Während die Menschen auf den Straßen den neuen Papst feiern, trifft in der Ewigen Stadt die junge Engländerin Clarissa ein, hungrig auf Leben und Freiheit. Sie erlebt eine Welt verwirrender Gegensätze: Glanz und Elend, Chaos und Größe, Freizügigkeit und Sittenstrenge. Vor allem aber gerät sie in den Bann zweier junger, ehrgeiziger Baumeister: Lorenzo Bernini und Francesco Borromini. Der eine von brillanter, weltgewandter Eleganz, Liebling der Frauen und des Papstes; der andere ein in sich gekehrter Mann, ein Getriebener auf der Suche nach Vollkommenheit. Gemeinsam wollen sie das neue Rom errichten. Doch die Liebe zu Clarissa verwandelt die zwei Freunde in erbitterte Feinde …
»Peter Prange weiß, was Leser wünschen. Gesamturteil: großartig!«Hör Zu
Weitere Bücher des Autors:
›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹
›Die Philosophin‹
Die Webseite des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: akg-images, Berlin/Bridgeman Images
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2002 by Peter Prange
vertreten durch
AVAinternational GmbH
www.ava-international.de
Der Roman erschien erstmals 2002 im Droemer Knaur Verlag.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403029-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Stadtplan Rom
Motto
Prolog: 1667
Erstes Buch Das süße Gift des Schönen1623–1633
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Zweites Buch Risse in der Fassade1641–1646
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Drittes Buch Der Phönix1647–1651
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Viertes Buch Im Vorgarten des Paradieses1655–1667
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Dichtung und Wahrheit
Danke
Für Serpil, meine Frau
»… per restituire meno del rubato …«
»Die Zeit enthüllt die Wahrheit.«
Lorenzo Bernini, unvollendete Allegorie
Prolog:1667
»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Es war in der ersten Morgenfrühe, der Stunde, in der die Nacht ihre böse Seele aushaucht. Mit feinem Klang schlug die Turmuhr von Santa Maria della Vittoria an, um die Gläubigen zum Angelus zu rufen. Noch war die dunkle Kirche menschenleer, nur im Schatten einer Seitenkapelle kniete eine vornehme Dame. Ein Schleier aus feiner, durchsichtiger Spitze umhüllte ihr weißes Haar und ihr Gesicht wie die Aura ihrer einst vollkommenen Schönheit. Lady McKinney war ihr Name, geborene Clarissa Whetenham, doch die Römer nannten sie »die Principessa«.
Fast ein Menschenleben hatte sie in Rom verbracht, doch noch immer empfand sie dieses kleine Gotteshaus als ein Refugium in der Fremde. Mit einem Seufzer senkte sich ihre Brust, während sie das Kreuzzeichen schlug, um sich zu sammeln.
Warum war sie zu dieser frühen Stunde hierher geflohen? Um zu Gott zu beten?
Clarissa schlug die Augen auf. Vor ihr, auf dem Altar, schimmerte im Schein der Kerzen das marmorne Antlitz einer Frau. Ihr Gesicht war von seligem Entzücken erfüllt, während ihr zu Boden gesunkener Leib sich einem Engel hinzugeben schien, der eine Lanze auf sie richtete. Wegen dieser Figur war Clarissa einst wie eine Heilige verehrt worden, wegen dieser Figur hatte der Papst sie als Hure verdammt. Denn das Gesicht dieser Frau war ihr Gesicht, der Leib ihr Leib.
Sie faltete die Hände um zu beten, allein in Gottes Gegenwart, doch sie konnte es nicht. Ihre Lippen formten Sätze der anderen.
»Ein Pfeil drang hin und wider in mein Herz«, flüsterte sie die Worte der Frau aus Stein, in der ihre eigene Jugend gebannt war. »Unendlich war die Süße dieses Schmerzes, und die Liebe erfüllte mich ganz und gar …«
Eilige Schritte schreckten sie auf.
»Vergebung, Principessa, aber man hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde.«
Vor ihr stand ein junger Mann, das Haar zerzaust, das Wams offen, ein Hemdzipfel aus der Hose, als hätte er die Nacht in den Kleidern verbracht. Es war Bernardo Castelli, der Gehilfe und Neffe ihres Freundes – des einzigen Menschen, der wirklich ihr Freund war. Als sie Bernardos angsterfülltes Gesicht sah, fühlte sie ihre bösen Ahnungen bestätigt.
»Steht es so schlimm?«
»Noch viel schlimmer!«, sagte Bernardo und tauchte seine Hand in ein Weihwasserbecken.
Draußen stand Clarissas Kutsche bereit. Im scharfen Trab rasselte sie durch die Gassen der allmählich erwachenden Stadt. Hier und da wurden die ersten Fenster geöffnet, verschlafene Gesichter lugten aus Türöffnungen hervor, ein paar Bäckerjungen eilten zur Arbeit. Plötzlich öffnete sich ein riesiger Platz vor Clarissas Augen, und wie ein Schneegebirge ragte der Dom von Sankt Peter in den Himmel empor, an dem die letzten Sterne erloschen.
Der Anblick versetzte ihr einen Stich. Hier hatte der Mann, den sie liebte und den sie hasste wie keinen zweiten Menschen auf der Welt, den größten Triumph seines Lebens gefeiert. Die Piazza war noch übersät von den Spuren des Jubelfestes, über zweihunderttausend Menschen hatten daran teilgenommen. Clarissa versuchte, Bernardos Worten zu folgen, der aufgeregt wirre Dinge berichtete, von Teufeln und Dämonen, die seinen Herrn befallen hätten, doch es gelang ihr nicht. Sie hatte nur eine bange Frage: War auch ihr Freund auf der Piazza gewesen?
Endlich bog die Kutsche in den Vicolo dell’Agnello ein. Auf dem Dach des windschiefen Hauses, über dem ein fahlgrauer Streifen den neuen Tag ankündigte, schimpfte eine Schar Spatzen, als Clarissa aus der Kutsche stieg. Die Haustür stand noch auf. Sie raffte ihren Rock und bückte sich, als sie durch die niedrige Tür trat. Ein scharfer, brandiger Geruch schlug ihr entgegen.
»Heilige Muttergottes!«
In der Küche sah es aus wie nach einem Überfall. Tisch und Stühle waren umgestoßen, auf dem Boden lagen angesengte Manuskripte und Schriftrollen verstreut, im offenen Herd loderte ein mächtiges Feuer.
»Pssst! Was ist das?«
Clarissa hielt den Atem an. Vom oberen Stockwerk war ein Rumpeln zu hören, dann ein dumpfer Aufprall. Im nächsten Moment ertönte ein Schrei, als würde ein Tier geschlachtet. Entsetzt schaute sie Bernardo an. Der schlug ein Kreuzzeichen und murmelte ein Stoßgebet. Sie drängte ihn beiseite und eilte die Stiege hinauf, zum Schlafraum seines Herrn.
Ein leises Röcheln empfing sie, als sie den Riegel löste und die dunkle Kammer betrat. Sie stieß ein Fenster auf, um etwas zu erkennen. Blass flutete das Licht des neuen Tages herein.
Als Clarissa ihren Freund entdeckte, musste sie sich an einem Pfosten festhalten: ein weißes Gesicht, aus dem sie zwei dunkle stumme Augen anblickten wie ein Gespenst. Für einen Moment hatte sie das Gefühl, ohnmächtig zu werden.
»Oh, mein Gott! Nein!«
Ihr Freund lag auf dem Boden, der früher so starke Körper in sich zusammengesunken, hilflos wie ein neugeborenes Menschenkind im Geburtsschleim. Das Nachthemd war blutüberströmt, in der Brust stak ein Schwert, das er mit beiden Händen umklammert hielt, als wolle er es nie wieder loslassen. Clarissa musste ihre ganze Willenskraft aufbieten, um sich aus ihrer Erstarrung zu befreien.
»Komm, Bernardo, hilf mir! Schnell!«
Am ganzen Leib zitternd beugte sie sich über den am Boden Liegenden, um seine Hände von dem Knauf zu lösen. Immer noch ruhten seine Augen auf ihr, als verfolge er jede ihrer Bewegungen, ohne sie wirklich zu sehen. Kraftlos hingen seine Mundwinkel herab. Atmete er noch? Seine Hände waren warm, so warm wie das Blut, das an ihnen klebte. Zusammen mit dem Gehilfen zog Clarissa das Schwert aus seiner Brust. Es war, als glitte die Klinge durch ihren eigenen Leib. Dann hoben sie ihren Freund, so behutsam sie konnten, vom Boden auf und legten ihn auf das Bett. Ohne eine Regung ließ er es mit sich geschehen, als wäre das Leben schon aus ihm gewichen.
»Lauf und hol den Arzt!«, wies sie Bernardo an, nachdem sie die Wunde mit ein paar Lappen verbunden hatten. »Er soll kommen – sofort! Und«, fügte sie leise hinzu, »wenn du beim Arzt warst, hol auch den Priester!«
Als sie allein war, setzte Clarissa sich an das Bett. War das der Mann, den sie seit so vielen Jahren kannte? Er war so blass, als hätte er keinen Tropfen Blut mehr unter der Haut.
»Warum hast du das getan?«, flüsterte sie.
Sein Gesicht war eingefallen, entstellt, die hohlen Wangen schienen nach innen gestülpt, und seine Augen, die in tiefe Höhlen gesunken waren, starrten ins Leere. Und doch wirkten seine Züge auf seltsame Weise entspannt. War er schon bei den Engeln und sprach mit Gott? Fast schien es Clarissa, als habe er endlich den Frieden gefunden, den er zeit seines Lebens vergeblich gesucht hatte. Sogar die scharfe Falte zwischen den Brauen auf seiner Stirn war verschwunden.
»Warum hast du das getan?«, flüsterte sie wieder und griff nach seiner Hand.
Plötzlich spürte sie, wie er den Druck erwiderte, ganz leise nur, ganz zart, aber sie spürte es doch. Jetzt bewegte er die Augen und sah sie an. Ja, er lebte noch, war noch bei Verstand! Ein Zucken ging durch sein Gesicht, er wollte sprechen. Clarissa beugte sich über ihn, legte ihr Ohr an seine Lippen, hörte die Worte, die er mit letzter Kraft hauchte.
»Ich … ich war auf der Piazza … Ich habe das Wunder gesehen … Es ist … vollkommen …«
Clarissa schloss die Augen. Er hatte das Geheimnis entdeckt! Wieder spürte sie seinen Atem an ihrem Ohr, er wollte ihr noch etwas sagen.
»Ein so großartiger Einfall … Meine Idee … Er hat sie gestohlen … Wie … wie konnte er nur wissen?«
Sie öffnete die Augen und blickte ihn an. Er erwiderte ihren Blick, ruhig und prüfend, als wolle er in ihre Seele schauen. Wusste er die Antwort auf seine Frage? Doch dann veränderte sich seine Miene; ein feines Lächeln spielte um seinen Mund, und aus seinen dunklen Augen leuchtete eine Art Genugtuung, ein kleiner, zerbrechlicher Triumph.
»Ich habe alles verbrannt …«, flüsterte er. »Sämtliche Pläne … Er … er wird mir nie wieder etwas stehlen.«
Sie küsste seine blutbefleckte Hand, streichelte sein weißes Gesicht, das immer noch zu lächeln schien.
Sie hatte versucht, das Schicksal dieses Mannes zu wenden, sich Befugnisse angemaßt, die allein dem Himmel vorbehalten waren, und er hatte sich in sein Schwert gestürzt. Kein Mensch konnte größere Schuld auf sich laden – das war die einfache, unerträgliche Wahrheit. Und während sie versuchte, sein Lächeln zu erwidern, drängte sich ihr eine böse Frage auf, eine Frage, die über ihr ganzes Leben entschied: War ein Kunstwerk, und sei es das größte der Welt, ein solches Opfer wert?
Erstes BuchDas süße Gift des Schönen1623–1633
1
Die Mittagshitze lastete wie Blei auf der Stadt Rom. Sie brütete in den menschenleeren Gassen, kroch in die Fugen der Mauern und brachte die jahrtausendealten Steine zum Glühen. Kein Lüftchen regte sich am wolkenlosen Himmel, von dem die Sonne niederbrannte, als wolle sie die Welt in eine Wüste verwandeln. Selbst die mächtige Kuppel des Petersdoms, unter der doch die ganze römische Christenheit Zuflucht fand, schien unter der drückenden Hitze einzusinken.
Man schrieb den 6. August des Jahres 1623. Seit drei Wochen war in der Sixtinischen Kapelle das Konklave versammelt, um einen neuen Papst zu wählen. Es hieß, die meisten der greisen Kardinäle seien an Malaria erkrankt, einige kämpften sogar mit dem Tod, sodass bei dieser Wahl wohl nicht der frömmste, sondern eher der robusteste Kandidat als Nachfolger Petri berufen würde.
Der Tag der Entscheidung aber schien fern – so fern, dass sich auf dem großen Platz vor dem Dom, auf dem sich sonst zur Zeit des Konklaves die Gläubigen erwartungsvoll drängten, nur ein barfüßiger Junge verlor, der mit seiner Schildkröte in der Mittagssonne spielte. An einer Leine führte er das Kriechtier über die verlassene Piazza, als er plötzlich stutzte. Er beschirmte mit seiner Hand die Augen, schaute zum Himmel, und während sein Mund immer größer und größer wurde, starrte er auf die dünne, weiße Rauchsäule, die kerzengerade aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufstieg.
»Habemus Papam!«, rief er mit seiner hellen Kinderstimme in die brütende Stille. »Es lebe der Papst!« Eine Hausfrau, die irgendwo am Fenster eine Decke ausschüttelte, hörte den Ruf, blickte zum Himmel und fiel in den Ruf ein, der sich gleich darauf wie ein Echo fortsetzte, erst in der Nachbarschaft, dann in den angrenzenden Gassen, schließlich im ganzen Viertel, sodass er bald aus unzähligen Mündern erscholl: »Habemus Papam! Es lebe der Papst!«
Wenige Stunden später quollen die Straßen und Plätze Roms über vor Menschen. Pilger rutschten auf Knien durch die Stadt und priesen mit lauten Gebeten den Herrn, während auf den Märkten Wahrsager, Kartenleger und Astrologen die Zukunft prophezeiten. Wie aus dem Nichts tauchten Maler und Zeichner auf, mit fertigen Bildern des soeben gewählten Papstes. Ihre Rufe wurden übertönt von den Anpreisungen fliegender Händler; für wenige Kupfermünzen boten sie Kleider und Devotionalien an, die Seine Heiligkeit angeblich noch am Vortag in Gebrauch gehabt hatte.
Durch das Gewühl eilte ein junger Mann mit prachtvollen schwarzen Locken und feinem Oberlippenbart: Gian Lorenzo Bernini, trotz seiner Jugend von fünfundzwanzig Jahren bereits angesehenes Mitglied in der Zunft der Marmorbildhauer. Ungeduldig drängte er jeden Passanten beiseite, der ihm im Weg stand. Er war so aufgeregt wie vor seiner ersten Liebesnacht. Denn der Mann, der ihn zu sich gerufen hatte, war kein Geringerer als Maffeo Barberini, der Kardinal, der am heutigen Tag als Urban VIII. den Stuhl Petri bestiegen hatte.
Im Audienzsaal des Papstpalastes herrschte angespannte Nervosität. Prälaten und Bischöfe, Fürsten und Gesandte steckten flüsternd die Köpfe zusammen und schielten gleichzeitig zu der großen Flügeltür am Ende des Saals, in Erwartung, beim Heiligen Vater vorgelassen zu werden. Angesichts ihrer reichen, goldbestickten Gewänder fühlte Lorenzo sich in dem schlichten, schwarzen Habit des Cavaliere di Gesù, das er sonst mit solchem Stolz trug, wie ein Bettler. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und setzte sich auf einen Stuhl unweit des Ausgangs. Bis die Reihe an ihn kam, würde es wohl Mitternacht werden.
Warum hatte der Papst ihn zu sich gerufen? Er hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn kaum hatte er Platz genommen, forderte ein Palastdiener ihn auf zu folgen. Der Lakai führte ihn durch eine Tapetentür und danach durch einen langen, kühlen Gang. Wohin brachte man ihn? Laut hallten die Schritte seiner Stiefel auf dem Marmorboden wider, aber noch lauter klopfte sein Herz. Er verfluchte seine Aufregung und versuchte sich zu beruhigen.
Plötzlich ging eine zweite Tür auf, und bevor er wusste, wie ihm geschah, stand er vor ihm. Mit einer Verneigung sank Lorenzo zu Boden.
»Heiliger Vater«, flüsterte er, vollkommen durcheinander, während ein Bologneserhündchen an seinem Gesicht schnupperte. Im selben Augenblick begriff er: Der Papst empfing ihn in seinen Privatgemächern, und all die aufgeblasenen Schranzen und Bittsteller da draußen mussten warten!
Eine weiß behandschuhte Hand streckte sich ihm zum Kuss entgegen. »Groß ist dein Glück, Cavaliere, Maffeo Barberini als Papst zu sehen. Aber viel größer noch ist unser Glück, dass der Ritter Bernini unter unserem Pontifikat lebt.«
»Ich bin nur der bescheidenste Diener Eurer Heiligkeit«, sagte Lorenzo und warf den Kopf in den Nacken, nachdem er, wie es das Zeremoniell verlangte, den Fischerring und den Pantoffel des Papstes geküsst hatte.
»Deine Bescheidenheit ist uns bekannt«, erwiderte Urban, während das Bologneserhündchen auf seinen Schoß kletterte, mit einem spöttischen Lächeln in den wachen blauen Augen, um sodann in einen privateren Ton überzuwechseln. »Glaub ja nicht, ich hätte vergessen, wie du bei unserem letzten Ausritt versucht hast, mir davonzugaloppieren.«
Lorenzo entspannte sich. »Das geschah nicht aus Übermut, Heiliger Vater, mein Pferd ging mit mir durch.«
»Dein Pferd oder dein Temperament, mein Sohn? Ich meine mich zu erinnern, dass du deiner Stute die Sporen gabst, statt sie zu zügeln. Aber bitte, steh auf! Ich habe dir nicht den Mantel des Cavaliere umgehängt, damit du mit ihm den Boden wischst.«
Lorenzo erhob sich. Dieser Mann, der gerade doppelt so alt war wie er, hasste zwar falsche Ergebenheit, doch noch mehr hasste er es, wenn man ihm nicht auf der Stelle Folge leistete. Lorenzo kannte ihn wie seinen Paten. Seit er mit seinem Vater Pietro die Familienkapelle der Barberini in Sant’ Andrea restauriert hatte, förderte Maffeo ihn in vielfältiger Weise und hatte ihn bei seiner Erhebung in den Ritterstand sogar eigenhändig eingekleidet, als Zeichen der Verbundenheit. Dennoch war Lorenzo in Gegenwart des mächtigen Mannes stets auf der Hut. Denn dessen väterliche Freundlichkeit konnte von einem Moment zum anderen in Zorn umschlagen, und Lorenzo glaubte nicht, dass sich daran etwas geändert hatte, nur weil Maffeo Barberini nun über der hohen, eckigen Stirn die weiße Mitra des Papstes trug.
»Ich hoffe, Ewige Heiligkeit werden auch in Zukunft noch Zeit finden, durch die Wälder des Quirinals zu reiten.«
»Ich fürchte, die Zeit der Ausritte ist vorbei«, seufzte Urban. »Wie überhaupt die Mußestunden vorerst ein Ende haben. Um mein Amt zu erfüllen, müssen wohl sogar die Oden unvollendet bleiben, die ich unlängst begonnen habe.«
»Das ist ein Jammer für die Dichtkunst«, sagte Lorenzo, »doch ein Segen für die Christenheit. Ich meine«, fügte er schnell hinzu, als Urban irritiert eine Augenbraue hob, »weil Ewige Heiligkeit nun Ihre ganze Kraft in den Dienst der Kirche stellen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr, mein Sohn. Und du sollst mir dabei helfen.« Nachdenklich streichelte der Papst den Hund auf seinem Schoß. »Du weißt, warum ich dich zu mir gerufen habe?«
Lorenzo zögerte. »Vielleicht, um eine Büste von Ewiger Heiligkeit anzufertigen?«
Urban runzelte die Stirn. »Kennst du nicht den Beschluss des römischen Volkes, nie wieder einem Papst bei Lebzeiten eine Bildsäule zu errichten?«
Alter Heuchler!, dachte Lorenzo. Natürlich kannte er das Gesetz, doch was galt schon ein Gesetz? Päpste waren auch nur Menschen! Laut sagte er: »Ein solcher Beschluss darf für einen Papst nicht gelten, wie Ihr einer seid. Das Volk hat ein Anrecht darauf, sich ein Bild von Ewiger Heiligkeit zu machen.«
»Ich will darüber nachdenken«, erwiderte Urban, und Lorenzo hörte schon die vielen blanken Scudi klimpern, mit denen der Papst ihn beschenken würde. »Ja, wahrscheinlich hast du Recht. Doch nicht darum ließ ich dich rufen. Ich habe andere Pläne mit dir – große Pläne …«
Lorenzo horchte auf. Größere Pläne als eine Büste? Was konnte das sein? Vielleicht ein Sarkophag für den verstorbenen Papst? Er biss sich auf die Zunge, um nicht danach zu fragen. Da er wusste, dass Maffeo Barberini gern und ausführlich dozierte, bevor er zum Kern einer Sache gelangte, hörte er also geduldig zu, wie Urban von Dingen sprach, die ihn nicht im Geringsten interessierten: von den dreisten Angriffen, denen die katholische Kirche im Norden des Heiligen Römischen Reiches ausgesetzt war, von den protestantischen Ketzern, die der Teufel Martin Luther angestiftet hatte, Krieg zu führen gegen den allein selig machenden Glauben, von der bedrückenden Stimmung in der Stadt Rom, von den immer geringeren Einkünften der Staatskasse, von der Misswirtschaft früherer Päpste, vom Niedergang der Landwirtschaft, der Wollproduktion und der Tuchwebereien, von der Gefährdung der Sicherheit durch nächtlich marodierende Banden und der Gefährdung der Moral durch zuchtlose Prälaten – selbst den Gestank in den Gassen und den Unrat in den Bedürfnisanstalten vergaß Urban nicht zu beklagen.
»Du wirst dich sicher wundern«, schloss er endlich, »was all diese Dinge dich angehen, einen Künstler und Bildhauer, nicht wahr?«
»Mein Respekt vor Ewiger Heiligkeit verbietet mir, danach zu fragen.«
Der Papst setzte den Hund auf den Boden. »Wir wollen ein Zeichen setzen«, sagte er, plötzlich wieder ins offizielle Wir des Pluralis Majestatis wechselnd und mit so fester Stimme, dass Lorenzo erschrak. »Ein Zeichen, wie die Welt noch keines gesehen hat. Rom soll wieder zu seiner alten Größe gelangen, als Hauptstadt der Christenheit und Festung gegen die Gefahren aus dem Norden. Es ist unser Beschluss, diese Stadt in den Vorgarten des Paradieses zu verwandeln, in ein irdisches Sinnbild von Gottes herrlichem Reich, zum Ruhme des katholischen Glaubens. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben, und du, mein Sohn«, fügte er hinzu und zeigte mit dem Finger auf Lorenzo, »du sollst dieses Werk für uns vollbringen, als der erste Künstler Roms, der Michelangelo der neuen Zeit!«
Urban holte Luft, um ihm seine Pläne zu erläutern. Als er nach über einer Stunde mit seiner Rede zu Ende war, sauste es in Lorenzos Ohren, und ihm war so schwindlig, dass das Gesicht des Papstes vor seinen Augen verschwamm. Fast wünschte er, dass diese Unterredung nicht stattgefunden hätte.
Denn hier ging es nicht um ein paar Scudi und ein bisschen Ruhm. Hier ging es um die Ewigkeit.
2
»Was für ein Abenteuer, William! Wir haben es geschafft – wir sind in Rom!«
»Abenteuer? Wahnsinn ist das! Oh, du mein Gott, warum bin ich nicht in England geblieben? Wehe, wenn der Spitzbube merkt, dass unsere Pässe hier gar nicht gelten.«
»Wie soll er denn? Der kann doch gar nicht lesen! Er hält die Papiere ja auf dem Kopf!«
Die untergehende Abendsonne tauchte die Porta Flaminia, das nördliche Stadttor von Rom, in goldgelbes Licht, während zwei Briten Einlass verlangten: der eine ein auffallend hübscher blutjunger Mann, dem breitkrempigen Hut und selbstbewussten Auftreten nach von adliger Herkunft, der andere, William genannt, ein hoch gewachsener, knochiger Hagestolz mit roter Hakennase und sicher dreimal so alt wie sein Begleiter, dem er in offenbar dienender Funktion zugeordnet war. Die zwei waren von ihren mit Taschen und Säcken bepackten Pferden abgestiegen, denn ein Leutnant der gabella, ein Zolloffizier mit so gewaltigem Schnauzbart, dass dieser dem Federbusch an seinem Helm kaum nachstand, verbaute ihnen den Weg. Mit ebenso wichtiger wie verständnisloser Miene prüfte er die Pässe, ohne die niemand in die Stadt hineindurfte, während zwei Soldaten das Gepäck auf zollpflichtige Einfuhren durchsuchten. Mit gelangweilter Dreistigkeit öffneten sie die Satteltaschen, wühlten in den Mantelsäcken und schauten sogar unter den Schweifen der Pferde nach, ob sich darunter noch etwas anderes als die Arschfurche der Tiere verbarg.
»Wie lange bin ich nun schon Ihr Lehrer und Tutor?«, fragte der Ältere seinen jungen Herrn, während der Zolloffizier ihre Papiere wütend zusammenfaltete. »Aber das ist das Schlimmste, was Sie mir je angetan haben: In die Hauptstadt der Papisten reisen, gegen das Verbot des Königs! Wenn uns Landsleute entdecken und beim Gesandten anzeigen, können wir nie wieder zurück in die Heimat. – He, du Bandit, lässt du das wohl sein!«
Erbost mit den Armen fuchtelnd, stellte er sich dem Zolloffizier entgegen, der sich gerade anschickte, den Leib seines Schützlings abzutasten.
»Keine Sorge, William, ich weiß ja, wonach er sucht«, sagte der junge Herr auf Englisch, und an den Offizier gewandt fügte er in fast akzentfreiem Italienisch hinzu: »Wie viel verlangst du, damit wir passieren dürfen?«
Zu seiner Verwunderung würdigte der Offizier ihn keines Blickes, sondern fuhr barsch zu William herum.
»Ausziehen!«
Obwohl auch William der italienischen Sprache mächtig war, verstand er nicht gleich.
»Ausziehen!«, wiederholte der Offizier, und noch während er sprach, begann er ohne Rücksicht auf Knöpfe und Nähte William die Kleider vom Leibe zu reißen.
»Ich protestiere im Namen des Königs von England!«, rief William mit zitternder Stimme, während die Passanten sich lachend nach ihm umdrehten und zuschauten, wie er versuchte, seine Blößen zu bedecken.
»Und jetzt du!«, herrschte der Offizier den jungen Herrn an. »Leibesvisitation!«
»Wagen Sie nicht, mich anzurühren!«, rief der, und das Blut schoss ihm ins Gesicht. »Ich habe nichts zu verzollen!«
»Und was ist das?«
Der Offizier griff nach dem goldenen Kreuz am Hals des jungen Herrn.
»Unterstehen Sie sich! Das Kreuz hat der Papst geweiht!«
»Der Papst?« Im selben Augenblick vollzog sich eine erstaunliche Wandlung im Gesicht des Offiziers. Hatte er eben noch so zornig dreingeblickt, als wolle er alle Briten der Welt erschlagen, strahlte er nun wie ein Vater, der seinen verlorenen Sohn empfängt. »Dann seid ihr keine Ketzer? Gelobt sei Jesus Christus!« Ehe die beiden es sich versahen, umarmte er sie und drückte ihnen seinen gewaltigen Schnauzbart ins Gesicht. »Worauf wartet ihr, Freunde? Steigt auf eure Pferde und reitet in die Stadt! Ihr sollt mit uns feiern! Es lebe Urban, der neue Papst!«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, da saßen die zwei schon im Sattel.
»Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen!« Der junge Herr lachte, als sie auf der anderen Seite der Stadtmauer waren, und küsste sein Kreuz.
»Gut gegangen? Wir sind mit knapper Not einer Katastrophe entronnen«, schimpfte William, noch damit beschäftigt, seine Kleider in Ordnung zu bringen. »Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich ausziehen müssen! Oh, was für ein Land, dieses Italien! Lauter Banditen und Gauner!«
»Jetzt hören Sie doch auf zu schimpfen, William! Schauen Sie sich lieber um! So eine herrliche Stadt!« Seine helle Stimme überschlug sich vor Aufregung, während er in verschiedene Richtungen gleichzeitig zeigte. »Da drüben, der Garten! Haben Sie je solche Pflanzen gesehen? Und die Häuser! Jedes Gebäude ein Palast! Und erst die Kleider, die die Frauen tragen! Prächtiger als die unserer Königin! Und riechen Sie nur diese Luft! So muss es im Paradies duften!«
»Das ist das süße Gift des Schönen«, knurrte William. »Der König weiß, warum er seinen Untertanen den Aufenthalt in dieser Stadt verbietet. Sie gaukelt einem die herrlichsten Dinge vor, doch dahinter? Fäulnis und Verderben! Und die Römer – lauter Jesuiten! Wenn sie den Mund aufmachen, lügen sie. Wenn sie lächeln, denken sie an Mord. Sirenengesänge überall, um brave Menschen vom Schiffsmast der christlichen Lehre loszubinden. Doch wehe, wer ihnen folgt! Er landet grunzend im Schweinestall der Circe!«
»Oh, wie sehen die beiden denn aus?«
Der junge Herr parierte sein Pferd und schaute zwei Frauen nach, die mit blutroten Lippen, kohlschwarzen Augen und turmhohen Frisuren durch die Menge liefen.
»Giftige Blumen, die im Sumpf bigotter Lüsternheit gedeihen.«
»Wie stolz sie sind! Doch was gibt’s da drüben?«, unterbrach er sich und zeigte schon wieder in eine andere Richtung. »Bei den Buden, wo sich die vielen Menschen drängen?«
»Wahrsager, nehme ich an.« Der Tutor schnaubte verächtlich durch die rote Hakennase. »Obwohl die Leute hier dreimal am Tag in die Kirche gehen, glauben sie an Zauberei.«
»Wahrsager?«, fragte der junge Herr begeistert und trieb sein Pferd an. »Das muss ich sehen!«
»Wollen Sie mich beleidigen?«, rief William erbost. »Habe ich so viele Jahre darauf verwandt, Sie im Geist der Vernunft zu erziehen, damit Sie sich von solchem Unsinn verwirren lassen?«
»Aber ich muss doch wissen, welches Schicksal mich hier erwartet!«
»Jetzt ist es aber genug!« William griff seinem Herrn in die Zügel, sodass sich das Pferd wiehernd aufbäumte. »Sehen Sie den Gasthof am Ende des Platzes? Dort gehen wir jetzt hin. Oder wollen Sie sich in diesen Kleidern Ihrer Cousine präsentieren?«
In dem Schankraum der Herberge saßen nur wenige Gäste. William wunderte sich nicht. Die Italiener aßen wie alle Spitzbuben der Welt erst spät in der Nacht, wenn anständige Menschen schliefen. Während der junge Herr mit seinem Mantelsack in einer Kammer verschwand, beauftragte William den Wirt, die Pferde zu versorgen. Er selbst wollte die Zeit nutzen, um sich Notizen zu machen. Doch daraus wurde nichts. Kaum hatte er sein Schreibzeug hervorgeholt, tippte der Wirt ihm auf die Schulter.
»Scusi, Signor, darf man erfahren, woher Sie kommen?«
»Woher wohl?«, erwiderte William und spuckte auf den mit Sägespänen bedeckten Boden. »Daher, wo alle anständigen Leute herkommen – aus England.«
»Oh, aus England?« Der Wirt strahlte, als habe ihm die Jungfrau Maria ihr Geheimnis offenbart. »Ich liebe England! So ein großes, tapferes Volk. Und hatten Sie eine gute Reise?«
»Reise? Es war die Hölle!« William seufzte laut auf. »Sie wissen, was die Alpen sind?«
»Si, Signor. Die höchsten Berge der Welt!«
»Allerdings. Und Menschen sind nicht dafür geschaffen, solche Berge zu erklimmen.«
»Normale Menschen vielleicht nicht, Signor, aber Engländer! Engländer können alles!«
William stutzte. Nanu, das schien ja ein ganz verständiger Mann zu sein.
»Bitte, Signor, erzählen Sie!«, drängte der Wirt. »Wie haben Sie es geschafft? Mit einer Kutsche?«
Auch die anderen Gäste rückten nun mit ihren Stühlen heran. William verspürte plötzlich die Pflicht, sie darüber aufzuklären, wozu Engländer imstande sind. Wahrscheinlich hatten die armen Teufel noch nie einen zivilisierten Menschen gesehen.
»Natürlich nicht«, brummte er. »Wie soll denn das gehen, mit einer Kutsche, ohne Straßen? Nein, wir mussten Schuhe mit Nägeln anziehen, um selber zu klettern, auf allen vieren, über Stock und Stein wie Bergziegen, durch ewigen Schnee und Eis bis in die Wolken, die so dicht zwischen den Gipfeln hingen wie ein englischer Plumpudding. Aber das können Sie bald alles in meinem Werk nachlesen«, er tippte mit seinem knochigen Finger auf sein Tagebuch. »›Reisen in Italien, unter besonderer Berücksichtigung der mannigfaltigen Verführungen und Verlockungen, welche in diesem Lande zu gewärtigen sind …‹«
»Plumpudding, Signor?«, fragte der Wirt leicht verwirrt, das einzige Wort aufgreifend, das er von dieser langen Rede behalten hatte. »Was ist das?«
»Eine Art Kuchen, schmeckt köstlich!«
»Oh, Sie haben Hunger? – Eh, Anna, ascolta, il signore vuole una pasta! Sbrigati!« Eifrig wandte der Wirt sich ab, um zur Küche zu laufen, als er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. »Porca miseria! Che bellissima donna!«
William schaute auf. Alle Augen waren auf die Tür der Kammer gerichtet, in der der junge Herr vor wenigen Minuten verschwunden war. Jetzt aber stand dort im letzten Licht der Abendsonne eine wunderschöne blutjunge Frau in einem langen, an Armen und Hüften gebauschten Kleid – einem duftigen Gewoge aus Musselin, Spitze und Schleifen, in dessen Mitte ein goldenes Kreuz funkelte.
»So, William, jetzt können wir zu meiner Cousine gehen.«
»Habe ich nicht gesagt«, fragte der Wirt und rieb sich die Augen, »Engländer können alles?«
William hob ohnmächtig die Arme. »Oh, du mein Gott! Ich glaube, jetzt fangen die Probleme erst wirklich an.«
Die junge Frau aber trat in den Schankraum, warf den blonden Lockenkopf in den Nacken und blickte mit ihren grünen Augen herausfordernd in die Runde. »Kann uns einer der Signori den Weg zum Palazzo Pamphili beschreiben?«
3
Der Palazzo Pamphili erhob sich an der Piazza Navona, einem der bedeutendsten Plätze der Stadt. Auf dem Grundriss des alten Domitian-Zirkus erbaut, war dieser Ort seit Jahrhunderten nicht nur ein bedeutender Marktplatz, der am Tage von Händlern und bei Nacht von Huren bevölkert war, sondern auch Schauplatz prunkvoller Feste. Hier fanden Reitturniere und Pferderennen ebenso statt wie Karnevalsaufzüge, kirchliche und weltliche Schauspiele.
Streng genommen war der Palazzo, an der westlichen Längsseite der Piazza gelegen, eher eine Häuserzeile als ein wirklicher Palast, zusammengekauft im Laufe der Generationen. Verbunden durch eine gemeinsame Fassade, konnte der Bau zwar als herrschaftlicher Sitz gelten, doch verglichen mit den Prachtbauten in der Nachbarschaft nahm sich das vierstöckige Gebäude eher bescheiden aus. An vielen, allzu vielen Stellen bröckelte der Putz von den Wänden, und bei ungünstiger Witterung stiegen die Ausdünstungen der zu kleinen Senkgrube bis in die Gemächer des piano nobile empor. Denn die Familie Pamphili gehörte längst nicht zu den wirklich reichen Familien Roms, auch wenn an diesem Abend noch zu später Stunde heller Lichterschein aus den zahllosen Fenstern drang, als würde hinter den dicken Mauern ein Fest gefeiert.
»Ich kann mich nicht genug wundern«, sagte Donna Olimpia, »dass deine Eltern dich auf eine solche Reise geschickt haben. Deutschland, Frankreich, Italien. Wie viel Mut dazu gehört! Warst du auch in Venedig?«
»Eine Stadt voller Wunder«, rief Clarissa mit leuchtenden Augen. »Allein die Markuskirche. Auf den Turm führt eine so breite Treppe, dass sogar Pferde hochsteigen können!«
»Eine Stadt voller nonsense«, brummte William an ihrer Seite. »Statt Straßen haben sie stinkende Flüsse zwischen den Häusern, die Frauen laufen auf hölzernen Stelzenschuhen herum, damit sie sich die Füße nicht nass machen, und in den Kellern faulen die Fässer.«
»Und in Florenz waren wir im Dom, wo ein Gelehrter bewiesen hat, dass die Erde sich dreht. Stellen Sie sich vor – die Erde dreht sich, ohne dass wir runterfallen! Galilei heißt der Mann.«
»Wie ich dich beneide!«, sagte Donna Olimpia. »Eine Frau, die allein von England nach Italien reist. Ich glaube, ich habe bislang noch von keinem solchen Fall gehört.«
Clarissa platzte fast vor Stolz, so sehr genoss sie die Bewunderung ihrer Cousine, und musste sich alle Mühe geben, um ihre Würde zu wahren. Mit scheinbarer Ruhe hielt sie die Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet, während die Diener das Essen auftrugen, doch ihr Herz jubilierte. Donna Olimpia war mit ihren dreißig Jahren nur ein Dutzend Jahre älter als sie – doch wie viel reifer, wie viel selbstbewusster, wie viel erwachsener wirkte sie in allem, was sie tat und sagte! Das helle, fein geschnittene Gesicht von schwarzen Ringellocken eingerahmt, die beim Sprechen auf und ab tanzten, war sie, ohne darum an weiblicher Schönheit einzubüßen, von jenem stolzen, majestätischen Wuchs, der Clarissa an den Italienerinnen so sehr imponierte und der den Männern das Befehlen wie das Gehorchen gleich unmöglich zu machen schien.
»Alle jungen Gentlemen bei uns in England«, sagte Clarissa, »machen eine Reise auf den Kontinent – warum nicht auch wir Frauen? Wir wollen doch genauso wissen, was in der Welt geschieht! Außerdem, seit ich zurückdenken kann, hat meine Mutter von Italien geschwärmt, von der Landschaft, von den Städten, von den Kunstschätzen. Vor allem von der Sonne, die hier das ganze Jahr scheint. Arme Mama! Sie kann sich einfach nicht an das englische Wetter gewöhnen.«
»Deine Mutter und ich waren die besten Freundinnen«, sagte Olimpia. »Was habe ich deinen Vater gehasst, als er sie nach England entführte!«
»Ich glaube, Mama hasst ihn dafür manchmal heute noch.« Clarissa lachte. »Zumindest im Winter. Auf jeden Fall hat sie ihn überredet, dass ich diese Reise machen darf. Und als William, der ja schon zweimal in Italien war, sich bereit fand, mich zu begleiten …«
»Der größte Fehler meines Lebens«, stöhnte ihr Tutor und verdrehte die Augen.
»… da hat mein Vater schließlich eingewilligt. Aber was ist das für ein nützliches Werkzeug«, unterbrach Clarissa sich, während sie Olimpias Beispiel folgend mit der kleinen Silbergabel, die neben ihrem Gedeck lag, das Fleisch auf ihrem Teller aufspießte, um es mit dem Messer zu zerteilen. »In England haben wir keine solchen Tischgeräte, da müssen wir die Hände zu Hilfe nehmen wie die Barbaren, und nicht jeder hat saubere Finger. Ich werde unbedingt ein paar Dutzend davon kaufen, wenn wir heimfahren.«
»Das brauchst du nicht, ich schenke dir welche zur Hochzeit«, sagte Olimpia. »Deine Mutter hat mir geschrieben, dass du bald heiraten wirst. Wann wird es so weit sein?«
Olimpia schaute sie mit prüfenden Augen an. Clarissa wurde plötzlich ernst.
»Die Hochzeit? Nun, sobald ich wieder zu Hause bin.«
»Dann wirst du es wohl gar nicht abwarten können, zurückzureisen?«
»Ja, sicher, Donna Olimpia.«
»Ich habe dir schon dreimal gesagt, du sollst mich weder Donna nennen noch Sie zu mir sagen! Aber weshalb wirst du so ernst, wenn ich nach deiner Hochzeit frage? Du siehst ja fast aus, als würdest du dich gar nicht freuen?«
Wieder dieser strenge, prüfende Blick. Clarissa fühlte sich überhaupt nicht mehr wohl. Sollte sie ihrer Cousine die Wahrheit sagen? Alles in ihr drängte danach. Aber sollte sie es auch tun? Olimpia würde sie sicher tadeln. Sie kannten einander ja kaum, sie sahen sich an diesem Abend zum ersten Mal. Clarissa entschied sich darum für die halbe Wahrheit.
»Es ist nur so«, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln, »ich würde gern viel länger hier bleiben. Es heißt, man brauche Jahre, um alles zu besichtigen, was es in Rom zu besichtigen gibt, die Ruinen, die Kirchen, die Bildergalerien, und ich möchte alles sehen – alles! Wer weiß, wann ich je wieder Gelegenheit habe, hierher zu kommen?«
»Und wo gedenken Sie zu wohnen?«
Es war das erste Mal, dass Principe Pamphilio Pamphili, Olimpias Gatte, sich in das Gespräch einmischte. Bei Clarissas Ankunft hatte er, ein ebenso hübscher wie eitler Mann, sie kaum eines Blickes gewürdigt, und seit sie am Tisch saßen, schlang er stumm sein Essen in sich hinein und ließ nur ab und zu eine unzufriedene Bemerkung fallen, mit einer so säuerlichen Miene, als empfinde er es als Zumutung, mit ihr und William die Mahlzeit einnehmen zu müssen.
»Ich … ich dachte«, stammelte Clarissa, während der Principe sie mit seinen engstehenden Augen so eindringlich ansah, dass sie fast ihr Italienisch vergaß. War das die römische Gastfreundschaft? Wenn ja, dann konnte sie darauf verzichten! Sie warf den Kopf in den Nacken und besann sich auf ihr bestes Italienisch. »Ich werde mir ein paar Zimmer in der Stadt nehmen. Vielleicht können Sie mir eine Herberge empfehlen, Donna Olimpia?«
»Eine Herberge, Miss Whetenham?«, protestierte William und ließ sein Bratenstück, das er gerade mit dem Daumen traktierte, auf den Teller fallen. »Wie soll ich da meine Arbeit tun?« Er drehte seine Hakennase Donna Olimpia zu. »Sie müssen wissen, Mylady, ich bin Schriftsteller und nehme diese beschwerliche Reise allein zu dem Zweck auf mich, ein literarisches Werk zu verfassen, welches das gebildete England mit Ungeduld erwartet: ›Reisen in Italien, unter besonderer Berücksichtigung der mannigfaltigen Verführungen und Verlockungen …‹«
»Hier können Sie jedenfalls nicht bleiben«, unterbrach Pamphili ihn. »Eine unverheiratete Frau, die in Männerkleidern reist!« Missmutig schüttelte er den Kopf, die Augen auf Clarissa gerichtet. »Wahrscheinlich können Sie auch lesen und schreiben, wie? Ich bin sicher, in England lernen Frauen das.«
»Hier etwa nicht?«, fragte Clarissa zurück.
Olimpia runzelte die Brauen. »Willst du sagen, du kannst lesen und schreiben?« Ihr Gesicht drückte Staunen und Bewunderung aus.
»Natürlich kann ich das!«, rief Clarissa.
»Wie ein Mann?« Olimpia zögerte eine Sekunde, als komme ihr ein Gedanke. »Auch … in Italienisch?«
»Wie denn nicht? Ich rede ja auch italienisch. Außerdem ist das Italienische nur eine drollige Abwandlung des Lateinischen«, fügte Clarissa mit einem triumphierenden Blick auf den Principe hinzu, »und darin hat William mich unterrichtet, als ich noch keine zehn war.«
Ein warmes, fast zärtliches Lächeln füllte Olimpias Miene. »Du erinnerst mich so sehr an deine Mutter«, sagte sie und tätschelte Clarissas Hand. »Und ein bisschen auch an mich selbst, als ich noch jung war. Ich würde dir gern die ältere Freundin sein, die deine Mutter mir früher war. Auf jeden Fall bleibst du bei uns. Wir haben über dreißig Zimmer, manche sind zwar kaum bewohnbar, aber es bleiben doch genug, um ein paar taugliche für dich zu finden.«
»Und ihr Pass?«, fragte Pamphili. »Haben Sie vergessen, dass Ihre Cousine sich gar nicht in Rom aufhalten darf? Wenn der englische Gesandte erfährt, dass wir sie hier beherbergen, kann das sehr unangenehme Folgen haben – vor allem für meinen Bruder.«
»Ihren Bruder lassen Sie nur meine Sorge sein!«, erwiderte Olimpia. »Ich bin sicher, es ist ganz in seinem Sinn. – Nein, keine Widerrede!«, schnitt sie Clarissa das Wort ab, als diese etwas einwenden wollte. »Die Familie ist uns Römern heilig! Außerdem, wenn wir Frauen nicht für uns sorgen, wer tut es dann? Als ich ein junges Mädchen war, wollte man mich zwingen, in ein Kloster zu gehen, und nur weil ich mich dagegen wie eine Löwin wehrte, konnte Pamphili mich heiraten. Zu meinem und zu seinem Glück«, fügte sie hinzu und nahm den Säugling, den eine Amme ihr reichte, auf den Arm. »Nicht wahr, mein teurer Gatte?«
Während Pamphili sich missmutig wieder seinem Essen zuwandte, wiegte Donna Olimpia ihr Kind in den Schlaf, mit leisen, zärtlichen Worten, und als der Kleine in ihren Armen eingeschlummert war, bedeckte sie sein Gesicht mit Küssen. Was für eine wunderbare Frau sie war! Clarissa hatte fast ein schlechtes Gewissen, ihr nur die halbe Wahrheit gesagt zu haben. Doch statt sich den Kopf zu zerbrechen, freute sie sich auf die künftigen Monate mit ihrer Cousine. Ganz gewiss würden sie Freundinnen werden! Clarissa brauchte nur den beleidigten Pamphili anzuschauen, um sich davon zu überzeugen.
»Dann ist es also entschieden?«, fragte Olimpia. »Du wirst bei uns wohnen?«
»Yes, mylady, it is!«, sagte William, bevor Clarissa antworten konnte.
4
Es war Mittagspause in Sankt Peter, der größten und bedeutendsten Baustelle Roms. Die Maurer und Steinmetze legten ihre Werkzeuge beiseite, wischten sich den Schweiß und Staub von der Stirn und ließen sich in einer Seitenkapelle des riesigen Doms nieder, um dort im kühlen Schatten ihr Vesper zu verzehren. Nur einer hielt sich von den übrigen abseits, Francesco Castelli, ein junger Steinmetz aus der Lombardei, der statt Wein, Brot und Käse ein Zeichenbrett und einen Graphitstift aus seinem Bündel hervorholte.
»He, Michelangelo, was zeichnest du da?«
»Sicher nackte Engel, so selig wie der guckt!«
»Oder vielleicht Eva mit der Schlange?«
»Glaub ich nicht! Was weiß denn der vom Paradies?«
Francesco achtete nicht auf die Rufe. Sollten ihn die anderen nur verspotten und Michelangelo nennen – er wusste, was er tat. Wie jede freie Stunde nutzte er auch die Mittagspause, um die Architektur von Sankt Peter zu studieren. Konzentriert und geduldig zeichnete er die Säulen und Bögen nach, um immer tiefer in die Gedanken seines großen Vorbilds einzudringen, von dem die herrlichsten Teile dieses Gotteshauses stammten, die Gregorianische Kapelle, in der Francesco sich soeben niedergelassen hatte, ebenso wie die mächtige Kuppel, die wie ein steinerner Himmel die Vierung überwölbte.
Francesco hatte nicht vor, sein Leben lang ein Steinmetz zu bleiben, um irgendwann einmal an einer Staublunge zu krepieren, unbekannt und unbedeutend, wie seine Kollegen, die ihre Tage und Jahre damit verbrachten, Steine zu behauen, Balustraden zu verzieren oder Profile auszuführen, nach fremden Entwürfen und ohne eigenen Anteil. Nein, er, Francesco Castelli, wollte Architekt werden, das war so gewiss wie sein Glaube an den dreifaltigen Gott, ein großer und bedeutender Baumeister, der eines Tages selber Kirchen und Paläste errichtete! Dafür hatte er seine lombardische Heimat verlassen, hatte bei Nacht und Nebel in Bissone sein Bündel gepackt, ohne seinen Eltern ein Wort zu sagen, und war erst nach Mailand und dann weiter nach Rom gezogen, um die Geheimnisse der Baukunst zu erlernen.
»Das ist eine Frechheit! Verlassen Sie meine Baustelle! Sofort!«
»Ihre Baustelle? Dass ich nicht lache! Seit wann sind Sie der Papst?«
Francesco schrak aus seinen Studien auf. Erregte Stimmen drangen vom Hauptaltar zu ihm herüber, Stimmen, die mit jedem Wort lauter und heftiger wurden. Er packte seine Sachen und spähte um die Säule, die ihn vom Mittelschiff trennte.
Im Kuppelraum, dem Allerheiligsten der Kirche, auf dem Grab des Apostels Petrus, reckte Carlo Maderno, Francescos greiser Lehrherr, voller Zorn seine Hände in die Höhe. Er hatte seine Sänfte verlassen, in der er, gebrechlich wie er war, gewöhnlich zur Baustelle getragen wurde, und trat einem jungen Mann entgegen, der, gekleidet wie ein Pfau, breitbeinig dastand, die Arme vor der Brust verschränkt, das Kinn erhoben, und dabei ein so verächtliches Gesicht zog, als wolle er auf den Boden spucken.
Francesco kannte diesen Mann, der kaum älter war als er selbst, so wie jeder in der Stadt ihn kannte: Gian Lorenzo Bernini, der Marmorbildhauer, der mit seinen Skulpturen bereits Aufsehen erregt hatte, als Francesco noch in die Lehre gegangen war. Maderno hatte sie einmal einander vorgestellt, doch Bernini hatte Francescos Gruß nie erwidert.
»Ich bin der Dombaumeister«, rief Maderno mit zitternder Stimme, »und ich verbiete Ihnen, hier auch nur einen Stein anzurühren!«
»Sie haben mir gar nichts zu verbieten«, erwiderte Bernini. »Papst Urban hat mich beauftragt, den Hochaltar zu bauen.«
Francesco biss sich auf die Lippen. Dann war es also doch wahr, was seit ein paar Tagen unter den Handwerkern der Dombauhütte gemunkelt wurde: dass der neue Papst die Ausgestaltung der Peterskirche dem jungen Bildhauer anvertrauen wollte. Was für eine Demütigung für den alten Dombaumeister!
»Sie – einen Altar bauen?«, fragte Maderno. »Wie denn, Sie Wunderkind? Dafür muss man Architekt sein, Ingenieur! Wissen Sie überhaupt, wie man das Wort Statik buchstabiert?«
»Nein.« Bernini grinste und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Dafür weiß ich aber, wie man Einfaltspinsel buchstabiert: M-a-d-e-r-n-o!«
Der greise Baumeister erstarrte, alles Blut wich aus seinem Gesicht, kraftlos hing ihm der Unterkiefer herab, und für einen Moment fürchtete Francesco, dass er tot umfallen würde. Francesco wusste, Maderno war in seinem Innersten getroffen, und er wusste auch, warum. Doch dann, so plötzlich, wie er erstarrt war, wandte sein Lehrherr sich ab; mit Tränen in den Augen, das schlohweiße Haar auf den Schultern, sank er in seine Sänfte und befahl zwei Arbeitern, ihn hinauszutragen.
»Dieses Haus«, rief er mit bebender Stimme, »obwohl das größte Gotteshaus der Erde, ist zu klein für diesen Menschen und mich.«
Francesco begriff nicht sogleich. Wie, Maderno, sein Lehrherr und Meister, verließ den Ort mit eingezogenem Schwanz wie ein verängstigter Straßenköter? Der Dombaumeister, der das Langhaus von Sankt Peter geschaffen hatte, die Vorhalle und die Fassade, wich zurück vor diesem eingebildeten Pfau, der noch keine einzige Mauer errichtet hatte, ja, wahrscheinlich nicht mal wusste, was eine Maurerkelle war? Gelähmt vor Wut schaute Francesco dem greisen Maderno nach, dem Mann, dem er alles verdankte, was er konnte und was er besaß.
Dann aber fiel sein Blick auf eine Zeichnung, die auf einem Arbeitstisch ausgebreitet lag. Im selben Augenblick stockte ihm der Atem, und alle Wut wich von ihm.
Es war ein Entwurf des Hochaltars: vier monumental gewundene Säulen, die sich mit der Kraft der österlichen Auferstehung in den Himmel schraubten, bekrönt von einem Baldachin, über dem der dem Grab entstiegene Jesus Christus triumphierte, mit Banner und Kreuz. Was für ein Geniestreich! Mit Madernos Plänen für den neuen Hochaltar seit Jahren vertraut, erkannte Francesco sofort, dass dieser Entwurf mit einem Schlag alle Probleme löste, an denen der alte Dombaumeister sich wieder und wieder die Zähne ausgebissen hatte, Probleme der Raumgestaltung und der Proportionen, die sich hier, scheinbar in müheloser Leichtigkeit, in ein Wunderwerk von Harmonie verwandelten.
Wer hatte diesen Plan gezeichnet?
»Da staunst du, was?«, fragte Bernini und zog ihm das Blatt unter der Nase weg. »Das ist der Altar, den ich hier errichten werde. Aber sag mal«, unterbrach er sich und blickte Francesco prüfend an, »bist du nicht der assistente von dem alten Scheißer? Ja doch, ich erkenne dich wieder!« Mit einem strahlenden Lächeln legte er Francesco eine Hand auf die Schulter. »Das ist ja prächtig, dann kannst du mir ja helfen. Na, was meinst du – hast du Lust?«
Francesco rang vor Empörung nach Worten. »Was … was … bilden Sie sich ein?!« Auf dem Absatz machte er kehrt und im Laufschritt eilte er davon, aus dem Dom hinaus ins Freie.
Draußen krähte irgendwo ein Hahn.
5
Lorenzo griff nach einem der Äpfel, von denen es in seinem Atelier stets einen Vorrat gab, und biss hinein. »Das Laster der Neapolitaner«, sagte er, mit beiden Backen kauend. »Ich glaube, wenn ich an Adams Stelle gewesen wäre, ich hätte der Versuchung auch nicht widerstanden.«
Vor ihm auf einem Schemel saß Costanza Bonarelli, die Frau seines ersten Gehilfen Matteo, ein Weib von solcher Schönheit, dass selbst Eva an ihrer Seite vor Neid erblasst wäre, und blickte ihn über die Schulter an. Auf ihrer makellosen Haut trug sie nichts als ein offenes, weit ausgeschnittenes Hemd, sodass Lorenzo Mühe hatte, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren: ihre Schönheit in dem Marmorblock zu verewigen, den er gerade mit seinem Meißel bearbeitete, wie er es von seinem Vater Pietro gelernt hatte, seit er einen Meißel in der Hand halten konnte.
»Ich habe das Gefühl«, sagte Costanza, »du bist heute nicht richtig bei der Sache.« Und mit einem Lächeln fügte sie hinzu: »Weder bei der einen noch bei der anderen.«
»Nicht bewegen!«, knurrte er. »Ich brauche dein Profil.«
Die Büste war fast fertig. Den Apfel in der Hand, trat Lorenzo zwei Schritte zurück, kniff ein Auge zusammen und neigte den Kopf, um Original und Abbild zu vergleichen. Mein Gott, was war sie nur für ein Prachtweib! Diese lauernde, doch gleichzeitig unschuldige Sinnlichkeit, die sie verströmte wie einen Duft. Mit leicht gerunzelter Stirn öffnete sie die vollen Lippen, als würde sie gerade von einem unsichtbaren Mann überrascht, auf den sie ihre Augen erwartungsvoll richtete. Man bekam sofort Lust, sie zu küssen. Ungeduldig verschlang Lorenzo den Rest seines Apfels und setzte wieder den Meißel an, um diesen Ausdruck in ihrem Gesicht festzuhalten.
»Verflucht!«, rief er plötzlich und steckte den verletzten Daumen in den Mund.
»Was ist los mit dir?«, fragte Costanza. »Seit wann passiert dir so was? Hast du Sorgen?«
»Sorgen?« Lorenzo seufzte. »Sorgen ist gar kein Ausdruck! Papst Urban hat in seiner Weisheit beschlossen, Rom werde unter seiner Herrschaft einen zweiten Michelangelo hervorbringen. Und rate mal, wen er dazu auserkoren hat!«
»Dich natürlich! Was für ein kluger Mann ist doch der Heilige Vater. Ich könnte mir keinen geeigneteren Künstler vorstellen! Du etwa?«
»Natürlich nicht!«, erwiderte Lorenzo und nahm den Daumen aus dem Mund. »Aber was für eine verrückte Idee! Als könne man ein Genie einfach ernennen wie einen Bischof oder Kardinal. Und jetzt erwartet Urban ständig neue Wunderdinge von mir.«
»Also, mir fielen da schon ein paar Dinge ein, in denen du ein Genie bist.«
»Nein, im Ernst. Er hat einen Plan für mich aufgestellt wie in der Schule. Ich soll bildhauern, ich soll malen, ich soll Architektur treiben, damit ich wie Michelangelo alle drei Künste beherrsche. Als hätte der Tag achtundvierzig Stunden. Und als wäre das nicht genug, lässt er mich fast jeden Abend zu sich rufen. Dann redet und redet er von dem neuen Rom, seinem Rom, das ich für ihn erschaffen soll. Erst bei Tisch, dann in seinem Schlafgemach, stundenlang, nicht mal im Bett hört er auf zu reden, bis ihm die Augen zufallen, und ich darf erst gehen, wenn ich die Vorhänge zugezogen habe.«
»Wie, du bringst den Papst ins Bett?«, Costanza hob drohend den Zeigefinger.
»Bitte, mir ist nicht nach Witzen zumute. Wie soll ich das denn alles schaffen? Schlaflose Nächte bereitet mir dieser Mann. Weißt du, was er gestern Abend verlangt hat? Ich soll den Hochaltar in Bronze ausführen! Jeder, der auch nur ein bisschen was von der Sache versteht, schlägt bei dem Gedanken die Hände über dem Kopf zusammen. Unter diesem Gewicht kracht doch der Boden ein, und der verfluchte Altar rauscht zum heiligen Petrus in die Gruft. Außerdem, woher soll ich solche Unmengen Bronze nehmen?«
»Und warum weigerst du dich dann nicht?«
»Ich? Mich weigern?« Lorenzo schnaubte. »Und wenn ich dreimal der neue Michelangelo bin – der Papst ist der Papst!« Er nahm wieder Meißel und Schlägel zur Hand und hämmerte in einem solchen Tempo an Costanzas Büste, als wolle er sie noch vor dem Abend fertigstellen. »Davon abgesehen«, brummte er nach einer Weile, »der Altar ist die Chance meines Lebens. Wenn ich das schaffe, dann …« Statt zu sagen, was dann geschehe, hämmerte er weiter stumm vor sich hin. »Herrgott noch mal!«, brauste er auf. »Wie zum Teufel soll das gehen? Wer legt mir das Fundament, das einen solchen Aufbau trägt? Und erst der Baldachin! Der wiegt doch so viel wie die halbe Kuppel!« Wütend warf er Schlägel und Meißel zu Boden. »Maderno hat Recht, der alte Scheißer – Recht, Recht, Recht! Ich kann das nicht, und ich will das auch gar nicht können. Ich bin Bildhauer, verflucht noch mal, kein Ingenieur!«
»Mein armer kleiner Lorenzo«, sagte Costanza und stand von ihrem Schemel auf. »Was meinst du, wollen wir für heute nicht lieber mit der Arbeit aufhören?«
Sie streichelte Lorenzos Wange und schaute ihn dabei mit ihren großen Augen so verführerisch an, dass ihm ganz flau im Magen wurde. Plötzlich war er wie verwandelt.
»Hast du eigentlich gar keine Angst, dass dein Mann Verdacht schöpft?« Er grinste.
»Matteo? Der hat nur einen Wunsch – dass ich glücklich bin!«
»Costanza, Costanza«, sagte Lorenzo. »Wenn es die Sünde nicht gäbe, ich glaube, du würdest sie erfinden.«
»Pssst«, machte sie und legte ihm einen Finger auf die Lippen. Dann lächelte sie ihn an, wie Eva einst ihren Adam angelächelt haben mag, und streifte sich das Hemd von den Schultern. Bloß und nackt, wie Gott der Herr sie erschaffen hatte, beugte sie sich über die Obstschale, nahm eine Frucht und drehte sich damit zu ihm herum. »Sag, mein Liebster«, hauchte sie, »möchtest du vielleicht einen Apfel?«
6
Rom, den 22. September 1623
Meine lieben Eltern,
jetzt bin ich schon sechs Wochen hier, doch erst heute finde ich die gehörige Muße, Ihnen zu schreiben. Ich habe deshalb ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber es ist so vielerlei passiert, dass ich zuversichtlich bin, Sie werden mir verzeihen.
Die Überquerung der Alpen war ein Erlebnis, welches ich mein Lebtag nicht vergessen werde. In Graubünden mussten wir warten, bis es zu schneien aufhörte. Unterdessen wurde unsere Kutsche in Einzelteile zerlegt und zusammen mit dem Gepäck auf Maulesel gebunden. Dann haben unsere Führer (einfache, aber herzensgute Bauern) uns in Biberpelze gesteckt: Bibermützen, Biberhandschuhe, Bibersocken – Sie haben ja keine Ahnung, wie kalt es da ist in der dünnen Luft –, und in Tragestühlen ging es endlich weiter.
Die Geschicklichkeit der Bergführer ist unvorstellbar. Sie haben Schuhe mit Nägeln unter den Sohlen, damit sie auch bei Schnee und Eis sicheren Tritt und Halt haben. Solchermaßen bewehrt, sind sie mit uns wie Gämsen den Mont Cenis hinaufgeklettert, immer zwei von ihnen mit einer Sänfte. William hat die ganze Zeit mit den Zähnen geklappert, ich weiß nicht, ob vor Kälte oder vor Angst, und geschimpft hat er, dass ich es nicht wiedergeben kann, ohne zu erröten. Dabei hielt er die Augen geschlossen, wie die Führer uns angewiesen hatten, damit uns nicht schwindlig wurde. Ich habe aber doch ab und zu geblinzelt – die steilen Schluchten und Abgründe sind gar wirklich beängstigend. Die Häuser im Tal waren so winzig klein, dass ich sie kaum noch erkennen konnte, und manchmal dachte ich, gleich stoßen wir an den Himmel.
Was nun mein Leben in Rom betrifft, so können Sie ebenso beruhigt sein wie William, der immerfort fürchtet, man könne unseren Aufenthalt dem englischen Gesandten anzeigen. Doch das ist ausgeschlossen – Pamphili hält mich hier ja wie eine Gefangene! Jenseits der dicken Palastmauern warten so viele Geheimnisse und Abenteuer darauf, entdeckt zu werden, und ich darf keinen Fuß vor die Tür setzen – es sei denn, um die Messe zu besuchen, verhüllt wie eine Muselmanin. Wie gerne würde ich die Altertümer sehen, die Paläste und Kirchen, vor allem aber die Werke des Michelangelo Buonarroti, von dem die ganze Welt spricht! Wenn ich daran denke, Rom vielleicht bald wieder zu verlassen, ohne etwas von der Herrlichkeit dieser Stadt gesehen zu haben, könnte ich weinen. Allein, mein Kerkermeister duldet nicht, dass ich mich in der Öffentlichkeit zeige.
Ganz anders Donna Olimpia! Sie ist mir in der kurzen Zeit schon eine richtige Freundin geworden, auch wenn es mir immer noch schwer fällt, sie mit Du anzusprechen. Voller Anteilnahme erkundigt sie sich nach meinen Verhältnissen zu Hause. Dabei merke ich erst, wie dumm und unerfahren ich bin, weiß ich doch auf ihre Fragen nur selten eine vernünftige Antwort. Warum zum Beispiel wünscht der König meine Verheiratung mit Lord McKinney? Hat dies, wie Olimpia vermutet, damit zu tun, dass wir dem Adel angehören und gleichzeitig Katholiken sind?
Umso mehr freut es mich, dass ich Olimpia in einer Sache dienlich sein kann. Stellen Sie sich nur vor, meine Cousine kann weder lesen noch schreiben! Dabei ist sie so wissbegierig und aufmerksam. Was sie einmal gehört oder gesehen hat, merkt sie sich für immer. Täglich nehmen wir uns mehrere Stunden Zeit für den Unterricht, obwohl sie doch den großen Haushalt führen muss und sich außerdem rührend um ihren kleinen Liebling kümmert, Camillo, ihren Sohn, einen allerliebsten Lockenkopf mit schwarzen Knopfaugen.
Pamphili, meinen Kerkermeister, bekomme ich nur bei Tisch zu Gesicht, und ich müsste lügen, wollte ich diesen Umstand bedauern. Alles, was er will, ist ein unterwürfiges Weib an seiner Seite. Wenn er den Mund aufmacht, dann nur, um mit säuerlicher Miene über uns Frauen zu klagen: dass wir es an der gebotenen Demut mangeln ließen und uns in Dinge einmischen wollten, von denen wir nichts verstünden, statt unseren natürlichen Pflichten nachzukommen. Als würde Donna Olimpia je etwas anderes tun!
Mindestens einmal am Tag bekommt Olimpia Besuch von ihrem Schwager, einem richtigen Monsignore, der einem Kloster unweit Roms vorsteht. Das ist ein so hässlicher Mensch, wie ich noch keinen zweiten gesehen habe, ein wahres Spottgesicht, von Pockennarben entstellt, doch scheint er ein gutes Herz zu haben. Während sein Bruder, der hochmütige Principe, sich nie mit Olimpia bespricht, hält der Abt so große Stücke auf sie, dass er keine Entscheidung trifft, ohne sich zuvor mit ihr zu beraten; ja, er verlässt nicht eher das Haus, als bis sie ihm ihren Zuspruch erteilt. Er ist der eigentliche Grund für Donna Olimpias Eifer, das Lesen und Schreiben zu erlernen (natürlich hinter dem Rücken ihres Mannes), wird er doch in diesen Tagen vom Papst als Nuntius nach Spanien entsandt. Sie wollen korrespondieren. Und da Olimpia nichts so sehr am Herzen liegt wie das Wohl der Familie Pamphili, nimmt sie die Mühen des Lernens ohne zu murren auf sich.
Doch jetzt muss ich schließen. Gerade klopft es an der Tür – das wird meine Freundin sein. Donna Olimpia veranstaltet heute zum Abschied ihres Schwagers ein Fest. Wenn ich die Geräusche im Haus richtig deute, treffen die ersten Gäste ein, und ich habe mich noch nicht umgezogen. Was meinen Sie, soll ich das Kleid mit dem Spitzenbesatz tragen, welches Sie mir zum achtzehnten Geburtstag schenkten? Das ist noch kein halbes Jahr her, und doch erscheint es mir wie eine Ewigkeit.
Ich grüße Sie in Liebe und Verehrung als
Ihre stets gehorsame Tochter
Clarissa Whetenham
PS. Würden Sie mir bitte auf die englische Bank hier einen kleinen Geldbetrag anweisen, damit ich mich im Palast einrichten kann? Ich möchte Donna Olimpia nicht damit behelligen. Sie spart sich ohnehin das Brot vom Munde ab, um die vielen Dienstboten zu bezahlen, die nötig sind, ein so großes Haus zu führen.
7
Clarissa hatte sich nicht getäuscht. Als sie endlich den Festsaal des Palazzo Pamphili betrat – sie hatte sich im letzten Moment doch für ein anderes Kleid entschieden, eine dunkle Robe mit Brokatbesatz, die ihrer Erscheinung zusammen mit dem zum Knoten gebändigten Haar ein würdevolleres, erwachseneres Aussehen verlieh –, waren dort bereits mehrere Dutzend Gäste versammelt.
»Höchste Zeit, dass du kommst!«, raunte Olimpia ihr im Vorübergehen zu. »Ich habe eine Überraschung für dich.«
»Eine Überraschung? Für mich? Was denn?«
»Das wirst du schon sehen«, erwiderte Olimpia mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Nur Geduld, ich muss mich jetzt um meinen Schwager kümmern.«
Was mochte ihre Cousine wohl meinen? Clarissa war ganz aufgeregt. Vielleicht würde Olimpia sie an diesem Abend ihren Gästen vorstellen, um sie in die römische Gesellschaft einzuführen? Wie gut, dass sie die dunkle Robe trug! Mit einem freudigen Kribbeln im Bauch malte sie sich aus, wie alle sich um sie scharten und sie nach ihrer Heimat befragten und nach ihren Erlebnissen auf der Reise.