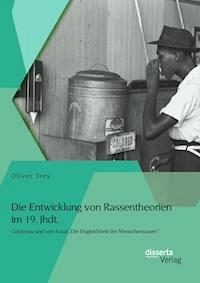Die Rassentheorie des Grafen Joseph Arthur de Gobineau. Eine Analyse des 'Essais', seiner Vorläufer und seiner Folgen E-Book
Oliver Trey
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich Geschichte Europas - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung, Note: 1,0, Universität Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Ende des 18. Jahrhunderts, spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich in Mittel-und Westeuropa ein „rassisches Denken“, durch das die verschiedenen Menschen der Erde in „Rassen“ eingeteilt wurden. Neu war dies freilich nicht, fanden sich doch schon bei Aristoteles ähnliche Elemente wie in den Rassentheorien des 19. Jahrhunderts. Das „rassische Denken“ erreichte nun aber eine neue Dimension. Dieses war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nur in einzelnen Fragmenten und Ansätzen vorhanden. Es existierte bis zu diesem Zeitpunkt keine allumfassende Theorie, keine Rassentheorie, in der die verschiedenen Vorstellungen und „Kenntnisse“ über „Rassen“ zusammengefaßt und „wissenschaftlich“ begründet waren. Solch eine Theorie wurde erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Joseph Arthur Graf von Gobineau entworfen. In dieser Theorie trat als eine Art Rassenphilosophie zum ersten Mal klar hervor, was bei Ernst Moritz Arndt und „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn noch unklar angedeutet war: Der biologische Materialismus verkündete die völlige Abhängigkeit des Menschen von seinen Erbanlagen und damit in letzter Konsequenz seine Willensunfreiheit. Joseph Arthur Graf von Gobineau wurde am 14. Juli 1816 in Ville d’Avray bei Paris geboren und verstarb am 13. Oktober 1882 in Turin. Seit 1877 lebte er zurückgezogen und widmete sich ausschließlich seiner schriftstellerischen Arbeit. Diese umfaßte neben seinem ‚Rassenwerk‘ „Essai sur l’inégalité des races hu-maines“ orientalische Studien, kulturgeschichtliche Darstellungen und eine Reihe schöngeistiger Schriften. Gobineau gehörte dem Kreis um Richard Wagner an. Mit seiner Abhandlung „Essai sur l’inégalité des races humaines“, in der er die Gleichwertigkeit der Menschen verschiedener „Rassen“ leugnete und die Überlegenheit der „arischen Rasse“ demonstrieren wollte, übte er auf Richard Wagner, Houston Stewart Chamberlain, Friedrich Nietzsche und die imperialistische Bewegung, die auch im Zusammenhang mit der Theorie des Sozialdarwinismus zu sehen ist, entscheidenden Einfluß aus. Des weiteren lieferte er mit seiner Abhandlung Argumente für den Rassenfanatismus des Nationalsozialismus. In den „Gestalten der Renaissance“ sah er den Ausnahmemenschen, den er verherrlichte, verkörpert. Mit dieser Verherrlichung nahm er Nietzsches Vorstellung vom Übermenschen vorweg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Aufbau der Arbeit
2. Verwendete Literatur und aktueller Forschungsstand
3. Problematik des Rassenbegriffs
3.1. Herleitung des Rassenbegriffs
3.2. Biologischer und soziologischer Rassenbegriff
3.3. Herausbildung der Anthropologie bis Gobineau
3.4. Entwicklung der anthropologischen Methoden bis Gobineau
3.5. Lamarckismus und Darwinismus
3.6. Bildung von Rassenhierarchien bis Gobineau
4. Rassenkonflikte, Rassismus und Rassentheorien
4.1. Einige Ausführungen zum Rassismus
4.2. Euroamerikanischer Rassismus im Kontext des arischen Mythos
4.3. Rassenkonflikte – In Wahrheit nur Gesellschaftskonflikte?
4.4. Funktionen von Rassentheorien
5. Historische Betrachtung der Entwicklung bis Gobineau
5.1. Allgemeine Vorbemerkungen
5.2. Geschichte des Rassismus bis Gobineau
5.3. Entwicklung der Rassenkonzepte bis Gobineau
5.4. Entwicklung der Rassentheorien bis Gobineau
6. Zusammenfassung
7. Die Rassentheorie Gobineaus
7.1. Allgemeines und Aufbau des „Essais“
7.2. Ausführungen Gobineaus zu den „Hauptrassen“
7.3. Ausführungen Gobineaus zur Rassenvermischung
7.4. Ausführungen Gobineaus zur Degeneration
7.5. Zu den positiven Aspekten der Rassenvermischung
7.6. Ausführungen zu der Ungleichheit der „Menschenrassen“
7.7. Ausführungen Gobineaus zu den verschiedenen „Rassen“
7.8. Zur Rassenvermischung und zum Niedergang der Zivilisationen
8. Wissenschaftlichkeit, Fatalismus und Pessimismus des „Essais“
9. Wirkung des „Essais“ und seine Beurteilung in der Literatur
10. Schlußbetrachtung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Einleitung
Seit Ende des 18. Jahrhunderts, spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich in Mittel- und Westeuropa ein „rassisches Denken“, durch das die verschiedenen Menschen der Erde in „Rassen“ eingeteilt wurden. Neu war dies freilich nicht, fanden sich doch schon bei Aristoteles ähnliche Elemente wie in den Rassentheorien des 19. Jahrhunderts.[1] Das „rassische Denken“ erreichte nun aber eine neue Dimension.
Dieses war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nur in einzelnen Fragmenten und Ansätzen vorhanden. Es existierte bis zu diesem Zeitpunkt keine allumfassende Theorie, keine Rassentheorie, in der die verschiedenen Vorstellungen und „Kenntnisse“ über „Rassen“ zusammengefaßt und „wissenschaftlich“ begründet waren. Solch eine Theorie wurde erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Joseph Arthur Graf von Gobineau entworfen.
In dieser Theorie trat als eine Art Rassenphilosophie zum ersten Mal klar hervor, was bei Ernst Moritz Arndt und „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn noch unklar angedeutet war: Der biologische Materialismus verkündete die völlige Abhängigkeit des Menschen von seinen Erbanlagen und damit in letzter Konsequenz seine Willensunfreiheit.[2]
Joseph Arthur Graf von Gobineau[3] wurde am 14. Juli 1816 in Ville d’Avray bei Paris geboren und verstarb am 13. Oktober 1882 in Turin. Gobineau wurde in Frankreich und in der Schweiz erzogen. Er diente der zweiten und dritten Republik sowie dem zweiten Kaiserreich als Diplomat; daneben widmete er sich der Schriftstellerei. 1849 wurde er „Chef de Cabinet“ unter Tocqueville während dessen kurzer Amtszeit als Außenminister. 1851 wurde er Gesandtschaftssekretär in Bern und bekleidete später diplomatische Posten in Hannover, Frankfurt, Teheran, Athen, Rio de Janeiro und Stockholm. Seit 1877 lebte er zurückgezogen und widmete sich ausschließlich seiner schriftstellerischen Arbeit. Diese umfaßte neben seinem ‚Rassenwerk‘ „Essai sur l’inégalité des races humaines“[4] orientalische Studien, kulturgeschichtliche Darstellungen und eine Reihe schöngeistiger Schriften.[5]
Gobineau gehörte dem Kreis um Richard Wagner an. Mit seiner Abhandlung „Essai sur l’inégalité des races humaines“, in der er die Gleichwertigkeit der Menschen verschiedener „Rassen“ leugnete und die Überlegenheit der „arischen Rasse“ demonstrieren wollte, übte er auf Richard Wagner, Houston Stewart Chamberlain, Friedrich Nietzsche und die imperialistische Bewegung, die auch im Zusammenhang mit der Theorie des Sozialdarwinismus[6] zu sehen ist, entscheidenden Einfluß aus. Des weiteren lieferte er mit seiner Abhandlung Argumente für den Rassenfanatismus des Nationalsozialismus. In den „Gestalten der Renaissance“ sah er den Ausnahmemenschen, den er verherrlichte, verkörpert. Mit dieser Verherrlichung nahm er Nietzsches Vorstellung vom Übermenschen[7] vorweg.
1. Aufbau der Arbeit
„Die Ungleichheit der Menschenrassen“, ein Werk, das zunächst ohne große Resonanz blieb, gilt als das Hauptwerk Gobineaus und steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Bevor jedoch auf die Rassentheorie Gobineaus eingegangen wird, wird im Vorfeld untersucht, was unter „Rasse“ – auch aus heutiger Sicht – zu verstehen ist. Es geht hierbei vor allem um die Problematik des biologischen und des soziologischen Rassenbegriffs sowie dessen Wandel.
Das 19. Jahrhundert war auch eine Epoche des Übergangs. Hierbei erfuhren die Wissenschaften eine ungeahnte Steigerung. Sie wurden getragen vom Bewußtsein der „Berechenbarkeit“ aller Dinge (Rationalismus) und zielten auf eine reine und exakte Feststellung und Erforschung von Tatsachen (Positivismus).[8] Somit hinterließ auch der Positivismus im Denken Gobineaus seine Spuren.
Da darüber hinaus neben dem „Essai“ von Gobineau oder allgemein neben den historischen Rassentheorien die positivistische Anthropologie sowie die verschiedenen biologischen Theorien über Vererbung, zusammengefaßt in den beiden Hauptströmungen Lamarckismus und Darwinismus, sowie ihre die menschliche Gesellschaft betreffenden Ausdeutungen als ideen- oder wissenschaftsgeschichtliche Wurzeln der späteren Rassentheorien gelten, werden an dieser Stelle auch einige Ausführungen zur positivistischen Anthropologie, zur Entwicklung der anthropologischen Methoden sowie zum Lamarckismus und Darwinismus[9] vorgenommen.
Damit soll gewährleistet werden, daß die damaligen wissenschaftlichen Konzeptionen der Anthropologie, Biologie und Soziologie/Sozialwissenschaft in bezug auf „Rasse“, „Abstammung“ und „menschliche Entwicklung“ zumindest in groben Zügen angerissen und nähergebracht werden. Es wird damit aufgezeigt, welchen Stand sie bis dahin in diesem Bereich erlangten.
In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Darstellung der Gefahren und Auswirkungen, die sich durch die Einteilung der Menschen in „Rassen“, „wissenschaftlich“ untermauert durch die neue (naturwissenschaftliche) Anthropologie des 18. und 19. Jahrhunderts, ergaben.
Darüber hinaus wird auf das Problemfeld von Rassismus und Rassentheorien eingegangen. Ausgehend von einigen allgemeinen Ausführungen über Rassismus wird dann zum euroamerikanischen Rassismus übergegangen und zu dessen Verbindungen mit dem Arier-Mythos. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob sich Rassenkonflikte in Wahrheit nicht doch nur als Gesellschaftskonflikte erweisen. Dabei werden auch die Hintergründe und Intentionen für die Erarbeitung und Entstehung von Rassentheorien benannt.
Da es sich zeigen wird, daß Gobineau durchaus Vorläufer und Wegbereiter hatte, er also lediglich jene Gedanken verdichtete, die in Werken anderer Autoren kursierten, werden im folgenden diese Vorläufer dargestellt.
So wird zuerst auf die Vorgeschichte des Aufbaus eines rassistischen Weltbildes und damit auf die Entwicklung rassischer Vorstellungen eingegangen. Hierbei soll bis auf Aristoteles zurückgegangen werden, um zu verdeutlichen, daß sich das „Denken“ in rassischen Kategorien keineswegs erst im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte. Es wird sich zeigen, daß es in der langen Geschichte dieser Entwicklung Veränderungen im Erklärungsmuster gab, um Unterschiede zwischen Menschen zu begründen. Begründete Aristoteles die Rangunterschiede zwischen den Menschen letztlich nicht biologisch, sondern kulturell, so verkündete die neue (naturwissenschaftliche) Anthropologie des 18. und 19. Jahrhunderts, daß solche Unterschiede vor allem biologisch zu erklären seien.
Nach dieser näheren Betrachtung der Geschichte des Rassismus wird dann die Entwicklung der verschiedenen Rassenkonzepte aufgezeigt und die Geschichte der Rasentheorien dargestellt, bevor in einem kleinen Zwischenresümee nochmals jene Konzepte, Ansätze und Theorien zusammengefaßt aufgezeigt werden, die sich bis zu Gobineau finden lassen.
Vor diesem Hintergrund erfolgt die Darstellung der Rassentheorie Gobineaus. Dabei werden die wesentlichsten Thesen Gobineaus sowie die Erklärungsmuster für seine Annahmen und Aussagen in seinem „Essai“ herausgearbeitet. In Anbetracht des Umfangs des Werkes wird die Analyse auf die wesentlichen Kernaussagen Gobineaus beschränkt bleiben. Hierbei werden auch mehrere Auszüge aus seinem Werk „Die Ungleichheit der Menschenrassen“ wiedergegeben, damit man sich einen Eindruck darüber verschaffen kann, wie Gobineau argumentierte und seine Theorie begründete. Dies soll auch einen Einblick in das „Gedankengut“ dieser Zeit ermöglichen.
Im folgenden wird der Frage nach der Wissenschaftlichkeit des „Essais“ nachgegangen sowie dessen fatalistischer und pessimistischer Charakter herausgearbeitet. Im vorletzten Kapitel dieser Arbeit werden dann die Auswirkungen dieses frühen Werkes einer Rassentheorie beleuchtet. Hierbei wird auch der Einfluß Gobineaus auf Richard Wagner, Houston Stewart Chamberlain, den „Bayreuther Kreis“ sowie auf die Rassenideologie des Dritten Reiches untersucht. Darüber hinaus wird untersucht, was Gobineau und sein „Essai“ bewirkt und verändert haben. In diesem Zusammenhang werden dann verschiedene Analysen Gobineaus aus der Literatur angeführt, die vor allem auch den Stellenwert Gobineaus im Bereich der Rassentheorie in den Blickpunkt rücken.
Dabei wird jedoch zunächst zu thematisieren sein, ob er überhaupt als Rassentheoretiker gelten kann. Denn woher hatte er sein Wissen? Woher hatte er die Einteilung in Arier und Semiten, die Einstufung (mit Rangordnung) in schwarze „Rasse“, gelbe „Rasse“ und weiße „Rasse“? Außerdem wird an dieser Stelle beleuchtet, ob man Gobineau als (Rasse-) Antisemiten bezeichnen darf, ob man mit dieser Einschätzung seinem Wirken, seinen Zielsetzungen sowie seiner Selbsteinschätzung überhaupt gerecht wird.
In der Schlußbetrachtung der Arbeit werden die wesentlichsten Aspekte dieser Arbeit zusammengefaßt und ein Resümee über das Wirken Gobineaus und die Bedeutung seines „Essais“ gezogen. Damit wird in der Schlußbetrachtung der Stellenwert Gobineaus für die Rassentheorien und -theoretiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, für den (Rasse-) Antisemitismus sowie für den Nationalsozialismus und dessen Ideologie zusammenfassend dargestellt.
Anzumerken bleibt noch, daß aufgrund der ebenso ambivalenten wie problematischen Anwendung des Begriffs „Rasse“ auf Menschen, „Rasse“ in Anführungszeichen erscheint und mithin nur eingeschränkt und relativiert gilt.[10]
2. Verwendete Literatur und aktueller Forschungsstand
Durch die in den letzten Jahren neu entfachte Rassismusdebatte erschien zu diesem Themenkomplex eine Vielzahl neuerer Literatur, die Probleme wie „Rasse“, Rassismus, Rassenkonflikte oder Rassentheorien aufgriff, sei es aus geschichtlicher, sozialwissenschaftlicher oder biologisch-humangenetischer Sicht.
Als grundlegende Literatur für den ersten Teil der hier vorliegenden Arbeit, der sich mit diesen oben genannten Punkten auseinandersetzt, dienen dabei einige Autoren, deren Werke das Thema „Rassismus“ umfassend behandeln. Dementsprechend häufig wird auf diese Autoren immer wieder zurückgegriffen.[11]
Das Werk „Verschieden und doch gleich“ von Luca und Francesco Cavalli-Sforza behandelt das Thema „Rassismus“ aus humanbiologischer, genetischer und evolutionsgeschichtlicher Sicht und legt auf diese Weise die Absurdität von Rassismus dar. Eckhard J. Dittrich greift den Rassismus in seinem Buch „Das Weltbild des Rassismus“ vor allem aus soziologischer Perspektive auf. Er betrachtet einerseits die „Rasse“ als biologisches und als sozialwissenschaftliches Problem und beschreibt andererseits die Entwicklung rassischer Vorstellungen im gesellschaftstheoretischen Denken seit Aristoteles und das Weltbild des wissenschaftlichen Rassismus. Dabei stellt er die These auf, daß gerade das westlich-abendländische Denken systematische Begründungen für soziale Ungleichheit und damit für eine weltbildliche Fundierung des Rassismus geliefert hat.
Immanuel Geiss liefert mit seiner „Geschichte des Rassismus“ dagegen ein Werk, welches das Phänomen des Rassismus aus der historischen Perspektive heraus beleuchtet. Er unterscheidet dabei zwei Hauptformen – den antijüdischen/antisemitischen und den antinegriden Rassismus – die sich zwar parallel, aber weitgehend unabhängig voneinander entwickelt hätten. Bei seiner Rassismusbetrachtung spannt er dabei den Bogen von der weiteren Vorgeschichte des Rassismus (1500 v. Chr.-1492 n. Chr.) über die engere Vorgeschichte des Rassismus (1492-1775), die Formierung des Rassismus (1775-1914), den Rassismus der Zwischenkriegszeit und der Zuspitzung des Rassismus in Deutschland während des Dritten Reiches bis hin zum Rassismus der Neuzeit.
Patrick von zur Mühlens Werk „Rassenideologien“ liefert eine umfassende Darstellung der Geschichte und Hintergründe von Rassenideologien und Rassentheorien. Von zur Mühlen kommt es in dieser verschiedene Länder vergleichenden Studie nicht darauf an, eine bestimmte Ideologie in einem begrenzten Zeitraum zu untersuchen, sondern eine bestimmte ideologische Thematik und deren Durchführung in einzelnen historischen Etappen, beginnend mit der Restaurationsepoche und endend mit der faschistischen Bewegung und dem Zweiten Weltkrieg.
Weitere Autoren, die an dieser Stelle zu nennen wären, sind Léon Poliakov, Christian Delacampagne und Patrick Girard mit ihrer Abhandlung „Über den Rassismus“, die die Anatomie und Geschichte des Rassenwahns beschreiben und darüber hinaus Deutungs- und Erklärungsversuche dieses Rassenwahns vornehmen, sowie Léon Poliakov mit seinem Buch „Der arische Mythos“, welches die Quellen von Rassismus und Nationalismus untersucht. Diese kulturgeschichtliche Betrachtung geht den Ursprungsmythen zentraler europäischer Nationen nach, um die mythischen Gründe des modernen Nationalverständnisses in Europa und des europäischen Rassismus offenzulegen.
Findet sich zu „Rassismus“ aufgrund des neu erwachten Interesses an diesem Thema sehr viel Literatur und ist hierbei zum einen die Forschungsdiskussion über die Ursachen von Rassismus sowie zum anderen dessen geschichtliche Aufarbeitung schon seit längerem im Gange, so wurde Gobineau und seinem Wirken in letzter Zeit dagegen eher weniger Interesse entgegengebracht.
Nennenswert als neuere Literatur über Gobineau sind hierbei vor allem die Studien von E. Y. Young „Gobineau und der Rassismus“ sowie das englischsprachige Werk vom Michael Denis Biddiss „Father of Racist Ideology“. Young, der Gobineau in seiner Arbeit geistesgeschichtlich deutet, versucht die anthropologisch-rassenbiologische Geschichtsauffassung und ihre Stellung im Rahmen der geschichtsphilosophischen Systeme abzugrenzen, um sodann die verschiedenen Strömungen aufzuzeigen, die zu Gobineau hinführen und auf denen er aufbaut. Schließlich untersucht Young die Wirkungen der Gobineauschen Lehre in Frankreich und Deutschland. Biddiss beschäftigt sich vor allem mit den gesellschaftlichen und politischen Ansichten Gobineaus. Weitere Monographien über Gobineau sind in neuerer Zeit nicht erschienen.
Neben diesen Einzelwerken über Gobineau lassen sich jedoch bei genauerer Sichtung der Literatur weitere Analysen Gobineaus und seiner Bedeutung finden. Diese Ausführungen über Gobineau erfolgen zumeist im Rahmen von Darstellungen der Geschichte der Rassentheorien oder der Vorläufer des modernen Rassismus in Büchern, die sich in irgendeiner Weise mit „Rasse, Rassismus oder Rassentheorien“ beschäftigen.
Nennenswert sind hierbei zunächst die Analysen im Werk von Detlev Claussen „Was heißt Rassismus“ sowie in der Abhandlung von Annegret Kiefer „Das Problem einer jüdischen Rasse“. Dabei untersucht Kiefer das Problem einer jüdischen „Rasse“ im Zeitraum von 1870 bis 1930 in der traditionellen Anthropologie, bevor sie auf den biologischen Antisemitismus sowie auf das antisemitische Denken in der Anthropologie und der Eugenik eingeht und damit auf den Prozeß der wissenschaftlich sanktionierten Unterdrückung der Juden.
Weitere Analysen finden sich in der strukturellen Untersuchung von Nicoline Hortzitz „Früh-Antisemitismus in Deutschland“ zu Wortschatz, Text und Argumentation in antijüdischen Texten, die zwischen 1789 und 1871/72 erschienen sind sowie in dem Buch von Georg L. Mosse „Die Geschichte des Rassismus in Europa“, welches versucht, die Geschichte des Rassismus in den Zusammenhang mit der europäischen Geschichte zu stellen. In diesem Buch stellt Mosse die These auf, daß Rassismus keine Seitenerscheinung, sondern ein grundlegendes Element der europäischen Kulturentwicklung gewesen ist. Der moderne Rassismus würde denselben Quellen entspringen, die auch die Grundströmungen moderner europäischer Kultur gespeist haben.
Darüber hinaus sind die Analysen in den schon erwähnten Werken von Patrick von zur Mühlen „Rassenideologien“ und Léon Poliakov/Christian Delacampagne/Patrick Girard „Über den Rassismus“ zu beachten.
Über die Gründe hierfür, daß es keine neueren Monographien über Gobineau gibt, kann nur spekuliert werden. Zum einen könnte es daran liegen, daß man bei der Suche nach den Vorläufern des modernen Rassismus und der späteren Rassenideologie des Dritten Reiches eher den Einfluß Chamberlains und Wagners als den Gobineaus untersucht hat. Zum anderen könnte es aber auch daran liegen, daß, ohne etwas vorwegzunehmen, sich die heutigen Autoren über Gobineau und seine Bedeutung im großen und ganzen einig sind. Gerade deswegen erscheint es aber lohnenswert, sich mit Gobineau auseinanderzusetzen.
Neben der bisher aufgeführten Literatur wird weiterhin die im Literaturverzeichnis angegebene Literatur herangezogen. Der im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende „Essai“ liegt dabei als deutsche Übersetzung von R. Kempf aus dem Jahr 1935 vor.
3. Problematik des Rassenbegriffs[12]
3.1. Herleitung des Rassenbegriffs
Das Wort „Rasse“ existierte schon lange in der Umgangssprache, bevor der erste Versuch unternommen wurde, das Wort wissenschaftlich zu definieren. Aus diesem Grund hatte die Unschärfe des Rassenbegriffs Tradition. Heute ist man der Ansicht, daß sich das Wort „Rasse“ etymologisch herleiten läßt.[13]
Es geht auf entsprechende Formen in romanischen Sprachen seit dem 13. Jahrhundert zurück. Etymologisch betrachtet, stammt der Rassenbegriff vom lateinischen ‚ratio‘, vermittelt über das italienische Wort ‚razza‘[14], was auch soviel wie ‚Sorte‘ oder ‚Art‘ bedeutet. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts existierte ‚race‘ im Französischen, von wo aus es später auch ins Englische und Deutsche mit gleicher Schreibweise gelangte. Die Rezeption des französischen Begriffs in Deutschland begann dabei im 18. Jahrhundert.[15] Doch scheint es so, daß er sich erst seit Kant wirklich in die deutsche Sprache eingebürgert hat.
Indessen findet man in früheren französischen Wörterbüchern eine ganz andere Etymologie, verbunden mit einem anderen Inhalt, einer anderen Bedeutung des Wortes. Der „Thrésor de la langue française“ von François Tant aus dem Jahr 1606 leitet ‚race‘ vom lateinischen ‚radix‘ her:
„Race vient de radix, racine, et fait allusion à l’extraction d’un homme, d’un chien, d’un cheval; on les dit de bonne ou de mauvaise race.“[16]
Und im „Dictionnaire universel“ von Furetière aus dem Jahr 1727 heißt es:
„Race: lignée, tous ceux qui viennent d’une même famille; génération continuée de père en fils; se dit tant des ascendants que des descendants; vient de radix, racine, pour indiquer la généalogie.“[17]
Damit beinhaltete das Wort „Rasse“ von Anfang an zwei verschiedene Bedeutungen. Man konnte das Wort einmal verwenden, um zu klassifizieren. In diesem Zusammenhang bezeichnete man mit „Rasse“ eine Sorte oder Art. Andererseits konnte man dieses Wort auch verwenden, um zu genealogisieren. Verwandte man das Wort „Rasse“ in diesem Kontext, so konnte man es gleichsetzen mit Abstammung, Herkunft oder Wurzel.
In bezug auf den Menschen schien der Begriff der „Rasse“ zunächst nur in der zweiten Bedeutung anwendbar gewesen zu sein, also im Sinne von Abstammung, Stamm, Familie, Geschlecht. Verstand man „Rasse“ in diesem Sinne, konnte man den Begriff auch mit Werturteilen verbinden. Dabei wurde der Begriff zu einem wesentlichen Bestandteil des Adels, und zwar sowohl der einzelnen adeligen Familien als auch des Adels als Stand selbst. Die Qualität der Zugehörigkeit zu einer guten oder edlen „Rasse“ folgte dabei einem maskulinen, patriarchalischen Prinzip, da sich diese Qualität, zusammen mit dem Namen der Familie, vom Vater auf den Sohn vererbte.
Für die historischen Rassentheorien war, wie man später noch sehen wird, dieser genealogische Aspekt des Wortes konstitutiv. Für die Herausbildung der Anthropologie spielte jedoch der erste Aspekt, der klassifikatorische, die Hauptrolle. Der Arzt und Reisende François Bernier (1620-1688) war wohl der erste Autor, der den Rassenbegriff in diesem Sinne auf den Menschen anwandte. So erschien 1684 im Journal des savants seine „Nouvelle division de la terre, par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent“. Bernier unterschied vier „Rassen“, nämlich die Europäer, die Afrikaner, die Asiaten und die Lappländer. Seine Rasseneinteilung sollte Grundlage einer neuen geographischen Einteilung der Erde sein.[18]
Eine noch weiter über die romanischen Anfänge zurückgehende Etymologie ist umstritten, so daß nur Hypothesen möglich sind. Der realhistorische Zusammenhang legt die Ableitung aus dem arabischen Wort ‚Ras‘ nahe – Kopf, Haupt, (Ober-) Haupt eines Clans oder Stammes, übertragen auch Abstammung. Die älteste bekannte europäische Wurzel des Wortes „Rasse“ im Spanien der Reconquista (1064-1492) ‚raza‘ würde sich damit zwanglos als Hispanisierung des arabischen ‚Ras‘ erweisen und das vielfältige Spektrum seiner Bedeutungen erklären, nämlich Abstammung, zunächst meist vornehmen, adligen Geschlechts, auch Dynastie, Königshaus. Im weiteren Sinn stand ‚raza‘/‚race‘ als Synonym für Generation innerhalb einer adeligen Familie zum Nachweis adeliger Abstammung.
3.2. Biologischer und soziologischer Rassenbegriff
In vielen antisemitischen Reden oder Druckwerken wird Bezug genommen auf die Begriffe „Rasse“[19] und Kultur, die so unbestimmt und allumfassend klingen. Ohne auf alle bisher vorgelegten Definitionen eingehen zu können, sieht die Soziologie die Kultur als ein komplexes Ganzes an, in dem alles enthalten ist, was Menschen denken, tun, fühlen oder besitzen. Nach Silbermann[20] lassen sich deshalb heraufbeschworene Unterschiede im Niveau der Fertigkeiten verschiedener Gruppen nur kulturell und nicht biologisch in der Form von Rassenunterschieden erklären.
Die „Rasse“ ist im Vergleich dazu (in bezug auf die biologische Sichtweise zur Rassenfrage) eine Gruppe von Menschen, denen gewisse vererbte physische Charakteristika zu eigen sind, die dazu dienen können, sie von anderen Gruppen zu unterscheiden. Dabei dürfen Kultur und „Rasse“ nicht verwechselt werden. Wenn nämlich im Begriff Kultur ausschließlich Bestrebungen nach Veredelung, Verfeinerung und Formung der Persönlichkeit unter Bändigung und Sublimierung der menschlichen Triebnatur gesehen werden, dann ist es ein nächster Schritt, fälschlicherweise zu unterstellen, daß sich Rassenunterschiede im Typ der Kultur, in nationalen Anschauungsweisen und anderen Eigenschaften des sozialen Verhaltens widerspiegeln.
Es ist zwar richtig, daß Bevölkerungsgruppen in gewissen Graden Unterschiede bezüglich physischer Charakteristika aufweisen und auch ihre kulturellen Praktiken offensichtlich verschieden sind – aber der Beweis, daß eine Kultur von den angeborenen Qualitäten einer menschlichen „Rasse“ abhängig ist, konnte bisher nicht erbracht werden. Denn wenn es wirklich so wäre, würde es in der Welt nicht so viele unterschiedliche Gruppen geben, die sich im wesentlichen der gleichen Kultur erfreuen. Andererseits gäbe es dann auch nicht in verschiedenen geographischen Teilen der Welt Mitglieder der gleichen „Rasse“, die gänzlich unterschiedliche kulturelle Muster aufweisen.
Dabei stellt sich die Frage, ob wir in Anbetracht heutiger Erkenntnisse von Anthropologen, Biologen und Humangenetikern überhaupt noch von „Rassen“ im biologischen Sinne sprechen sollten (dürfen) oder ob es nicht richtiger ist, den Rassenbegriff nur in soziologischer Sichtweise zu benutzen. Wippermann[21] kommt in Anlehnung an die Erkenntnisse heutiger Anthropologen und Humangenetiker zu dem Schluß, daß keine verschiedenen „Menschenrassen“ existieren. So schreiben auch Cavalli-Sforza:
„Tatsächlich ist bei der Gattung Mensch eine Anwendung des Begriffs ‚Rasse‘ völlig unsinnig.“[22]
Grund hierfür sei, so Cavalli-Sforza, daß alle Menschen in genetischer Hinsicht so unterschiedlich und doch gleichzeitig so ähnlich seien.[23]
Wenn wir heute also von „Rassen“ sprechen, meinen wir vor allem den Rassenbegriff in seiner soziologischen Ausdeutung, da es nach heutiger Erkenntnis keine verschiedenen biologischen „Menschenrassen“ gibt und es somit falsch ist, den Rassenbegriff in seiner biologistischen Bedeutung zu gebrauchen.[24]
In diesem Falle bedeutet der Ausdruck „Rasse“ eine Gruppe von Menschen, denen man einen gemeinsamen Ursprung und infolgedessen gemeinsame Züge – geistige wie körperliche – zuschreibt. Hierbei tritt in der Regel das Problem auf, daß man diese Merkmale, insbesondere wenn es sich um geistige handelt, bei der „Rasse“, der man sich selbst zugehörig glaubt, als gut, bei anderen „Rassen“ aber als tadelnswert oder sogar verabscheuungswürdig einschätzt.[25]
Es geht im Grunde also darum, daß man das, was man von sich selbst oder einem anderen hält, auf seine eigene Gruppe bzw. andere Gruppen ausdehnt. Was man in Wirklichkeit auf diese Weise bezeichnet, ist eine politische oder kulturelle Gegebenheit, zum Beispiel eine Nation, die aber vom biologischen Standpunkt aus keinerlei Einheitlichkeit aufweist. So schreibt Poliakov:
„Was jedoch vom soziologischen Standpunkt aus zählt, ist der Glaube an einen gemeinsamen und besonderen Ursprung, ein Glaube, der häufig eine Haltung der Feindseligkeit oder der Verachtung in bezug auf eine andere Gruppe mit sich bringt – und eben das ist Rassismus.“[26]
Poliakov betont, daß dieser Glaube leicht aus Konflikten jeder Art entstehen könne. Als solche Konflikte führt er Rivalitäten, Kriege oder sogar Revolutionen an. So sei die französische Revolution mitunter als Aufstand des gallischen Dritten Standes gegen den fränkischen Adel gewertet worden.[27]