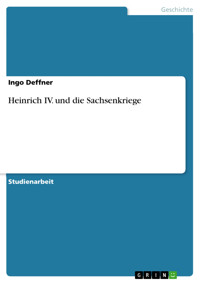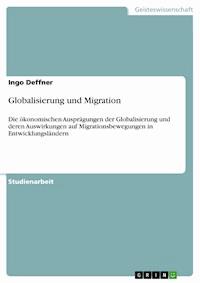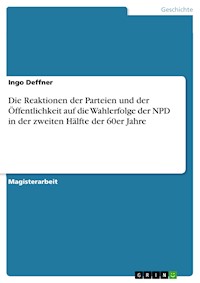
Die Reaktionen der Parteien und der Öffentlichkeit auf die Wahlerfolge der NPD in der zweiten Hälfte der 60er Jahre E-Book
Ingo Deffner
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Geschichtswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: (...) Wie reagierten sowohl die Öffentlichkeit als auch die politischen Parteien auf den Aufstieg der NPD, wie ging man mit dieser unerfreulichen neuen Herausforderung am rechten Rand v.a. im Hinblick auf strategische Abwehrmöglichkeiten um, und welche Interaktionen zwischen den politischen Protagonisten trugen neben den strukturellen Ursachen mit zum Aufstieg und v.a. zur Niederlage der NPD bei? Offensichtlich gelang es in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zumindest phasenweise nicht mehr, sowohl den rechten als auch den linken Rand des politischen Spektrums in die etablierte Parteienlandschaft zu integrieren. Da sich diese Arbeit mit der NPD als Partei des rechten Randes beschäftigt, muss daher auch nach den Ursachen des Aufstiegs und des Niedergangs der NPD gefragt werden. Dabei werden von der Forschung mit einigem Recht hauptsächlich externe Faktoren in den Blick genommen, denen nur von Dudek/Jaschke ein weiterer Aspekt hinzugefügt wird, indem sie den Einfluss der Medien und der politischen Parteien im Bundestagswahlkampf als entscheidend für die Niederlage der NPD benennen. 8 Diese These, die von den Autoren allerdings eher randständig erwähnt und kaum untermauert wird, gab den ersten Anstoß für diese Arbeit und mündete in der Frage, ob sich Belege für deren Richtigkeit finden lassen würden. Eine weitere Leitfrage lautet daher: Inwieweit waren die Auseinandersetzungen mit der NPD im Bundestagswahlkampf 1969 dafür verantwortlich, dass die NPD an der 5 %-Hürde des Wahlrechts scheiterte? Nicht zuletzt: Ergaben sich durch die Wahlerfolge der NPD auch direkte oder indirekte Einflüsse auf entscheidende Weichenstellungen in der Innenpolitik? Da diese Frage bei umfassender Beantwortung allein schon eine eigenständige Untersuchung erforderlich machen würde, wird hier allerdings eine Einschränkung gemacht, indem exemplarisch auf die Landtagswahlen des Herbstes 1966 und deren Einfluss auf die Bildung der Großen Koalition fokussiert wird. Der enge zeitliche Zusammenhang spricht dafür, dass es hier zu wechselseitigen Beeinflussungen gekommen sein muss. Im Gesamtzusammenhang der Arbeit sollen die Antworten auf diese Fragestellung Hinweise darauf liefern, ob es auch jenseits von direkter politischer Einflussnahme Interaktionen zwischen den großen Parteien und der NPD gegeben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Page 3
Einleitung
„Alle Extremitäten (sic!) der Politik haben keine Chance, in Deutschland festen Fuß zu fassen.“1
Als Bundeskanzler Ludwig Erhard nach der Bundestagswahl 1965 mit dieser Bemerkung auf etwas exzentrische Weise die allgemeine Auffassung über die Stabilität der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck brachte, hatte die NPD mit einem Stimmenanteil von 2 % nicht einmal ein Jahr nach ihrer Gründung erstmals aufhorchen lassen. Ein gutes Jahr später wurden Erhard und die politische Öffentlichkeit nicht nur der Bundesrepublik Deutschland durch den Einzug der Nationaldemokraten in die Landtage von Hessen und Bayern auf recht drastische Weise scheinbar eines „Besseren“ belehrt. Sowohl im Ausland als auch in der politischen Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland war das Echo auf diese scheinbar völlig unerwarteten Wahlerfolge gewaltig. In der Folge sollte die NPD bis zur ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl 1969 zu der „bei weitem erfolgreichsten rechtsradikalen Partei der alten Bundesrepublik“ werden.2
Wurde die von der NPD ausgehende Gefahr von den kritischen Zeitgenossen, die vor dem Hintergrund der krisenhaften Erscheinungen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Art oftmals (nicht nur) polemische Vergleiche mit der Endphase der Weimarer Republik heraufbeschworen, bei weitem überschätzt?3Immerhin schrieb Ralf Dahrendorf schon 1968, dass „ein Autoritarismus traditioneller Prägung“ in der deutschen Gesellschaft unmöglich geworden sei“4. Bei der Betrachtung des tiefen Falls der NPD in die Bedeutungslosigkeit nach der Bundestagswahl 1969, von dem die Partei sich erst in jüngster Vergangenheit wieder erholte, muss die vordergründi-
1Zit.n. Kühnl, Reinhard u.a.: Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neofaschistischen
Partei, Frankfurt a.M. 1969 (zitiert als: Kühnl 1969), S.294
2Gnad, Oliver: Die NPD, in: Tenfelde, Becker (Hrsg.): Handbücher zur Geschichte des Parlamenta-
rismus und der politischen Parteien Band 12: Statistik der Parlamente und Parteien in den westlichen
Besatzungszonen und in der BRD, Teilband IV: FDP sowie kleinere bürgerliche und rechte Parteien,
Düsseldorf 2005 (zitiert als: Gnad 2005), S. 603
3Diese Frage stellen auch Dudek, Peter/ Jaschke, Hans-Gerd: Entstehung und Entwicklung des
Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Band 1, Opladen 1984 (zitiert als Dudek/Jaschke 1984,
Band 1), S.286. Zr Frage synchroner Entwicklungen in Bonn und Weimar zwischen 1966 und 1969
vgl. v.a. Kühnl 1969, Lücke, Paul: Ist Bonn doch Weimar, Frankfurt 1968 (zitiert als Lücke 1968);
Niethammer, Lutz: Angepasster Faschismus. Politische Praxis der NPD, Frankfurt/Main 1969 (zitiert
als Niethammer 1969); Abendroth, B.W.: Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie in der Bundesre-
publik, Frankfurt 1965 (zitiert als: Abendroth 1965) und in der Frankfurter Rundschau, 8.2.1967
Die Frage nach der Vergleichbarkeit von Bonn und Weimar wurde in der Geschichte der Bundesrepu-
blik im Übrigen regelmäßig dann gestellt, wenn Rechtsextremisten in den Fokus der Aufmerksamkeit
rückten, zuletzt von Marion Dönhoff (DIE ZEIT, 20.11.1992 und Freimut Duve (TAZ. 27.11.1992),
aber auch schon von Allemann, F.R: Bonn ist nicht Weimar, Berlin 1956 (zitiert als: Allemann 1956).
4Dahrendorf, Ralf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1968 (zitiert als: Dahren-
dorf 1968), S.467
Page 4
ge Frage nach einer Gefährdung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland nach dem Vorbild der Weimarer Entwicklung sicherlich verneint werden.
Dennoch verengt diese Frage den Blickwinkel zu sehr auf eine dauerhafte politische Etablierung der Nationaldemokraten, die offensichtliche Durchsetzung von rechtsextremen Ideologien in politischen Sachfragen oder gar eine (hypothetische) „Machtergreifung“ bzw. eine Regierungsbeteiligung der Nationaldemokraten. Dabei war die NPD genauso erfolglos wie alle anderen rechtsextremen Parteien vorher oder nachher. Besonders Niethammer zeigt diesbezüglich in seiner auch heute noch maßgeblichen Untersuchung sehr eindrucksvoll, dass die Arbeit der NPD in den Parlamenten fast ausschließlich aus politischer Agitation bestand, aber ansonsten von Niveau-, Rat- und völliger politischer Wirkungslosigkeit in Sachfragen geprägt war5.
Der Aufstieg der NPD als „quasi-unvorhergesehenes und nicht eingeplantes Phänomen“ weckte schlagartig Erinnerungen an den Siegeszug des NS-Regimes bei den Zeitgenossen, Erinnerungen, die man längst erfolgreich verdrängt zu haben glaubte.6In der Öffentlichkeit wurde daher auch die Frage diskutiert, ob die NPD „nur“ eine Partei alter Nazis und der Ewiggestrigen sei oder ob sie vielmehr von Menschen gewählt wurde, die einfach „(...)von Sorge um das künftige Schicksal Deutschlands bewegt seien“, wie der Außenminister der großen Koalition, Willy Brandt, 1967 anlässlich eines Besuchs in New York erklärte.7
Allein schon die bisher angedeuteten Reaktionen auf den Aufstieg der NPD geben einen deutlichen Hinweis darauf, wie groß die Spannbreite unterschiedlicher Einschätzungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den prominenten politischen Protagonisten jener Jahre war. Daher ergeben sich die Leitfragen dieser Arbeit fast zwangsläufig:
Wie reagierten sowohl die Öffentlichkeit als auch die politischen Parteien auf den Aufstieg der NPD, wie ging man mit dieser unerfreulichen neuen Herausforderung am rechten Rand v.a. im Hinblick auf strategische Abwehrmöglichkeiten um, und
5Niethammer 1969, S.96-203. Geschweige denn, dass es die Gefahr einer Machtergreifung durch die
NPD jemals auch nur ansatzweise gegeben hätte. Solche Befürchtungen einiger Zeitgenossen müssen
vor dem Hintergrund des „Zeitgeistes“ und der Tatsache gesehen werden, dass der Niedergang der
NPD nach der Bundestagswahl 1969 so nicht vorhersehbar war und man überwiegend noch Anfang
September 1969 fest mit einem Einzug der NPD in den Bundestag rechnete.
6Dudek/Jaschke 1984, Band 1, S.318
7Brandt zitiert n. Kühnl 1969, S.7. Diese Meinungsäußerung bezeichnete Reinhard Kühnl als reprä-
sentativ für die Auffassung weiter Teile der Öffentlichkeit.
Page 5
welche Interaktionen zwischen den politischen Protagonisten trugen neben den strukturellen Ursachen mit zum Aufstieg und v.a. zur Niederlage der NPD bei? Offensichtlich gelang es in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zumindest phasenweise nicht mehr, sowohl den rechten als auch den linken Rand des politischen Spektrums in die etablierte Parteienlandschaft zu integrieren. Da sich diese Arbeit mit der NPD als Partei des rechten Randes beschäftigt, muss daher auch nach den Ursachen des Aufstiegs und des Niedergangs der NPD gefragt werden. Dabei werden von der Forschung mit einigem Recht hauptsächlich externe Faktoren in den Blick genommen, denen nur von Dudek/Jaschke ein weiterer Aspekt hinzugefügt wird, indem sie den Einfluss der Medien und der politischen Parteien im Bundestagswahlkampf als entscheidend für die Niederlage der NPD benennen.8Diese These, die von den Autoren allerdings eher randständig erwähnt und kaum untermauert wird, gab den ersten Anstoß für diese Arbeit und mündete in der Frage, ob sich Belege für deren Richtigkeit finden lassen würden. Eine weitere Leitfrage lautet daher: Inwieweit waren die Auseinandersetzungen mit der NPD im Bundestagswahlkampf 1969 dafür verantwortlich, dass die NPD an der 5 %-Hürde des Wahlrechts scheiterte?
Nicht zuletzt: Ergaben sich durch die Wahlerfolge der NPD auch direkte oder indirekte Einflüsse auf entscheidende Weichenstellungen in der Innenpolitik? Da diese Frage bei umfassender Beantwortung allein schon eine eigenständige Untersuchung erforderlich machen würde, wird hier allerdings eine Einschränkung gemacht, indem exemplarisch auf die Landtagswahlen des Herbstes 1966 und deren Einfluss auf die Bildung der Großen Koalition fokussiert wird. Der enge zeitliche Zusammenhang spricht dafür, dass es hier zu wechselseitigen Beeinflussungen gekommen sein muss. Im Gesamtzusammenhang der Arbeit sollen die Antworten auf diese Fragestellung Hinweise darauf liefern, ob es auch jenseits von direkter politischer Einflussnahme Interaktionen zwischen den großen Parteien und der NPD gegeben hat.
Zur Beantwortung der genannten Leitfragen müssen in dieser Arbeit mehrere nach-geordnete Fragestellungen erörtert werden:
8Als externe Einflüsse werden hier die wirtschaftlichen und außenpolitischen Entwicklungen jener
Jahre angesehen, die das Wahlverhalten der Bevölkerung hinsichtlich der NPD zwar nachhaltig be-stimmten, aber nicht AUFGRUND der NPD-Entwicklung von der Politik beeinflusst worden sind
bzw. von der Bundesregierung gar nicht verändert werden konnten. Diese externen Einflussfaktoren
sind von der Forschung auch nachhaltig berücksichtigt worden und werden in Kapitel I.1.3 beschrie-
ben. Zu den weiterführenden Thesen Dudek/Jaschkes im Hinblick auf die Niederlage der NPD 1969
vgl Dudek/Jaschke 1984, S. 340.
Page 6
Versuchten die Unionsparteien oder auch die FDP, die NPD„rechts zu überholen“, um so befürchtete Verluste rechtskonservativer Wählerstimmen an die Nationaldemokraten zumindest zu begrenzen und zwar unter Verkennung der von Niethammer formulierten Gefahr, dass demokratische Parteien, die mit einer faschistischen in Wettbewerb treten, Gefahr laufen sich ihr eigenes Grab zu schaufeln?9Wurden derartige Verhaltensweisen v.a. unter wahltaktischen Aspekten angewandt oder wider-stand man der Versuchung, die NPD auf diese Weise zu bekämpfen? Bestanden die antifaschistischen Reflexhandlungen auf der linken Seite des politischen Spektrums insbesondere außerparlamentarischer Kräfte (z.B. der Gewerkschaften oder verschiedener Bürgeraktionen, aber auch der Jusos und radikalen Gruppierungen innerhalb der sog. „APO“) demgegenüber aus purem Aktionismus bzw. reiner Propaganda oder standen diese in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Niederlage der NPD?
Etwas überspitzt muss in diesem Zusammenhang auch gefragt werden, ob der antifaschistische Aufschrei in weiten Teilen der Publizistik, der dem Aufstieg der NPD folgte, etwa auch ein Zeichen von demokratischer Unreife war, der es einer immerhin nicht verbotenen Partei unmöglich machte, ihr demokratisches Recht auf freie Meinungsäußerung und Werbung um Wählerstimmen in einem freien Wahlkampf auszuüben und zwar nicht, wie der damalige Bundesvorsitzende der NPD (Adolf von Thadden) meinte, unter „ bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen“ ?10
Um die genannten Leitfragen ebenso wie die nachgeordneten Fragestellungen zu beantworten, wird in dieser Arbeit folgendermaßen vorgegangen: In einem ersten Schritt sollen die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und zeitgenössischer Analysen, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten von Aufstieg und Fall der NPD beschäftigen, dargestellt werden. Am Anfang dieses Teils steht die Betrachtung sowohl der Bedeutung der Deutschen Reichspartei (DRP) für die Gesamtentwicklung der NPD, die in mancher Hinsicht als Nachfolgeorganisation der DRP bezeichnet werden kann, als auch der Gründungs- und Konsolidierungsphase der NPD selbst. Im weiteren Verlauf des ersten Kapitels werden außerdem die Wahlerfolge und -niederlagen der NPD und deren Determinanten, die Sozialstruktur und
9Niethammer 1969, S.261, der die Niederlage der NPD in seinem Buch nicht mehr verarbeiten konnte
und daher andere Voraussetzungen zur Beurteilung hatte, ebenso wie die handelnden Parteien und die
gesamte politische Öffentlichkeit auch.
10zitiert nach Dudek/Jaschke 1984, S.318
Page 7
die Mitgliederentwicklung und schließlich die ideologische Entwicklung der NPD in den Blickpunkt genommen. Dabei wird jedoch weitgehend auf die Darstellung von Details verzichtet, denn dieses Kapitel dient v.a. der Bündelung der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die NPD.
Auf dieser Basis sollen im zweiten Teil die Reaktionen der politischen Öffentlichkeit auf die Wahlerfolge der NPD bei den Landtagswahlen in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg dargestellt und insbesondere im Zusammenhang mit der Bildung der großen Koalition analysiert werden. Die Schlussphase der Regierung Erhardt wird dabei ebenso in den Blick genommen wie die eigentlichen Koalitionsverhandlungen zwischen den Bonner Parteien, die im Wesentlichen zwischen der Landtagswahl in Hessen und derjenigen in Bayern stattgefunden haben.
Am Ende dieses Kapitels steht die Analyse der Reaktionen der politischen Öffentlichkeit und der Parteien auf die Landtagswahl in Baden Württemberg. Diese stellte so etwas wie eine Testwahl im Hinblick auf die Bundestagswahl des Jahres 1969 dar, weil auch in Baden-Württemberg eine Große Koalition regierte und die Öffentlichkeit allein schon aus diesem Grund ihr besonderes Augenmerk auf das südwestliche Bundesland richtete.
Im dritten Teil schließlich wird die Bundestagswahl 1969 in den Blickpunkt der Betrachtung genommen, denn in den Reaktionen der Öffentlichkeit, den politischen und militanten Auseinandersetzungen und den Diskussionen über exekutive Maßnahmen gegenüber der NPD sollen die Gründe für die Niederlage der NPD abschließend herausgearbeitet und der Frage nach der Bedeutung dieser Auseinandersetzungen für das letztliche Scheitern der NPD nachgegangen werden.
Zum Abschluss dieser Einleitung noch einige Bemerkungen zur Literaturlage und denjenigen Quellen, die in dieser Arbeit benutzt wurden: Eine Analyse, die hinsichtlich der NPD zum größten Teil auf die Reaktionen der politischen Öffentlichkeit und der Parteien fokussiert, ist bisher weder von der historischen noch von der politikwissenschaftlichen Forschung geleistet worden, obwohl Dudek/Jaschke die Forderung danach schon 1984 erhoben haben und zu keiner rechtsextremistischen Partei der Bundesrepublik mehr Literatur existiert als zur NPD. Genannt werden muss hier neben der unüberschaubaren zeitgenössischen und
Page 8
oftmals sehr unwissenschaftlichen Literatur insbesondere die Arbeit Schmollingers, die dieser für das Parteienlexikon von Richard Stöß vornahm.11Seit 1984 sind neben der neuesten Analyse von Oliver Gnad nur noch zwei Arbeiten erschienen, die sich explizit mit der NPD in den 60er Jahren beschäftigen.12Die wenigen anderen Arbeiten, die sich seitdem überhaupt mit der Geschichte der NPD in den 60er Jahren beschäftigt haben, geben lediglich einen ereignisgeschichtlichen und i.d.R. knappen Überblick im Rahmen einer Darstellung der Geschichte des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik seit 1945 oder behandeln in geringem Maße Einzelaspekte der Parteientwicklung.13Das ist einigermaßen erstaunlich, bedenkt man, welche Aufmerksamkeit der Rechtsextremismus in der Bundesrepublik durch die gewalttätigen Exzesse insbesondere Anfang der 90er Jahre, die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in der letzten Dekade und die gerade einsetzende Diskussion um die besorgniserregende Verankerung der NPD in der Jugendkultur der neuen Bundesländer erhalten hat. In diesen Zusammenhängen wurden auf unterschiedliche Weise auch immer wieder Medieneinflüsse, das Verhalten der etablierten Parteien und die Haltung der Öffentlichkeit generell teilweise sehr kritisch hinterfragt. Die einzigen Autoren, die sich zumindest am Rande mit den Reaktionen der politischen Öffentlichkeit und der demokratischen Parteien auf die NPD-Erfolge 1966-1969 beschäftigt haben, sind Dudek/Jaschke selbst und Reinhard Kühnl.14Erstere nehmen dabei jedoch auch hinsichtlich der Bundestagswahl hauptsächlich die außerparlamentarischen Auseinandersetzungen der Gewerkschaften und der APO in den Blick und rekonstruieren zusätzlich den Verlauf der Verbotsdebatte anhand einiger
11Schmollinger, Horst W.: Die nationaldemokratische Partei Deutschlands, in: Stöss, Richard (Hrsg.):
Parteien-Handbuch: Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, Band II, Opladen 1984
(zitiert als: Schmollinger 1984). Zusammen mit den Arbeiten von Dudek/Jaschke, Kühnl und Niet-
hammer stellen diese auch heute noch die Standardwerke zum Thema „Die NPD in den 60er Jahren“
dar und wurden in weiten Teilen als Grundlage des ersten Kapitels benutzt. Zur zeitgenössischen
Literatur vgl. Gnad 2005, S.598 ff.. Auch diese wurde zu Rate gezogen, wo das zu verantworten war.
Allerdings könnte man zu diesem Thema eine Literaturarbeit unter dem Stichwort „Ideologie“ schrei-
ben.
12Das sind: Fascher, Eckhard: Modernisierter Rechtsextremismus. Ein Vergleich der Parteigrün-
dungsprozesse der NPD und der Republikaner in den 60er und 80er Jahren, Berlin 1994 (zitiert als:
Fascher 1994) sowie Hoffmann, Uwe: Die NPD. Entwicklung, Ideologie und Struktur, Frankfurt/Main
1999 (zitiert als: Hoffmann 1999)
13So z.B. zum Problem des Partienverbots in: Leggewie, Claus/ Meier, Horst: Verbot der NPD oder:
Mit rechtsradikalen leben?, Frankfurt 2002 (zitiert als Leggewie 2002) oder im Zuge einer Über-
blicksdarstellung: Backes, Uwe/ Jesse, Eckhard: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn 1993 (zitiert als Backes/Jesse 1993) Pfahl-Traugber: Armin; Rechtsextremismus,
Bonn 1993 (zitiert als Pfahl-Traugber 1993); Schubarth, Wilfried/ Stöss, Richard: Rechtsextremismus
in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Bilanz, Bonn 2000 (zitiert als Schubarth 2000) u.a
14Vgl. Dudek/Jaschke 1984, S. S.327 f. und Kühnl 1969, S. 294 ff.
Page 9
weniger Zeitungsmeldungen. Die Reaktionen der politischen Parteien und der politischen Öffentlichkeit jenseits dieser Aspekte werden jedoch gar nicht erwähnt. Reinhard Kühnl dagegen fokussiert seine Betrachtung der „NPD im politischen Kräftefeld“ insbesondere auf die Beweisführung seiner These, dass die „zögerliche Haltung der politischen Parteien gegenüber der NPD Parallelen zur Konfliktstruktur zwischen den demokratischen und extremen Parteien der Weimarer Republik erkennen“ ließe.15Dementsprechend scheint auch Kühnls Quellenauswahl in dieser Frage ein wenig von seinen ideologischen Interessen geleitet worden zu sein und erfüllt die Anforderungen an eine gewisse wissenschaftliche „Unparteilichkeit“ nur sehr bedingt. Trotzdem finden die Thesen und Argumente der genannten Arbeiten auch in dieser Analyse unter den genannten Vorbehalten Verwendung, ohne dass sie deren Rückgrat bilden könnten.
In der übrigen Literatur zur Parteienforschung oder zur Großen Koalition der 60er Jahre findet die NPD dagegen genauso geringe Aufmerksamkeit wie in den meisten Geschichtswerken zu dieser Epoche, wenn auch die Bedeutung der NPD-Erfolge an einigen Stellen durchaus zum Ausdruck kommt.16Die Gründe hierfür scheinen aber neben der anderen Fokussierung der Arbeiten zumindest hier und da auch in einer gewissen Unterschätzung der Rolle der NPD in den 60er Jahren zu liegen.
Aufgrund der geringen Beachtung, welche die Auseinandersetzung der politischen Parteien und der Öffentlichkeit mit der NPD bisher gefunden hat, musste gerade in Teil II und Teil III dieser Arbeit vorwiegend auf eigene Forschungen zurückgegriffen werden. Als Quellen wurden dabei v.a. die Pressearchive der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Friedrich-Ebert- Stiftung Bonn, sowie die Bestände des Zeitungsforschungsinstituts in Dortmund benutzt. Zusätzlich konnte auch auf andere Archivalien der genannten Stiftungen zurückgegriffen werden. Zu nennen sind hier insbesondere die Privatnachlässe von Kurt-Georg Kiesinger sowie Kai-Uwe von Hassel. Diese Magisterarbeit kann auch in Folge des zur Verfügung stehenden Raumes und unter dem Zeitaspekt nicht alle Facetten dieses Themas erschöpfend bewältigen und
15Zudem sei seine Analyse eingebettet in eine polemische Gesellschaftskritik, die deutlich die Hand-
schrift der „Neuen Linken“ aufweise, so Oliver Gnad weiter. Vgl. dazu Gnad 2005, S. 599. Dem kann
sich der Verfasser dieser Arbeit nicht verschließen.
16Als Beispiele seien hier genannt: Baring, Arnulf: Machtwechsel, Stuttgart 1983, hier: ungek. Neu-
ausgabe Berlin 1998 (zitiert als: Baring 1998); Bösch, Frank: Macht und Machtverlust: Die Geschich-
te der CDU, Stuttgart/München 2002 (zitiert als: Bösch 2002); Kleinmann, Hans-Otto: Geschichte der
CDU, Stuttgart 1993 (zitiert als Kleinmann 1993); Schönhoven, Klaus: Wendejahre, Bonn 2004 (zi-
tiert als Schönhoven 2004) u.a..
Page 10
schon gar nicht die zur Verfügung stehenden Quellen insgesamt würdigen.17Daher musste auf bestimmte Aspekte, die der Beantwortung der Leitfragen besonders dienlich sind, fokussiert werden, während andere ganz wegfallen mussten. Zu nennen sind hier insbesondere die ideologische Auseinandersetzung der APO mit der NPD und in weiten Teilen auch die militante Gegenwehr vor der Bundstagswahl 1969, die aber bei Dudek/Jaschke ausreichend gewürdigt ist.18Zudem werden die ausländischen Reaktionen auf die NPD-Erfolge nur in ihrer Wirkung auf die Innenpolitik dargestellt. Ebenso werden die Landtagswahl zwischen 1967 und 1968 nicht näher betrachtet, da sich hier keine Aspekte finden lassen, die denjenigen Reaktionen auf die Wahlen in Bayern und Hessen Neues hinzufügen könnten.
17Das kann auch nicht die Absicht dieser Arbeit sein. Sehr wohl besteht seitens des Verfassers aller-
dings die Hoffnung, dass die Ergebnisse eventuell Verwendung in weiterführenden Studien finden
könnten.
18Dudek/Jaschke 1984, S. 327ff.
Page 11
I Aufstieg und Fall der NPD in den 60er Jahren
1 Von der DRP zur NPD- Personelle und organisatorische Kontinuitäten
1.1 Die Entstehungsbedingungen der NPD
Die organisatorischen Voraussetzungen für die Gründung der NPD wurden entscheidend von ihrer wichtigsten Vorläuferorganisation geprägt, der „Deutschen Reichspartei“ (DRP).19Diese begann nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl 1961 unter Führung des späteren NPD-Spitzenfunktionärs Adolf von Thadden mit neuen Einigungsversuchen des „nationalen Lagers“, um den Trend des generellen politischen Bedeutungsverlustes rechter Parteien und der DRP im besonderen aufzuhalten.20Insbesondere die antisemitischen Schmierwellen, die Weihnachten 1959 mit der Schändung einer Synagoge in Köln durch zwei DRP- Mitglieder begannen, hatten eine Schockwelle in der Bundesrepublik ausgelöst und die Öffentlichkeit im Hinblick auf rechtsextreme und neonazistische Umtriebe sensibilisiert. Fast zwangsläufig stand die DRP im Zentrum der Beschuldigungen, wenn auch in Teilen der Union die sog. „Hintermänner-These“ von einer Verschwörung kommunistischer Kreise gegen die Bundesrepublik favorisiert und von der DRP gerne aufgenommen wurde.21In der Folge wurde der rheinland-pfälzische Landesverband am 27.1.1960 als „Nach-folgeorganisation der SRP“ verboten; eine bundesweite Ausweitung des Verbots blieb allerdings aus.
Die Führung der DRP, die von Thadden in der Rückschau mit seltenem Witz als „Fünferbande“ bezeichnete, sah in dieser Situation keine andere Möglichkeit als eine Neuauflage der altbekannten Sammlungsstrategie des rechten Lagers.22Die Bildung einer einheitlichen Bewegung sollte bis Ende der 50er Jahre insbesondere in den Konzepten der DRP nach dem Vorbild der „Harzburger Front“ am Ende der Weimarer Republik erfolgen23. Die Funktionäre der DRP hatten teilweise langjährige „Kar-
19Schmollinger1984, S. 199 ff.
20zur Geschichte der DRP, soweit diese die Gründung der NPD betraf v.a. Dudek/Jaschke 1984, Band
1 , S.181-272; vgl. Smoydzin, Werner: NPD- Geschichte und Umwelt einer Partei, Pfaffenhoffen/Ilm
1967 (zitiert als: Smoydzin 1967), S. 80-109 und Sowinski, Oliver: Die deutsche Reichspartei 1950-
1965: Organisation und Ideologie einer rechtsradikalen Partei, Frankfurt/Main 1998 (zitiert als: So-
winski 1998)
21Dudek/Jaschke 1984 Band 1, S. 267f.
22Diese Fünferbande ( Adolf von Thadden, Otto Heß, Waldemar Schütz, Bernhard von Grünberg und
Wilhelm Meinberg) kontrollierte auch die NPD in den 60er Jahren weitgehend, vgl. Dudek/Jaschke
1984 Band 1, S. 271; vgl. Schmollinger 1984, S. 1922 und Niethammer 1969, S. 262
23Sowinski 1998, S.345, wenngleich diese Konzeption eher einem „Ideal“ entsprach als einer tatsäch-
lich realistischen politischen Strategie.
Page 12
rieren“ in anderen rechtsextremen Splitterparteien der Nachkriegszeit hinter sich und dementsprechend viele erfolglose Sammlungsversuche.24Allerdings waren die Bedingungen für einen erfolgreichen Sammlungsversuch zu Beginn der 60er Jahre unter mehreren Gesichtspunkten relativ günstig: Paradoxerweise hatten gerade die Wahlniederlagen der DRP und der kleineren Bürgerblockparteien bei der Bundestagswahl 1961 und die endgültige Dominanz der CDU/CDSU im bürgerlichen Lager den Boden dafür bereitet.25Die DRP nahm nun, wenn auch auf niedrigem Niveau, die dominierende Rolle im rechtsextremen bzw. nationalistischen Lager ein. Außerdem sprachen auch die politischen Rahmenbedingungen für die Möglichkeit eines Aufschwungs rechtsextremer Parteien, der nur durch die Bündelung aller Kräfte erreicht werden konnte.
Erfolgreich konnte ein solcher Versuch allerdings nur sein, wenn dem ersten Schritt (Zusammenschluss möglichst vieler rechtsextremer Kleingruppen) die Erschließung neuer Wählergruppen auf dem rechtskonservativen Flügel v.a. der Unionsparteien gelang.