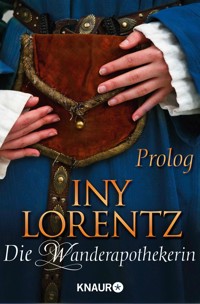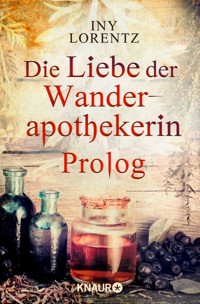9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein blutiger Feldzug, zwei mutige Schwestern und ein erbarmungsloser Verfolger – ein fesselnder historischer Roman von Bestseller-Autorenduo Iny Lorentz Im Jahr 1343 erobert König Pere IV. von Katalonien-Aragón in einem brutalen Feldzug das Königreich Mallorca. Die Angreifer stürmen auch die Burg des Grafen von Marranx, der einst seinem Todfeind die Braut geraubt hatte. Nun sollen die Töchter des Grafen, Miranda und Soledad, für jene Schmach bezahlen. Um Haaresbreite gelingt den Mädchen die Flucht, doch ihr Verfolger, Domenèch Decluér, ist besessen von dem Wunsch nach Rache. Als er die Schwestern schließlich in einem Fischerdorf aufspürt, wo sie sich als Mägde verkleidet verstecken, scheint ihr Schicksal besiegelt... Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Mittelalters voller Spannung, Intrigen und Leidenschaft. »Die Rebellinnen« ist eine überarbeitete Neuausgabe von »Die Rebellinnen von Mallorca«, das 2008 unter dem Pseudonym Eric Maron erschienen ist. Die Meister des historischen Romans zeichnen hier einen farbenprächtigen historischen Roman vor der Kulisse des mittelalterlichen Mallorcas. Entdecken Sie auch die anderen Mittelalter-Romane von Iny Lorentz: - Die Saga von Vinland (Norwegen und Island) - Die Rose von Asturien (Spanien) - Die Löwin (Italien) - Die Wanderhuren-Reihe (Deutschland)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Rebellinnen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein farbenprächtiger historischer Roman vor der Kulisse des mittelalterlichen Mallorcas!
Mallorca im Jahre 1343: Das Inselreich wird in einem blutigen Feldzug durch König Pere IV. von Katalonien-Aragón erobert. Auch die Burg des Grafen von Marranx fällt dem übermächtigen Gegner in die Hände, und sein Erzfeind nützt die Gelegenheit zur Rache: Weil der Graf ihm einst die Braut raubte, sollen jetzt dessen Töchter für die Schmach von damals bezahlen. Nur um Haaresbreite gelingt es Miranda und Soledad zu entkommen, doch ihr Verfolger ist wie besessen vom Gedanken an Vergeltung. Als er die beiden schönen jungen Frauen schließlich aufspürt, scheint ihr Schicksal besiegelt …
Bei »Die Rebellinnen« des Bestseller-Autoren-Duos Iny Lorentz handelt es sich um eine überarbeitete Neuausgabe von »Die Rebellinnen von Mallorca«, die 2008 unter dem Pseudonym »Eric Maron« erschienen sind.
Inhaltsübersicht
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Zweiter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Dritter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Vierter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Fünfter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Sechster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Siebter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Nachbemerkung
Personenliste
Historischer Überblick
Erster Teil
Die Töchter des Grafen
I.
An einem Frühsommertag im Jahre des Herrn 1343 stürmte der Turmwächter in den Saal, in dem sich die restlichen Bewohner der Burg versammelt hatten, und blieb mit bleichem Gesicht vor dem Grafen von Marranx stehen. »Herr, der Feind!«
Guifré Espin schob sich in eine Fensternische und stieß die hölzernen Läden auf. Ein kalter Windstoß fegte herein und brachte die Öllampe auf dem Tisch zum Erlöschen. Es war wie ein böses Omen. Der Graf schüttelte sich, um das Gefühl unausweichlichen Verhängnisses abzustreifen, und lehnte sich weit hinaus. Das Tal öffnete sich zu einer mit Mandelbäumen übersäten Ebene, durch die eine Straße auf das Dorf am Fuß der Burg zulief und sich dann wie eine Schlange den Hang zur Festung hochwand. Zwischen dem hellen, mit Blüten übersäten Grün erblickte Guifré Espin jenen Trupp Bewaffneter, den der Wächter entdeckt hatte.
Er zählte sechs Ritter zu Pferd und mindestens sechzig Männer zu Fuß und nickte erbittert, als habe er nichts anderes erwartet. Als er sich umdrehte, standen die drei Waffenknechte vor ihm, die ihm treu geblieben waren. Die Männer sahen so aus, als würden sie am liebsten die Beine in die Hand nehmen und laufen, so weit sie nur konnten. Der einzig unbewaffnete Mann im Raum aber blickte so grimmig drein, als wolle er die sich Nähernden eigenhändig erschlagen. Es war Antoni, der Leibdiener des Grafen, ein untersetzter Mann mittleren Alters mit einem eher ehrlichen als hübschen Gesicht und den dunklen Augen seiner maurischen Großmutter. Als Guifré Espin ihn mit einem fragenden Blick streifte, stieß er einen unchristlichen Fluch aus, trat an die Wand und nahm eine der dort hängenden Streitäxte herab.
Guifrés Tochter Soledad folgte seinem Beispiel, während ihre um zwei Jahre ältere Schwester Miranda sich auf einen Stuhl fallen ließ und die Hände vors Gesicht schlug. Der Graf strich seiner Erstgeborenen über die honigfarbenen Haare und zuckte zusammen, als sie mit tränenerfülltem Blick zu ihm aufsah. Sie glich so stark ihrer Mutter, dass er ihren Anblick kaum ertragen konnte. Daher wandte er sich abrupt um und trat wieder in die Fensternische. Der Kriegertrupp war so nahe herangekommen, dass er die Wappen auf den Schilden der vordersten Ritter erkennen konnte. An der Spitze ritt Joan Esterel, der wohl jenen Neffen an ihm rächen wollte, den er vor wenigen Tagen beim Kampf um den Almudaina-Palast getötet hatte. Ihm folgte Domenèch Decluér, der seit sechzehn Jahren auf Vergeltung für seine gekränkte Ehre wartete und sich nun kurz vor dem Ziel wähnte.
»Sie haben sich nicht viel Zeit gelassen«, spottete Guifré Espin.
Die bitteren Worte waren nur für ihn selbst bestimmt, doch Antoni wagte es nachzufragen. »Wen habt Ihr denn ausmachen können, Herr?«
Der Graf von Marranx bleckte die Zähne. »Eine Sammlung alter und neuer Feinde, die danach gieren, einen alten Dachs wie mich in seinem Bau auszuräuchern.«
»Habt Ihr auch die Farben der Grafen von Urgell oder des Vescomte de Vidaura erkannt?« Antonis Stimme klang ängstlich und hoffnungsvoll zugleich.
Graf Guifré musterte die Wappen der übrigen Ritter, und als er in den Raum zurücktrat, stand die Antwort auf seinem Gesicht geschrieben. »Nein! Von denen lässt sich keiner hier blicken. Damit zeigen die Herren von Urgell mir deutlich, dass sie meine Töchter nicht als Blutsverwandte anerkennen.«
Seine Schultern sanken nach vorne, und er wirkte mit einem Mal viel älter als seine achtunddreißig Jahre. Das wenige, was er noch an Hoffnung gehegt hatte, sollte sich also nicht erfüllen. Die Sippen der Herren von Urgell – Verwandte und angesehene Lehensleute des Königs von Katalonien, Aragón und Valencia – waren nicht bereit, ihm zu verzeihen, dass er eine ihrer Verwandten am Vorabend ihrer Hochzeit entführt hatte und mit ihr ins Königreich Mallorca geflohen war. Nun war Jaume III. von seinem Vetter Pere IV. von Katalonien-Aragón vertrieben worden, und um seinen Herrschaftsanspruch zu festigen, hatte dieser Jaumes ehemaligen Gefolgsleuten angeboten, ihm als neuen Herrn von Mallorca die Treue zu schwören und dafür ihre Ländereien behalten zu dürfen. Nur an ihn, Guifré Espin, Graf von Marranx, war kein solches Angebot ergangen. Das schmerzte ihn nun stärker als erwartet, auch wenn er im Grunde mit nichts anderem gerechnet hatte. Er wusste, welchen Groll König Pere wegen seiner Flucht an den Hof seines Vetters gegen ihn hegte, aber er hatte sich nicht vorstellen können, dass sein einstiger Lehnsherr so wenig Gnade zu üben bereit war und nun auch seine Töchter dem Verderben preisgab.
»Bei Gott, diese Niederlage hätte nicht sein müssen. Wir hätten Peres Truppen aufhalten können!« In seiner Stimme schwang all die Wut über die vielen wankelmütigen Edelleute, die ihn seit dem Kampf um die Ciutat de Mallorca erfüllte. Viel zu wenige waren gekommen, um mit ihren Männern die Stadt gegen das Heer Katalonien-Aragóns zu verteidigen, und so war Jaumes Herrschaft glanzlos zu Ende gegangen.
»Wo waren denn die Herren, die unserem König die Treue geschworen haben? Wo sind die de Llors, die de Biures und wie sie alle heißen abgeblieben, als Mallorca sie brauchte? Verflucht sollen sie sein, und ganz besonders dieser elende Kardinal de Battle, dessen Verrat den Katalanen erst den Schlüssel der Ciutat in die Hand gegeben hat!« Der Graf zitterte wie im Fieber, als er an die verzweifelte Gegenwehr der Verteidiger dachte. Die Zahl seiner Mitstreiter hatte bei weitem nicht ausgereicht, den Feind aufhalten zu können, und so hatte er die meisten Gefolgsleute in einem verzweifelten Abwehrkampf verloren.
»Ich hätte mich hier nicht aufhalten dürfen, sondern gleich gestern, als ich hierher zurückkam, mit euch fliehen sollen.« Man konnte Guifré Espin ansehen, wie sehr es ihn schmerzte, seine Töchter nicht vor dem Zugriff des Feindes gerettet zu haben.
Antoni schüttelte den Kopf. »Ihr konntet doch nicht ahnen, dass sich die Ritter Kataloniens wie Aasgeier auf Eure Fährte heften würden, Senyor! Wären Eure Verfolger nur einen Tag später hier aufgetaucht, hätten wir uns in Sicherheit bringen können.«
Im Grunde seines Herzens glaubte Antoni allerdings nicht daran, dass ihnen die Flucht hätte gelingen können, denn König Peres Männer hielten höchstwahrscheinlich schon alle Häfen besetzt und würden die Schiffe, die nach Perpinya oder Frankreich abgingen, besonders gründlich kontrollieren. Seinem Herrn sah man auch in Verkleidung den Edelmann an, und man würde ihn und seine Töchter sofort verhaften, wenn sie sich einem Schiff näherten.
»Sie gieren nach unserem Blut. Nun gut, dann soll es fließen!« Guifré maß seine Waffenknechte mit kritischem Blick. Sie hatten ihm im Kampf um die Ciutat de Mallorca gute Dienste geleistet und waren bis zur Stunde nicht von seiner Seite gewichen. Nun aber wäre ihr Tod ein nutzloses Opfer, das zu bringen er nicht bereit war.
»Verschwindet von hier! Verlasst Marranx! Dies ist nicht mehr euer Kampf.«
Die drei Männer atmeten erleichtert auf und liefen zur Tür. Dort drehte einer sich um und bedachte Guifré mit einem zweifelnden Blick. »Aber wir dürfen Euch doch nicht im Stich lassen, Herr.«
»Geht! Ich befehle es euch.« Kaum hatte der Graf die Hand gehoben, als wolle er sie wegscheuchen, rannten die drei davon, als sei der Teufel hinter ihnen her.
»Wir werden die Berge der Tramuntana überqueren und dabei die entlegensten Pässe nehmen müssen, wenn wir unseren Feinden entkommen wollen.« Antoni hoffte wider besseres Wissen, seinen Herrn doch noch zur Flucht überreden zu können.
Dieser starrte ihn grimmig an. »Und warum bist du noch hier?«
»Weil ich es so will!« Antoni wagte nicht zu sagen, dass er sich für das Gesinde schämte, das die Burg bereits bei der Nachricht von der verlorenen Schlacht verlassen hatte. Seiner Ansicht nach hätten die Leute wenigstens bis zur Rückkehr des Grafen warten und ihn bitten können, sie gehen zu lassen. So aber hatten Miranda und Soledad das Abendessen und das Frühstück, dessen Reste noch auf der langen Tafel aus wohlriechendem Mandelholz standen, mit eigener Hand zubereiten müssen. Zwar hatte er ihnen geholfen, so gut er es vermochte, doch er verstand mehr davon, einem Edelmann in Kleidung und Wehr zu helfen, als mit Kochtöpfen zu hantieren.
Der Graf warf einen letzten Blick auf seine Feinde, die gerade in den Wald aus Steineichen einritten, welcher die Burg wie ein erster Wall umgab, und nickte dann Antoni zu. »Bring meine Rüstung! Ich werde diese Schurken gebührend empfangen.«
Damit war es entschieden. Guifré Espin de Marranx würde nicht vor seinen Feinden davonlaufen, sondern ihnen einen Kampf liefern, an den sie noch lange zurückdenken sollten.
Antoni beeilte sich, das Kettenhemd zu holen und es seinem Herrn überzustreifen. »Soll ich zum Torturm laufen und das Fallgitter herunterlassen?«, fragte er, während er dem Grafen die Beinschienen anlegte.
Guifré Espin lachte spöttisch auf. »Wozu denn? Meine verstorbene Gemahlin und ich haben stets ein gastfreundliches Haus geführt.«
Antoni wagte nicht, zu widersprechen, auch wenn sein Herz sich verkrampfte. Sein Blick wanderte zu den beiden Mädchen hinüber. Mit ihren vierzehn Jahren war Miranda eine knospende Schönheit mit weichen, bereits fraulich wirkenden Formen, blauen Augen und ebenmäßigen Gesichtszügen. Sie hätte das Ebenbild ihrer Mutter werden können, wenn das Schicksal ihr nun nicht so erbarmungslos mitspielen würde. Da weder einer der Herren von Urgell noch ein Vidaura unter den sich nähernden Feinden zu finden war, der sie als Verwandte unter seinen Schutz hätte stellen können, würde sie den Männern zum Opfer fallen, die darauf gierten, vermeintliche Kränkungen an seinem Herrn und dessen Sippe zu rächen. Auch die noch kindlich wirkende Soledad würde man nicht verschonen.
Diese schien das Schicksal, welches ihr bevorstand, viel weniger zu fürchten als die in Tränen aufgelöste Miranda, denn ihre haselnussbraunen Augen sprühten vor Zorn, und sie schüttelte so wild den Kopf, dass ihr dunkelblondes Haar um ihren Kopf stob. »Ich werde diesen Hunden das Mahl mit der Axt auftischen!«
Miranda schrie auf, als stünden die Feinde schon vor der Tür, klammerte sich an Soledad und begann haltlos zu schluchzen. Antoni hätte seine junge Herrin gern getröstet, aber dazu war nun keine Zeit mehr. Er schloss mit zitternden Fingern den letzten Riemen der Rüstung, zog den Helm seines Herrn fest und reichte ihm das mächtige Schlachtschwert, das nur wenige Ritter mit einer ähnlichen Leichtigkeit zu führen wussten wie der Graf von Marranx. »Herr, kümmert Euch nun um Eure Töchter! Sollen sie Euren Feinden als Beute dienen?«
Graf Guifré schüttelte unmerklich den Kopf und hob das Schwert. Er hasste das, was er jetzt tun musste, doch es war besser für seine Kinder, wenn die Eroberer zwei tote Leiber vorfanden, deren Seelen bereits in einer besseren Welt weilten.
Als ihr Vater mit erhobenem Schwert auf sie zukam, spürte Soledad, wie die Angst ihr die Muskeln auf dem Rücken schmerzhaft zusammenzog. Den panikerfüllten Gesprächen des Gesindes hatte sie entnehmen können, was ihr bevorstand, wenn sie den Angreifern lebend in die Hände fiel, und ihr war klar, dass ein schneller Tod diesem Schicksal vorzuziehen war. Daher legte sie die Axt weg, an die sie sich wie an einen Talisman geklammert hatte, und senkte den Kopf.
Guifré Espin achtete jedoch nicht auf sie, sondern starrte auf Miranda hinab, die ihn mit den Augen seiner toten Gemahlin anblickte, und fühlte, wie das Schwert in seiner Hand zu zittern begann. Núria de Vidaura i de Urgell war ihm in Flucht und Verbannung gefolgt und hatte ihm ihre Töchter als kostbarstes Geschenk hinterlassen. Wenn er die beiden jetzt tötete, zerstörte er das Vermächtnis seiner Frau. Einen Augenblick lang kämpfte er mit sich, dann stieß er sein Schwert in die Scheide zurück und winkte Antoni zu sich.
Der Diener hoffte für einen Augenblick, sein Herr hätte die Sinnlosigkeit eines Widerstands eingesehen und wäre bereit, mit ihm und den Mädchen zu fliehen. Aber Guifré Espin schüttelte fast unmerklich den Kopf, zog seinen Siegelring vom Finger und drückte ihn dem Diener in die Hand. »Du wirst meine schutzlosen Töchter behüten und führen, Antoni. Nehmt den Weg über die Berge und wartet, bis ihr eine Gelegenheit findet, nach Perpinya zu König Jaume zu reisen. Dieser Ring hier wird euch ausweisen und Seiner Majestät zeigen, dass ich bis zum letzten Augenblick für ihn eingestanden bin!«
Die erstarrte Miene seines Herrn bewies dem Diener, dass Guifré Espin den Tod gewählt hatte. Mit einem dicken Kloß im Hals steckte er den Ring unter sein Hemd und wollte sich eben abwenden, als die Hand des Grafen schwer auf seine Schulter fiel. »Die beiden sollen sich in der Mägdekammer Kleidung besorgen, damit man sie nicht erkennt. Hier, das brauche ich nicht mehr, und die, die kommen, um mich zu töten, sollen es auch nicht bekommen.«
Guifré Espin nahm seine Geldbörse, die er beim Anlegen der Rüstung vom Gürtel genestelt hatte, und reichte sie Antoni. »Und nun macht, dass ihr verschwindet! Die Heilige Jungfrau von Núria möge euch beschützen.« Ohne seinen Töchtern noch einen Blick zu schenken, wandte er sich um und verließ die Halle.
Soledad wollte ihm folgen, doch der Diener hielt sie auf. »Lasst uns gehen, sonst kommen unsere Feinde doch noch über uns.« Ohne auf eine Antwort seiner Schutzbefohlenen zu warten, fasste er sie bei den Händen und zog sie mit sich zu dem Trakt, in dem bis zum Vortag die Mägde gehaust hatten. Er konnte nur hoffen, dass die Frauen bei der Flucht ein paar Kleider zurückgelassen hatten, die den Mädchen passten, denn in den Gewändern, die sie im Augenblick trugen, würden sie unterwegs auffallen wie Fasane unter einer Schar Rebhühner.
II.
Domenèch Decluér blickte auf den Felssporn mit der Burg, der über die Kronen der Steineichen ragte. Es schien ihm, als müsse er nur die Hand ausstrecken, um mit der Lanze gegen das Tor pochen zu können. Doch der Weg verlief nicht gerade, sondern schlängelte sich in vielen Windungen hinauf, und als der Ritter die Burg das nächste Mal zu Gesicht bekam, schien sie ihm ferner zu sein als zuvor. Ein Fluch verließ seine Lippen, dann aber glättete seine Miene sich wieder.
»Auf diesen Tag habe ich fast sechzehn Jahre gewartet!«, rief er Joan Esterel zu, der sein Pferd ungeduldig vorwärts trieb.
Esterel war ein großer Mann mit breiten Schultern und einem wie aus Stein gehauenen Gesicht. Er hatte sich von Kopf bis Fuß mit Eisen gepanzert, und ein schwächer gebautes Pferd als sein wuchtiger Hengst hätte ein solches Gewicht nicht tragen können. Jetzt aber troff auch diesem Pferd vor Erschöpfung der Schaum vom Maul. »Verdammnis über dieses Krähennest da oben und seinen Herrn! Wenn wir noch länger benötigen, um anzukommen, schlägt der Hund sich noch in die Büsche.«
»Wenn er das tut, werden wir ihn jagen wie einen Hasen und ihm wie einem solchen das Genick zerschlagen.«
Ritter Joan antwortete mit einem bösen Auflachen. »Mein Schwert giert danach, das Blut dieses Verräters zu vergießen. Wenn ich nach Sant Salvador de Bianya zurückkehre, will ich meiner Schwester berichten können, dass der Mörder ihres Sohnes durch meine Hand gefallen ist.« Das klang so begierig, dass Domenèch Decluér sich ein Grinsen verkneifen musste. Seinetwegen konnte sich Joan Esterel gerne als Erster in den Kampf stürzen. Graf Guifré hatte einen Ruf als Turnierkämpfer, und daher war er nicht darauf erpicht, ihm Auge in Auge gegenüberzustehen.
Als der Steineichenwald hinter ihnen zurückblieb, schlug er mit der gepanzerten Faust durch die Luft, als sei er ebenfalls darauf aus, den Feind so schnell wie möglich sein Schwert fühlen zu lassen. »Gleich haben wir ihn!«
Joan Esterel stieß seinem Hengst erregt die Sporen in die Weichen und trieb ihn den hier steil ansteigenden Weg hoch, der auf den Torbau der Burg Marranx zuführte. Domenèch Decluér folgte ihm ein wenig langsamer. Obwohl er sich sorgfältiger umsah als sein Begleiter und den bevorstehenden Kampf nicht auf die leichte Schulter nahm, spielte ein erwartungsvolles Lächeln um seinen Mund. Er war stolz darauf, dass König Pere ihn zum Anführer dieser Schar gemacht hatte und keinen der katalonischen Grafen, insbesondere nicht die Herren von Urgell, die genügend Grund hatten, den Verführer ihrer Verwandten zu verderben. Keiner aus dieser Sippe hatte Einspruch erhoben, und somit war ihm das alleinige Recht zugefallen, die Beleidigung zu rächen, die Guifré Espin, jetziger Comte von Marranx, den Urgells, den Vidauras und ihm selbst zugefügt hatte.
Joan Esterel schien Decluérs Gedanken erraten zu haben, denn er drehte sich mit einem Mal zu ihm um. »Wie ich hörte, habt auch Ihr ein Hühnchen mit Guifré de Marranx zu rupfen, Senyor Domenèch. Er war es doch, der Euch am Vorabend Eurer Hochzeit mit Núria de Vidaura i de Urgell die Braut geraubt hat, nicht wahr? Ohne diese Tat wärt Ihr nun der Gesippe einer der mächtigsten Familien Kataloniens und bereits zum Baron oder Grafen erhoben worden.«
Es lag so viel Spott in diesen Worten, dass Decluérs Gesicht sich vor Wut verzerrte. Die Schmach brannte noch immer, und er hatte Guifré Espin weder den Raub der Braut vergeben noch das damit verbundene Scheitern seines Aufstiegs in den höchsten Adel Kataloniens. Er zwang sich zu einem Schulterzucken, das wegen der hinderlichen Rüstung jedoch ungesehen blieb. »Er wird dafür bezahlen, Freund Joan.«
»Aber nicht durch Euch! Guifré hat meinen Neffen erschlagen, darum fordere ich das Recht, ihm als Erster gegenüberzutreten!« In Ritter Joans Worten schwang die Warnung, ihm ja nicht in die Quere zu kommen. Decluér wusste jedoch, dass es dem anderen nicht nur um seine Rache ging. König Pere hatte dem Mann, der ihm den Kopf des Verräters Guifré brachte, dessen Besitzungen versprochen, und die wollte Joan Esterel sich sichern. Dafür aber muss der Dachs aus seiner Höhle gelockt und erlegt werden, dachte Domenèch Decluér höhnisch. Wenn man einem Guifré Espin gegenüberstand, nützte schiere Kraft allein wenig. Das würde sein kampfbegieriger Begleiter noch erfahren müssen. Decluér wusste bereits, dass dem Grafen von Marranx, dem Herrn über zehn Dörfer, nur noch eine Hand voll Bewaffneter geblieben war, die die Burg niemals würden halten können. Das war beruhigend, auch wenn Decluér jederzeit neue Truppen aus der Ciutat de Mallorca nachholen konnte.
Joan Esterel zeigte mit seiner Lanze nach oben. »Seht! Das Tor steht offen.«
Er hörte sich an wie ein Knabe, der ein Wunder zu sehen glaubt. Auch Domenèch Decluér starrte verblüfft auf die Toröffnung, die weder durch die schweren, bronzebeschlagenen Torflügel noch durch das Fallgitter verschlossen worden war. Der Turm hätte sie lange aufhalten können, denn er ragte höher auf als fünf übereinander stehende Männer und bewachte den jetzt zu beiden Seiten steil abfallenden Weg. Der erste Zwinger der Burg war eng und stellte, solange die Burg von genügend Leuten verteidigt wurde, eine tödliche Falle für jeden Eindringling dar. Aber weder auf dem Turm noch auf den Mauern waren Krieger zu sehen.
»Der Vogel ist anscheinend doch ausgeflogen!«, schnaubte einer ihrer Begleiter ein wenig enttäuscht. Es handelte sich um Joaquin de Serendara, einen jungen kastilischen Ritter, der um irgendwelcher Händel willen seine Heimat hatte verlassen müssen.
»Das werden wir schnell feststellen!« Joan Esterel lenkte seinen mächtigen Hengst auf das offene Tor zu. Er musste den Kopf einziehen, um nicht gegen die Decke zu stoßen. Für einen Augenblick erwartete Domenèch Decluér eine Falle, der Esterel erliegen würde. Der Mann kam jedoch unbehelligt hindurch und hielt im vorderen Zwinger an.
»Der Bau ist wie ausgestorben!« Wut und Enttäuschung verzerrten seine Stimme, als er sich zu seinen Begleitern umdrehte und ihnen mit der Lanze winkte, ihm endlich zu folgen. Joaquin de Serendara und der junge Franzose Giles de Roubleur drängten ihre Rosse an Ritter Domenèchs Rappen vorbei und schlossen zu Esterel auf.
Burg Marranx war auf mehreren Felsplateaus erbaut worden, die wie riesige Stufen übereinander lagen. Auf der untersten stand der Torturm, der den Weg in den ersten Zwinger sicherte. Dahinter führte ein steil ansteigender Pfad zum Haupttor der Burg, das in den stärksten Befestigungsring eingelassen war. Auch dessen Flügel standen weit offen. Ein Reiter, der jenes Tor durchqueren wollte, musste sich jedoch tief über den Hals seines Pferdes beugen und war damit jedem Verteidiger hilflos ausgeliefert. Joan Esterel ritt hinein und stieß bei jedem Schritt seines Hengstes mit der Lanze nach vorne, um einen möglichen Gegner abzuwehren. Doch er traf nur leere Luft. Im zweiten Zwinger hob er den Kopf und starrte nach oben auf die von einem weiteren Torturm durchbrochene Schildmauer, die den Weg in den Kern der Burganlage versperrte, an der sich die Wohngebäude befanden. Auch dieses Tor stand offen, war aber so niedrig, dass kein Reiter es passieren konnte.
Auf halbem Weg nach oben entdeckte Esterel einen Mann, der im Schatten des inneren Tores wartete. Obwohl er ihn nicht genau erkennen konnte, war er sicher, Guifré de Marranx vor sich zu sehen. Ungeduldig trieb er seinen Hengst den steilen Weg hoch und stach mit der Lanze nach dem Grafen. Dieser trat jedoch mit einem verächtlichen Lachen zurück und war mit einem Schritt außerhalb der Reichweite der Lanzenspitze.
»Dir fehlt wohl der Mut, mir Schild an Schild gegenüberzutreten?«, fragte Guifré Espin spöttisch.
Esterel stieß einen zornigen Ruf aus, stieg schwerfällig aus dem Sattel und kam neben seinem Hengst zu stehen.
»Nun stirb, du Hund!«, rief er, während sein Schwert mit einem misstönenden Schrillen aus der Scheide fuhr. Er wartete einen Augenblick, ob sein Gegner ins Freie treten würde, doch da der Graf von Marranx nur den Schild hob, stürmte Esterel gegen ihn an. Die Schwerthiebe hallten in dem engen Durchgang wie die Schläge eines riesigen Hammers. Obwohl Esterel mit voller Kraft auf seinen Gegner einschlug, schienen seine Hiebe zu verpuffen, während sein Gegner ihn hart und präzise traf.
Domenèch Decluér sah seinen Begleiter wanken und lächelte spöttisch. Joan Esterel kämpfte so geradlinig wie ein Ochse und war schon immer in Schwierigkeiten geraten, wenn er einem flinkeren und zu allem entschlossenen Feind gegenüberstand. Das schien der Ritter nun selbst zu begreifen, denn er versuchte, sich von seinem Gegner zu lösen. Doch bevor es ihm gelang, fuhr Guifré Espins Schlachtschwert auf ihn herab. Funken stoben auf, als die Klinge sich durch Esterels Rüstung bohrte. Die Katalanen, die wie gebannt dem Kampf zugesehen hatten, hörten den Ritter erstickt aufschreien und sahen ihn stürzen. Der Graf von Marranx versetzte dem Liegenden einen leichten Stoß mit dem rechten Fuß, so dass Esterel wie ein Bündel Lumpen den steilen Aufgang hinabkollerte und vor Decluérs Pferd liegen blieb.
Joaquin de Serendara und Giles de Roubleur stießen wütende Rufe aus und drangen gemeinsam auf Guifré Espin ein, behinderten sich in der Enge jedoch gegenseitig. Jeder von ihnen hoffte, sich durch den Tod des Grafen in den Besitz seiner Burg und der zu ihr gehörenden Liegenschaften setzen zu können. Doch Decluér sah auch für beide gemeinsam nur geringe Chancen gegen Guifré Espin. Daher drehte er sich zu den Fußsoldaten um, die nun ebenfalls den Zwinger erreicht hatten. »Die Armbrustschützen zu mir!«
Zwanzig Männer traten vor und spannten ihre Waffen. Obwohl sie nur wenige Augenblicke benötigten, um schussbereit zu sein, war der Kampf im Torbogen schon zu Ende, und zwei junge Edelleute, die ausgezogen waren, um in König Peres Diensten Ruhm und Reichtum zu erwerben, hatten den Tod gefunden. Die beiden anderen Ritter, die noch zu dem Trupp gehörten, blickten Decluér zweifelnd an, doch keiner von ihnen protestierte, als dieser den Armbrustschützen befahl, vorzutreten und zu schießen.
Durch den Kampf gegen den Kastilier und den Franzosen hatte Guifré de Marranx die Vorbereitungen im Zwinger nicht bemerkt, und als er aufschaute und die Armbrustschützen entdeckte, war es für einen Rückzug zu spät. Würde er versuchen, in den inneren Hof zu flüchten, wären die Geschosse schneller als er, und er wollte nicht in den Rücken getroffen werden. Mit einem wilden Auflachen zog er den Schild enger an den Leib und bat die Heilige Jungfrau in einem stummen Gebet, sich seiner elternlosen Töchter anzunehmen. Er hörte das Schwirren der Bolzen und die harten Schläge, mit denen sie Schild und Rüstung durchschlugen, und wunderte sich, weil er immer noch stand. Es gelang ihm sogar, das Schwert zu heben und auf seine Feinde zuzugehen.
Decluér streckte entsetzt die Hände aus, als er den Grafen auf sich zukommen sah, und wich mit einem Laut vor ihm zurück, der an das Winseln eines getretenen Hundes erinnerte.
Guifré Espins Klinge erreichte seinen Gegner jedoch nicht mehr, denn seine Arme sanken plötzlich herab, und er brach in die Knie. Vor seinen Augen tanzten rote Schleier, und nun spürte er den Schmerz, der sich in seinem Körper ausbreitete, und die eisige Kälte, die seine Glieder ersterben ließ. »Verflucht sollst du sein, Decluér! Bei Gott, jeder andere Ritter ist edler und tapferer als du!«
Er sah seinen Feind nur noch als verschwimmenden Schatten vor sich und glaubte, in bodenloser Schwärze zu versinken. Gleichzeitig aber fühlte er noch einmal die Freude darüber, seiner Frau Núria eine Ehe mit diesem ehrlosen Menschen erspart zu haben. Und da sah er ein helles Licht aufleuchten, aus dem seine Gemahlin heraustrat. Sie kam mit einem strahlenden Lächeln auf ihn zu und streckte ihm die Hände entgegen.
Domenèch Decluér blickte wie erstarrt auf den Grafen von Marranx herab und musste sich überwinden, ihn mit der Schwertspitze zu berühren. Doch Guifré Espin war so tot, wie es ein Mann mit einem Dutzend Armbrustbolzen im Leib nur sein konnte. Jetzt erst begriff er, dass der Kampf um die Burg gewonnen war. Die beiden anderen Ritter drängten an ihm vorbei nach oben, um zu plündern, und die meisten Fußsoldaten folgten ihnen in der Hoffnung, dass auch für sie etwas abfallen würde. Decluér sah es mit einem verächtlichen Achselzucken, denn seine Beute würde weitaus größer sein. Er beugte sich über den toten Grafen, löste den Kinnriemen und zog ihm den Helm vom Kopf. Dann sah er das sanfte Lächeln, das noch im Tod um die Lippen seines verhassten Feindes spielte, und taumelte wie vom Schlag getroffen zurück.
Wuterfüllt trat er gegen den Leichnam, hob dann Espins Schwert auf und hieb dem Toten mit einem gut gezielten Hieb den Kopf ab. Dieser rollte ein Stück den Hang hinab und blieb an der Burgmauer liegen. Wie zum Hohn für Decluér war das glückliche Lächeln nicht aus Guifré Espins Antlitz gewichen. Der Ritter hob sein Schwert, um es aus dem Gesicht seines Feindes zu hacken, hielt aber rechtzeitig inne, denn er benötigte einen erkennbaren Beweis für den König.
»Nimm den Kopf des Verräters und stecke ihn in einen Sack!«, herrschte er den einzigen bei ihm verbliebenen Soldaten an und betrat dann das Innere der Burg. Einer der Edelleute kam ihm mit einem prall gefüllten Beutel in der einen und einem überschwappenden Krug in der anderen Hand entgegen.
»Alle Vögel sind ausgeflogen, Senyor Domenèch. Das Nest ist vollkommen leer. Aber dafür ist der Wein vom Besten. Hier, trinkt auch einen Schluck!« Er streckte Decluér den Krug hin.
Dieser schlug ihm das Gefäß aus der Hand. »Du Narr! Nicht den Weinkeller solltest du suchen, sondern die Töchter des Verräters! Sie müssen irgendwo sein.«
Jetzt kam auch der andere Ritter herbei. »In der Burg sind sie nicht. Unsere Leute haben alles durchsucht, von den Kellergewölben bis zum Dachfirst.«
»Dann schaut im Brunnen nach! Guifré Espin war ein starrköpfiger Narr. Es kann gut sein, dass er seine Töchter getötet und dort versenkt hat.« Decluér spürte, wie rote Wut ihn durchlief, denn er fühlte sich um einen Teil seiner Rache betrogen. Er hatte sich bereits genüsslich ausgemalt, wie er die Töchter Guifrés und Núrias wie gewöhnliche Mägde benutzen und sie danach von seinen Soldaten vergewaltigen lassen würde, bis nur noch zuckende Bündel blutigen Fleisches vor ihm lagen.
Die Soldaten verbrachten den Rest des Tages auf der Suche nach den beiden Mädchen, kehrten aber zu Decluérs Enttäuschung erfolglos zurück. Am nächsten Tag schickte er einen Teil der Reisigen aus, um die Umgebung abzusuchen, aber auch das brachte keinen Erfolg. Schließlich ließ er die Dörfler aus ihren Hütten zerren und diese durchsuchen, ohne etwas zu finden, und selbst ein strenges Verhör der Leute brachte ihm keine neuen Erkenntnisse. Die einfachen Bauern kamen nur selten auf die Burg, und das Gesinde hatte deren Mauern bereits vor der Ankunft ihres Herrn verlassen. So konnte niemand Decluér sagen, was mit Espins Töchtern geschehen war.
III.
In der Burg hatte Soledad das Grauen, das sich in sie fraß, noch im Zaum halten können. Als sie jedoch in dem viel zu weiten Kleid, das eine der geflohenen Dienstmägde in der Gesindekammer zurückgelassen hatte, hinter Antoni und ihrer Schwester den schmalen Ziegenpfad hochkletterte, der ihnen als einziger Fluchtweg verblieben war, zwang etwas in ihr sie, dem Geräusch wuchtiger Schwerthiebe zu lauschen, das sich an den Felswänden brach. Als es verstummte, schlug das Elend wie eine reißende Woge über ihr zusammen. »Papa!«, wimmerte sie und blieb stehen.
Antoni bemerkte erst nach etlichen Schritten, dass sie ihm nicht folgte, und drehte sich besorgt um. »Kommt, wir müssen weiter. Noch können die Feinde uns sehen.«
Miranda, die bis jetzt vor Tränen halbblind dahin gestolpert war, spürte nun, dass ihre jüngere Schwester sie brauchte. Sie kehrte zu Soledad zurück, umarmte sie und drückte sie an sich. »Wir müssen stark sein, Sola! Es ist Vaters Wille, dass wir seinen Feinden entkommen. Du wirst Papa doch sicher nicht enttäuschen wollen?«
Die Jüngere schüttelte sich wie ein nasser Hund. »Gewiss nicht, Mira, aber …« Ein heftiger Tränenstrom schwemmte die Worte, die sie hatte sagen wollen, hinweg.
Miranda packte ihren Arm und zog sie kurzerhand mit sich. Auch sie fühlte sich vor Entsetzen wie gelähmt, doch sie wusste von ihrer Leibmagd, was mit den Frauen und Mädchen eines überfallenen Dorfes oder einer eroberten Burg geschah, und ihr war klar, dass die Feinde ihres Vaters sie nicht anders behandeln würden als die Bauernmädchen. »Ein schneller Tod durch die Hand des Vaters wäre gnädiger gewesen!«
Als Soledad erschrocken aufschluchzte, begriff Miranda, dass sie diesen Gedanken laut ausgesprochen hatte.
Antoni, der zu seinen Schützlingen zurückgeklettert war, um ihnen über ein schwieriges Wegesstück hinwegzuhelfen, hatte Mirandas Worte vernommen und nickte heftig. »Das wäre er gewiss! Also dürfen sie euch nicht in die Hände bekommen.« Sein Blick glitt zur Burg hinüber, auf deren höchstem Turm noch immer das Banner des Grafen von Marranx wehte. Er konnte nicht wissen, dass die Eroberer in ihrem Bemühen, die Töchter des Grafen zu finden, vergessen hatten, es herunterzuholen.
Mehr als einmal tauchte einer von Decluérs Soldaten auf den Mauern auf und starrte auf die zerklüftete Landschaft ringsum. Doch da die drei Flüchtlinge immer wieder zurück zur Burg blickten, nahmen sie die Leute rechtzeitig genug wahr, um sich zwischen Felsen und Gebüsch verkriechen zu können. Dort blieben sie an den Boden gepresst liegen, bis niemand mehr zu sehen war. Ein Einheimischer hätte den Verfolgern die verborgene Pforte, von der aus Antoni und seine beiden Schutzbefohlenen auf den Ziegenpfad gelangt waren, zeigen und sie führen können. Doch zum Glück für die Flüchtlinge hatten die Bauern sich angesichts der fremden Soldaten in ihren Hütten verkrochen und blieben dort, bis man sie mit Waffengewalt ins Freie zerrte.
Als die Nacht hereinbrach, waren sie für Antonis Gefühl weit genug gekommen, um rasten zu können. Er führte die beiden Mädchen ein Stück vom Pfad weg in ein steil ansteigendes Bergtal, wo er eine kleine Grotte kannte, die mehrere Ausgänge aufwies. Da sie es nicht wagen konnten, ein Feuer anzuzünden, kauerten Miranda und Soledad sich eng aneinander. Keine von ihnen glaubte, nach einem so schrecklichen Tag Ruhe finden zu können, doch beide schliefen in dem Moment ein, in dem sie den Kopf auf ein paar hastig ausgerupfte Grasbüschel gebettet hatten.
Antoni legte seine Jacke über die Mädchen, setzte sich auf einen Stein am Höhleneingang und starrte ins Freie. In der entgegengesetzten Richtung zur Burg zeigten ein paar flackernde Lichter an, dass es dort ein Dorf gab, in dem noch gearbeitet wurde, und nicht weit von der Höhle entfernt entdeckte er das Lagerfeuer eines Hirten. Beides brachte ihm die Gefahr zu Bewusstsein, in der er und seine Schutzbefohlenen schwebten. Er wusste nicht viel über das frühere Leben Guifré Espins, denn er war erst in dessen Dienste getreten, als dieser bereits zum Grafen von Marranx erhoben worden war. Doch das wenige reichte aus, das Schlimmste für die Töchter seines Herrn zu befürchten. Hatte er zunächst geplant, über die Berge zu den Häfen im Westen zu gehen und eine Passage nach Perpinya zu kaufen, erschien dieses Vorhaben ihm nun allzu verwegen. Die Feinde seines Herrn, insbesondere Domenèch Decluér, würden alles daransetzen, die Erbinnen des Grafen in ihre Hände zu bekommen.
Doch wohin sollte er sich wenden? Antoni wusste, dass es seine Pflicht war, Miranda und Soledad zu König Jaume zu bringen, der sich der Töchter seines getreuen Waffengefährten annehmen würde. Doch die Häfen waren in der Hand König Peres, dessen Männer Schiffe und Reisende kontrollierten, um zu verhindern, dass größere Schätze von der Insel gebracht wurden. Der Diener rieb sich die Stirn und versuchte, seinem erschöpften Gehirn einen hilfreichen Gedanken abzuringen. Doch sosehr er auch nachsann, er fand keinen Rat. Sein ganzes Leben lang hatten andere über ihn bestimmt, und jetzt sah er sich außerstande, eine Entscheidung zu treffen.
Als die Sonne am nächsten Morgen über die östlichen Höhen stieg, wusste Antoni im ersten Augenblick nicht, ob er die ganze Nacht gewacht hatte oder im Sitzen eingeschlafen war. Er kämpfte sich mühsam hoch und kletterte in die Höhle. Der noch schwache Schein des Tageslichts hatte bereits die Stelle erreicht, an der die beiden Mädchen schliefen. Sie lagen halb übereinander wie junge Katzen, doch das Geräusch von Antonis Schritten riss sie aus ihrem Schlummer.
»Ich hatte einen ganz entsetzlichen Traum«, begann Soledad, verstummte aber dann und riss ihre Augen weit auf. »Es war kein Traum! Vater ist tot, nicht wahr?«
Antoni nickte ernst. »Ja! Er ist tot und hat uns in einer schier aussichtslosen Lage zurückgelassen.«
»Sobald wir bei König Jaume in Perpinya angekommen sind, wird alles gut. Dann werden wir Vater rächen! Ich schwöre, dass ich nur den Ritter zum Gemahl nehmen werde, der Domenèch Decluér tötet und dessen schwarze Seele in die Hölle schickt, wenn ich es nicht gar selber mache.« Die Niedergeschlagenheit, die Soledad am Tag zuvor in den Klauen gehalten hatte, war einem zornigen Mut gewichen.
Miranda nahm die bedrückte Miene des Dieners wahr und begriff, dass sie immer noch in Gefahr schwebten, gefangen und den Mördern ihres Vaters ausgeliefert zu werden. »Perpinya liegt jenseits des Meeres, und du glaubst nicht, dass wir es bis dorthin schaffen, nicht wahr, Antoni?«
Er hätte ihr gerne widersprochen, doch er wollte ihre Lage nicht beschönigen. »Wenn wir versuchen, auf ein Schiff zu gelangen, werden die Katalanen uns sofort festnehmen.«
Soledad ballte ihre Hände zu Fäusten. »Und was ist mit den Schmugglern, die von geheimen Buchten ausfahren? Sollen die uns doch nach Perpinya bringen!«
Antoni hob verzweifelt die Arme. »Dazu müssten wir welche finden. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass sie euch für ein paar Silberlinge an eure Häscher ausliefern.«
»Ich hasse diese Katalanen!«, fauchte Soledad und vergaß dabei ganz, dass ihre Eltern ebenfalls Katalanen gewesen waren.
Antoni blickte sie nachdenklich an, ohne sie zu korrigieren. In seinen Adern floss das Blut aller Völker, die seit Anbeginn der Zeit auf Mallorca gesiedelt hatten. Seine Vorfahren hatten Karthager, Römer, Vandalen, Westgoten und Araber kommen und gehen sehen und sich auch mit den Katalanen abgefunden, die Jaume I. nach seinem Sieg über den maurischen Emir vor mehr als hundert Jahren auf die Insel gebracht hatte. Da seine Leute Christen gewesen waren, hatte man sie im Unterschied zu den Arabern weder vertrieben noch versklavt. Dennoch war ihr Leben kaum besser als das von Sklaven, denn die Neuankömmlinge hatten das beste Land für sich beansprucht und die früheren Bewohner verdrängt. Antonis Familie war nicht mehr als eine Kate am Strand, ein Fischerboot und die harte Arbeit in den Salinen von Banyos de San Joan geblieben. Auch er hätte sein Leben dort fristen müssen, wäre er nicht als junger Mann dem Grafen von Marranx aufgefallen und in dessen Dienste genommen worden.
Der Gedanke an die Heimat ließ ihn aufseufzen, und einen Augenblick später atmete er wie erlöst auf, denn er wusste nun, was er zu tun hatte. An der Südostküste von Mallorca, fern aller großen Häfen, würde niemand die Töchter des Grafen suchen. Es war ein weiter, beschwerlicher Weg bis dorthin, für den sie wohl mindestens drei Tage benötigen würden. Doch in Sa Vall, eine gute Stunde von Banyos de San Joan entfernt, würden sie vorerst in Sicherheit sein, denn die Leute dort ließen keinen der Ihren im Stich. Vielleicht verfügten sein Bruder Josep oder dessen Freunde sogar über Kontakte zu Schmugglern, die Miranda und Soledad nicht verraten, sondern von der Insel fortbringen würden.
Antoni bemühte sich, den verängstigten Mädchen eine zuversichtliche Miene zu zeigen. »Es ist das Beste, wir verstecken uns eine Weile, bis der Eifer unserer Verfolger erlahmt ist. Nach Westen dürfen wir uns nicht wenden, und in der Ciutat de Mallorca werden wir ebenfalls keine Zuflucht finden. Bei meinen Verwandten im Südosten aber dürften wir in Sicherheit sein. Was danach kommt, mögen Gott und die Heilige Jungfrau von Núria bestimmen.«
»Es ist ein weiter Weg bis dorthin, nicht wahr? Wir haben nichts zu essen, und mir knurrt schon jetzt der Magen.« Soledad schämte sich, angesichts der Katastrophe zugeben zu müssen, dass sie hungrig war.
Antoni war froh darüber, zeigten ihre Bedürfnisse ihm doch, dass sie ihren ersten Schmerz überwunden hatte. Miranda aber, die sich am Vortag tapfer um ihre Schwester gekümmert hatte, wirkte nun niedergeschlagen und gleichzeitig von Panik erfüllt, so als wären die Verfolger dicht hinter ihnen.
Antoni hatte nicht vor, seine junge Herrin ihren Ängsten zu überlassen. »Kommt jetzt! Wir müssen aufbrechen. Bis Mittag oder, besser noch, bis zum Abend sollten wir darauf verzichten, uns etwas zu essen zu besorgen. Erst wenn Marranx weit genug hinter uns liegt, werde ich versuchen, ein paar Oliven und etwas Brot einzuhandeln.« Er trat auf den Höhlenausgang zu, wandte sich dort noch einmal um und sah zu, wie Soledad ihre Schwester hochzerrte.
»Komm jetzt, Mira! Decluérs Schweinehunde werden bestimmt die ganze Umgebung absuchen, und wenn wir noch länger zögern, finden sie uns.« Das war nicht unbedingt die Ausdrucksweise, die einer jungen Dame angemessen war, doch sie erfüllte ihren Zweck, denn mit einem Mal kam Leben in Miranda, und die beiden Schwestern traten zu Antoni an den Höhlenausgang. Der Diener deutete ihnen an, in Deckung zu bleiben, verließ vorsichtig den Schatten der Felsen und sah sich um. Zu seiner Erleichterung schienen keine Verfolger in der Nähe zu sein, und es war auch sonst niemand zu sehen, der sie hätte verraten können.
IV.
Etwa um dieselbe Zeit, in der ein treuer Diener die beiden Töchter des Comte de Marranx nach Osten führte, saß im fernen Deutschland ein in ein knöchellanges, blaues Gewand und einen roten, pelzverbrämten Mantel gekleideter Edelmann auf seinem Sessel und blickte auf seine Söhne hinab, die jeder ein kurzes, blaues Wams und eng anliegende, rote Strumpfhosen trugen. Die beiden Jünglinge waren gleich groß und schlank und hatten die gleichen blonden Haare, die der allmählich ausbleichenden Lockenpracht ihres Vaters ähnelten, aber der Ausdruck ihrer Gesichter spiegelte den Unterschied zwischen ihren Charakteren wider. Andreas, der Bastard, zeigte offen, dass er sich verletzt und gekränkt fühlte, während der um dreizehn Monate jüngere, legitim geborene Rudolf sich nur wenig Mühe gab, seine Schadenfreude zu verbergen. Seine aufgeschürfte Wange und das blaue Auge machten es ihm leicht, sich als unschuldiges Opfer brüderlicher Aggression darzustellen, obwohl die Verletzungen wahrscheinlich weniger schmerzhaft waren als die Rippenprellung, die er seinem Bruder zugefügt und mit der er Andreas’ Schlag erst provoziert hatte.
Ludwig, Graf von Ranksburg, stemmte sich aus seinem Sessel hoch und atmete tief durch. Er wusste nicht, mit welcher Tat er Gott so erzürnt hatte, dass dieser ihm Söhne geschenkt hatte, die wie Hund und Katz zueinander standen. Zürnte der Herr ihm, weil er von der Kinderlosigkeit seiner ersten Ehefrau enttäuscht eine dralle Bauernmaid in sein Bett geholt und geschwängert hatte? Schließlich hatte er damals nicht ahnen können, dass seine Gemahlin nur wenige Wochen später sterben und ihm den Weg in eine neue Ehe freimachen würde. Vielleicht war es auch die Strafe dafür, dass er Andreas nach dessen Geburt mit dem Namenszusatz ›von den Büschen‹ versehen hatte, der zusammen mit dem Bastardbalken im Ranksburger Wappen auf seine wenig ebenbürtige Mutter hinwies. Diesen Übermut bereute er schon lange, denn anders als die Leute nun annehmen mussten, war Andreas’ Mutter ihm nicht hinter einigen Büschen zu Diensten gewesen, sondern in einem ehrlichen Bett.
Andreas’ Blick war offen, ja sogar treuherzig, während Rudolf es nicht wagte, seinen Vater anzublicken. Dennoch musste der Graf den Falschen bestrafen, denn er hatte seiner Gemahlin Elsgarde versprochen, ihren Sohn für alle sichtbar über den Bastard zu stellen, und an diese Zusage hielt er sich. Niemand fragte danach, wie er seinen Ältesten behandelte, und Andreas musste lernen, dass Rudolf als legitimer Sohn und Erbe seines Vaters sein Herr war und er Ungerechtigkeiten hinzunehmen hatte, ohne gleich die Hand gegen den Bruder zu erheben.
»Ich habe euch beide zu Knappen gemacht und von meinem treuen Waffenmeister ausbilden lassen. Doch ihr streitet euch wie Bauernbengel und spielt einander üble Streiche, anstatt euch in der hohen Kunst der Ritterschaft zu üben!«
Als Andreas den Mund öffnete, um zu protestieren, donnerte sein Vater ihn an. »Du hältst den Mund! Es ist deine Schuld, dass es so gekommen ist. Du solltest deinem jüngeren Bruder ein Vorbild sein, doch stattdessen prügelst du dich mit ihm und fügst ihm Wunden zu.«
»Das ist nicht wahr!«, platzte Andreas heraus.
Statt einer Antwort schlug Graf Ludwig seinen Bastard ins Gesicht. Der Hieb war nicht besonders hart, doch er schmerzte den Jungen fast ebenso sehr wie das hinterhältige Grinsen, das sich auf Rudolfs Gesicht ausbreitete.
»Da ihr euch nicht vertragen wollt, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu trennen«, fuhr der Graf fort.
Rudolfs Grinsen schwoll zu einem breiten Feixen, denn er wusste, dass nicht er es sein würde, der weichen musste. Das ließ schon seine Mutter nicht zu. War Andreas endlich fort, gab es niemanden mehr, der es wagen würde, ihn zu übertreffen. Dann war er endlich der unumschränkte Herr aller Knappen, die am Hofe seines Vaters erzogen wurden.
Andreas sah seinem Bruder an, dass dieser triumphierte. Das wunderte ihn nicht, denn Rudolf hasste ihn, seit dessen Mutter ihm die Bedeutung dieses Wortes beigebracht hatte. Der Grund, weshalb seine Stiefmutter ihn so verabscheute, war Andreas jedoch nicht bekannt. Von Anfang an hatte Frau Elsgardes Sohn als Erbe von Ranksburg gegolten, während er selbst dereinst nicht mehr als die üblichen Gaben eines hochrangigen Vaters erhalten würde: Rüstung, Pferd und Schwert. Damit hatte Andreas sich längst abgefunden, und er war auch bereit, dem legitimen Bruder später als treuer Vasall zu dienen, so wie sein Vater es von ihm forderte. Rudolfs ständige Sticheleien und seine Gemeinheiten sowie die Verachtung, die ihm die Frau seines Vaters entgegenbrachte, machten es ihm jedoch schwer, sein Temperament zu zügeln.
In seine Gedanken versponnen hätte Andreas beinahe die Entscheidung seines Vaters überhört. »Andreas, du gehst jetzt und bleibst in deiner Kammer, bis Kuno dich morgen zu dem Ritter bringt, dem du fürderhin als Knappe dienen sollst. Gebe Gott, dass du dich bei diesem Mann disziplinierter und gehorsamer verhältst als zu Hause.« Graf Ludwig gab dem Älteren einen Stoß und sah mit einem bitteren Gefühl zu, wie dieser mit hängendem Kopf davonschlich.
Rudolf verbarg seinen Triumph nicht, war allerdings immer noch nicht zufrieden. »Andreas darf aber erst nach mir zum Ritter geschlagen werden!« Am liebsten hätte er »niemals« gesagt, doch er wusste, dass der Vater darauf nicht eingehen würde.
Der Graf kniff die Lippen zusammen und bedachte seinen jüngeren Sohn mit einem ärgerlichen Blick. Es war Andreas gegenüber zwar wiederum ungerecht, ihn auch in dieser Beziehung zurückzusetzen, doch er würde Rudolfs Forderung erfüllen, denn er hoffte, dass sich die Abneigung seines jüngeren Sohnes gegen den Bruder legen würde, wenn er erst erwachsen geworden war und sich in allen Dingen bevorzugt wusste.
Rudolf nahm das Schweigen seines Vaters als Zustimmung und setzte nach. »Ich will auch nicht, dass Andreas weiterhin so gekleidet ist wie ich. Schließlich ist er ein Bastard, und ich bin der nächste Graf auf der Ranksburg. Die Leute müssen wissen, wer ihr künftiger Herr ist.«
Graf Ludwig schnaubte verärgert, denn die Worte seines Erben verrieten nicht zum ersten Mal dessen kleinlichen Charakter. Nur bei den Waffenübungen liefen seine beiden Söhne in jenen gleichfarbenen Gewändern herum, welche auch die übrigen Knappen trugen. Während der restlichen Zeit steckte Rudolf in prächtigen Hüllen, die seine Mutter für ihn anfertigen ließ, während Andreas’ Gewänder sich kaum von denen der Knechte unterschieden.
Der Graf blickte seinen Erben tadelnd an. »Wann der Ritterschlag erfolgt und welche Kleidung man trägt, ist in meinen Augen völlig belanglos, wenn man sich seinem Stand gemäß benimmt. Du weißt, dass du mein Erbe sein wirst, und du bist Andreas bisher in jedem Punkt vorgezogen worden. Jeder von euch weiß, auf welchem Platz er zu stehen hat. Trotzdem ist Andreas dein Bruder und damit der engste Gefolgsmann, den du finden kannst. Halte ihn gut fest, denn du wirst seinen Schwertarm brauchen. Die Ranksburger Besitzungen sind nicht unumstritten, und es gibt genug Herren, die nur darauf lauern, uns die eine oder andere Burg zu entreißen. Vor allem die Sippe auf Niederzissen wartet ungeduldig, dass ich bald zu alt sein werde, mein Schwert zu schwingen. Ihr beide seid gerade erst dem Knabenalter entwachsen, und das wird der eine oder andere Feind sich gewiss zunutze machen wollen. Du brauchst einen Burgvogt oder Waffenmeister, auf dessen Treue und dessen Schwertarm du dich felsenfest verlassen kannst. Wo aber findest du einen Besseren als den, in dessen Adern dasselbe Blut fließt wie in den deinen?«
Rudolf wehrte spöttisch ab. »Nur zur Hälfte fließt gleiches Blut in seinen Adern, Vater. Zur anderen Hälfte ist Andreas ein Bauer, während ich ein Edelmann bin.«
»Dann benimm dich auch wie ein solcher!« Ludwig von Ranksburg presste die Hände auf die Oberschenkel, um der Wut auf seinen Erben nicht mit einer kräftigen Ohrfeige Luft zu machen. Rudolf war eitel und neidisch und blickte nicht weiter als bis zu seinem Tellerrand. Da war Andreas’ Charakter weit mehr nach seinem Herzen geraten. Der Junge hatte zwar kein so robustes Gemüt wie Rudolf, dafür aber einen scharfen Verstand. Er war nicht so oberflächlich wie sein Bruder und wusste die Dinge zu hinterfragen. Herr Ludwig haderte im Geheimen mit Gott, weil dieser seinem Bastard all jene Eigenschaften mitgegeben hatte, die er bei seinem Erben schmerzlich vermisste. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu versuchen, diese beiden ungleichen Ochsen in dasselbe Joch zu spannen.
»Geh jetzt und setze deine Waffenübungen fort. Bleibe von Andreas fern und verspotte ihn nicht, sonst werde ich zornig.« Der Graf verabschiedete seinen Erben mit einem Stoß und wandte sich zum Gehen. Rudolf sah seinem Vater feixend nach, bis dieser in einem der Korridore verschwunden war, lenkte seinen Schritt dann aber nicht auf den Hof, in dem die anderen Knappen unter der Anleitung Ritter Kunos übten, sondern lief die Treppe hoch, die zu den Gemächern seiner Mutter führte.
Frau Elsgarde saß auf einem bequemen Stuhl und beaufsichtigte die Mägde, die mit flinken Händen nähten und stickten. Es sollte ein Waffenrock für ihren Sohn werden, mit dem ranksburgischen Wappen auf der Brust, das eine von einer Dornenranke gekrönte Burg darstellte. Einer der Vorfahren Graf Ludwigs hatte während der Kreuzzüge ein winziges Stück der Dornenkrone des Herrn Jesus Christus aus dem Heiligen Land mit nach Hause gebracht und zum Symbol seines Geschlechts gemacht. In Elsgardes Augen war nur ihr Sohn wert, dieses Wappen zu tragen. Als Rudolf eintrat, wies sie die Frauen an, allein weiterzuarbeiten, und eilte ihm entgegen. Angesichts seines blauen Auges und der Blutkruste auf seiner Wange schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen.
»Das war gewiss wieder dieser bäuerische Bastard! Ich habe deinem Vater schon hundertmal gesagt, er soll den Kerl zu den leibeigenen Knechten stecken und nicht mit dir zusammen erziehen.«
Rudolf grinste hämisch. »Vater schickt ihn zu einem fremden Ritter, der seine Ausbildung übernehmen soll. Ich habe sogleich die Gelegenheit ergriffen, Vater davon zu überzeugen, Andreas erst nach mir zum Ritter schlagen zu lassen.«
Elsgarde strich ihm über das Haar, als müsse sie ihn über eine Enttäuschung hinwegtrösten. »Dieser nach Mist stinkende Bastard dürfte gar nicht zum Ritter geschlagen werden. Aber leider hört mein Gemahl nicht auf mich.«
Rudolf verzog das Gesicht, als quälten ihn plötzlich Zahnschmerzen. »Vater hat mir befohlen, Andreas zum Vogt einer meiner Burgen zu machen oder gar zu meinem Waffenmeister.«
»Was nicht noch alles?«, fragte die Mutter höhnisch. »Gibst du dem Kerl eine Burg, wird er versuchen, sie zu seinem Erbe zu erklären und an sich zu reißen, und als Waffenmeister würde er dich für eine Burg und ein Stück Land an deinen ärgsten Feind verkaufen. Wenn du Freunde und Verbündete suchst, so findest du sie bei meiner Sippe, den hochedlen Herren derer von Zeilingen.«
Frau Elsgarde lächelte ihrem Sohn aufmunternd zu, holte dann einen sauberen Lappen und Salbe und versorgte seine Schramme. Danach legte sie ein mit Essig getränktes Tuch auf sein Auge, um die Schwellung zu bekämpfen, doch Rudolf riss es sofort wieder herunter.
»Aua! Das brennt doch fürchterlich.«
»Aber es hilft!«, antwortete seine Mutter, begnügte sich dann jedoch damit, die Schwellung mit Wasser zu kühlen. Während sie ihren Sohn mit Worten tröstete, die eher einem kleinen Kind angemessen waren als einem Halbwüchsigen, erinnerte sie sich seufzend daran, dass Rudolf in etwas weniger als sechs Monaten seinen sechzehnten Geburtstag feiern würde. In zweieinhalb, spätestens aber in vier Jahren würde er zum Ritter geschlagen werden. Sie beschloss, alle Fäden zu ziehen, damit Rudolf diese Ehre so früh wie möglich zuteil werden würde. Inzwischen wollte sie die Tatsache nutzen, dass der Bastard endlich die Ranksburg verlassen musste. Kam Andreas ihrem Gemahl nicht mehr tagtäglich unter die Augen, würde sie wohl ein offeneres Ohr für ihren Vorschlag finden, dem Kerl den Ritterschlag zu verweigern oder ihn wenigstens an einen Ort zu schicken, an dem er ihrem Sohn nicht mehr gefährlich werden konnte.
Andreas ahnte, mit welchen Wünschen die Frau seines Vaters seine Abreise begleitete, und sah daher nicht sehr hoffnungsvoll in die Zukunft, als er am nächsten Morgen in Begleitung des Waffenmeisters Kuno und dreier Reisigen den Ort verließ, an dem er geboren und aufgewachsen war. Er bemühte sich, Stärke zu zeigen, denn er wollte sich nicht anmerken lassen, wie weh es ihm tat, davongejagt zu werden. Dabei wusste er genau, dass es durchaus üblich war, die Söhne von Adeligen als Knappen in die Dienste anderer Standesherren zu geben und von ihnen zu Rittern ausbilden zu lassen. Fern von zu Hause sollten die jungen Männer Erfahrungen sammeln und Freundschaften mit Gleichaltrigen schließen, die ihnen später von Nutzen sein konnten. Ihm war auch klar, dass die meisten viel jünger waren als er, wenn sie ihr Elternhaus verließen und in die Ferne zogen. Aber während diese das Ansehen ihrer Väter mitbrachten, würde er dort, wo er nun hingeschickt wurde, auch nur als Bastard gelten, dem es bestimmt war, seinem edel geborenen Bruder zu dienen. Die höhnischen Mienen Rudolfs und Frau Elsgardes, die von der Freitreppe aus seiner Abreise zusahen, gaben ihm einen Vorgeschmack auf das, was ihn an seinem Ziel erwarten mochte. Stärker als deren offen zur Schau gestellte Schadenfreude aber traf ihn die Tatsache, dass sein Vater es nicht für nötig befunden hatte, sich von ihm zu verabschieden, und sich auch nicht an einem der Fenster sehen ließ.
V.
Um etwaige Verfolger zu täuschen, führte Antoni seine Schutzbefohlenen zunächst in nordöstliche Richtung, so als wollten sie versuchen, die versteckten Buchten von Cala Tuent oder von Sa Calobra zu erreichen. Zunächst half ihnen das gebirgige Land der Tramuntana mit seinen Steineichen, Pinien und wilden Ölbäumen, sich vor fremden Blicken zu verstecken, auch wenn sie wie Ziegen über die Felsen klettern mussten. Nachdem sie das zu Marranx gehörende Land hinter sich gelassen hatten, änderten sie die Richtung und folgten dem Bett eines ausgetrockneten Flusses, das sich zwischen dem Puig de Sa Creu und dem Soucadena entlangschlängelte. Dabei umgingen sie die Ortschaften Mancor de la Vall und Selva und sahen schließlich den Kirchturm von Búger vor sich. Kurz vor dem Marktflecken bog Antoni nach Son Mulet ab und suchte ein Stück außerhalb des Ortes in einem Olivenhain Zuflucht, dessen Bäume zu seinem Bedauern noch keine Früchte trugen. Dort ließen sich die Mädchen zu Boden fallen und weinten vor Erschöpfung.
Antoni begriff, dass er ihnen etwas zu essen besorgen musste, sonst würde er sie nicht mehr auf die Beine bringen. Unentschlossen wandte er sich an Miranda, die er als seine Herrin ansah. »Ich werde losziehen und versuchen, Nahrungsmittel zu bekommen. Bleibt still liegen, damit Euch niemand sieht. Ihr habt ja selbst die katalanischen Ritter gesehen, die in kleinen Gruppen das Land durchstreifen, um den Bewohnern zu zeigen, wer hier nun das Sagen hat.«
Soledad wischte sich mit dem Ärmel über die Augen und schüttelte sich, als wollte sie die Müdigkeit aus Kopf und Gliedern vertreiben. »Wenn du jetzt gehst, müssen wir sofort nach deiner Rückkehr weiterziehen. Sonst besteht die Gefahr, dass dir jemand folgt und uns entdeckt. Ich weiß nicht, wie viel die Töchter des Grafen von Marranx den Katalanen wert sind, doch für die meisten Menschen hier stellen schon ein paar Münzen eine Verlockung dar.«
Antoni dachte kurz nach und musste zugeben, dass Soledad Recht hatte. Es wäre leichtsinnig, zuerst Essen zu besorgen und dann hier zu lagern. Das Land war nach dem überraschenden Angriff der Katalanen in Aufruhr, und es gab viele Menschen, die bereit waren, auf Kosten anderer ihr Glück zu machen.
»Glaubt Ihr, Ihr könntet es noch eine Weile ohne Essen aushalten?«, fragte er.
Soledad wechselte einen kurzen Blick mit ihrer Schwester, deren Gesicht grau war vor Erschöpfung. »Es muss sein! Die Sonne sinkt schon hinter den Horizont, und es wird bald zu dunkel, um weitergehen zu können. Also sollten wir hier schlafen. Mag der morgige Tag uns mehr Glück und vor allem einen vollen Magen bringen.«
»Wie kannst du nur ans Essen denken, wo Vater doch erst einen Tag tot ist?«, tadelte Miranda sie mit weinerlicher Stimme.
Soledad fuhr mit einer wütenden Handbewegung durch die Luft. »Ich denke vor allem an unseren Vater! Er hat sich geopfert, damit wir fliehen konnten. Also müssen wir alles tun, um zu überleben und ihn eines Tages rächen zu können. Aber dazu sollten wir bei Kräften bleiben!«
Antoni rieb sich nachdenklich die Nase. »Soledad hat Recht. Der Herr würde es so wollen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich weiter hinten einen Orangenbaum gesehen, der noch Früchte trägt. Ich werde ein paar holen. Es ist zwar nicht viel, doch es muss uns bis morgen früh genügen.« Er verschwand zwischen den krummen, seit Jahren nicht mehr gestutzten Olivenbäumen und ließ die beiden Mädchen allein.
»Wir hätten Waffen mitnehmen sollen. So sind wir jedem Fremden wehrlos ausgeliefert.« Soledad sah sich bei ihren Worten um und las ein paar faustgroße Steine auf, die sie im Notfall als Wurfgeschosse verwenden konnte. Da ihre Nerven bis zum Äußersten gespannt waren, wäre Antoni beinahe ihr erstes Opfer geworden. Sie erkannte ihn erst im letzten Augenblick und lenkte den Stein mit den Fingerspitzen in eine andere Richtung.
Antoni zuckte zusammen, als nicht weit von ihm ein Stein zwischen die Blätter eines Olivenbaums fuhr, zwang sich aber zu einer halbwegs freundlichen Grimasse. »Um Oliven zu ernten seid Ihr leider zu früh dran, Herrin.« Er brachte die Worte so komisch heraus, dass Soledad für einen kurzen Augenblick ihren Kummer vergaß und zu lachen begann. Damit zog sie sich einen tadelnden Blick ihrer Schwester zu und setzte sich beleidigt auf einen kleinen Felsen. Antoni reichte ihr zwei Orangen, gab Miranda zwei weitere und behielt die beiden kleinsten für sich. Miranda griff gierig nach den Früchten, schälte sie so schnell, als hinge ihr Leben von ihnen ab, und schlang sie fast ungekaut hinab. Soledad aber starrte die Orangen lange an und begann beinahe widerwillig sie zu essen.
Dann beschattete sie ihre Hand und betrachtete den Sonnenuntergang. »Ich glaube, wir sind erholt genug, um doch noch so lange weitergehen zu können, bis es dunkel geworden ist.«
Miranda schüttelte den Kopf. »Ich bin zu müde, und mir tun die Füße fürchterlich weh.«
Soledad war ebenfalls kaum noch in der Lage zu laufen, doch sie konnte an nichts anderes denken, als so rasch wie möglich das Meer zu erreichen und ein Schiff zu finden, das sie nach Perpinya zu König Jaume III. bringen würde. Für einen Augenblick starrten die beiden Schwestern einander so böse an, als wollten sie sich in die Haare fahren. Dann sah Soledad ein, dass es besser war, hier zwischen den schützenden Bäumen abseits aller Behausungen zu lagern. »Also gut. Bleiben wir. Wer weiß, ob wir im Dunkeln ein besseres Versteck fänden. Diesmal sollten wir abwechselnd wachen, damit Antoni ebenfalls etwas Schlaf bekommt.«
Der Diener freute sich, dass Soledad sich um ihn sorgte, erklärte aber wortreich, dass es ihm nichts ausmachen würde, noch eine weitere Nacht wach zu bleiben. Er hoffte, dass die beiden Mädchen nicht zu genau in seiner Miene lasen, denn er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er in der letzten Nacht doch ein wenig eingenickt war.
Soledad winkte energisch ab. »Es ist besser, wenn jede von uns einige Zeit Wache hält! Andernfalls schläfst du uns womöglich noch ein, und dann entdeckt man uns.«
»Male den Teufel nicht an die Wand!«, wies ihre Schwester sie zurecht.
»Teufel? Der kann auch nicht schlimmer sein als Domenèch Decluér, dieser elende Hund!« Soledad bleckte die Zähne und verkündete, dass sie nicht eher ruhen werde, bis dieser Ritter sein unrühmliches Ende gefunden hätte. Da sie schon während des Tages kaum ein Wort hatte fallen lassen, das nicht mit Hass auf Decluér erfüllt gewesen war, belächelten ihre Schwester und Antoni ihren Wutausbruch, ohne auf ihre Worte einzugehen. Der Diener sah sich nach einem sicheren Platz für die Nacht um und erspähte einen Ölbaum, der so krumm wuchs, dass seine Zweige einen natürlichen Vorhang bildeten und drei Menschen ein gutes Versteck boten. Schnell sammelte er etwas trockenes Gras, damit die Mädchen nicht auf dem blanken Boden schlafen mussten, und wartete, bis sie sich niedergelegt hatten. Dann rollte er sich wie ein Hund zu ihren Füßen zusammen und war schon eingeschlafen, als sein Kopf den Boden berührte.
»Wie du siehst, hatte Antoni die Ruhe nötiger als wir«, raunte Soledad ihrer Schwester zu.