
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Reise des Königs
- Sprache: Deutsch
Basco, Fea, Koro und Jindari wachsen in einer Stadt zwischen Meer und Wüste auf. Als Fea einen Diebstahl begeht, überschlagen sich die Ereignisse und das alte Leben der vier Kinder wird auf den Kopf gestellt. Bald befinden sie sich auf einer Reise um die Welt in der Begleitung eines unsterblichen Königs, der seine eigenen undurchschaubaren Ziele verfolgt. Doch schon bald heftet sich ein Jäger an ihre Fährte. Die Reise des Königs - Das Alte Reich, ist ein familienfreundliches Fantasy-Abenteuer, das den Leser auf den Weg durch ein altes, zerfallenes Reich voller Wunder schickt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Nöbel
Die Reise des Königs
Buch 1: Das Alte Reich
Vom selben Autor bei BoD außerdem erschienen:
Durch die Nacht – eine Anthologie,
ISBN-13: 9783750472198
Folgen Sie dem Autor auch auf:
Facebook und Instagram und YouTube unter Jan Nöbel.
Soundcloud und Podbean unter heartwords.
Jan Nöbel
Die Reise des Königs
Buch 1: Das Alte Reich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Vierte Auflage
© 2022 Jan Nöbel – alle Rechte vorbehalten
www.jannoebel.de E-Mail; [email protected]
Herstellung und Verlag: BoD – Book on Demand, Norderstedt
Covergestaltung von: Ria Raven Coverdesign
https://riaraven.de/ E-Mail; [email protected]
Bildmaterial: Shutterstock, Adobe Stock
Lektorat: Friederike Fischer
https://www.friederikefischer.eu/
ISBN: 9783756220601
Der Gefangene
Auf seinem einsamen Rundgang trieb es ihn vom nordwestlichen zum südwestlichen Wachtturm. Er ließ seinen Blick über das Meer schweifen, auf der Suche nach einer Rettung, einem Fluchtweg. Eine Stunde, eine zweite, eine dritte stand er dort.
Dann setzte er seine Runde fort, erklomm den Reichsfried, den höchsten Turm seiner Festung, dazu bestimmt über sein Reich zu wachen. Dort blickte er über die weite Ebene, wo einst Wege wie Kreidezeichnungen bis hinter den Horizont gereicht hatten. Endlose Wiesen aus wilden Kräutern, Disteln und Gräsern lagen wie ein unerreichbares Gemälde unter ihm. Sie wogten sanft im Reigen des Windes und trieben den Duft des beginnenden Frühlings zu ihm herauf, vermischten sich mit der würzigen Meeresluft und der Kälte des jahrhundertealten Festungsgesteins.
Wieder verharrte er eine Stunde, zwei und auch eine dritte. Dann kehrte er in die Hallen und Gänge zurück, bestieg den einen besonderen Turm, der nur ihm und seiner Familie gewidmet war, und wartete.
Und irgendwann, als die Grillen jenseits der Fenster zirpten und kleine, glühende Punkte über die endlose Wiese irrlichterten, hörte er ein Flügelschlagen. Ein Rabe erschien im Fenster, und an seinem rechten Bein hing ein Zettel. Vorsichtig entfernte der Gefangene das Blatt, entfaltete es, las die Botschaft und ließ sie wie eine Träne zu Boden fallen.
Der Vogel wandte sich von dem an der Mauer herabsinkenden Mann ab, breitete seine Schwingen aus und sprang dem Horizont entgegen.
1. Teil: Medina Bayha Bihar
Die Stadt zwischen den Meeren
Basco
Basco saß auf der Lehmmauer und starrte über das östliche Meer. Schiffe lagen im Hafen, löschten ihre Ladungen oder beluden ihre Lagerräume neu. Die gebellten Befehle der Seeleute und das rhythmische Klatschen des Wassers gegen Schiffsrümpfe und Kaimauern schufen eine eigentümliche, geschäftige Stimmung, die belebend und beruhigend zugleich auf Basco wirkte. Der Wind wehte von Norden und trieb Sand und würzige Seeluft durch die Hafenstadt.
Die Sonne würde erst in einer Stunde ihren Zenit erreichen und alles in erdrückende Hitze tauchen. Bis dahin wollte Basco auf der Mauer ausharren. Erst am Nachmittag lohnte es sich, zum Hafen zu gehen. Vormittags luden die Schiffe nur Lebensmittelvorräte aus, die in der Kühle des frühen Tages nicht so schnell verdarben.
Nach der Mittagshitze hingegen verließen die Reisenden die Schiffe. Oft waren es fremdartig gekleidete, manchmal auch sehr merkwürdig erscheinende Menschen. Am Hafen fielen sie kaum auf, da es so viele Fremdlinge auf einmal dort gab, aber in der Stadt wirkten sie wie Feuer in einer dunklen Nacht.
Basco konnte es kaum erwarten, bis er die Fremden sah. Jeden Tag las er in der Bibliothek von anderen Ländern, ihren Gebräuchen und ihrer Geschichte. Doch ihre Einwohner vor sich zu sehen, ihre Sprache zu hören, war für ihn die größte Faszination und Freude.
Fea
Der Markt lebte von Geschrei. Die meisten Händler schrien. Oft nur, damit sie besser gehört wurden als ihre Nachbarn. Umso erstaunlicher, dass die vielen Kaufleute ihre Geschäfte mit normaler Stimme tätigten, nicht wenige sogar nur mit einem Flüstern.
Fea schlenderte unauffällig über den Markt. Längst hatte sie gelernt, dass es sehr schnell auffiel, wenn man über den Marktplatz schlich. Kleine Bereiche der Geräuschlosigkeit fielen sofort auf. Gerade Händler besaßen ein sehr feines Gehör für Stille.
Fea ging inzwischen ganz anders an die Sache heran: Sie sang aus vollem Hals und so schief sie konnte. Es kam immer häufiger vor, dass ihr einige Händler sogar etwas gaben, damit sie wieder verschwand.
Koro
Ein Schlag folgte auf den nächsten, und Koro achtete darauf, bei jedem Hieb richtig zu atmen. Funken stieben auf, trafen die dicken, ledernen Handschuhe. Hin und wieder verirrte sich einer auf Koros nackten, sehnigen Arm, doch er achtete nicht darauf. Das Einzige, was für ihn zählte, war seine Atmung. Mit ihr kam und ging die Kraft.
Der letzte Schlag traf, und sofort steckte Koro die Klinge in den Wasserbottich. Es dampfte und zischte. Für einen Moment sah er nur die Wolke aus verdampftem Wasser, dann hob er die knackende Klinge.
„Schon besser, Junge, aber noch nicht gut genug.“
Innerlich zuckte Koro zusammen, doch äußerlich zwang er sich zur Ruhe.
Der Meister legte eine verrußte Pranke auf die Schulter seines Lehrlings. Koro sackte für einen Moment ein, stemmte sich dann aber dem Druck entgegen.
Er spürte das Grinsen des Mannes.
„Deine Technik ist ohne Zweifel hervorragend, aber dir fehlt das Gefühl.“
Koro nickte nur stumm, auch wenn er es anders sah. Außerdem … was wusste sein Meister schon von Gefühl? Wenn der mit seinem Hammer das Eisen bearbeitete, dann wirkte es eher, als ob er nur stumpf auf den Amboss drosch.
Ein dröhnendes Lachen füllte die Schmiede, und der Schnäuzer des Meisters flatterte wie ein Segeltuch.
„Und jetzt: Ab mit dir, Junge.“
Ohne dass Koro sich dagegen wehren konnte, wurde er herumgerissen und weggestoßen. Taumelnd fing er sich und ging weiter, streifte dabei erst die Lederhandschuhe und dann die Lederschürze ab, hängte sie an einen Haken und rannte los.
Der Schmied sah ihm schmunzelnd nach.
Jindari
Sie saß auf der Mauer und blickte über den Garten, der zu Zeinens Haus gehörte, dem Kampfkunstmeister von Koro. Es konnte nicht mehr lange dauern, denn die Sonne stand fast im Zenit.
Hinter ihr drang wie durch eine dicke Wand der geschäftige Lärm der Stadt zu ihr heran. Gegen Mittag, wenn die Hitze ihren Höhepunkt erreichte, wurde es immer ein wenig ruhiger. Viele Bewohner zogen sich dann in die Häuser und in die kühlen Gärten zurück, um der trockenen Hitze zu entgehen.
Jindari blickte auf die Pergamentrolle, die sie in den Händen hielt. Seit drei Tagen saß sie schon an dem Gedicht, aber es wollte bisher nicht so richtig funktionieren. Jedes Mal, wenn sie sich hinsetzte, um einige Zeilen zu schreiben, versiegten ihre Gedanken wie das Wasser in der Wüste.
Eine lautlose Bewegung am Haus erweckte ihr Interesse.
Mit ein wenig Glück … Ja! Er war es! Ein junger Mann erschien. Nun, eigentlich ein Junge. Obwohl, wenn Jindari ehrlich war, musste dieser Junge der männlichste Junge der ganzen Stadt sein.
Seine dunklen Haare klebten unerhört männlich an seiner Stirn. Sein Gesicht zeigte immer noch leichte Rußspuren von der harten Arbeit in der Schmiede. Vor einem Monat war sie ihm begegnet, als ihre Eltern ein paar neue Zierschwerter für das Gesellschaftszimmer gekauft und Jindari mitgenommen hatten. Er hatte am Amboss gearbeitet, mit diesem ernsten Ausdruck in den wundervollen Augen. Und dann erst seine Muskeln!
Inzwischen hatte Jindari sich vorsichtig mit ihm angefreundet. Sie wollte gar nicht wissen, was ihre Mutter zu einem Schmiedelehrling sagen würde!
Still und ernst trat Koro, der männlichste Vierzehnjährige der ganzen Stadt, aus dem Haus.
Hinter ihm betrat ein alter Mann den Garten, in weißes, locker sitzendes Leinen gekleidet. Koro hingegen trug einfachen Stoff, luftig und leicht.
Jindari nahm den Federkiel und setzte zum Schreiben an, hielt dann aber inne. Ihre Gedanken, die eine Lobpreisung der betörenden Schönheit blühender Feigenbäume entwickelt hatten, bestanden plötzlich nur noch aus … Koro.
Ein Tropfen Tinte fiel auf das Pergament.
Er erinnerte sie an seine Augen und ließ sie leise seufzen.
Gleichzeitig meldete sich eine andere Stimme in ihr, die sich über ihr fast dümmliches Verhalten aufregte.
Im Garten begannen Koro und sein Lehrer den Unterricht.
Mit schmachtendem Blick entglitten ihr Pergament und Federkiel.
Basco
Basco schlenderte über den Kai des Hafens und hielt Ausschau. Wonach genau konnte er nicht sagen. Es ging eher darum, einen Eindruck zu gewinnen, den Duft des Fremden zu schnuppern.
Die Seeleute achteten kaum auf ihn, nahmen ihn gar nicht wahr. In ihren ledrigen, von Sonne, Meerwasser und Arbeit gegerbten Gesichtern spiegelte sich nur die Konzentration auf die Arbeit wieder.
Hier und da sah Basco fremde Schiffe. Große, bauchige Holzkähne mit gewaltigen Segeln. Matrosen mit bleichen Gesichtern kletterten durch die Takelage oder luden Fracht ab. Die Sprache der Männer klang ungewöhnlich laut, jedes Wort schien wie für einen Streit gemacht.
Dann sah er Männer, deren Haut so schwarz wie Feuerstein war. Ihre Augen leuchteten wie Sterne in den dunklen Gesichtern, und ihre hochgewachsenen Körper waren in leuchtend blaue Tuchgewänder gehüllt. Gemessen an den Lasten, die sie trugen, mussten sie sehr stark sein, denn sie benutzten nur selten Kräne und schleppten die meisten Dinge zu zweit, für die sonst drei oder mehr Männer gebraucht wurden.
Ihre Sprache schien aus kurzen Wörtern, Klicklauten und Schnalzen zu bestehen.
Einer der Männer bemerkte Bascos faszinierte Blicke und lächelte breit. Seine Zähne strahlten wie kostbares weißes Porzellan. Dann hob er seine mächtige Pranke und tätschelte erstaunlich sanft Bascos Kopf. Dazu sagte er mit tiefer Stimme einige unverständliche Worte, die für Basco freundlich klangen. Der Fremde zog die Hand zurück, wandte sich halb um und rief etwas in Richtung des Bootes. Ein anderer Feuersteinmann schaute von einem Sack auf, sah dann kurz zu Basco und nickte. Der zweite Mann kehrte auf das schlanke Schiff zurück und erschien dann wieder mit vier verschiedenen Pergamentrollen in den Händen.
Der erste Mann nahm die Rollen und überreichte sie Basco. Dabei sprach er einige Worte in der fremden Sprache. Der Mann, der die Rollen geholt hatte, übersetzte sie.
„Schah möchte zum Geschenk machen, diese … Zeugnisse. Sie haben Schah … erfreut, als er selber Kind war“, sprach der zweite Mann gestelzt. Er musste sich wohl sehr konzentrieren, um die Worte zu finden. „Schah mögen … erwachte Kinder mit Blick weit offen. Du erinnern Schah an ihn. An seine … Neugier.“
Schah, wenn es denn sein Name war, lächelte noch breiter. Basco überlegte, was er Bedeutungsvolles als Dank sagen konnte, brachte aber nur ein stockendes „D-danke“ hervor.
Schah lachte laut und tief und verwuschelte Bascos Haar. Der andere Mann reichte Basco die vier Schriftrollen und verbeugte sich kurz. Basco tat es ihm gleich und verlor dabei fast die Pergamentrollen. Wieder lachte Schah laut und freundlich. In seinen Augen stand kindliche Freude.
Fea
Fea sang voller Inbrunst das Lied über das Mädchen Blume.
„AUS EINEM FERNEN KRALL …
KAM BLUME DADADALL!!!
Mhmmhm TRAF EINEN JUNGEN,
glaube ich, ER HIESS … NANANA!!“
Sie bekam den Text nicht mehr ganz zusammen, machte das aber durch ihre Lautstärke wieder wett.
„ALSO SAGTE DER MMHMMHM …
UND SIE MEINTE NANADAAA
UND AUS EINEM FERNEN KRALL!“
Sie wusste auch nicht, ob und warum das Mädchen Blume hieß, aber das spielte überhaupt keine Rolle. Inzwischen hatte sie zwei Goldringe, einen Apfel und eine Silbermünze „eingenommen“. Den Apfel hatte ihr der Händler sogar selbst gegeben.
Vor und hinter ihr teilte sich die Menge wie ein Schwarm Fische vor einem größeren, möglicherweise bissigen Jäger. Ganz selten drehte sich jemand zu ihr um, meist mit dem Blick eines Menschen, der in einem Glas Nüsse die einzige faule Nuss erwischt hatte.
Fea nahm dies als Kompliment.
Das fortführend, was sie selber Singen nannte, schlenderte sie weiter und warf dabei den Marktständen flüchtige Blicke zu.
Ihr ging es bei den Diebestouren nicht einmal darum, etwas Nützliches zu ergattern. Vielmehr musste sie in Übung bleiben, damit sie in „Notfällen“ nicht erwischt wurde. Zwar arbeitete ihr Vater derzeit am Hafen, aber nicht immer reichte das Geld, um für alle zu sorgen. In solchen Fällen ging Fea „spazieren“ und bekam auf einmal ganz viele praktische Dinge geschenkt, wie zum Beispiel einen Laib Brot und einen kleinen Sack Couscous. Falls ihre Eltern sich darüber wunderten, so zeigten sie es jedenfalls nicht, und Hauptmann Protek hatte sie auch noch nicht zu Hause besucht, um mit ihren Eltern zu … reden.
Fea ließ sich von der Menge an den Stand von Marodaesh treiben, dem Kunstschnitzer und Spielzeugmacher. Vielleicht hatte er wieder neue Soldaten geschnitzt. Ihr Bruder liebte die hölzernen Männer, deren Arme an kleinen Nägeln befestigt waren, so dass man sie ein wenig bewegen konnte. Unwillkürlich wanderten ihre Finger über die Theke, hielten dieses fest, ließen jenes los … bloß keine Hektik, guck einfach, als ob du es kaufen willst.
Ohne hinzusehen, löste sie ein kleines Pferd von seinem Reiter, ließ ihn auf den Boden fallen und das Ross im Ärmel verschwinden. Ein Schild landete in ihrer Hand, genauso wie ein kleiner Helm. Auf einmal hielt sie einen Spielzeugsoldaten in der Hand. Ein schwarzer, glänzender Hut saß auf seinem Kopf. Der Oberkörper wurde von einer schneidigen blauen Jacke umhüllt, die Beine steckten in einer engen weißen Hose. Schwarze Stiefel und ein langes, gekrümmtes Schwert vollendeten das Bild.
Schon allein die Uniform ließ den Soldaten echter wirken als alles, was der Spielzeugmacher bisher geschaffen hatte. Und dann das Gesicht …
Marodaesh hatte seinen bisherigen Spielzeugen keine Gesichtszüge verliehen. Der Schreiner betonte immer, er sei kein guter Maler, und Gesichter brauche eh niemand.
Aber dieser Soldat … fast glaubte Fea, er würde sie beobachten, sie und ihre Stärke, ihre Willenskraft einzuschätzen versuchen.
Behutsam, fast so, als würde eine schnelle Bewegung den Soldaten zu einem Angriff reizen, stellte Fea ihn wieder zurück. Doch noch immer fummelten ihre Finger wie von selbst an dem Spielzeugsoldaten herum, lösten etwas Längliches von ihm ab. Und als der Soldat wieder auf der Auslage stand, wandte Fea sich schnell um und hastete fort.
Außer Atem erreichte sie ihr Zuhause. Doch selbst in der gemeinsamen Kinderkammer kauernd, spürte sie noch den Blick des bestohlenen Soldaten.
Koro
Schweiß bedeckte Koros Kopf. Reglos verharrte er in der letzten Position, überprüfte im Geiste seine Haltung und wartete auf die erlösenden Worte seines Meisters.
Gleichzeitig versuchte er, Jindari, die auf der Gartenmauer saß und verträumt zu ihm herüberblickte, aus seinen Gedanken zu vertreiben. Es gelang ihm nur mühsam. Wenn er nur gewusst hätte, worüber sie gerade nachdachte … bestimmt wieder so ein Mädchenklatsch, den er eh nicht verstand. Sicherlich ging es dabei um …
„Hast du geübt?“ Die Frage glich einer lauernden Schlange und riss Koro aus seinen Gedanken. Er wagte nicht, zu antworten.
„Mhm“, machte der Meister, als Koro schwieg. „Hast du deine Fehler gespürt?“
Koro wagte nicht, sich zu bewegen. Schweiß rann ihm über den Körper, tropfte von Nase und Kinn ins warme Gras. Der Mund des Meisters erlaubte sich ein kurzes Lächeln. Seine Augen sparten sich die Mühe und studierten Koro weiterhin wachsam.
„Also gut … entspann dich.“
Langsam und kontrolliert löste sich Koro aus seiner Haltung, doch auch er blieb wachsam.
„Zu deiner ersten Frage, Zeinen, natürlich habe ich geübt. Zu deiner zweiten Frage: Ja, ich habe meine Fehler bemerkt.“
Der Meister musterte Koro forschend.
„Mhm.“ Seine Lippen bildeten einen schmalen Strich. In den Augen stand etwas, das Koro als eine Mischung aus Mitleid, Sorge und Ärger deutete.
„Bemerkst du auch, welche Worte du benutzt? Oder benutzt du sie mehr aus einem Gefühl heraus?“
„Ich verstehe nicht, Zeinen, was haben Worte mit Kampf gemeinsam?“
„Alles! Merk dir das, Koro!“, schnappte sein Meister. „Es spielt keine Rolle, ob du deine Worte benutzt oder deine Fäuste. Beides ist Kampf und beides dient deinem Weg! Wenn du dabei nichts spürst, bleibt beides ohne Leben! Und nur wenn es mit Leben erfüllt ist, wirst du auf deinem Weg weiterkommen!“
Koro schreckte innerlich zusammen. So aufgebracht hatte er seinen Meister selten erlebt. Was sollte dieses Gerede von Gefühl? Er konnte die Techniken, konnte ihren Ablauf nahezu perfekt und machte nur sehr selten Fehler in der Form.
„Zeinen, du sagst immer wieder, dass meine Techniken fast makellos seien. Was soll ich jetzt damit anfangen, wenn du mir sagst, mir fehle Gefühl?“
Der Meister presste seine Lippen fest aufeinander und sah Koro lange an. Wut, Enttäuschung und Hilflosigkeit wechselten sich in seinem Gesicht ab.
„In jedem deiner Schläge, in jedem deiner Blöcke, in jeder deiner Bewegungen sieht man, dass du nur die Technik gelernt hast. Du solltest dich fragen, Koro, ob du kämpfen willst oder ob du glaubst, dass du kämpfen musst.“
Der Blick des Meisters glitt über Koros Gesicht. Er schien nach einer Regung zu suchen, nach einer Reaktion der Erkenntnis. Genauso gut hätte er eine Steinmauer beobachten können.
„Geh jetzt.“ Forderte Zeinen seinen Schüler auf. Es klang fast enttäuscht. „Vielleicht verstehst du es mit der Zeit.“
Verwirrt und betroffen verließ Koro den Garten.
Ihm blieb noch etwas Zeit, bis sein nächster Unterricht begann.
Zeit, die er brauchte, um seine Gedanken zu ordnen.
Jindari
Jindari saß verträumt auf der Lehmmauer und starrte auf die Stelle, an der Koro und sein Meister bis vor wenigen Momenten gestanden hatten. In ihren Gedanken spukte ein Koro umher, der sich gegen seinen Lehrer behauptete. Zwar kannte sie nicht den Inhalt des Streits zwischen ihnen, doch mit Sicherheit ging es um Neid. Solch perfekte Techniken konnten nur Neid hervorrufen.
Mit den Gedanken bei Koro stand Jindari auf und lief leichtfüßig über das Gewirr von Mauern davon. Es bildete ein ganz eigenes Labyrinth unabhängig von den vielen Gassen und Straßen. Wer es darauf anlegte, konnte in kurzer Zeit einen Großteil der Stadt durchqueren, ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen. Menschen auf den Lehmmauern bildeten ein genauso vertrautes Bild wie Fußgänger auf der Straße. Natürlich führte der schmale Weg auf den Mauern immer wieder zu kleinen oder größeren Meinungsverschiedenheiten. Sie wurden dadurch entschieden, das am Ende nur noch einer von zweien auf der Mauer stand.
Wenige Meter vor ihr teilte der Kamelweg die Mauern. Die alte Straße war vor dem Bau des Neuen Marktes der wichtigste Weg durch die Stadt gewesen, geriet nun aber immer mehr in Vergessenheit.
Tarnah, ihr nerviger kleiner Bruder, hatte Jindari einmal gezeigt, wie sie solche Straßen schnell überqueren konnte. Er tat den ganzen Tag lang fast nichts anderes. Jindari verfiel in einen leichten Trab und kletterte blitzschnell an einer niedrigen Häuserwand hoch. Auf dem flachen Dach angekommen, beschleunigte sie weiter und rannte auf den Rand des Daches zu.
Kurz fragte sie sich, ob ihre Erinnerungen stimmten, aber für Zweifel war es zu spät.
Mit dem letzten Schritt stieß sie sich ab und sprang.
Gefährlich tief unter ihr lag die Straße. Einige Männer führten Kamele unter Jindari hindurch. Frauen saßen auf Bänken und redeten aufgeregt miteinander. Ein Hund rannte mit einem Stück Fleisch im Maul die Straße entlang, der wütende Metzger direkt hinter ihm.
Jindari achtete nicht darauf. Ihre Konzentration galt nur dem – den Göttern und Geistern sei Dank – flachen Dach auf der anderen Straßenseite. Jindari spürte den Luftzug des Gegenwindes an ihrem Körper. Ihr leichtes, weißes Kleid flatterte.
Mit rudernden Armen und Beinen schoss sie auf das flache Dach zu, das noch immer viel zu weit entfernt war. Inzwischen interessierte sich die Erdanziehung verstärkt für Jindari und zog sie gnadenlos in Richtung Boden. Der Moment dehnte sich. Sie nahm die Welt mit erschreckender Klarheit wahr. Mit Entsetzen erkannte Jindari, dass sie das andere Dach nicht mehr erreichen würde …
Die Welt tat einen Satz und auf einmal raste die Zeit.
Jindari warf sich nach vorn und ihre Füße berührten gerade noch die Dachkante. Noch bevor die Erkenntnis ihren Kopf erreichte, rollte sie sich bereits ab. Sie machte einen Purzelbaum, kam in einer flüssigen Bewegung wieder hoch und nutzte den Schwung, um über einige Krüge hinwegzuspringen. Die Restgeschwindigkeit trug sie zum anderen Ende des Daches. Noch bevor sie sich dessen bewusst wurde, sprang sie ein weiteres Mal. Sie vollführte einen Salto und rollte sich über ein gefährlich schmales Stück Mauer ab.
Gleichzeitig erreichte die Nachricht ihren Kopf, dass sie immer noch lebte und dass sich dies auch nach dem zweiten Sprung nicht geändert hatte. Der Bann brach und Jindari begann wieder zu denken. Sie schnellte hoch und lief unbeholfen ein paar taumelnde Schritte, das Ende der Mauer kam immer näher. Mit wild rudernden Armen und einem verzweifelten Schrei auf den Lippen stoppte sie auf der Mauerkante, kämpfte um ihr Gleichgewicht und wankte vor und zurück. Dann fiel sie.
Nach wenigen Sekunden meldeten ihre Füße, dass der Sturz bereits vorüber war und sie auf Gras stand.
Jindari lehnte sich mit rasendem Puls an die niedrige Mauer und rutschte dann, langsam ausatmend, an ihr herab.
Das Schwert und die Diebin
Basco
Am frühen Nachmittag betrat Basco die Bibliothek. Sie konnte sich nicht mit der messen, die in der fernen Hauptstadt weit im Nordwesten stand. Aber sie war weit und breit für ihr umfassendes historisches Archiv und ihre detaillierten Seekarten bekannt.
Basco arbeitete und lebte seit vier Jahren bei Basileios, dem Archivar. Mit sechs Jahren hatten seine Eltern ihn in die Obhut des alten Mannes gegeben, da ihnen das Geld fehlte, um für Basco und seine Geschwister sorgen zu können. Anfangs hatte der Junge oft heimlich unter dem Laken auf seiner Pritsche geweint. Jedoch schlug Basileios ihn nicht, zumindest nicht so, wie sein Vater es getan hatte. Außerdem gab er Basco regelmäßig zu essen und brachte ihm Lesen und Schreiben bei. Dafür musste er dem Alten in der Bibliothek helfen und in seinem Auftrag nach neuen Schriftstücken Ausschau halten. Nach einem halben Jahr, als er die ersten Sätze lesen konnte, hatte er angefangen, sich mit der Situation zu arrangieren.
Bascos Leben verlief in ruhigen, übersichtlichen Bahnen.
Und eine davon schien ohne Umwege in eine Zukunft als Archivar zu führen, eines Tages vielleicht mit einem kleinen Jungen an seiner Seite, der ihm nicht ganz unähnlich sein würde.
Schwer atmend trat Basco zwischen den dicken Samtvorhängen hindurch, welche die äußere Tür verdeckten, damit kein Sand in die Bibliothek gelangte. Auf der großen, borstigen Matte im Windfang klopfte er sich die Sandalen ab und trat dann durch die leichteren Leinenvorhänge in den kühlen Hauptsaal. Der Raum war riesige zehn Meter lang, und der Boden zeigte ein Sonnenmosaik, das im Laufe der Zeit von Hunderten von Füßen abgewetzt worden war. Die Decke bildete eine kleine Kuppel, deren kunstvolle Fresken kaum noch zu erkennen waren.
Knapp unter den rechteckigen Fenstern, die die Wand direkt unterhalb der Kuppel säumten, warfen zahlreiche Spiegel das Tageslicht an verschiedene Stellen im Raum. Durch ein System von Schnüren, Stangen und Zahnrädern ließen die Spiegel sich vom Boden aus verstellen. Basileios hatte ihm erklärt, dass direktes Licht den Büchern schade. Es raube ihnen die Farben. Daher hatten die Erbauer – der Bibliothekar sprach diesen Begriff aus, als würde er von Göttern reden – dieses System aus Spiegeln und Linsen geschaffen, mit dem Sonnenlicht umgeleitet oder konzentriert werden konnte. Wenn man es nicht brauchte, wurde es einfach nur an die Wände geworfen. Dadurch konnte bei Bedarf die ganze Bibliothek erleuchtet werden. Und wenn man ein Buch las, so nahm man einen kleineren Spiegel und eine Linse, richtete beides aus und warf das Licht auf eine weiße Platte über dem Buch, die dann regelrecht erstrahlte.
Auf Bascos Frage hin, weshalb das Licht denn die Farben raube, gab Basileios ihm einen Klaps auf den Hinterkopf und erklärte ihm umständlich, dass Farbe wie Schatten sei, dass das Licht keinen Schatten mochte und ihn deshalb stahl. Basco hatte bei der Erklärung gestutzt und gefragt, wieso das Licht denn den Schatten klaue, wenn es ihn doch nicht mochte, aber das brachte ihm nur einen weiteren Klaps ein und die Bemerkung, dass der Lehrling nicht die Weisheit seines Meisters anzweifeln solle. Von da an war Basco klar gewesen, dass der Bibliothekar einfach keine Ahnung hatte. Ab diesem Zeitpunkt las Basco noch mehr, versuchte immer mehr, die Welt, in der er sich bewegte, zu verstehen.
„BASILEIOS?“, rief Basco in die Dunkelheit zwischen den Lichtinseln hinein. Wenn der alte Archivar es wollte, war es äußerst schwer, ihn im Archiv zu finden. Er verschmolz dann regelrecht mit der Wand, wurde zu einem Teil der Schriftrollen und Bücher.
„MEISTER, WO SEID IHR?“ Jahrhunderte des Wissens verschluckten seine Stimme. Die Folianten mochten Ruhe, und wann immer ein lautes Geräusch sich zwischen die Regale und Fächer verirrte, nahmen die Schriftstücke es beiseite und brachten es zum Schweigen.
Ratlos drehte sich Basco im Kreis, suchte nach einem Anhaltspunkt, wo der Alte sich aufhielt. Angestrengt lauschte er in die Dunkelheit, in die entferntesten Winkel des Archivs. Es ging darum, jene Geräusche zu hören, die in die Welt der Bücher passten. Schreien passte nicht, auch kein Rufen. Genauso gut hätte man versuchen können, Mäuse mit einer Katze anzulocken. Basileios hatte es ihm oft genug erklärt. Wenn man jemanden oder etwas finden wollte, dann gab es zwei Wege, von denen meist wenigstens einer funktionierte: Entweder hörte man auf die Dinge, die nicht passten und die eine Disharmonie (Basco hatte das Wort nachschlagen müssen) erzeugten, oder man lauschte auf die Dinge und ihren Klang, die in den Raum hineingehörten. Basco hatte eine Weile benötigt, um den Sinn hinter dieser Aussage zu verstehen. Und noch länger hatte es gedauerte, bis er die Geräusche identifiziert hatte, die ins Archiv gehörten.
Schwer atmend stand er nun auf der abgewetzten Sonne des Mosaiks, schloss die Augen und lauschte.
Das Rascheln von Papier, über das der trockene Wüstenwind streift …
Mein eigener Atem wie einzelne Donnerschläge …
Bleiernes Schweigen, wie es nur von Schriftstücken in einer Bibliothek verursacht werden kann …
Das stumme Schwingen der Bänder, die zu den Spiegeln führen …
Basco öffnete die Augen wieder. Alle Geräusche, abgesehen von seinem eigenen Atem, gehörten in die Eingangshalle. Allerdings fehlte der Klang des Bibliothekars. Ob er in die Stadt gegangen war? Basco bezweifelte das. Der Alte fühlte sich in der Stadt unwohl, passte nicht in das Bild, in die Umgebung. Er lebte in einer Welt der Stille, die jedes Geräusch wie einen Eindringling behandelte. Eine Welt, in der alles seinen Platz besaß und konserviert war. Die Stadt stellte das genaue Gegenteil dar. In ihr bildete Basileios eine Disharmonie, eine Unregelmäßigkeit, die sofort auffiel. Sie verunsicherte den Bibliothekar, wie alles, was seine geordnete Welt durcheinanderbrachte. Mit einem Schaudern erinnerte sich Basco an die Neuordnung des Archivs vor einem Jahr. Nachdem die Anordnung des Sultans gekommen war, hatte Basileios auf seine eigene, unheimliche und stille Art drei Tage lang getobt. In dieser Zeit hatte Basco versucht, ihm so gut es ging aus dem Weg zu gehen. Noch nie hatte er den Alten so aufgebracht erlebt. Und auf der anderen Seite kannte der Junge keinen anderen Bewohner der Stadt, der so nach Neuem gierte und ihm bereitwillig einen Platz in seinem Reich einräumte. Dieser Wissensdurst war bei Basco auf fruchtbaren Boden gefallen, nur fühlte er sich in der Welt jenseits des Archivs nicht unwohl. Vielmehr drängte es ihn jeden Tag erneut an den Hafen, hin zu dem Fremden, das er dort entdecken konnte.
Basco ging bedächtig die Lehmtreppe hinauf und bog in das Archiv alter Seekarten ein. Im Sagenarchiv hielt sich Basileios nur auf, wenn es etwas Neues einzusortieren gab. Ansonsten kümmerte Basco sich um das kleinste der Archive.
Erneut schloss er die Augen.
Dieses besondere Rascheln, das nur von Papier verursacht wird, das viel Zeit auf hoher See verbracht hat und durch Salz gegerbt ist …
Mein Atem, der nun wieder etwas ruhiger geworden ist und sich immer mehr der Bibliothek angleicht …
Nein, auch hier fehlte der Meister.
Basco drehte sich um und schritt ruhig zum historischen Archiv. Es enthielt fast doppelt so viele Schriftstücke wie das Archiv der Seekarten. Die vielen Regale ließen den Raum unglaublich groß erscheinen, obwohl er nicht mehr Platz einnahm als die anderen Archive.
Nüchterne Berichte und von tiefen Gefühlen inspirierte Briefe, die raschelnd verharren, auf jemanden warten, der sich ihrer Geschichte annimmt …
Der leichte Wind, der um die vielen Ecken und Kanten der Regale streicht und dabei einen ganz eigentümlichen Klang von Veränderung mit sich bringt …
Ein leises, kaum erkennbares Zischen, das von einem Finger stammt, der behutsam über eine Papyrusrolle streicht …
Basco öffnete die Augen, und dann sah er ihn:
Basileios saß auf einem Stuhl, vor ihm auf einem Pult lag eine lange Rolle aus jenem Papier, das als eines der ersten überhaupt galt. Der Bibliothekar hatte den Kopf weit darüber gebeugt, und sein Finger wanderte mit diesem besonderen Zischeln über die Rolle. Der Alte hatte Basco einmal erklärt, dass man nur so richtig lesen könne. Man müsse die Worte auch spüren, sie ganz erfassen. Der Junge hielt dies für Unsinn. Vielmehr glaubte er, dass der Alte einfach nicht mehr gut sah und mit Hilfe des Fingers nicht die Orientierung verlieren wollte.
„Meister“, flüsterte Basco respektvoll. „Unten am Hafen gab mir einer der Feuersteinmenschen …“
Der Finger, der gerade noch an Wörtern entlangstrich, hob sich im nächsten Moment.
„Ah? Was habe ich dir über die Verwendung solcher Namen gesagt?“ Diese Worte, bedächtig geflüstert, wirkten wie eine massive Mauer auf Bascos in Fahrt gekommene Gedanken. Wollte er nicht daran zerschellen, so musste er schleunigst die Richtung ändern.
„Ihr habt gesagt, dass man Menschen nicht mit Dingen gleichsetzen solle, egal woher sie kommen. Ihr habt gesagt, dass man, wenn man den Namen von etwas nicht kenne, ihn erfragen solle.“
„Und? Wie heißen diese Menschen? Wie nennen sie sich?“
„Ich weiß es nicht“, gestand Basco, der innerlich an der Mauer entlangschabte und verzweifelt versuchte Abstand zu gewinnen. „Aber ihre Sprache hört sich an, als ob sie die ganze Zeit über schnalzen würden. Und … und sie sind stark und den einen – er schien besonders wichtig zu sein – nannten sie ‚Schar‘ …oder so. Ein anderer sprach unsere Sprache und hat für Schar übersetzt, aber nicht besonders gut. Und ihre Haut war sehr dunkel, fast schwarz.“
„Welche Menschen können es also gewesen sein?“ Die Mauer rückte ein wenig nach hinten, aber noch nicht weit genug. Eine falsche Antwort und er würde unangenehme Bekanntschaft mit ihrer Härte bei oberflächlich angewandtem Halbwissen, also Vorurteilen, machen. Auf Basileios’ Liste schlimmer Verbrechen kamen Vorurteile gleich an zweiter Stelle hinter Bücherverbrennung.
„Wahrscheinlich kamen sie aus dem südlichen Teil des Pelgremin-Kontinents, von dort, wo die Sonne am heißesten ist. Ich habe kürzlich gelesen, dass es dort einige große Reiche gibt. Allerdings muss es ein Land sein, das am Meer oder an einem Fluss liegt, der zum Meer führt, denn sie betreiben Schifffahrt. Und da gibt es nur zwei Länder, die mir einfallen: das Pandriath und Gell Luldrus.
Die Menschen aus dem Pandriath nennen sich ‚Menschen des Morgens‘, weil sie glauben, dass sie die ersten Menschen waren. Und die Bewohner von Gell Luldrus nennen sich selbst ‚Schattenkinder‘, da sie ihr Leben fast nur während der Nacht bestreiten, weil es ihnen tagsüber zu heiß ist.“ Basco zögerte kurz, als er das Gesagte im Geiste wiederholte. „Ich glaube – nein, ich denke, dass es die Menschen des Morgens waren. Sie wirkten nicht so, als ob sie müde gewesen wären, also sind sie das Leben bei Tag gewohnt, ja, und ihre Haut schien wirklich sehr schwarz zu sein, also wird sie oft der Sonne ausgesetzt sein, genau.“
Seine Lippen bewegten sich noch ein wenig weiter, so als müsste er noch ein paar Gedanken nachschmecken, und dann nickte er leicht. Die Mauer schien nun weit weg und gar nicht mehr so hart zu sein wie noch Sekunden zuvor.
„So so. Die Menschen des Morgens also. !Xigtao, wie sie sich auch nennen.“ Der Alte schnalzte – oder war es mehr ein Klicken –, wie Schah es getan hatte. „Und wie kommt es, dass du dein Wissen erst jetzt nutzt? Anstatt sie mit einem Ding zu vergleichen, hättest du ihnen zumindest ihren Landesnamen geben können.“ Basco setzte zu einer Erwiderung an, aber der Alte schnitt ihm das Wort ab. „Na, dann zeig mir mal, was dir die Händler gegeben haben.“
Der Junge stutzte kurz, und dann fielen ihm wieder die Schriftrollen ein. Behutsam zog er sie aus seinem Beutel hervor und ging damit zu einem freien Pult. Dort legte er drei auf eine kleine Ablage und die vierte entrollte er. Ruhig griff er zu den Bändern, welche die Spiegel steuerten, und richtete einen Lichtstrahl auf die kleine weiße Platte über dem Pult aus.
Der Alte sah Basco schweigend über die Schulter.
Zum ersten Mal warf Basco selbst einen Blick auf die Rolle. Aus Angst, dass sein Meister das Fehlen von Farbe erkennen würde, hatte er sich nicht getraut, die Schriftstücke in der Stadt zu öffnen. Und jetzt …
Etwas veränderte sich am Klang der Bibliothek. Das Geräusch von jemandem, der sich zwar bemühte, der aber noch nicht ganz in diese spezielle Stille hineinpasste.
„Basco, ich glaube, dein Schüler ist gerade gekommen.“
Fea
Fea saß in ihrer Kammer und drückte sich an die Wand über ihrer Strohmatte. Nun, eigentlich war es nicht ihre Kammer. Sie nannte sie nur so, weil sie von ihren drei Geschwistern die Älteste und damit die Bestimmerin war. Rotgoldene Sonnenstrahlen leuchteten durch das Fenster, zeigten den stillen Tanz von Staub und Sand in der Luft. Der Tag neigte sich dem Abend entgegen, bald schon würde ihr Vater vom Hafen heimkommen. Bis dahin musste sie ihre Geschenke verstecken.
Sie rollte ihre Matte vom Fußende her auf und löste eine kleine Holzplatte vom Boden. Eines Tages hatte sie die Platte in der Bucht, ein wenig abseits des Hafens, gefunden. Die Maserung hatte sie direkt in ihren Bann gezogen. Alter, Salz und Sonne ließen das Holzstück wie Stein aussehen. Mit ein wenig Sand und Staub darüber konnte man es kaum von einem normalen Lehmboden unterscheiden. Sie nutzte diese Eigenschaften für eines ihrer Verstecke. Unter der Platte wartete ein kleines Loch. Sie dachte nicht lange nach, sondern versteckte die beiden Goldringe und die Silbermünze darin, legte die Platte darüber, verteilte etwas Staub auf ihr und rollte die Matte zurück.
Blieben noch der Apfel und … ja, was eigentlich? Während ihrer Flucht hatte sie keinen Gedanken darauf verschwendet, was sie dem Soldaten … nein, was sie dem Spielzeugmacher geklaut hatte. Sie versuchte, sich zu erinnern, aber ihre Finger verweigerten ihr die Auskunft, und ihr Gedächtnis schloss sich dem an. Sie kramte in ihrem Ärmel, durchsuchte die vielen kleinen Taschen, die sie in mühsamer Kleinarbeit eingenäht hatte. Die Taschen waren so eingearbeitet, dass etwas Kleines einfach hinein-, aber nicht mehr ohne Hilfe hinausgelangen konnte. Mit zittrigen Händen durchstöberte sie ihre Ärmel, verhakte sich und schimpfte lautlos.
So laut sie sich auf dem Markt gab, so leise verhielt sie sich zu Hause. Sie konnte nie wissen, wie sich ihr Vater fühlte, wenn er von der Arbeit kam. Auffallen war jedoch selten gut.
Dann fand sie das kleine Ding, zog es hastig hervor und ließ es auf den Boden fallen. Noch immer fühlte sie sich beobachtet, glaubte, den Soldaten hinter dem zugigen Fenster lauern zu spüren. Sie hob es hoch, ihre Hände wie eine Schatzkiste darum geschlossen. Vorsichtig öffnete sie die Finger ein Stück weit, gerade genug, um hineinzuspähen. Ihre Augen bestätigten, was ihre Hände ihr bereits mitteilten. Das Ding war so lang wie ihr Mittelfinger und bestand aus Holz. Sie öffnete die Hände noch ein bisschen weiter, und dann sah sie es richtig.
Es war ein Schwert, ganz eindeutig. Die Klinge leicht gebogen und die Spitze abgeschrägt. Nur eine Seite besaß eine Schneide. Das Schwert ähnelte den Säbeln der Hauptmänner, allerdings ohne so breit zu sein. An der Klinge sah sie Scharten, das Holz wirkte wie alter Stahl, spiegelte sogar das Licht der Sonne in ihre Augen.
In ihrem Kopf formten sich Bilder. Sie konnte sich vorstellen, wie das Schwert durch die Luft schnitt, wie es in den Händen des Soldaten geschwungen wurde. Fast meinte sie, den Klang des Stahls zu hören, wenn er Hiebe parierte, dass Schreien von Kriegern, das Zischen der kalten Waffe, wenn sie aus der Scheide gezogen wurde.
Es sah so echt aus …
Von einem Moment zum anderen wuchs das Schwert aus ihrer Hand heraus. Es geschah so plötzlich und geräuschlos, dass Fea nicht einmal Zeit hatte, sich zu erschrecken.
Der Staub tanzte ungerührt weiter, das Licht beschien die Klinge, als hätte sie schon immer in Feas Hand gelegen. Ungläubig tastete sie nach der Schneide, wollte das Holz befühlen. Ihr Zeigefinger berührte die Klinge nur sachte. Sie bemerkte den Schnitt nicht sofort. Erst als ein kleiner Blutstropfen ihren Finger hinabrann, sah sie die feine Wunde, betrachtete sie wie einen Fremdkörper.
Aber wie konnte das sein? Das Schwert war doch nur ein kleines, unscheinbares Holzspielzeug …
So plötzlich wie das Schwert gewachsen war, schrumpfte es wieder zusammen. Diesmal erinnerte Fea sich daran, erschrocken zu zucken. Gleichzeitig meinte sie, von der Tür her ein überraschtes Ausatmen zu hören. Doch als sie schnell herumfuhr, sah sie nur den kleinen Flur und die schmutzig-weißen Wände.
Sie kehrte mit ihrem Blick zu dem Schwert zurück, aber nur kurz, damit sie es nicht wieder … weckte?
Sie blickte sich noch einmal um, dann stand sie schnell auf und ging zu dem glaslosen Fenster. Nur die Händler konnten sich Glas in ihren Fenstern leisten, die meisten anderen Bürger der Stadt mussten mit einfachen Stoffen vor den Öffnungen in den Wänden vorliebnehmen.
Sie spähte auf den kleinen Hof hinaus. Der Sand hatte wegen einer nahen Steinwerkstatt eine braune Färbung, wie man sie nur selten in der Stadt fand. Der Staub der verschiedenen Steine wehte regelmäßig zu Feas Haus herüber und verfärbte den Hof und die Hauswand immer mehr.
Als sie sich sicher war, dass niemand sie beobachtete, griff sie unter den Rand des Fensters und zog einen lehmfarbenen Lappen aus einem schmalen Spalt dort, wickelte das kleine Holzschwert hinein und stopfte den Fetzen zurück. Dann wandte sie sich um und stürzte aus der Kammer.
Ihre Mutter kam gerade zur Tür herein, über der einen Schulter ein Reisigbündel, über der anderen einen Sack mit löchriger Kleidung. Viele Menschen in der Stadt gaben ihrer Mutter Kleider zum Nähen, da sie die Arbeiten schnell, gründlich und vor allem günstig erledigte. Nur wenige wussten, dass Fea einen nicht geringen Anteil dieser Arbeit leistete. Feas kleiner Bruder Medem folgte seiner Mutter mit einem Sack Reis ins Haus.
„Fea, bist du schon da.“ Ihre Mutter stellte keine direkte Frage. Das tat sie selten. Sie stellte viel mehr fest, wie die Dinge beschaffen waren. „Hast du dich mit deinen Freundinnen getroffen.“ Fea eilte zu ihrer Mutter und nahm ihr das Reisigbündel ab.
„Weißt du doch, Mama.“ Sie trug das Holz zu dem kleinen Lager neben der Kochstelle und legte es dort ab. Fea legte immer großen Wert darauf, ihre Mutter nicht zu belügen. Natürlich konnte sie ihr auch nicht die Wahrheit sagen, also erfand sie Ausreden, die sich nach einer Wahrheit anhörten, wenn man sie so verstehen wollte. „Aber ich wollte mich nachher noch mal mit dem Mädchen von der Schmiede treffen. Du weißt schon, sie wohnt oben neben dem großen Markt. Ihrem Vater gehört die Schmiede.“
„Und du triffst dich mit ihr.“ Ihre Mutter trug den Sack Kleidung in den kleinen Raum, der ihr und ihrem Mann als Schlafraum diente. „Der Schmied hat einen Lehrling, nehme ich an.“
Fea nickte eifrig. „Sogar zwei, aber nur mit einem von ihnen ist er richtig zufrieden. Den anderen … Koro oder Kodo oder so heißt er … den mag er zwar sehr, aber er weiß nicht, ob der es bis zum Schmied bringen wird.“
„Hast du gehört, Medem, vielleicht gehst du morgen ja zum Markt und guckst dich ein bisschen in der Schmiede um. Wer weiß, mit ein bisschen Glück …“ Sie ließ den Satz unvollendet. Jeder in der Familie sorgte sich um den Jungen, da er noch immer bei keinem Meister untergekommen war, aber bereits auf sein achtes Lebensjahr zuging.
„Bevor du zu diesem Mädchen gehst, stopf bitte noch ein paar der Löcher von den Hosen aus dem Sack. Nimm dir vor allem die vor, die von Hauptmann Protek sind. Er legt immer großen Wert auf deine Arbeit.“
Fea nickte und ging zu dem prall gefüllten Sack, wühlte sich durch die Wäsche und fand die zwei weiten, sandfarbenen Hosen des Hauptmanns. Es handelte sich eindeutig um die Arbeitshosen des Wächters, denn sie bestanden aus speziell gefertigtem Leinen. Eine kleine Waage und ein Krug waren direkt unter den Hosenbund eingestickt, das Wappen der Stadtwache.
Fea untersuchte die Löcher und machte sich dann an die Arbeit. Nur Augenblicke später betrat ihr jüngster Bruder Bika das Haus und sah sich verstohlen um. Wäre Fea nicht durch ihre Arbeit abgelenkt gewesen, so hätte sie den eigentümlichen Braunton seiner Kleidung und seiner Finger bemerkt und auch seinen hastig auf sie gerichteten Blick.
Koro
„D. E. R, der, H. E. R. R. SCH. E. R, Herrscher, H. E. R. R. SCH T, herrscht. Der, Herrscher, herrscht.“
Im Laufe seines Lebens hatte es immer wieder Situationen gegeben, die Koro mit Hilfe seiner körperlichen Kraft bewältigt hatte. Schon als Kind waren die meisten anderen Kinder mit seinem Schlag besser vertraut gewesen als mit seinem Namen. Natürlich hatte Zeinen dies alles geändert und Koro vermied es inzwischen, sich zu prügeln, doch die Erinnerung an kleine und größere Raufereien und Kämpfe steckte tief in seinen Muskeln. Nun aber stellte er sich einem der schwersten Gegner, der jemals seinen Weg gekreuzt hatte.
„D. ER, der, R. Ä. U. BE R, Räuber, R. A. U. B. T, raubt. Der Räuber raubt.“
Sein Lehrer nickte zufrieden. Noch immer ärgerte es Koro, dass er von einem Zehnjährigen in Lesen und Schreiben unterrichtet wurde, aber Basco machte sich nie über ihn lustig. Im Gegenteil, er bewies einen solchen Eifer und eine solche Freude dabei, dass er Koro damit ansteckte.
Seit vier Tagen ging er jeden Nachmittag in das Archiv und übte sich dort in der Kunst der geschriebenen Worte.
Die Idee, Lesen zu lernen, spukte schon seit Jahren in seinem Kopf herum, aber er hatte sich nie die Zeit dazu genommen, hatte sich immer ganz auf seine Schmiede- und Kampfkunst konzentrieren wollen. Doch vor einigen Tagen hatte der Schmied ihn an die Seite genommen und ihm dröhnend erklärt, dass man als Schmied unbedingt Lesen und Schreiben beherrschen müsse, wenn man es zu etwas bringen wollte.
Koro hatte darauf hingewiesen, dass sein Meister selbst weder das eine noch das andere beherrsche, woraufhin der ihn an Terka erinnert hatte, den Mann seiner ältesten Tochter. Dieser sah aus wie ein Händler und hockte die ganze Zeit über in einem kleinen Raum in der Schmiede und starrte Blätter an. Manchmal schrieb er auch etwas darauf und starrte dann wieder stundenlang.
Niemand hatte Koro je erklärt, was Terka tat, aber es schien keinen zu stören, dass er nicht arbeitete, sondern einfach nur da saß.
Der Meister erklärte Koro kurz etwas über Einnahmen und Ausgaben. Darüber, was man glaubte zu haben, und was hinterher herauskam, wenn man es aufschrieb und überprüfte. Deshalb beschäftigte er Terka. Nicht ohne Grund sei er einer der reichsten Schmiede, denn die anderen glaubten immer nur, viel zu haben, bemerkten aber kaum, was sie täglich alles verloren. Er hingegen wusste, was er besaß, und was noch viel wichtiger war: Was er jeden Tag verlor. Und gleichzeitig könne er dem Schreiberling nur vertrauen, weil er der Mann seiner Tochter sei, der es nie wagen würde, ihn zu beklauen. Aber wenn ein Schmied selbst Lesen und Schreiben könne, dann erübrigte sich so jemand wie Terka.
Also lernte Koro die Kunst der Schrift. Insgeheim glaubte er aber, dass noch mehr dahintersteckte, denn der andere Lehrling musste nicht lesen oder schreiben. Und das, obwohl er schon ein Jahr länger als Koro in der Schmiede arbeitete.
Und irgendwie, das musste Koro zugeben, bereitete ihm das Lesen und Schreiben Spaß. Es eröffnete ihm eine neue Welt. Basco erzählte ihm immer wieder von Hunderten und Tausenden von Geschichten, die aufgeschrieben nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Dabei brannte in den Augen des Jungen ein Feuer, das Koro faszinierte. Gleichzeitig weckte es in ihm die Erinnerung an seinen Vater, der früher nachts mit ihm auf dem Dach gesessen hatte, mit ihm in die Sterne geblickt und ihm Geschichten erzählt hatte. Märchen von kleinen, frechen Wichten, von starken Helden und mächtigen Königen. Die Heldensagen hatte er immer am liebsten gehört und oft seinen Vater gebeten, sie ihm noch einmal zu erzählen. Doch irgendwann war sein Vater auf eine Handelsreise gegangen und er und das Schiff kehrten nie wieder heim. Seitdem trauerte Koros Mutter und wartete auf ihren Mann. Und Koro wartete darauf, groß und stark genug zu werden, um nach seinem Vater zu suchen.
„DER. H. Ä. N. D. L. E. R, Händler, H. AN. DE. L. T, handelt. Der Händler handelt.“
„Sehr gut. Ich muss sagen, du machst gute Fortschritte, Koro.“ Koro spürte, dass Basco ihm über die Schulter blickte. „Es erstaunt mich, wie gleichmäßig du schon schreibst. Wenn du so weitermachst, dann brauchst du bald keinen Lehrer mehr.“
Ein stolzes Lächeln stahl sich auf Koros Lippen, und er spürte, wie seine Augen kurz aufblitzten. Dann erinnerte er sich daran, dass er vor einem Jüngeren stand … nein, saß, und wurde wieder ernst.
„Danke, aber ich bin noch lange nicht so gut, dass ich auf deine Hilfe verzichten könnte.“
„Hm. Und du bist dir ganz sicher, dass du nicht schon einmal irgendwo lesen gelernt hast?“
Koro nickte und wandte sich wieder dem Blatt zu.
Er spürte, dass Basco über etwas nachdachte, und dieses Denken füllte die beruhigende Stille des Archivs. Noch immer fühlte Koro sich wie ein Fremdkörper inmitten all der alten Schriftstücke. Er bemerkte, dass er sich zu laut bewegte, dass er zu laut atmete und dass er auf eine seltsame Art und Weise zu laut dachte. Basco hingegen schien ein Teil des Gebäudes zu sein. Manchmal bemerkte Koro ihn erst, wenn der Junge ihm auf die Schulter klopfte.
„Erinnerst du dich an die Geschichte, die ich dir vor ein paar Tagen erzählt habe?“, brach Basco schließlich das Schweigen. „Ich meine die von der Frau, die von dem König geraubt wurde?“
Koro nickte stumm und versuchte sich weiter auf das Blatt zu konzentrieren.
„Nun, ich möchte dir … also es ist so, dass …“ Der Jüngere hielt inne, schien auf etwas zu lauschen, nickte dann und sprach: „Komm einfach mal mit, ich will dir was zeigen.“
Zögerlich drehte sich Basco um und ging aus dem kleinen, für Gäste bestimmten Lesezimmer hinaus. Dabei blickte er immer wieder über seine Schulter, als wäre er unsicher, ob Koro ihm folgte.
Koro wunderte sich etwas über das verstohlene Verhalten seines Lehrers, folgte ihm dann aber.
Der kleine Lesesaal lag neben der Treppe, die in die obere Etage der Bibliothek führte. Gästen war es streng verboten, einen anderen Raum als das Lesezimmer zu betreten. Wenn man ein bestimmtes Schriftstück suchte, so wendete man sich direkt an den Bibliothekar, und dieser bemühte sich, einem den Wunsch zu erfüllen. Die oberen Etagen stellten so etwas wie ein heiliges, aber verbotenes Land dar, das nur ausgewählte Menschen, also der Bibliothekar und sein Lehrling, betreten durften. Nicht einmal der Kämmerer hatte je einen Fuß in die Archive gesetzt.
Und nun ging Koro leise, fast verstohlen, hinter Basco die Treppe hinauf. Die Stufen mündeten in eine kleine Galerie, die in drei verschiedene Räume führte. Zielstrebig ging Basco auf den Raum zu, der direkt über dem kleinen Lesezimmer liegen musste.
„Dies ist das Sagenarchiv“, flüsterte Basco verschwörerisch, fast so, als würden sie planen, den Kämmerer zu stürzen. „Basile… mein Meister, der Archivar, hält nicht viel von Sagen. Er meint, man könne besser gleich in das historische Archiv gehen und sich mit der Wirklichkeit befassen.“ Erneut schloss Basco kurz die Augen und schien zu lauschen. „Gut, er ist nicht in der Nähe.“
Koro rechnete fast damit, dass jeden Moment Männer in schwarzer Kleidung und mit ernsten Mienen aus den Schatten traten und sie in die dunklen Geheimnisse der politischen Welt einweihten. Wahrscheinlich gab es irgendeine geheime Bruderschaft, oder auch Schwesternschaft, die sich seit Jahrhunderten im Verborgenen hielt und sich über ausgeklügelte, versteckte Symbole in … ja, in Gemälden untereinander austauschten. Bestimmt gab es Verwicklungen, die bis in die Hauptstadt reichten …
„… dich?“
Koro bemerkte, dass der Jüngere ihm eine Frage gestellt hatte. Nicht selten passierte es, dass er sich in Gedanken verlor und sein Kopf sich irgendwelche absonderlichen Dinge ausdachte, womit er dann gar nicht mehr aufhören konnte.
„Äh, wie bitte?“, fragte er hilflos. Im Vergleich zu Bascos geflüsterten Worten dröhnten seine wie ein Gewitter. Der Jüngere zuckte zusammen, als hätte man ihm eine Ohrfeige verpasst, und atmete dann betont beherrscht ein und aus.
„Welche Geschichten, ich meine Märchen, Geschichten beziehungsweise Geschichte … die gibt’s ja drüben, also nebenan im historischen Archiv, also welche Märchen hörst du gerne?“
„Ich? Also …“ Koro überlegte kurz. Immerhin stand er vor einem jüngeren Kind, da konnte er schlecht zugeben, dass er sich immer noch von seiner Mutter Märchen erzählen ließ. „Also … als ich so alt war wie du, da habe ich gerne Sagen über große Krieger und Helden gehört. Wie die von dem Heroen Pars La Val.“
„Ah, ja, die kenne ich. Recht unterhaltsam. Möchtest du sie selbst lesen?“
„Selbst lesen? Ich? Muss man dafür nicht erst eine Prüfung bestehen?“
„Nein, eigentlich nicht. Wieso sollte man?“
„Sind die Worte nicht anders? Schwieriger?“
„Nun, der Verfasser von Pars La Val war nicht für seine gute Handschrift bekannt. Tatsächlich brauchte man drei Gelehrte, um sie zu entziffern. Aber die hier lagernde, nein, ruhende Ausgabe ist überarbeitet.“
„Dann kann ich die Worte auch lesen?“
„Bestimmt. Bei einigen könntest du etwas Übung brauchen, aber bei den meisten anderen …“
Eine Unruhe erfasste Koro, die er bisher nicht gekannt hatte. Alles in ihm sehnte sich nach dieser Sage, sehnte sich danach, sie selbst zu entdecken, zu erfahren. Es war, als würden die Bücher, Schriftrollen und Pergamentstapel ihn rufen und locken, ihm ihre Geschichten förmlich zuschreien. All die hier ruhenden Gedanken, all die Geschichten, all das Erfahrene! Fast konnte man taub davon werden, wenn man dem Ganzen zu sehr Beachtung schenkte. Aber wenn er sich auf eine Rolle, ein Schriftstück konzentrierte, dann trat der Lärm in den Hintergrund, wich einer packenden Stille. Die Bücher wirkten wie Münder, bereit, alles preiszugeben, wenn sie dafür nur ein bisschen Leben eingehaucht bekamen. Koro lächelte.
Die Bücher erwiderten es.
„Dann los.“
Jindari
Natürlich gab es Ärger. Sie bekam immer Ärger, wenn ihr Kleid schmutziger war, als es normalerweise bei einem Spaziergang durch die Stadt hätte werden dürfen.
Es passte nicht zu einer Dame. Eine Dame, oder ein Mädchen, das irgendwann eine Dame werden sollte, rannte nicht durch die Straßen, sie schritt durch den Pöbel. Auf gar keinen Fall sprintete sie über die Mauern und sprang in halsbrecherischer Art und Weise von einem Haus zum nächsten, schon gar nicht in ihrem neusten Kleid, junges Fräulein, und setzte sich dann auch noch einfach im Garten von Ume Ouliad, der alten Schnepfe, auf den Rasen. „Und überhaupt, was ist denn das für eine Art, sich bei fremden Leuten, noch dazu bei einem Lehrer für Straßenschläger auf die Lehmmauer zu setzen und sie anzustarren? Und dann lässt du auch noch teures Pergament im Garten zurück. Was, wenn diese unkultivierte alte Person bei uns an die Haustür klopft und deine Sachen zurückgibt und wir uns auch noch bedanken müssen, na? Belfia, das alte Waschweib, würde sich die Lippen trocken schwatzen, wenn sie das mitbekäme. NIRGENDWO könnten wir uns dann noch blicken lassen!“
Irgendwann hatte Jindari bemerkt, dass es nicht ihre eigenen Gedanken waren, die durch ihren Kopf dröhnten, sondern die keifende Stimme ihrer Mutter.
Sie musste immer höllisch aufpassen, dass sie damit nicht durcheinander kam, oder – und das war noch schlimmer – dass sich diese Stimme in ihr festsetzte. Das würde bedeuten, ihrer Mutter recht zu geben, ihr und diesen ganzen eitlen Frauen aus den alten Handelshäusern.
Überhaupt fragte sie sich, was diese Frauen so besonders machte, dass sie fanden, ihre Meinung sei grundsätzlich die richtige. Sie sprachen immer viel über Kultur und dergleichen. Über Gemälde, Poesie und die schönen Künste. Aber wenn sie sich wieder trennten, erlosch auch das Interesse an diesen Dingen. Stattdessen kannte sich ihre Mutter wunderbar mit Gerüchten aus, und ihre spärlichen Fähigkeiten im Lesen verwandte sie nur auf die Lektüre der Flüsterbriefe.
Die Flüsterbriefe … oh wie Jindari die hasste. Die Verfasser kannten ihre Kunden, daher war alles, was in diesen Briefen stand, groß und dick geschrieben und jedes Wort besaß nach Möglichkeit nicht mehr als zwei Silben. Mit echter Literatur hatte das genauso viel zu tun wie … wie … na, wie eben etwas, das überhaupt nicht zusammenpasste. Ihre Mutter bestand darauf, das Jindari sich den wöchentlichen Flüsterbrief durchlas, da er eine gute Allgemeinbildung vermittle, aber genauso gut konnte sie einer Mauer zuhören. Das Einzige, was man von den Flüsterbriefen erfuhr, war, wer mit wem vielleicht was wie und wo gemacht habe. Das betraf aber nur die Menschen, die in einer der Händlerfamilien lebten. Andere schienen für die Verfasser gar keine richtigen Menschen zu sein, sondern nur Personen oder Leute, an einem gnädigen Tag auch wohlwollend die Anderen genannt.
„Dein Lehrer wird bald kommen. Ich hoffe, du hast deine Schreibarbeiten erledigt. Barahk ist zwar kein Händler, aber er besitzt eine gewisse Kultiviertheit, die für eine Person seines … Standes überraschend ist.“
Er kann zum Beispiel einen Brief lesen, ohne dass sich dabei sein Mund bewegt oder er einen Finger als Lesehilfe braucht. Und er benötigt dafür auch keinen ganzen Vormittag.
„Natürlich solltest du dir kein Beispiel an gewissen Eigenheiten nehmen. Er hat manchmal seltsame Flausen, aber die sollten dich gar nicht berühren. Konzentrier dich einfach auf das Sachliche, auf die Kultur, die dahinter steckt.“
Und das war noch so eine Angewohnheit ihrer Mutter: Sie neigte zur übertriebenen Betonung von Wörtern, auf die sie besonders stolz war. Die Flüsterbriefe gaben wöchentliche Auskunft über neue, wichtige Worte und über alte, verbrauchte. Dabei wurde nicht die Bedeutung vermittelt, sondern lediglich zu welchen Sätzen sie passten und wie oft man sie in einer normalen Unterhaltung nutzen und einstreuen sollte.
Jindari hatte in den letzten Jahren während solcher Standpauken die Fähigkeit entwickelt, sich ganz auf andere Dinge zu konzentrieren. Während ihre Mutter den Monolog weiterführte, verfolgte nur ein winziger Teil ihres Bewusstseins die Rede. Sie konnte so rechtzeitig wieder aufwachen, wenn bestimmte Stichwörter fielen.
„… kannst du dir vorstellen, was es heißt, noch nie in einem Flüsterbrief von Frau von Pfirsich erwähnt worden zu sein. Der Schlüssel heißt hierzu Kultur! Und nun kannst du in dein Gemach gehen und dich auf den Unterricht vorbereiten.“

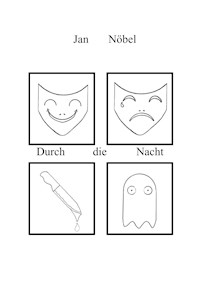













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













