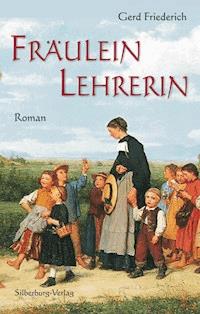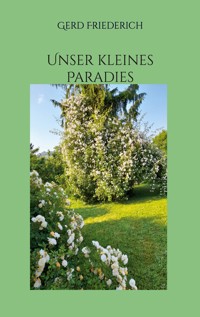Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fürst Samarow, unter dem Künstlernamen Eugen Maron bekannt, mittlerweile 84 Jahre alt, verbringt viel Zeit in seinem Atelier. Er ist einer der angesehensten Maler im Königreich Württemberg. Kaum ist das Gemälde fertig, das sein eigenes Leben widerspiegeln soll, geht er mit seinem Freund Alex auf große Reise. Dabei denkt er immer wieder zurück an die Schule für Lithografie in München, an seine Jahre in Heilbronn, an die Fahrt nach Odessa und die letzten Jahrzehnte, an seine einzigartige Glückssträhne, seine Verfehlungen und die Schicksalsschläge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Friederich, aufgewachsen im hohenlohischen Langenburg und schwäbischen Bietigheim an der Enz, studierte in Würzburg fürs Lehramt (Deutsch, Kunst, Geschichte, Geografie) und berufsbegleitend noch zweimal, zunächst in Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Landeskunde), wo er mit einer Arbeit zur Schulgeschichte promovierte, und viele Jahre später in Nürnberg (Malerei). Er arbeitete als Lehrer, Heimerzieher, Personalreferent, Schulrat, Lehrerausbilder und veröffentlichte viel Fachliteratur. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
Inhalt
Stuttgart, Juli 1872
Bruchsal, Juli 1872
Paris, Juli 1872
Frankfurt, Juli 1872
Kassel und Göttingen, August 1872
Hamburg, August 1872
Travemünde, August 1872
Wismar, Ende August 1872
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
(Rainer Maria Rilke)
Stuttgart, Juli 1872
Heute muss es gelingen!
Alt werden ist kein reines Vergnügen, aber alt werden ohne dieses Bild?
Niemals!
Den Kopf gesenkt, in eine dicke Wolldecke gewickelt, erwarte ich in meinem Atelier, was der Tag bringen mag. Der Garten vor mir liegt fahl und schweigsam im ersten Morgenlicht. Der Sturm, der gegen Mitternacht ums Haus geheult und Regenschauer gegen die Fensterscheiben geklatscht hat, dass das Atelier an allen Verstrebungen und Nieten ächzte und zitterte, hat sich gelegt. Vom nächtlichen Inferno ist nichts mehr zu hören und zu sehen. Eine gelbgetigerte Katze schleicht auf Kieswegen um die Blumenrabatte und schnuppert. Das merkwürdige Schimmern am Horizont, das mich zunächst beunruhigte, bedeute absolut nichts, hat mir meine Frau vorhin versichert. Ein strahlender Sommertag stehe uns bevor.
Mein Sessel aus heimischer Weide, mit vielen Kissen ausgepolstert, ist bequem, kann ich doch die Beine auf einem Hocker ausstrecken.
Meine Kehle ist trocken. Der kleine Schluck Wasser erfrischt. Vorsichtig stelle ich das Glas neben die Karaffe zurück auf den Beistelltisch.
Die dumpfen Schmerzen in meinen Schläfen habe ich zurechtgewiesen: Jetzt nicht! Morgen kümmere ich mich um euch.
Und wenn es nicht gelingt? Den alten Widerspruchsgeist bügele ich sofort nieder: Quatsch! Warum sollte es denn nicht gelingen?
Die ganze Nacht habe ich hier verbracht. Auf meine Bitte hin hat meine Frau gegen Morgen die Flügeltüre zum Garten geöffnet, als sie mich aufsuchte und nach meinen Wünschen fragte. Frische Luft strömt herein und verbreitet den belebenden Geruch von feuchter Erde und dampfenden Bäumen, Sträuchern und Stauden.
Heute muss es gelingen!
Mir kommt in den Sinn, dass ich viele Wünsche, Vorstellungen und Träume in meinem Leben gehabt habe. Manche sind in Erfüllung gegangen. Vieles ist unerreicht geblieben oder ist mir wieder aus den Händen geglitten. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Leben zufrieden.
»Mir geht es ordentlich«, habe ich meiner Frau versichert. Die Schmerzen erwähnte ich nicht. Damit will und muss ich allein fertigwerden.
Gerade heute will ich an nichts denken, das belasten könnte. Denn jetzt gilt es, voller Tatendrang das Jahrhundertwerk zu vollenden.
Ich bin am Abend wieder nicht ins Schlafzimmer gegangen, konnte ich in letzter Zeit doch nicht mehr schlafen. Viele Nächte bin ich nur noch wach unter dem Federbett gelegen und habe zur Decke gestarrt. Hier im Atelier, beim Duft der Natur und mit Blick auf Narzissen, Flieder und Clematis, den geliebten Nussbaum und den Himmel, vergehen die Stunden viel schneller, so will es mir scheinen.
Auf der großen Staffelei vor dem Fenster steht das Bild, das ich heute zu Ende malen will.
Die Sonne über dem Meer soll es einfangen, die unter den Wolken hervorschaut. Sie erleuchtet ein paar Wellen und einen schmalen, grünen Saum vor dem Waldrand. Das Wasser graublau bis türkis, der Himmel tiefblau und die Sonne von weiß über gelb bis blutrot. Es soll ein geheimnisvolles Gemälde werden, das einen Hoffnungsschimmer in die Düsternis setzt, wie auch ich in den letzten Jahren, allen Zipperlein zum Trotz, fast immer heiter geblieben bin, voller Zuversicht auf eine bessere Welt.
»Sie malen das Abendrot?«, hat der Student am Vortag gefragt.
»Woraus schließen Sie das?«
»Aus den Farben der Sonne: weiß, gelb und rot.«
»Und wie malt man das Morgenrot?«
Der Student hat verschämt gelacht: »Weiß, gelb und rot.«
»Und wie unterscheidet sich dann das Morgenrot vom Abendrot?«
Der Student hat mich ratlos angeschaut, worauf ich zu ihm gesagt habe: »Warten wir’s ab.« Mehr nicht, denn ich weiß selbst noch nicht, ob ich die in einem Feuermeer untergehende Sonne oder ihre Wiedergeburt im strahlenden Morgenlicht malen soll.
Ich habe in den vergangenen Monaten oft vom Meer geträumt. Von Sonne und Wind, der fast immer von Westen kommt. Und ich habe geglaubt, das Salz zu schmecken und das Wasser zu riechen.
Ich mag den Wind, weil er mit jeder Böe die Schmerzen und alle trüben Gedanken aus dem Kopf bläst. Ich sehne mich nach Sonne, Meer und Wind. Aber nach Neurussland und ans Schwarze Meer will ich nicht mehr. Mit meinem früheren Leben habe ich abgeschlossen.
Ich träume oft von der Ostsee, und ich hoffe, bald ihre feinen Sandstrände unter meinen Füßen zu spüren, ihre Bodden- und Fördenküsten zu sehen, ihre vielen kleinen Inseln, ihr sanftes, freundliches Wetter und ihre reichen Hansestädte zu genießen. Ich bin noch nie dort gewesen, aber ich habe viel darüber gelesen, habe Bilder angeschaut und allerlei gehört, und fast immer nur Gutes. Auch die raue Nordsee mit ihrem Wattenmeer und den Gezeiten, in vielerlei Hinsicht das Gegenteil der Ostsee, will ich sehen.
Ob ich in meinem Alter eine so große Reise überhaupt noch wagen kann, frage ich mich jeden Tag. Mit Freund Alex habe ich schon oft darüber gesprochen. »Wart’s ab«, hat er jedes Mal orakelt.
Durch die Türe zum Hausflur kommt das Zimmermädchen mit dem Tee. Es balanciert das Tablett auf der linken Hand.
Eine schöne, junge Frau, geht mir durch den Kopf, und ich beobachte, wie sie Kanne und Tasse, beides aus feinstem Porzellan, sowie einen ebensolchen Teller mit einem Wurst- und einem Käsebrot neben Karaffe und Wasserglas auf dem kleinen Tisch abstellt. Ihre Bewegungen sind geschmeidig, ihr Auftreten zurückhaltend, ihr Gesicht fast noch kindlich und glatt.
»Wie lange bist du jetzt schon bei uns?«
»Am Johannistag sind es drei Monate, Durchlaucht.«
»Ich will kein Fürst und auch keine Durchlaucht mehr sein, also lass das bitte!« Und damit sie das nicht als Rüge auffasst, spende ich ihr ein verzeihendes Lächeln. »Und nimm das Käsebrot bitte wieder mit. Ich habe keinen Hunger.«
Sie nickt. »Brauchen Sie noch etwas?«
Als ich den Kopf schüttele, verschwindet sie wieder im Haus. Die Kanne ist ohne Deckel, wie ich es wünsche, weil so der Tee schneller abkühlt. Ich hasse heißen Tee. Kleine hellgrüne Blättchen schwimmen im Wasser, denn morgens trinke ich nur noch grünen Tee. Professor Leisinger vom Katharinenhospital hat mir dazu geraten. Täglich zwei Kannen, eine morgens, eine abends, dann würde ich hundert Jahre alt werden.
Vielleicht ist das Unsinn, doch manchmal nützt es, an solche Dinge zu glauben.
Ich trinke langsam und zwinge mich, das Wurstbrot zu essen. Appetit habe ich schon lange nicht mehr. Vielleicht wird es anders, wenn das Bild fertig ist.
Mit einem Mal, will es mir scheinen, höre ich Möwen schreien. Aber kann das sein? Kein Meer weit und breit! Oder doch? Vor langer, langer Zeit habe ich die Möwen bewundert, wie sie sogar bei aufziehendem Sturm über das Wasser segelten und auf den Wellen schaukelten. Das ist im Hafen von Odessa gewesen. Ich habe in einem Café hoch über dem Schwarzen Meer gesessen, habe den Hafen gezeichnet und den später nach mir benannten Jahreskalender erfunden, der bis heute in vielen Häusern hängt und inzwischen von meinem Sohn fortgeführt wird.
Ich setze mich aufrecht und trinke noch eine Tasse Tee. Wieder diese ziehenden Schmerzen in den Schläfen. Seit meinem Aufenthalt im Hospital ist nichts mehr wie früher.
*
Das Haus, in dem ich schon seit gefühlt prähistorischen Zeiten lebe, liegt nur wenige Schritte vom Stuttgarter Zentralbahnhof in der Schlossstraße entfernt. Eine Allee begrünt die kleine Nebenstraße, deren eine Seite fast ganz von meinem Anwesen eingenommen wird.
Wenn man mich besuchen will, muss man durch das schmiedeeiserne Tor gehen, umrankt von geschmiedetem und vergoldetem Efeu. Neben dem Tor hängt ein Messingschild. Darauf steht Maron und darunter Samarow.
Viele Leute, die vorbeischlendern, fragen: Samarow? Wer ist Samarow? Maron, Maron? Ist das nicht der Maler? Und wie kann sich der eine solche Villa leisten? Das amüsiert mich doch sehr, wenn ich hinter den Hecken in der Sonne liege und den Passanten zuhöre.
Dass ich auch Samarow heiße, eigentlich Fürst Samarow bin, wissen nur noch wenige, lebe ich doch schon seit über fünfzig Jahren in Stuttgart. Aber es stimmt schon, dass ich einst hier bei Hofe eine große Rolle spielte, Gold- und Silberminen im Ural besaß, ein großes Gut bei Odessa hatte und mit Getreideausfuhren aus Russland reich wurde. Ganz alte Leute erinnern sich, dass ich zwei Identitäten und zwei Pässe habe, einen russischen auf den Namen Fürst Ewgenij Samarow und einen württembergischen, ausgestellt auf Eugen Maron. Jetzt bin ich für meine Nachbarn und die Stuttgarter der Maler Maron, der prämierte Landschaftsbilder auf die Leinwand zaubert und gelegentlich auch Porträts auf Bestellung fertigt.
Wenn Passanten durch das lange Schmiedegitter spähen, blicken sie auf einen von Blumenrabatten gesäumten Weg. Rechts davon stehen drei Birken, zwei ausladende Rhododendronbüsche und viel blau und rot blühendes Erika. Der Gärtner muss den Pflanzen jedes Frühjahr frischen Torf geben, brauchen doch die Büsche und das Erika einen sauren Boden.
Der Weg führt zu einer breiten Marmortreppe. Steigt man die hinauf, kommt man in mein Haus. Ich nenne es Haus, aber meine Nachbarn sagen Villa, Villa Maron.
Links neben meinem Haus steht ein kleineres Gebäude fürs Personal: Hauswirtschafterin, Köchin, Zimmermädchen, Hausmeister und Gärtner. Einen Kutscher habe ich schon lange nicht mehr, weil ich nur noch selten das Haus verlasse. Und will ich doch mal wohin, dann lasse ich einen Lohnfuhrmann rufen.
Dass hinter beiden Häusern ein großer Garten liegt, wissen nur Eingeweihte. Auch mein Atelier, das hinten an mein Haus angebaut ist, kann man von der Straße aus nicht sehen.
*
»Schläfst du?« Ich höre ihre Stimme und schlage die Augen auf.
»Ich muss wohl eingenickt sein. Wann kommt der Student?«
»Frühestens in zwei Stunden.«
Meine Frau räumt den Beistelltisch ab, bis auf das Glas, in das sie Wasser aus dem Krug gießt, nimmt das Tablett auf und fragt im Weggehen, schon zum zweiten Mal an diesem Morgen: »Kann ich dir etwas Gutes tun?«
Ich schüttele den Kopf und schließe die Augen. Sie verlässt das Atelier, und ich dämmere vor mich hin.
Nach dem Aufenthalt im Hospital habe ich mich zuhause in den Garten gesetzt und über die letzten Jahrzehnte nachgedacht.
Vierundachtzig! Ein schönes Leben!
Gedankenverloren sehe ich zur Krone des Nussbaums auf.
Wieder mal Glück gehabt!
»Viel trinken«, hat der Arzt zum Abschied gesagt. »Und Alkohol meiden.«
Glück gehabt, aber was ist Glück?
Viel Geld auf der Bank? Frau, drei Kinder, ein Haus? Macht gewiss glücklich, zwar nicht immer, aber dann und wann sehr wohl. Doch das allein kann es nicht sein. Mit Geld kann man sich keine zusätzlichen Lebensjahre verschaffen. Mit Geld kann ich mein Sündenregister nicht löschen lassen. Mit Geld kann man sich keine Gesundheit kaufen. Mit Geld geraten die Kinder nicht besser.
Was ist dann Glück?
Ich trinke das Glas leer und stelle es zurück auf den Tisch.
Wahrscheinlich ist Glück für jeden etwas Anderes. Als Kind war ich glücklich, wenn man mir einen Bleistift geschenkt hat. Oder wenn ich auf dem Rücken eines Pferdes sitzen durfte. Jetzt habe ich einen angesehenen Beruf und einen großen Freundeskreis.
Damals, im Hospital, war ich vierundsiebzig. Und jetzt bin ich vierundachtzig. Vierundachtzig! Wer schafft das schon? Ich kenne nicht viele, die so alt sind.
Ist das Glück?
Wohl eher nicht!
Doch wie und woran misst man eigentlich Glück? An der Blitzartigkeit, mit der es einen überfällt? An der Dauer und Stärke?
Nein, jetzt weiß ich es: Glück ist kein Zustand, vielmehr ein Augenblicksgefühl. Mal ist es urplötzlich da. Mal stellt es sich schleichend ein. Mal kommt es laut, mal leise. Für einen Wimpernschlag sind alle Sorgen verschwunden, und die Seele atmet auf. Aber dann ist es auch schon vorbei, und alles wieder wie zuvor.
Man wird so leicht kein Haus finden, das mit allen vier Seiten nach Süden liegt. Beim Glück ist es auch so. Der Schatten gehört zum Leben wie die Sonne.
»Aber du bist ein Wunder!« Der Nussbaum strahlt im Morgenlicht und grüßt ins Atelier herein. Nach meiner Hochzeit habe ich ihn eigenhändig gepflanzt. Vor über fünfzig Jahren! Lebensbaum nannten ihn damals die alten Leute, bringe er doch Zuversicht ins Leben, sei kraftstrotzend und strahle auf die umgebende Natur und auch auf die Menschen aus.
In den ersten Jahren wuchs der Steckling sehr unregelmäßig, höchstens eine Handbreit im Jahr. Ich wollte ihn schon heraushauen. Doch dann, als hätte es der Winzling geahnt, schoss er in die Höhe, jedes Jahr etwa drei bis vier Fuß. Jetzt ist er ein mächtiger Baum, hat einen dicken Stamm und eine über dreißig Fuß breite Krone.
Ich atme den aromatischen Duft des Baumes tief ein und werfe einen dankbaren Blick auf das dunkelgrüne Blätterdach. In etwa drei Monaten darf ich wieder, wie jeden Herbst, die köstlichen Nüsse genießen. Fallen sie zu Boden, platzt die grüne, fleischige Außenschale auf. Tag für Tag sammle ich sie ein, sonst stibitzen sie die Eichhörnchen und Elstern. Mit zwei Nüssen in einer Hand kann man die verholzte Schale knacken und mit braunen Fingern die noch weiche, goldgelbe, bitter schmeckende Haut vom Kern abziehen. Schälnüsse! Dazu ein Stück Käse und ein frisches Brot! Was für eine Gaumenfreude!
Aber warum bin ich die Treppe hinuntergefallen? Habe ich im düsteren Treppenhaus eine Stufe übersehen, bin ins Leere getreten und habe das Gleichgewicht verloren? Oder bin ich für einen Augenblick nicht voll bei Sinnen gewesen und so kopfüber die Treppe hinabgepurzelt?
Der Arzt im Hospital hat mich mehrfach gefragt und prüfend angeschaut. Ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, aber der Arzt hat mir nicht geglaubt.
»Das ist verdammt wichtig«, hat mich der Arzt ermahnt. »Wenn nämlich ein gesundheitlicher Aussetzer die Ursache war, dann müssen wir alles tun, ihn zu finden. Sonst könnte er jederzeit wiederkommen. Und dann?«
Seit meiner Entlassung aus der Klinik zermartere ich mir das Hirn. Selbst weiß ich keine Antwort und fragen kann ich niemand, weil ich im Treppenhaus allein gewesen bin.
Glücklicherweise habe ich unser Vermögen notariell den Kindern überschrieben. Wenigstens darüber muss ich mir keine Sorgen machen.
*
»Das Bad ist angerichtet!« Das Zimmermädchen reißt mich aus meinen Tagträumen.
»Wie bitte?«
»Sie wollten doch heute ein Bad nehmen. Die gnädige Frau meint, bis der Student kommt, bleibe dafür genug Zeit.«
Die Comtesse de Châtillon, Hoffräulein bei Königin Katharina, hat oft von der Reinlichkeit ihrer kaiserlichen Hoheit geschwärmt. Die Königin wasche sich jeden Morgen und Abend mit Seife und nehme mindestens einmal wöchentlich ein Bad. Und sie putze die Zähne jeden Tag mit Zahnpulver auf einem silbernen Bürstchen.
Das hat mir zu denken gegeben. Ich begann, mich für Körperpflege und Sauberkeit im Haus zu interessieren, zumal die Zeitungen immer öfter über dieses Thema berichteten. Hygiene! Das neue Modewort hatte ich zuvor weder gelesen noch gehört. Nicht lange her, da wurde behauptet, Waschen sei schlecht, weil ungesund und gefährlich. Alle Krankheiten entstünden durch verseuchtes Wasser, das über die Poren der Haut in den Körper eindringt. Nun wurde das Gegenteil behauptet. Körperhygiene verhüte Krankheiten und festige die Gesundheit.
Ich probierte dies und das und kaufte mir schließlich eine hölzerne Zahnbürste mit Schweineborsten. Ich versuchte es mit Zahnreinigungspulver in der Dose, stieg dann auf Zahnseife um, die mit Pfefferminze oder Menthol angereichert war, und kam schließlich auf die mit Glyzerin versetzte Zahnpasta, die anfangs aus Amerika importiert wurde. Seitdem ziehe ich mehrmals die Woche einen gewachsten Seidenfaden durch meine Zähne.
Auch kaufte ich eine Badewanne aus verzinktem Eisenblech und ließ im Untergeschoss meines Hauses einen Baderaum mit Holzboden und Kleiderständer, Handtuch- und Seifenablage einrichten. Das Badewasser wird im Waschkessel erhitzt, der in der Waschküche nebenan steht.
Als in Stuttgart die hölzernen Wasserleitungen durch abgedeckte steinerne Gerinne ersetzt und der neue Bahnhof und andere Gebäude sowie zahlreiche Laufbrunnen mit Frischwasser versorgt wurden, ließ ich eine Wasserleitung in mein Haus legen.
Zeitgleich habe ich eine Hausordnung verkündet, wonach sich alle Familienmitglieder und Hausbediensteten morgens und abends mit Seife waschen und einmal wöchentlich ein Bad nehmen müssen. Dafür darf sich jede und jeder Bedienstete alle drei Monate bei der Hauswirtschafterin eine wunderbare Seife aussuchen. Zur Wahl stehen die klassische Kernseife sowie Seifen mit ätherischen Ölen, wie Lavendel, Rosmarin oder Lemongras, hergestellt in Klars Seifenmanufaktur in Heidelberg und gekauft beim Beißwenger in der Königstraße, gegenüber der Legionskaserne.
Jeder im Haus weiß, dass ich keine ungepflegten Fingernägel und schmutzige Kleidung toleriere. Auch bezüglich der Sauberkeit in den Zimmern und im ganzen Haus bin ich kompromisslos. Also beachtet man meine Appelle ohne Murren, denn ich zahle gut und gewähre allen Bediensteten einen freien Tag in der Woche, was sonst in keinem Haushalt in Stuttgart üblich ist. Dafür gehen meine Leute für mich durchs Feuer, zumal ich alle im Haus achte und jedermann höflich begegne. Ich kann mit Genugtuung behaupten, dass in meinem Haus eine harmonische Fröhlichkeit herrscht.
Große Feste richte ich schon lange nicht mehr aus. Aber Besucher sind immer willkommen. Sei es zu Kaffee, Tee und Kuchen, sei es zum Mittagessen oder Abendvespern. Dabei werden keine extravaganten Gerichte aufgetischt. Ich liebe einfache, schmackhafte Speisen zu Mittag. Und am Abend will ich nichts Warmes, allenfalls mal zwei Spiegeleier, eine Pastete oder eine Gemüsesuppe. Ansonsten schätze ich ein rustikales Angebot an Brot, Käse, Wurst, gelegentlich eine Terrine, frisches oder eingelegtes Gemüse und Früchte der Saison. Wenn sich jeder nach Herzenslust selbst bedient, kommt es beim Essen zu den lebhaftesten Gesprächen, was mir sehr behagt.
*
Ich recke und strecke mich, denn ich habe bemerkt, dass ich dann fast schmerzfrei und gerade gehen kann. Ich steige ins Untergeschoss hinab, prüfe im Badezimmer, ob das Wasser warm ist und Seife und Handtuch bereitliegen, schließe die Tür ab, entkleide mich und steige in die Wanne.
Jeder im Haus, also gewiss auch ich, hat Anspruch auf eine viertelstündige Badezeit. Mehr nehme auch ich mir nicht heraus. Darum schaue ich auf die französische Kaminuhr aus Rosenholz, die mir Freund Alex vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt hat. Ein wahres Meisterwerk der Uhrmacherkunst. Die Wartung des Acht-Tage-Uhrwerks mit römischem Zifferblatt und viertelstündigem Schlagwerk obliegt der Hauswirtschafterin. Es ist noch nie stehengeblieben, weshalb ich die Dame belobigt und mit drei Tagen Sonderurlaub belohnt habe.
Heute entscheide ich mich für die Seife mit Lemongras. Ich liebe ihren frischen, fruchtigen Duft, der zugleich kühlend wirkt und Stechmücken fernhält, was in diesen warmen Sommertagen sehr nützlich ist. Nach dem Einseifen stelle ich mich in die Wanne, schöpfe klares Wasser aus dem Bottich neben der Wanne und spüle die Seife ab.
Nachdem ich mich abfrottiert habe, kleide ich mich an, steige die Treppe ins Erdgeschoss hinauf und gehe wieder ins Atelier.
Das Atelier sieht nicht nur aus wie ein Gewächshaus, es ist eines. Vor die gartenseitige Rückwand der Villa hat man senkrechte und waagrechte Eisenträger montiert, Glasscheiben eingepasst und auf dem Boden glasierte Ziegelsteine verlegt.
Vom Flur des Hauses gelangt man direkt in das gläserne Atelier und von dort durch die breite Flügeltüre in den Garten. Steht diese offen, habe ich das Gefühl, ich arbeite im Freien. Dann duftet es im Atelier, als säße ich unter Bäumen oder zwischen Gerbera, Lilien, Nelken und Rosen. Und wenn ich unterm Nussbaum oder inmitten der Blumenrabatte malen will, dann stelle ich meine Feldstaffelei dorthin und genieße die Natur und das Wechselspiel von Licht und Schatten.
*
Die Stimme meiner Frau reißt mich aus meinen Gedanken. Ich bin durstig, mein Mund ist trocken, die Zunge klebt mir am Gaumen.
Sie sieht es und bringt mir sofort eine Tasse Tee und etwas Gebäck.
»Geht’s dir gut?«, fragt sie besorgt.
»Doch, doch!«, lächle ich sie an. »Das Bad hat mich erfrischt.«
Sie schnuppert. »Lemongras?«
Ich bestätige es durch Nicken. »Das passt gut zu einem schönen Sommertag.« Ich lenke ihren Blick in den Garten: »Sieh dir nur diese herrliche Blütenpracht an.«
»Jedes Frühjahr erstaunt es mich aufs Neue«, sagt sie, »dass aus kleinen, manchmal winzigen bräunlichen Samen und verschrumpelten Zwiebelchen so vielerlei Pflanzen mit wunderbaren Farben hervorsprießen.«
Das Zimmermädchen unterbricht: »Der Herr Student ist da. Darf er reinkommen?«
»Ich bitte darum.«
Ich nehme die Beine vom Hocker und schlage die Wolldecke zur Seite. Langsam stehe ich auf, während meine Frau das Atelier verlässt.
Und schon begrüßt mich der Student mit einem fröhlichen »Guten Morgen!«
»Sie sind pünktlich. Danke!« Ich reiche ihm die Hand und setze mich vor die Staffelei.
»Ich will, dass das Bild heute fertig wird.« Es klingt bestimmter als von mir beabsichtigt. »Darum machen wir es so: Sie mischen die Farben, wie ich es Ihnen sage, und reichen mir die Pinsel. Für jede Farbe ein anderer Pinsel. Und während ich male, mischen Sie neue Farben an und reinigen die Pinsel, aber bitte draußen im Garten.«
Der Student nickt.
Er hat blondes Haar, glattrasierte, feine Gesichtszüge über einem weißen Hemd und einer schwarzen Halsbinde. Einreihiges, schwarzes Sakko, nur der oberste Knopf geschlossen, wodurch die graue Weste hervorschaut. Weit geschnittene, graue Hosen aus heller Baumwolle.
»Diese bunt gemusterten Westen und karierten Hosen trägt man nicht mehr?«
Der junge Mann schüttelt den Kopf.
»Der erste Student, der mir behilflich war, Jonathan hieß er, der trug so etwas.«
»Das ist gewiss schon einige Jahre her.«
»Stimmt. Und wie heißen Sie?«