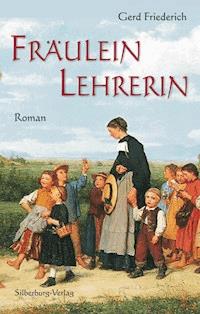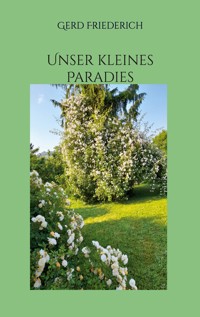Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1815. Schreckensnachricht auf dem Wiener Kongress: Napoleon ist aus Elba ausgebüxt und bedroht erneut ganz Europa. Der Vulkan Tambora im indonesischen Archipel ist explodiert. Eine Schwefelgas- und Aschewolke treibt anderthalb Jahre lang um den Globus. Zwei Sommer ohne Sonne und ohne Ernte folgen. Eine Hungernot ohnegleichen löst in Baden, Württemberg und der Schweiz eine mächtige Auswanderungswelle ans Schwarze Meer aus. Und mittendrin ein junger Mann, der im krisengeschüttelten Württemberg sein Glück findet. Wer ist er?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Gerd Friederich, aufgewachsen im hohenlohischen Langenburg und schwäbischen Bietigheim an der Enz, studierte in Würzburg fürs Lehramt (Deutsch, Kunst, Geschichte, Geografie) und berufsbegleitend noch zweimal, zunächst in Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Landeskunde) und viele Jahre später in Nürnberg (Malerei). Er arbeitete als Lehrer, Heimerzieher, Personalreferent, Schulrat, Lehrerausbilder und veröffentlichte viel Fachliteratur. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
Inhalt
Vorwort
Württemberg
Reise ans Schwarze Meer
Am Schwarzen Meer
Wossinsk
Künstler und Unternehmer
Böse Nachrichten
Bessarabien
Württemberg
Anhang
Ihr seid ein Stäubchen am Gewand der Zeit, lasst euren Streit! Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich samt euch im Weltall dreht. Mikroben pflegen nicht zu schrei’n. Und wollt ihr schon nicht weise sein, könnt ihr zumindest leise sein! Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit! Hört auf die Zeit!
(Erich Kästner)
Vorwort
Mit vierzehn hatte ich Gitarrenunterricht in Stuttgart. Jede Woche fuhr ich mit dem Zug hin und suchte nach der Musikstunde den Lesesaal der Landesbibliothek auf. Dort stöberte ich in ausliegenden alten Zeitungen, Zeitschriften und Handbüchern. So bin ich zur Geschichte gekommen, meiner Leidenschaft, die mich bis heute nicht loslässt. Nicht das, was man in der Schule lehrt, das langweilige Zeug von Kaisern, Königen, Kriegen und politischem Ränkespiel, interessierte mich, sondern die Alltagsgeschichte. Zum Beispiel: Seit wann gab es Unterhosen und Zahnbürsten? Was machten die Leute im 19. Jahrhundert, wenn sie in der Residenzstadt weilten und plötzlich aufs Klo mussten? Was aß und trank man früher, und wie verbrachte man den Feierabend, sofern man überhaupt einen hatte?
Irgendwann fiel mir auf, dass es im Lesesaal eine eigene Rubrik für »Einwanderung und Auswanderung« gab. Nach der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg fanden Glaubensflüchtlinge wie Calvinisten, Hugenotten und Waldenser in Württemberg eine neue Heimat. Doch ab 1800 wanderten viele Württemberger aus. Sie wollten Religionsfreiheit. Oder sie flüchteten, weil die vielen napoleonischen Kriege Armut, Hungersnöte und politische Unterdrückung zur Folge hatten. Zudem lockten die russischen Werber mit billigem Landerwerb, Steuerfreiheit und Befreiung vom Militärdienst. Gerade junge Männer wollten dem langen Zwangsmilitärdienst in Württemberg entgehen. Allein 1803 trafen rund siebentausend Kolonisten aus Württemberg in Neurussland ein, und es wurden von Jahr zu Jahr immer mehr. Das alles las ich in einschlägigen Journalen.
Eine Buchreihe im Lesesaal der Landesbibliothek hatte es mir besonders angetan, die »Württembergischen Jahrbücher«, scheußlich eingebundene und nach dem Staub der Jahrhunderte riechende Bücher in zwei Regalen. Herausgegeben wurden die ersten Bände von Magister Johann Daniel Georg Memminger, dem Geografen und Statistiker, der das Statistisch-Topographische Bureau des Königreichs Württemberg leitete, eines der ältesten Statistikbüros der Welt.
In diesen Jahrbüchern, das erste erschien 1818, stand alles, was es in jener Zeit über Württemberg und darüber hinaus zu wissen gab. Die Herrscherfamilie, die Ministerien, die staatlichen Ämter und detaillierte Statistiken, die erschöpfend alle Berufsfelder, Wirtschaftszweige und Gesellschaftsfragen erfassten. Dazu eine ausführliche »Chronik« und sehr ergiebige »Denkwürdigkeiten« über das Berichtsjahr, von neuesten Ausgrabungen bis zu Hagelschlag und Überschwemmungen. Es schlossen sich Nekrologe an, Würdigungen verstorbener Persönlichkeiten. Schließlich die für mich interessanteste Rubik »Abhandlungen und Nachrichten verschiedenen Inhalts«: Geschichtliches, Geografisches, Kulturelles, Kurioses usw.
Der erste Band enthielt im Rückblick Details zu den Hungerjahren 1816 und 1817. Ein Ereignis, das mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Was war die Ursache? Heute wissen wir es, damals gab es nur vage Andeutungen: Am 10. April 1815 explodierte der Vulkan Tambora im indonesischen Archipel, bis heute die größte Naturkatastrophe aller Zeiten. Eine riesige Asche- und Schwefelwolke trieb anderthalb Jahre lang rund um den Globus. Mitteleuropa und insbesondere den deutschen Südwesten traf es besonders schlimm: Hagelstürme, Frost und Schnee im Sommer, sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen in ungeahntem Ausmaß. Die Folge: eine unbeschreibliche Hungersnot, Getreidewucher, Flucht aus der Heimat, wenige nach Amerika, die meisten nach Neurussland.
Die zwei Jahre ohne Sommer lösten auch Reformen und Erfindungen zur Bewältigung der Krise aus. Sehr viel, was heute noch zählt, ist damals entstanden, zum Beispiel die Wohltätigkeitsorganisationen, das Katharinenstift, das Katharinenhospital, die Württembergische Landessparkasse, die Universität Hohenheim, diverse Schulreformen und das Cannstatter Volksfest.
Im November 2013 zeigte das Landesmuseum Württemberg die Ausstellung »Im Glanz der Zaren«. Es ging zwar vordergründig um Zarin Maria Fjodorowna von Russland (geborene Sophie Dorothee von Württemberg), Königin Katharina Pawlowna von Württemberg (Ehefrau des württembergischen Königs Wilhelm I. und Lieblingsschwester von Zar Alexander I.), Großfürstin Elena Pawlowna von Russland (geborene Charlotte von Württemberg) und Königin Olga Nikolajewna (Ehefrau des württembergischen Königs Karl I. und Tochter des Zaren Nikolaus I.). Aber zugleich veranschaulichte die Ausstellung dokumentenreich die Not jener Jahre und die Antworten darauf.
Damals begann ich mit den Vorarbeiten zu diesem Roman, der Historisches mit Fiktivem verbindet. Er will ein Licht auf jene wirren Jahre werfen. Dazu bitte auch den Anhang beachten. Vor allem aber möchte ich die Leserinnen und Leser unterhalten.
Württemberg
Heilbronn am Neckar, Juni 1815. Ein strahlender Sommertag. Tausende russischer und österreichischer Soldaten biwakierten auf dem weiten Grün zwischen Neckar und ehemaliger Reichsstadt. Mit Würfelspiel und allerlei Schabernack vertrieben sie sich die Zeit. Die Offiziere logierten in der Stadt.
Gegen halb sieben Uhr abends ritt Zar Alexander durchs Fleiner Tor. Voraus trabte, auch er hoch zu Ross, der Stabstrompeter. Er blies den Pariser Marsch, der eigens zum Einzug des Zaren in Paris im März 1814 komponiert worden war.
Kinder stürzten aus dem Haus. Männer und Frauen legten rasch alles beiseite, banden die Schürzen ab und rannten hinterher. »Der Zar ist in der Stadt!«, schallte es hundertfach durch die Gassen. »Hosianna! Der Friedensfürst ist da!«
Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Alle wollten den berühmten Mann sehen, der – gerade einmal sechsunddreißig Jahre alt – schon als mächtigster Monarch der Welt galt. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Alle wollten dem strahlenden Helden dieser kriegslüsternen Zeit huldigen, der den blutrünstigen Franzosenkaiser endlich besiegt und eben noch in Wien den Kongress zur Neuordnung Europas dominiert hatte. Achttausend Heilbronnerinnen und Heilbronner waren aus dem Häuschen.
In grüner Uniform ritt Europas Erlöser von der napoleonischen Pest auf seinem Schimmel die Fleiner Straße entlang, flankiert von ordensgeschmückten Ordonnanzoffizieren. Dicht gedrängt standen die Einheimischen und bestaunten den Vielgeliebten. Begeistert jubelten sie ihm zu, lobten ihn über den grünen Klee und priesen seine Macht und Herrlichkeit. Viele applaudierten. Der Zar grüßte huldvoll mit erhobener Hand.
Schon bog die Reiterkolonne auf den Kiliansplatz ein, gefolgt von einer großen Kinderschar. Auch hier standen die Menschen Schulter an Schulter.
»Ein dreifach donnerndes Hoch – Hoch – Hoch!«, schrie das Volk, als der Zar den Marktplatz erreichte. Ein Beifallssturm ohnegleichen brandete auf. Zurufe hallten über den Platz und hießen Seine Majestät willkommen. Tausende drängten sich im Karree und begafften das farbenprächtige Schauspiel. Die Zuschauer rempelten und schubsten, lachten und kreischten. Frauen stießen spitze Schreie des Entzückens aus. Einige fielen in Ohnmacht und mussten mit Riechsalz, kaltem Wasser und Ohrfeigen wiederbelebt werden. Viele, zu viele wollten dem strahlenden Helden so nahe wie möglich sein. Auch in allen Fenstern hingen Leute.
Da! Die Rathaustür öffnete sich. Der Stadtschultheiß trat heraus, die silberne Amtskette um den Hals. Ihm folgte in feierlichem Zug der Magistrat der Stadt. Jetzt stieg das Stadtoberhaupt die Treppe an der Rathausbalustrade hinab und bahnte sich einen Weg durch die Menge.
Zwölf Jahre zuvor war Heilbronn von einer freien Reichsstadt zur württembergischen Oberamtsstadt herabgestuft und damit zu einer Stadt unter vielen im Königreich Württemberg erniedrigt worden. Schuld daran war Napoleon. Deshalb begrüßten die Heilbronner den russischen Zaren umso freudiger und dankbarer, hatte der doch den Franzosenkaiser in die Verbannung geschickt.
»Vielleicht …«, sagte der Stadtschultheiß zu seinem Sekretär und wischte sich den Schweiß aus dem feisten Gesicht, »… vielleicht bringt uns der Zar die alte Zeit zurück.«
»Gewiss, Herr Stadtschultheiß«, beeilte sich der Sekretär und lüftete devot seinen Zylinder, »wenn wir es geschickt anstellen.«
»Seiner Majestät ein dreifach donnerndes Hoch – Hoch – Hoch!«, schrie auch der Stadtschultheiß mit hochrotem Kopf und verneigte sich vor dem weltberühmten Reiter, während die Herren Stadträte Jubelund Vivatrufe anstimmten.
Zar Alexander, eben vor dem Portal zum Rauchschen Palais angekommen, schwang sich elegant vom Pferd und übergab die Zügel an einen seiner Offiziere. Auch die beiden Generäle, die dem Zaren das Geleit gaben, saßen ab und salutierten.
»Ich danke Ihnen persönlich und Ihrer ganzen Stadt für den freundlichen Empfang«, sagte der Zar, nickte dem Stadtschultheiß huldvoll zu und grüßte erneut mit erhobener Hand in die Runde. Dann schritt er auf das Portal zu.
Das Rauchsche Palais war das größte und schönste Gebäude am Heilbronner Markplatz. Es war erst wenige Jahre zuvor errichtet worden und diente der Kaufmannsfamilie Rauch als Firmensitz und Wohnhaus. Das Palais hatte vier Stockwerke und mehr als hundert prachtvoll gestaltete und modern ausgestattete Räume.
Kaufmann Max Moritz von Rauch, vom württembergischen König sieben Jahre zuvor in den Adelsstand erhoben, verneigte sich tief und hieß den hohen Gast in seinem Haus herzlich willkommen. Zusammen mit seinem Bruder betrieb er eine Tabak-, Öl- und Farbholzmühle und besaß ein florierendes Handelsunternehmen. Die zwanzig schönsten Zimmer stellte Rauch dem hohen Gast zur Verfügung.
*
Buchdruckermeister Wilhelm Becker stand mit Eugen, seinem Zeichner und Lithografen, am Fenster und beobachtete aus dem ersten Stock seines Hauses, wie der Zar den Bewohnern der Stadt für das herzliche Willkommen dankte und Münzen an Umstehende verteilen ließ.
Aus dem Fenster nebenan sah die Meisterin entzückt dem prächtigen Treiben zu. Sie hatte ein Kissen über den Fensterrahmen gelegt, um sich bequem hinauslehnen zu können. Sie war Beckers zweite Frau, gerade einmal Anfang zwanzig, bildhübsch mit blonden Haaren, grauen Augen und einem wachen Verstand. Sie stammte aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald und war von ihren Eltern nach der Schulentlassung als Hausmädchen verhökert worden. So war sie vor ein paar Jahren nach Heilbronn und in den Haushalt des Buchdruckers gekommen. Der Meister konnte sich nicht sattsehen an der jungen Schönheit, doch seine Frau striezte das Mädchen, wann immer sich eine Gelegenheit bot.
Eines Morgens lag die Meisterin tot im Bett. Niemand konnte sich das erklären. Nach einer Anstandsfrist von einem halben Jahr heiratete der Witwer seine Hausgehilfin. Seine erste Ehe war kinderlos geblieben. So hatte er sich von seiner zweiten Frau nichts sehnlicher als einen Stammhalter gewünscht. Vergebens. Man begann schon in der Stadt zu munkeln, das könnte auch am Ehemann liegen.
»Verflixt und zugenäht!«, entfuhr es Eugen, einem jungen Mann mit lebhaften Augen, kurzem Oberlippenbart und buschigen, dunklen Augenbrauen. Er ärgerte sich und deutete auf den Druckerlehrling, der sich eben vor einem russischen Offizier verbeugte, weil der ihm eine Münze geschenkt hatte.
»Pfft!«, machte der Meister, dem man ansah, dass ihm das Essen schmeckte. Er war groß, mit einem breiten Gesicht, dicken Armen, stämmigen Beinen, einem mächtigen Bauch und einem Doppelkinn, das ihm über den Kragen quoll.
»Wertloses Zeug!« Des Meisters tiefe Stimme erfüllte den Raum, in dem sie standen, prallte von Decke und Wänden ab und schallte zum Fenster hinaus. Ein paar Leute vor dem Haus schauten verwundert herauf.
»Du spinnst wohl!«, rief eine Frau empört und zeigte dem Meister ihre Münze. Zum Beweis biss sie in das Metall. »Echtes Silber.« Die Umstehenden lachten.
Auch Eugen lachte.
Sein Meister holte aus und gab ihm eine schallende Ohrfeige, denn er war ein verbiesterter Mann, der keinen Spaß vertrug und keinen Widerspruch duldete. Weil er aber der Frau vor seinem Haus, die er als die Gattin des ehrenwerten Gerichtsschreibers erkannte, keine Maulschelle verpassen konnte, musste Eugen büßen.
Eugen schäumte. Vor Wut hätte er seinen Meister am liebsten zum Fenster hinausgeprügelt, aber er biss die Zähne zusammen und nahm sich vor, es ihm heimzuzahlen.
Sogleich hatte er eine Idee, denn er war ein kreativer junger Mann mit einer ungewöhnlichen Beobachtungsgabe.
*
Eugen schaute sich die beiden russischen Generäle gründlich an. Der Zufall wollte es, dass einer genau in diesem Augenblick unter Eugens Fenster vorbeikam.
»Herzlich willkommen in Heilbronn, Herr General«, rief Eugen dem hohen Offizier auf Russisch zu.
Der blieb stehen, sah am Haus hinauf und Eugen direkt in die Augen: »Wer bist du und woher kommst du, dass du so gut Russisch kannst?«
»Ich komme aus Russland, Herr General.«
»Und was machst du hier?«
»Ich arbeite als Zeichner und Lithograf.«
Der hohe Offizier sah den jungen Mann erstaunt an: »Lithograf?«
Eugen nickte.
»Noch nie gehört. Was macht ein Lithograf?«
»Wunderbare Bilder! Schwarz-weiße und farbige!«
»Zeigst du’s mir?«, fragte der Offizier.
»Klar!« Eugen platzte vor Stolz. Und der Meister beeilte sich, den vornehmen Russen herzlich in sein Haus einzuladen.
So erschien am nächsten Morgen eine russische Ordonnanz in der Druckerei und kündigte an, Generalfeldmarschall Fürst Wolkonski werde am Abend um sechs Uhr eintreffen.
Meister Becker bekam weiche Knie. Eine ehrwürdige Durchlaucht, ein leibhaftiger Generalfeldmarschall in seinem Haus! Unglaublich! Seine Frau hingegen lachte, putzte sich heraus und fieberte dem hohen Besuch entgegen.
Eugen frohlockte. Die halbe Nacht hatte er durchgearbeitet. Eine fast fertige Zeichnung, die einen Reiter auf einem feurigen Rappen zeigte, hatte er vollendet und dem Reiter die Gesichtszüge des russischen Offiziers verpasst. Er musste das Bild nur noch kolorieren. Die Uniform mit ihren grünen, gelben und roten Farben hatte er sich eingeprägt. Fürs Einfärben blieb bis zum Abend genügend Zeit.
Als der fürstliche Generalfeldmarschall, begleitet von seiner Ordonnanz, zur vereinbarten Zeit eintraf, begrüßte er Meister Becker recht unterkühlt, verbeugte sich vor dessen Frau Mathilde, aber hatte nur Augen und Ohren für Eugen und unterhielt sich auf Russisch mit ihm. Er bewunderte die Werkstatt und Eugens Talent, die herrlichsten Motive mit einer speziellen Tusche seitenverkehrt auf einen Stein zu zeichnen, den Stein zu ätzen und das Gezeichnete mit der Reibepresse zu drucken.
»Wie viele Exemplare können Sie von einem Stein drucken?«, wollte der hohe Gast wissen.
»So viele Sie wollen«, sagte Eugen stolz, »und in allen verfügbaren Farben.« Er führte den Fürsten vor die Bilderkrippe und zeigte ihm eine Auswahl seiner Bilder: Porträts, Szenen aus der griechischen und römischen Antike, Landschaftsmalereien, verschiedene Allegorien und Historienbilder.
Der Feldmarschall kam aus dem Staunen nicht heraus. Und als Eugen sein Geschenk überreichte, riss der allmächtige Offizier die Augen auf und lächelte, denn er erkannte sich sofort, in Galauniform, hoch zu Ross und in fabelhafter Pose. Eine Augenweide! Nicht einmal der Zar besaß ein so perfektes Porträt.
Voller Stolz zeigte er das Bild den beiden Offizieren in seiner Begleitung. Die staunten über die prachtvolle Lithografie und die lebensechte Darstellung ihres obersten Militärführers.
»Und wie haben Sie diese Kunst erlernt, junger Mann?«, wandte sich der Feldmarschall an Eugen, natürlich auf Russisch.
»Ich habe Tag und Nacht gezeichnet, bis ich es konnte. Und diese neue Kunst habe ich in der ersten und einzigen Schule für Lithografen erlernt.«
»Sie sind wirklich ein Meister Ihres Faches«, lobte der Feldmarschall. »Und wem verdanken Sie Ihr Können? Was meinen Sie?«, wollte er wissen.
»Meiner Begabung und meiner Heimat.«
»Also Russland?«, vergewisserte sich der Feldmarschall. Und als Eugen nickte, lief ein Grinsen über das Gesicht des vornehmen Besuchs. »Dann gehört Ihr Können eigentlich dem Zaren.«
Er beriet sich eingehend mit seiner Ordonnanz und wandte sich schließlich an Meister Becker, sein Offizier übersetzte: »Was hat die Ausstattung dieses Ateliers gekostet?«
Der Meister zuckte die Achseln. Er war sehr verstimmt.
»Dann suchen Sie bis morgen früh alle Rechnungen heraus.«
Der Meister wollte widersprechen, doch der Feldmarschall fiel ihm ins Wort: »Wenn Russland einen so begabten jungen Mann hervorgebracht hat, dann wollte es bestimmt nicht, dass sich ein Heilbronner Buchdrucker damit eine goldene Nase verdient. Vielmehr wollte es, dass der junge Mann sein Können Russland zur Verfügung stellt.«
Meister Becker packte der Zorn, aber er schluckte dreimal und hielt wohlweislich den Mund, warf Eugen und seiner Frau giftige Blicke zu, verließ grußlos nach der russischen Delegation das Haus und warf die Tür ins Schloss.
»Jetzt hockt er sich ins Wirtshaus und lässt sich volllaufen«, klagte die Meisterin und brach in Tränen aus. »Ach, wenn mein Wilhelm nur nicht so jähzornig wäre«, schluchzte sie und konnte sich nicht beruhigen. Eugen, der längst bemerkt hatte, dass es um die zweite Ehe seines Meisters schlecht bestellt war, legte tröstend seinen Arm um die junge, unglückliche Frau. Sie ließ es nicht nur geschehen, nein, sie warf sich an seine Brust, weinte noch ein bisschen, lachte plötzlich hell auf über die Verbohrtheit ihres Mannes, schloss die Haustür von innen ab und ließ den Schlüssel stecken. Dann führte sie Eugen in ihr Schlafzimmer. Dort vertrieben sie sich aufs Angenehmste die Zeit, bis es an der Haustür klopfte und rüttelte.
Am nächsten Morgen betrat der russische Offizier, der gut Deutsch sprach, in Begleitung eines Soldaten die Druckerei, verlangte die Rechnungen, addierte die dort aufgeführten Beträge und legte Meister Becker wortlos die Summe in Silbergulden auf den Tisch. Dann bat er um Schreibzeug und Papier, fertigte eine Quittung, die Meister Becker zähneknirschend unterschreiben musste, und stellte mit erhobenem Zeigefinger fest: »Damit ist alles, was sich im Atelier des jungen Mannes befindet, russisches Eigentum. Bis zum Abtransport nach Russland wird eine russische Wache jedem den Zutritt zum Atelier verwehren, außer dem jungen Lithografen.«
Er grüßte militärisch und ließ Meister Becker sprachlos und zornbebend zurück. Der Soldat bezog Posten vor der Tür zum Atelier, nicht wissend, dass es einen Hintereingang ins Haus gab. Wie bei herrschaftlichen Gebäuden durchaus üblich, verfügte auch Beckers Haus über zwei Eingänge, das vornehme Portal zum Marktplatz hin und die Hinterhoftüre. Wer das Portal öffnete, der sah geradeaus die prachtvolle Treppe in den ersten Stock, wo der Hausherr mit seiner Frau wohnte. Auf der linken Seite war der Eingang zur Druckerei, auf der rechten die Türe zur lithografischen Werkstatt, vor der jetzt ein russischer Soldat stand. Durch die Hinterhoftüre gelangte man in ein enges, tristes Treppenhaus mit Zugängen zum Erdgeschoss, zur Wohnung des Hausherrn und zum zweiten Stock, wo das Dienstpersonal hauste. Hintereingang und Hintertreppe waren dem Personal vorbehalten. Meister Becker wurde hier noch nie gesichtet. Er verließ sein Haus ausnahmslos durch das Portal zum Marktplatz, und genauso betrat er es wieder. Das war seiner Selbstsucht geschuldet. Er wollte um jeden Preis als bedeutender Bewohner dieser Stadt wahrgenommen werden.
Der russische Offizier war schon an der Haustür, als er unvermittelt stehen blieb und sich noch einmal umdrehte: »Junger Freund«, sagte er zu Eugen, »bitte kommen Sie heute um vier Uhr ins Rauchsche Palais. Generalfeldmarschall Fürst Wolkonski möchte Sie sprechen.« Und an Meister Becker gewandt: »Sollte meinem jungen Freund oder dem Atelier Schaden zugefügt werden, ziehe ich Sie zur Rechenschaft.«
*
Eugen blieb bis zur vereinbarten Zeit in seinem Atelier. Hier wähnte er sich sicher vor den Beschimpfungen und Ohrfeigen seines Meisters. Hier konnte er in aller Ruhe an einem neuen Reiterbild arbeiten, das den Zaren zeigen sollte.
Kurz vor vier rannte er über den Marktplatz und meldete dem Wachhabenden vor dem Palais, der Generalfeldmarschall habe ihn einbestellt.
Kurze Zeit später wurde er mit höchster Ehrerbietung ins Zimmer des Fürsten geführt, der sich erfreut zeigte, den Künstler zu sehen.
»Ich habe mit dem Zaren über Sie gesprochen, junger Freund«, kam Wolkonski ohne Umschweife zur Sache. »Er hat entschieden! Sie müssen nach Russland zurückkehren! Am besten nach Odessa! Odessa ist unser Militärhafen für das Schwarze Meer und der Sitz des neuen Gouvernements von Neurussland. Sie sollen in Odessa eine Werkstatt für Zeichenkunst und Lithografie einrichten und begabte junge Leute in Ihrer Kunst ausbilden.«
Eugen strahlte übers ganze Gesicht. Er hatte damit gerechnet, bald abreisen zu müssen. Allerdings hatte er befürchtet, er würde künftig sein Leben im Tross der russischen Armee fristen. Darum war ihm die Rückkehr in die Heimat höchst willkommen.
»Wann soll ich abreisen?«
»Etwa in einer Woche.«
»Und womit soll ich in Odessa das Atelier einrichten?«
»Alles, was sich in Ihrer Werkstatt befindet, wird unsere Armee nach Odessa transportieren. Und für die Reise und den Neubeginn in Odessa werde ich sorgen. Hier ein Vorschuss.«
Er gab ihm ein paar Zettel. Eugen warf einen kurzen Blick darauf und riss die Augen auf. Fünfzig-Rubel-Scheine. Fünf Stück. Zweihundertfünfzig Rubel insgesamt.
Eugen bedankte sich mit einer tiefen Verbeugung. Jetzt wirst du reich, fuhr es ihm durch den Kopf.
»Verpacken Sie in den nächsten Tagen alles, was in Ihrem Atelier ist. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an meine Ordonnanz.«
Damit war Eugen huldvoll entlassen. Er eilte über den Marktplatz, setzte sich in seinem Atelier an den Tisch und legte die fünf Scheine vor sich hin. Er hatte noch nie einen Fünfzig-Rubel-Schein gesehen, geschweige denn besessen. Er wusste, dass Zarin Katharina die Große ihre Kriege gegen die Türken erstmals mit Papierrubeln beglichen hatte, die so viel wert waren wie das Metallgeld. Dass die Kriege unter den Zaren Paul und Alexander mit Papiergeld finanziert wurden, wusste er auch. Nur dass das Papiergeld seitdem an Wert einbüßte, wusste er nicht. Darum war es ihm auch egal.
Eugen verglich die Geldscheine sehr sorgfältig. Sie waren in allem identisch bis auf die dreimal aufgedruckten siebenstelligen Seriennummern.
Vier Scheine steckte er in die Schublade unter dem Tisch, den fünften untersuchte er mit der Lupe. Er rieb das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger. Es war dünn. Er hielt es gegen das Licht und entdeckte das umlaufende Wasserzeichen. Er strich über das Papier und ertastete zwei Prägestempel, schwach zu erkennen.
Dann lehnte er sich zurück und dachte nach. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Wie leicht wäre es für ihn, solche Scheine herzustellen.
Am einfachsten wäre der Aufdruck zu fälschen: »Dem Überbringer dieser staatlichen Anweisung wird die Assignationsbank fünfzig Rubel in gängigem Geld des Jahres 1815 zahlen. Bankdirektor …« Es folgte eine Originalunterschrift mit schwarzer Tinte. Oben mittig und unten links und mittig stand die siebenstellige Seriennummer. Unten noch zwei Originalunterschriften.
»Respekt«, murmelte Eugen, »bisher absolut fälschungssicher. Aber«, er kratzte sich am Hinterkopf, »mit der nagelneuen Lithografierkunst könnte man vielleicht eine Kopie wagen.«
Er studierte das Wasserzeichen. Es war zwar schon beim Papierschöpfen entstanden, doch mit einer Mischung aus Olivenöl und weißlichen Farbpigmenten ließe es sich nachträglich aufdrucken. Er hatte es schon selbst ausprobiert. Glücklicherweise wussten das nur wenige Fachleute.
Die meiste Arbeit dürften die beiden Prägestempel machen. Auf dem linken waren Fahnen zu sehen und ein Adler, der auf einer Kanonenkugel saß. Die Umschrift lautete: »Er bietet Sicherheit und Schutz.« Der rechte zeigte einen Felsen im Meer mit der Umschrift »Unzerstörbar«.
Zwischen den Prägestempeln war der Wert der Note aufgedruckt: FÜNFZIG in weißen Großbuchstaben auf schwarzem Rechteck, darunter 50 in Ziffern.
Die Rückseite war blank, bis auf eine vierte Unterschrift, genau in der Mitte platziert.
*
Eugen hielt es nicht mehr auf seinem Platz. Er rannte aus dem Haus und weiter zum Bollwerksturm, wo die Papier- und Walkmühle am Neckar stand. Den Besitzer Johann Valentin Ebbeke kannte er gut, hatte er doch schon oft Papier eingekauft, sowohl für die Druckerei des Meisters als auch für seine eigenen Lithografien.
Ebbeke stand vor seiner Mühle und sah dem Herbeieilenden belustigt entgegen.
»Ist mal wieder das Papier alle?«
»So ist es, Meister Ebbeke«, bestätigte Eugen. »Aber diesmal muss es ein feines weißes Papier sein.«
»Dann such dir aus, was du brauchst. Weißt ja selber, wo die feinen Papiere liegen.«
Eugen lief ins Lager, prüfte die verschiedenen Papiersorten zwischen Daumen und Zeigefinger und verglich sie immer wieder mit der Fünfzig-Rubel-Note in seiner Hosentasche.
Endlich fand er, was er suchte: weißes dünnes Papier, die Maserung wie beim Geldschein.
Er rollte sechs Bogen vorsichtig zusammen und trat vors Haus.
Der Papiermüller hob warnend den Zeigefinger: »Das sind meine besten Papiere.«
»Was soll’s kosten, Meister Ebbeke?«
»Drei Silbergulden, weil du’s bist.«
Eugen feilschte nicht, obwohl er glaubte, übervorteilt zu werden, zahlte und beeilte sich, in sein Atelier zu kommen.
Unterwegs haderte er mit sich. Noch hatte er sich nichts zuschulden kommen lassen. Noch war er ein ehrlicher junger Mann, zwar noch grün hinter den Ohren, aber voller Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er in Zukunft nutzen könnte.
Ist doch bloß ein Druck wie jeder andere auch, tröstete er sich. Ob ein Bild vom Generalfeldmarschall hoch zu Ross oder ein Fünfzig-Rubel-Schein, das machte doch keinen Unterschied. Außerdem würde niemand geschädigt. Der Schein in der Hosentasche hatte die Seriennummer 19 654 301, also dürfte es inzwischen mehr als zwanzig Millionen solcher Geldnoten geben. Ein Schein mehr oder weniger, beruhigte er sein Gewissen, das fiele gar nicht auf.
Zurück in seiner Werkstatt gab er sich einen Ruck: Jetzt probiere ich’s einfach mal. Wenn’s was wird, dann sehen wir weiter. Andernfalls ist’s auch recht.
Sogleich machte er sich an die Arbeit und zeichnete das Wasserzeichen seitenverkehrt auf Stein. Schon beim zweiten Druckversuch war die Nachbildung ordentlich; beim dritten, er hatte die Emulsion aus Öl und Pigmenten etwas verändert, war sie perfekt.
Müde von der Arbeit und den Aufregungen des Tages legte er sich in seinem Atelier schlafen. Seit dem Besuch des Generalfeldmarschalls teilte er das Bett im zweiten Stock nicht mehr mit Karl, dem Buchdruckerlehrling. Wo immer möglich, ging er dem Meister aus dem Weg und blieb auch nachts in seiner Werkstatt, bewacht von einem russischen Soldaten. Und der Meister ließ ihn in Ruhe, wusste er doch, dass der junge Mann russischer Staatsbesitz war. Sich mit einem Fürsten und Generalfeldmarschall anlegen, das traute er sich nun doch nicht.
Anderntags gravierte Eugen die Seriennummern (ohne die beiden letzten Ziffern), den Nennwert des Geldscheins in Großbuchstaben und Ziffern sowie die Geldanweisung, die aus einem Satz bestand, mit spezieller Tusche auf die Druckplatte. Dann ätzte er den Stein, druckte das Gezeichnete mit der Reibepresse präzise über das Wasserzeichen und ergänzte die beiden letzten Ziffern der Seriennummer mit sicherer Hand. So könnte er hundert falsche Fünfzig-Rubel-Scheine mit fortlaufender Seriennummer herstellen. Insgesamt fünftausend Rubel, ein Vermögen. Mehr sollten es auf keinen Fall werden.
Mit der Lupe prüfte er Wasserzeichen und Aufdruck der ersten drei Scheine. Er war sehr zufrieden. Jetzt fehlten nur noch die beiden Prägestempel.
Eugen ging in seinem Atelier auf und ab und dachte nach. Dann, die Lichtpause der Stempel vor sich, zeichnete er den Adler auf der Kanonenkugel und die Umschrift seitenverkehrt auf eine polierte Marmorplatte und ritzte die Linien und Schraffuren. Schließlich legte er die bedruckten Scheine mit der Vorderseite präzise auf die Prägevorlage und drückte Motiv und Umschrift mit der Spitze eines Falzbeins durchs Papier.
Dann ritzte er den zweiten Stempel und versah die drei Scheine mit der noch fehlenden zweiten Prägung.
»Und woher nehme ich die schwarze Tinte?«, murmelte Eugen vor sich hin. Er wusste, wie man sie herstellt: zerstoßene Galläpfel, Vitriol und Weinessig aufkochen, arabischen Gummi einrühren und dann ein paar Tage in verschlossener Glasflasche ziehen lassen.
Doch diese Zeit hatte er nicht mehr, auch besaß er keine Schreibfeder. Darum sinnierte er lange und rannte schließlich zum Schulmeister, der um die Ecke wohnte.
Ihn bat er um ein kleines Fläschchen schwarzer Tinte und zwei neue Schreibfedern. Für zwanzig Kreuzer bekam er das Gewünschte.
Den nächsten Tag arbeitete er wie besessen. Großes Finale. Er lithografierte, druckte, signierte und prüfte, prüfte und prüfte. Dann warf er die Feder in die Schale auf dem Tisch und ließ sich auf den Boden fallen, erschöpft, abgekämpft, aber glücklich. Jetzt war er wirklich reich.
»Odessa, ich komme!«, rief er, trat vor die Tür seines Ateliers und wiederholte seine Worte auf Russisch. Der Wachposten, dem man inzwischen ein Sofa zum Ausruhen hingestellt hatte, lachte.
*
Eugen wollte das Haus durch die Vordertür verlassen, doch die Hausherrin stand auf der Herrschaftstreppe und sah ihn bittend an.