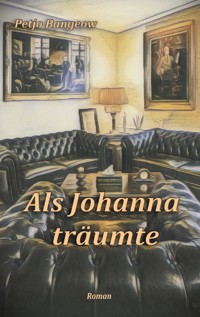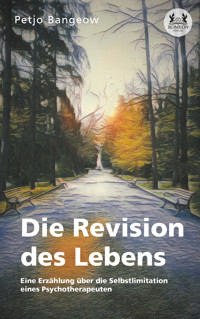
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romeon-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Professor Rubinstein überweist dem Chicagoer Psychotherapeuten, Dr. Daniels, einen jungen Patienten, um ihn in seinen verbleibenden Lebensmonaten psychologisch betreuen zu lassen. Der junge Mann ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Das kommt einem Todesurteil gleich. Er verabschiedet sich jedoch schon nach der zweiten Sitzung von Dr. Daniels. Er hat bemerkt, dass er seit seiner Krebserkrankung die beste Zeit seines Lebens hat, da er sich seither im Alltag viel stärker darauf konzentriert, wonach ihm der Sinn seht. Eine Psychotherapie raubt ihm nur kostbare Zeit. Das regt Dr. Daniels dazu an, über sein eigenes Leben nachzudenken. Und so fasst er den Entschluss, seine Prioritäten neu zu ordnen. Bald darauf muss er jedoch feststellen, dass jeder Neubeginn zu spät kommen kann, wenn man mit dieser Entscheidung zu lange wartet. In dieser bewegenden Erzählung wird psychologisches Fachwissen, z. B. aus der Bindungsforschung und der Kognitionspsychologie, sowie aus anderen Wissenschaftsbereichen für den Leser ›leicht verdaulich‹ eingebaut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Revision des Lebens
1. Auflage, erschienen 08-2023
Umschlaggestaltung: Romeon Verlag
Text: Petjo Bangeow
Layout: Romeon Verlag
ISBN (E-Book): 978-3-96229-624-7
www.romeon-verlag.de
Copyright © Romeon Verlag, Jüchen
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Petjo Bangeow
Die Revision des Lebens
Eine Erzählung über die Selbstlimitation eines Psychotherapeuten
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Über den Autor
Vorwort
Mit dem Sinn des Lebens befassen sich Menschen seit vielen Jahrhunderten. Aristoteles zum Beispiel sah die Glückseligkeit als die Vollendung eines jeden Lebens. Seither haben sich noch viele weitere Denker, vor allem aus Sicht der Philosophie und der Theologie, damit beschäftigt, eine Formel für ein sinnerfülltes Leben zu finden. Die Antwort ist, es gibt diese Formel nicht. Zumindest nicht die Formel.
Es gibt mehrere hunderte, tausende oder vielleicht Millionen von Formeln. Und jede dieser Formeln hat eine individuelle Gültigkeit. Nicht für jeden, aber für irgendjemanden. Der Sinn des Lebens wird mitunter von unserem persönlichen Wertesystem bestimmt. Der eine sieht seinen Sinn darin, seine Kinder gesund und glücklich aufwachsen zu sehen. Der andere sieht seinen Sinn darin, im PS-starken Sportwagen die Nachtklubs von Berlin abzufahren, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, jemals Kinder haben zu wollen. Keiner dieser Lebensentwürfe ist richtig oder falsch. Sie sind für das Individuum, das ihn lebt, gültig. Es gibt allerdings Menschen, die im Laufe ihrer begrenzten Lebenszeit den Sinn ihres Lebens infrage stellen. Das kann zu einer absoluten Erfüllung führen, wenn man den neuen Lebensentwurf als eine Verbesserung der Lebenssituation erlebt. Wenn man sein Wertesystem neu ordnet. Es kann aber auch zu einer Krise führen, weil man ein bis dato glücklich geführtes Leben plötzlich hinterfragt und im Laufe des Prozesses ›kaputtdenkt‹. Dann wurde das bestehende Wertesystem durcheinandergebracht, ohne eine neue Ordnung bekommen zu haben. Nicht jeder sollte sich also zwingend die Frage nach seinem Sinn des Lebens stellen. Zumal der Sinn des Lebens, analog zur Identität, als ein Konzept verstanden werden sollte. Er wird in einer bestimmten Phase des Lebens entwickelt und auch wieder verworfen, um ein neues Konzept zu entwickeln. Folglich ist der Sinn des Lebens nichts Statisches. Er unterliegt einem dynamischen Prozess. Das was im Leben einer Person sinnstiftend ist, kann sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen sehr unterschiedlich darstellen. Mit fünfzehn Jahren erlebt man eine spirituelle Verbundenheit mit der Natur wahrscheinlich als wenig sinnstiftend. Im Alter von vierzig Jahren vielleicht schon. Eine allgemeingültige Antwort auf den Sinn des Lebens, käme also dem Versuch gleich, weltweit und über alle Kulturen hinweg gültige Benimmregeln zu etablieren.
Die Revision des Lebens ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Eine von vielen. Diese Erzählung wird einige, hoffentlich viele Menschen ansprechen. Aber sie wird nicht jeden ansprechen. Dennoch soll sie jeden dazu einladen, sich die Frage zu stellen, ob man über seinen Sinn des Lebens nachdenken möchte. Immerhin eine Frage, die man sich nicht jeden Tag stellt. Es geht in dieser Erzählung auch darum, sich seine Wünsche und Träume in der Gegenwart zuzugestehen, anstatt sie sich für die Zukunft aufzubewahren. Ohne dass wir es wissen, kann die Zukunft nämlich sehr kurz sein.
Diese Erzählung beruht, zumindest in Teilen, auf wahren Begebenheiten, die mir im Laufe meiner Tätigkeit als Psychotherapeut widerfahren sind. Insofern ist sie eine Erzählung, die mich dazu angeregt hat, über mein Leben nachzudenken. Und nun möchte ich sie gerne mit anderen teilen. Und die Erzählung soll Patienten vergegenwärtigen, dass Psychotherapeuten auch etwas von ihnen lernen. Patienten stellen für leidenschaftliche Psychotherapeuten, wie ich einer bin, keine Belastung dar, sondern in den meisten Fällen eine Bereicherung. Sie zeigen uns auf, auf welch eine verblüffende Art und Weise die Seele versucht, durch die Bildung von Symptomen eine Lösung für psychische Belastungszustände herbeizuführen. Quasi wie in einem Überlebensmodus. Ein paranoider Wahn beispielsweise hilft dem Schizophrenen, seinen diffusen, nicht greifbaren Ängsten einen Sinn zuzuschreiben. In dem Moment, in dem er zur Überzeugung erlangt, vom FBI verfolgt zu werden, werden seine zuvor unerklärlichen Angstzustände für ihn logisch und vernünftig. Der Wahn rationalisiert also die Ängste subjektiv und schafft dem Betroffenen einen Handlungskontext. Im Laufe einer Psychotherapie zeigen uns die Patienten dann, wie Menschen sich neue Lösungsstrategien erarbeiten können, die keine Symptome als unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Ist dieser Zustand erreicht, fühlen sich Leute von ihrem seelischen Leid geheilt. Insofern widme ich dieses Buch in zweiter Linie den vielen jungen Menschen, die mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben, sie auf einem schwierigen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. In erster Linie widme ich dieses Buch meiner liebsten Frau Niku und meiner liebsten Tochter Elvira, die meinen Sinn des Lebens darstellen.
Dr. phil. Petjo Bangeow
Kapitel 1
Es ist ein kalter Wintermorgen. Punkt 6 Uhr klingelt der Wecker. Wie gewohnt. Dr. Daniels erhebt sich schwerfällig aus seinem Bett. Wieder könnte er sich dafür ohrfeigen, dass er wie jeden Abend zuvor dachte, dass sechs Stunden Schlaf ausreichen würden. Nun ist er einmal mehr eines Besseren belehrt worden. Das Buch war zu spannend, um es zeitiger wegzulegen. Und wann sollte er sonst einmal zum Lesen kommen, wenn nicht spät am Abend? Immer dann, wenn seine Frau Mina neben ihm und seine kleine Tochter Elmira im Zimmer nebenan eingeschlafen waren. Dabei kann er sich glücklich schätzen, dass Elmira mit ihren zwei Jahren schon die meisten Nächte durchschläft.
Viel zu müde, um einen klaren Gedanken fassen zu können, geht er mit leisen Schritten aus dem Schlafzimmer nach rechts den langen Flur ihres Apartments entlang. Er bemüht sich wie immer, seine Mina und Elmira nicht zu wecken. Deshalb bewegt er sich wie auf Eierschalen laufend durch den langen Flur. Ganz am Ende des Flurs liegt das Badezimmer. Dort beginnt die tägliche Routine: Waschen, Zähneputzen, seine Haare zu einem gepflegten Seitenscheitel stylen. Dann direkt aus dem Bad hinüber ins Ankleidezimmer, wo er seine akribisch zurechtgelegte Kleidung für den heutigen Arbeitstag vorfindet. Wie am Abend zuvor von ihm vorbereitet. Eine schwarze Jeans, ein dunkelgrünes Hemd, bei welchem er es pflegt, die Ärmel hochzukrempeln. Wie jemand, der bereit ist, etwas anzupacken. Darüber eine Herrenweste. Zuletzt seine nicht zu übersehende, hochglanzpolierte Armbanduhr und Halbschuhe, die etwas Schickes, aber zugleich etwas Sportliches ausstrahlen. So wie er selbst. Er ist kräftig, aber nicht dick. Er ist sportlich, aber nicht durchtrainiert. Diesen Habitus weiß er in sein sportlich-elegantes Outfit geschickt zu verpacken. Stilvoll, aber nicht spießig. Er hat etwas von einem britischen Gentleman, der dennoch lässig genug rüberkommt, um nicht verklemmt zu wirken.
Leise schreitet Dr. Daniels aus dem Apartment. Als er endlich in seinem Auto sitzt, kann er durchatmen. Er hat Mina und Elmira heute Morgen nicht wach gemacht. Wenn das nämlich passiert, fühlt er sich meist schlecht, weil er weiß, wie es ist, nicht ausschlafen zu können. Wenn es doch passiert, nimmt es Mina mit einem Lächeln hin. »Da kannst du nichts dafür, Peter! Die Schränke und Türen stehen dir halt immer im Weg«, sagt sie dann zu ihm. Nun hat er die rund vierzigminütige Fahrt bis in seine Praxis vor sich. Es ist noch dunkel und die kalte Winterluft Chicagos lässt durch seinen feuchten, warmen Atem die Windschutzscheibe seines Wagens beschlagen. Als er den V8-Motor seines Jaguars startet, dröhnt es aus den Auspuffrohren. Er liebt diesen Klang. Und er liebt dieses Auto. Hier fühlt er sich wie in seinem Wohnzimmer. Alles ist auf ihn abgestimmt.
Entlang des Highways hört er, wie so oft, einen gesellschaftskritischen Podcast. Als Psychotherapeut versteht er sich als ein Denker, der sich mit den großen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen sollte. Heute geht es um die neue Arbeitskultur in den Vereinigten Staaten. Wie so oft regt ihn die gesellschaftliche Entwicklung auf. Zu viel illegale Einwanderung, eine zunehmende Arbeitslosigkeit und eine zunehmende Frustration unter den Menschen. Dies kriegt er auch in seiner therapeutischen Arbeit mit seinen Patienten zu spüren, welche oftmals schon längst resigniert haben und dem Alkohol und den Depressionen verfallen sind.
Nach einer reichlichen halben Stunde endlich die Abfahrt. Langsam beginnt die Sonne aufzugehen. Die Silhouetten der Umgebung werden langsam sichtbar und somit auch die in der Ferne liegenden Lichter und Gebäude von Naperville. Die Mittelstadt, in die Dr. Daniels seine Praxis verlegte, nachdem die Patienten für ihn in Chicago knapp wurden. Alle wollen in der Großstadt praktizieren. In Naperville konnte er sich aber schnell einen guten Ruf als Therapeut erarbeiten. Er war beliebt bei seinen Patienten und wurde stets von Ärzten, die mit den seelischen Leiden ihrer Patienten überfordert waren, wärmstens empfohlen. Dadurch lief seine Praxis sehr gut und er hatte genug räumlichen Abstand zwischen seinem Wohnort und seiner Praxis, sodass er nach Feierabend fast nie auf Patienten traf, die ihn dann auf der Straße in ein therapeutisches Gespräch verwickeln wollten.
Kurz nachdem er vom Highway abgefahren ist, sieht er bereits die grellen Beleuchtungen der Tankstelle zu seiner Linken und des Schnellimbisses zu seiner Rechten. Von hier ist es nur noch ein Katzensprung bis in seine Praxis, die sich im Untergeschoss einer denkmalgeschützten Villa im neoklassizistischen Stil befindet.
In der Praxis angekommen die gleiche Routine wie immer: Aufschließen, Licht anschalten, über den marmorierten Boden des großen Wartebereiches in die Küche, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Während der Kaffee durchläuft, geht er von der Küche in den großen Behandlungsraum. Hier fühlt er sich wie zuhause. Dieser Raum ist im klassisch englischen Stil gehalten. Große Wandgemälde von Sigmund Freud und Jean-Martin Charcot prangen über einem braunen Chesterfield-Sofa, auf welchem seine Patienten ihren Platz finden. Dr. Daniels großer Ohrensessel steht direkt hinter der Kopfseite des Sofas. Er praktiziert noch die gute alte Psychoanalyse, so wie sie eigentlich nur noch von den alten Psychiatern gehandhabt wird. Jene Psychiater, die eigentlich schon längst im Rentenalter sind, aber entweder aus Geldnot oder aus Liebe zu ihrem Beruf weiter praktizieren. Im Vergleich zu diesen Kollegen wirkt Dr. Daniels mit seinen 37 Jahren wie ein blutiger Anfänger. Trotzdem kann er mittlerweile auch auf eine fast zehnjährige Berufserfahrung zurückblicken.
Nachdem er die drei antiken Stehlampen mit ihren Messingständern einschaltet, checkt er seinen Anrufbeantworter. Heute nur zwei Nachrichten.
Ms. Winterfield um 10 Uhr hat abgesagt und Ms. Johnson lässt ihn wissen, dass sie sich vermutlich um einige Minuten zu ihrem Termin um 13 Uhr verspäten wird. Dr. Daniels legt großen Wert auf Pünktlichkeit. Das macht er seinen Patienten immer wieder deutlich. Aber eine kurze Info vorab, reicht ihm aus, um es als Entschuldigung akzeptieren zu können.
Nun ein kurzer Blick in seinen Terminkalender für heute. Um 8 Uhr kommt Ms. Summer, um 9 Uhr Mr. Boyle … »Oh je!«, murmelt er vor sich hin. Warum er sich gleich morgens zwei schwer depressive Patienten hintereinander einbestellt hat, bleibt ihm ein Rätsel. Depressive Patienten können für einen Therapeuten manchmal besonders herausfordernd sein. Ihre Hilflosigkeit und Resignation sind oft ansteckend, sodass Therapeuten an ihnen verzweifeln können. Umso wichtiger ist ein Biss in sein Sandwich, was er sich von zuhause mitgebracht hat und eine Tasse heißen Kaffees, bevor Ms. Summer erscheint. Einen knurrenden Magen kann er bei der anstehenden Herausforderung nicht auch noch gebrauchen.
Gerade in der Küche angekommen und sein Frühstück in der Hand, klingelt das Telefon. Er überlegt kurz, ob er es klingeln lassen soll. Er hat seinen Patienten eingebläut, dass sie ihm eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen sollen, wenn er nicht zu sprechen ist. Dann entschließt er sich doch, an seinen Schreibtisch im gegenüberliegenden Behandlungsraum zu gehen, um die Telefonnummer zu checken. »Vielleicht ist es ja wichtig«, flüstert er vor sich her. Die Nummer kommt ihm bekannt vor. Es dürfte die Nummer von Professor Rubinstein sein. Der alte Internist, der mit seinen fast 90 Jahren eigentlich schon längst sein Rentenalter überschritten hat. Als Mann jüdischer Herkunft hatte er damals als kleiner Junge mit seinen Eltern die Flucht vor den Nazis in die USA angetreten und es hier zu einem angesehenen Spezialisten seines Fachs gebracht. Dr. Daniels mochte den alten Greis, der als Jude natürlich auch viel über Freuds Theorien gelesen hatte. Er hebt also ab.
»Herr Professor! Was verschafft mir die Ehre?«
»Guten Morgen, Dr. Daniels! Ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, Sie so früh schon zu erreichen. Doch die Hoffnung hat wohl triumphiert. Ich hoffe, es ist nicht ungelegen?«
»Ganz und gar nicht, Herr Professor«, wobei er doch lieber in Ruhe sein Sandwich gegessen und seinen Kaffee getrunken hätte.
»Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich habe einen jungen Patienten, den ich gerne bei Ihnen vorstellen würde.«
»Was ist daran neu?«, scherzt er lachend. Doch er bemerkt, dass dem Professor nicht zum Scherzen ist.
»Sein Name ist Jeffrey Sinner. Er ist vor geraumer Zeit palliativ erkrankt. Leider konnten durch die bisherigen Behandlungsversuche keinerlei Verbesserungen erzielt werden. Man hatte vor sieben Monaten ein Karzinom in seiner Bauchspeicheldrüse entdeckt, welches zu allem Überfluss im weiteren Verlauf zu streuen begann und andere Organsysteme befallen hatte. Ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom an sich kommt quasi einem Todesurteil gleich. Aber wenn es streut … Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn, Doktor.«
»Was kann ich für ihren Patienten tun?«
»Ich bin der Ansicht, er sollte in seinen verbleibenden Lebensmonaten psychologisch begleitet werden. Ich hatte gehofft, dass Sie sich dieser Angelegenheit vielleicht annehmen könnten.«
Dr. Daniels spürt eine innerliche Zurückhaltung in sich aufkommen, die er sonst nicht von sich kennt, wenn es darum geht, schwere Behandlungsfälle anzunehmen.
»Von wie vielen verbleibenden Lebensmonaten reden wir denn?«, fragt er zögerlich.
Für ein paar Sekunden scheint die Verbindung zum Professor unterbrochen. Dann bemerkt er, dass der Alte nur kurz innehält, bevor er ihm antwortet.
»Prognostisch bin ich mir mit den mitbehandelnden Kollegen darüber einig, dass Mr. Sinner vermutlich noch maximal vier Monate bleiben. So ganz genau kann man das nie sagen. Je nachdem wie schnell die gestreuten Tumorzellen voranschreiten und das Ursprungskarzinom weiter wächst, kann es auch deutlich weniger sein.«
Dr. Daniels zögert. Mit Krebspatienten hatte er bis dato kaum Erfahrungen. Er war sich auch schon immer unsicher darüber, ob der psychoanalytische Behandlungsansatz für solche Fälle überhaupt geeignet sei. Aber hier ging es womöglich gar nicht einmal um eine Psychoanalyse, sondern darum, sich eines sterbenden Menschen empathisch anzunehmen. Und die gegenseitige Sympathie, die ihn mit Professor Rubinstein verbindet, erlaubt es ihm nicht, das Anliegen auszuschlagen.
Professor Rubinstein bemerkt, dass Dr. Daniels zurückhaltender als üblich reagiert. »Also, was sagen Sie?«
»Sie können sich auf mich verlassen, Professor. Sagen Sie dem Patienten er kann sich übermorgen um 17 Uhr bei mir in der Praxis vorstellen. Ich werde mir nach meinem letzten Patienten eine Stunde Zeit für ihn nehmen, damit wir uns kennenlernen können und ich mir ein Bild von seiner seelischen Verfassung machen kann. Es ist davon auszugehen, dass er nach solch einer Prognose unter einer ziemlichen mentalen Belastung leidet. Angstzustände und depressive Verstimmungen mit Schlafstörungen sind zunächst einmal annehmbar. Ich melde mich nach dem Termin bei Ihnen, Herr Professor, um mit Ihnen meinen Eindruck zu teilen.«
»Vielen herzlichen Dank, Dr. Daniels! Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tun würde. Ich gebe Mr. Sinner den Termin durch. Falls etwas dazwischenkommen sollte, wird er sich persönlich bei Ihnen melden. Ansonsten bleibt es bei Ihrem Terminvorschlag. Auf Wiederhören, Herr Kollege. Bleiben Sie gesund und bei Trost!«, scherzt der alte Professor.
»Auf Wiederhören, Professor! «
Dr. Daniels legt auf. Sein Sandwich liegt unangerührt vor ihm auf dem Schreibtisch. Die Tasse mit dem lauwarmen Kaffee steht daneben. Er schaut auf seine schicke Armbanduhr.
8.07 Uhr! Mist! Ms. Summer wird schon da sein. Hastig nimmt er noch einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse und beißt großzügig von seinem Sandwich ab. Dann das Zwicken in seinem Bauch. Er verträgt Kaffee eigentlich nicht so gut. Erst recht nicht auf nüchternen Magen und wenn er unter Zeitdruck steht. Dann bittet er seine erste Patientin für den heutigen Tag herein. Die mittefünfzigjährige Ms. Summer. Der Arbeitstag hat begonnen.
Kapitel 2
Als Dr. Daniels zwei Tage später während seines Frühstücks in der Praxis seinen Terminkalender für den Tag checkt, fällt ihm auf, dass eine Extraschicht ansteht. Professor Rubinsteins Krebspatient um 17 Uhr. Mist! Er hat Mina vergessen zu sagen, dass er heute später kommt. Das Abendessen muss also auf ihn warten. Als Iranerin ist Mina eine Meisterin des persischen Kebabs. Schnell tippt er ihr eine Nachricht, dass es heute später wird.
Was sagt man einem Menschen, der am Sterben ist? Dessen Zeit sehr bald gekommen ist. Der kaum noch Zukunft vor sich hat und womöglich voller nachvollziehbarer Ängste vor seinem nahenden Ableben ist. Dr. Daniels entschließt sich, die erste Sitzung so zu handhaben, wie er es bei jedem anderen Patienten auch tun würde. Der Patient soll berichten, er beobachtet ihn dabei, leitet das Gespräch durch Fragen in die Richtung, die er für relevant hält. Er hat es sich abgewöhnt, vor dem ersten Kennenlernen Befunde von Kollegen und Kliniken über die Patienten zu lesen. Viel zu hoch ist das Risiko, dass er seinen diagnostischen Blick durch die Meinung anderer beeinflussen lässt. Denn der erste Eindruck hat eine besonders prägende Wirkung. Der Primacy Effekt ist eine klassische Falle, bei der man alle weiteren Informationen nur noch im Kontext seines ersten Eindrucks interpretiert. Das kann zu falschen Schlüssen und Fehldiagnosen führen. Deshalb sollen die Patienten in erster Linie berichten. Für Dr. Daniels ist nicht nur entscheidend, was sie berichten, sondern auch wie. Was verrät die Mimik, die Gestik, die Stimmlage, die Körperhaltung und vor allem, welche Bedürfnisse stecken hinter den Äußerungen der Leute. Und das Ganze ohne unnötige Wertungen vorzunehmen, um den Patienten nicht das Gefühl zu geben, ihre Ansichten oder Empfindungen seien richtig oder falsch. Das ist die große Kunst. Dann fühlen sich Menschen verstanden und beginnen zu vertrauen. Darin ist Dr. Daniels ein Meister geworden.
Doch welche Bedürfnisse hat ein Mensch, der kurz vor seinem Tod steht? Kontrolle? Bindung? Ohne Aussicht auf ein Leben, macht das alles wenig Sinn. Vielleicht am ehesten den Wunsch nach Autonomie, wenn es um den Ort und das Umfeld des eigenen Todes geht. Dr. Daniels merkt, wie er sich bereits gedanklich in diesen bevorstehenden Fall verrennt. Das sieht ihm eigentlich nicht ähnlich. Es scheint, als würde der Fall bereits jetzt etwas mit ihm machen.
Pünktlich um 16.50 Uhr verlässt Mr. Coyle das Behandlungszimmer. Jetzt bleiben noch ein paar Minuten für die Dokumentation der Sitzung des jungen aufstrebenden Bänkers, der bereits jetzt, mit gerade einmal 26 Jahren, seine mentalen Grenzen maßlos überschreitet und einer Erschöpfungsdepression gegenübersteht. Während Dr. Daniels seine Notizen niederschreibt, hört er durch die geschlossene Tür seines Behandlungszimmers, wie der Türschnapper der Eingangstür sein typisches Schnallen von sich gibt. Das muss Mr. Sinner sein.