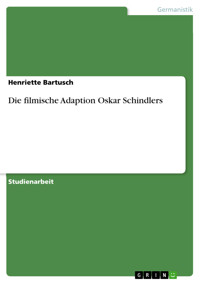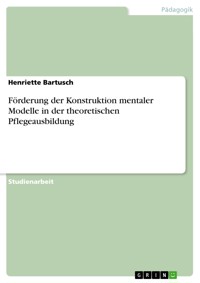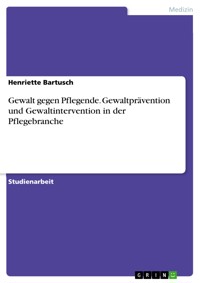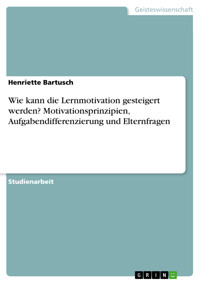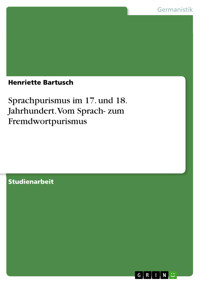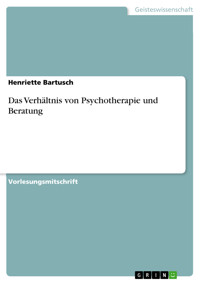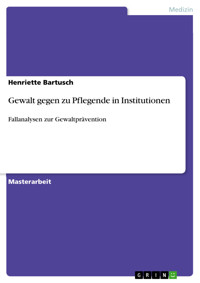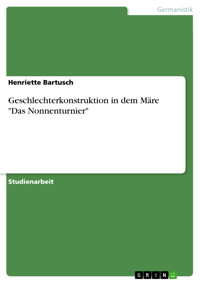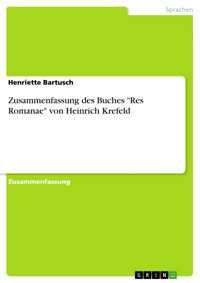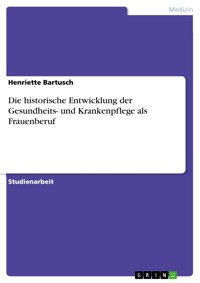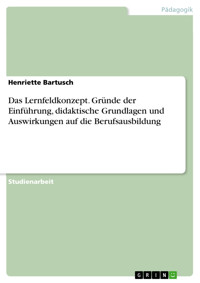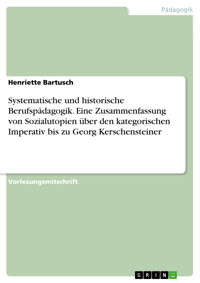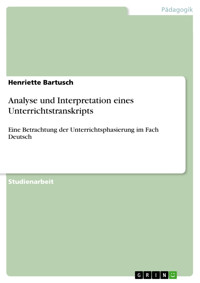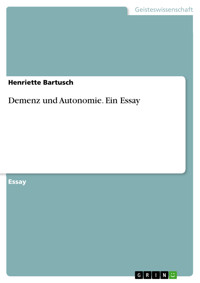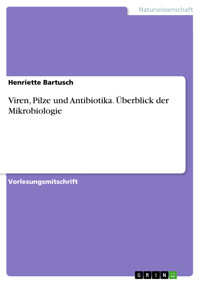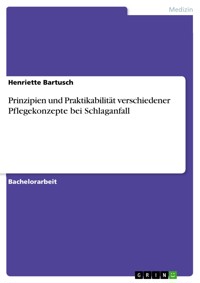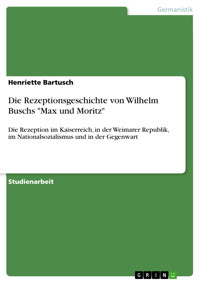
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Technische Universität Dresden (Institut für Germanistik), Veranstaltung: Poetischer Realismus, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel vorliegender Hausarbeit ist es, Wilhelm Buschs Geschichte der Buben Max und Moritz hinsichtlich ihrer Rezeption im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der Gegenwart chronologisch unter die Lupe zu nehmen. Da die Geschichte noch heute in vielen Regalen deutscher Haushalte vorzufinden ist, lohnt es sich, einen Blick auf die Rezeptionsgeschichte dieses Werkes zu werfen und danach zu fragen, wie sich die Geschichte der Rezeption vom Max und Moritz gestaltete und bis heute gestaltet. Um diese Zielstellung zu erfüllen, ist die Arbeit folgendermaßen gegliedert. Zunächst soll die Begrifflichkeit der Rezeption kurz erörtert werden, um daraus eine theoretische Grundlage abzuleiten, auf deren Basis die folgenden Ausführungen beruhen. Das darauffolgende Kapitel soll umrisshaft den Verlauf der Rezeptionsgeschichte von Max und Moritz zeichnen. Dazu werden die erste Aufnahme und Verarbeitung des Buches nach der Erstveröffentlichung sowie die Rezeption im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sowie in der Gegenwart betrachtet. Dafür sollen vor allem repräsentative Werke von Zeitzeugen beziehungsweise aus der jeweiligen Zeit verwandt werden. Abschließend fasst eine Schlussbetrachtung die wichtigsten Aspekte der Arbeit zusammen und dient zugleich der Rückführung zum Thema.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Erarbeitung einer Arbeitsdefinition zur Rezeptionsbegrifflichkeit
3. Rezeptionsgeschichtlicher Abriss
3.1 Erste Aufnahme und Verarbeitung
3.2 Kaiserreich
3.3 Weimarer Republik und Nationalsozialismus
3.4 Gegenwart
4. Schlussbetrachtung
5. Bibliographie
1. Einleitung
„Bei keinem anderen Werk von Wilhelm Busch ist es schwerer, die eigentliche Autorintention von den Überlagerungen der Rezeptions- und Deutungsgeschichte zu trennen als bei »Max und Moritz« [Herv. des Verf.].“[1]
Pape deutet mit seiner Feststellung bereits an, dass die Geschichte von Max und Moritz eine Geschichte ist, die in der Vergangenheit vielfältigen Gesprächsstoff geboten und zu mannigfaltiger Auseinandersetzung mit ebendieser angeregt hat. Dadurch soll sich – laut Pape – eine Art Schleier über die Erzählung gelegt haben, der den wahren Kern dieser überlagern würde.
Zudem impliziert Papes Aussage, dass Buschs Werk eine besiegelte Popularität vorzuweisen hat, da es vielfältig rezipiert wurde – und bis heute noch wird –, wodurch die Geschichte von Max und Moritz über die Jahre eine ebenso große Vielfalt an Bedeutungszuschreibungen gewonnen hat. Denn schließlich erhält ein Text „seine Bedeutung(en) im Akt des Lesens durch Zuschreibungen, die ein Leser aufgrund seines Weltwissens, seiner Kenntnisse, Erfahrungen und emotionalen Einstellungen vornimmt“[2]. Diese Rezeptionsprozesse äußern sich letztlich in „Kritiken, Rezeptionsprotokollen oder literarischen Werken“[3], die den Verlauf einer Rezeptionsgeschichte markieren.
Da die Geschichte der beiden Buben noch heute in vielen Regalen deutscher Haushalte vorzufinden ist – man bedenke, dass die Veröffentlichung von Max und Moritz zum gegenwärtigen Zeitpunkt 150 Jahre zurückliegt – und von einem „vergleichbaren Buch eine annähernd vergleichbare Wirkung nie ausgegangen (ist)“[4], lohnt es sich einen Blick auf die Rezeptionsgeschichte dieses Werkes zu werfen und danach zu fragen, wie sich die Geschichte der Rezeption vom Max und Moritz gestaltete und bis heute gestaltet. Somit ließe sich auch nachvollziehen, aus welchen Stoffen der von Pape vermutete Schleier gestrickt ist.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, Buschs Geschichte von den beiden Jungen hinsichtlich ihrer Rezeption in den einzelnen Zeiträumen chronologisch unter die Lupe zu nehmen. Um diese Zielstellung zu erfüllen, ist die Arbeit folgendermaßen gegliedert. Zunächst soll die Begrifflichkeit der Rezeption kurz erörtert werden, um daraus eine theoretische Grundlage abzuleiten, auf deren Basis die folgenden Ausführungen beruhen. Das darauffolgende Kapitel soll umrisshaft den Verlauf der Rezeptionsgeschichte von Max und Moritz zeichnen. Dazu werden die erste Aufnahme und Verarbeitung des Buches nach der Erstveröffentlichung sowie die Rezeption im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sowie in der Gegenwart betrachtet. Dafür sollen vor allem repräsentative Werke von Zeitzeugen beziehungsweise aus der jeweiligen Zeit verwandt werden. Abschließend fasst eine Schlussbetrachtung die wichtigsten Aspekte der Arbeit zusammen und dient zugleich der Rückführung zum Thema.
Die Quellen zur Bearbeitung der Kapitel wurden über den Internet-Katalog und die Datenbanken der sächsischen Landes- Staats- und Universitätsbibliothek Dresden ausgewählt. Dabei dienten vorwiegend Suchbegriffe wie Wilhelm Busch, Max und Moritz und Rezeption* oder Wirkung* zur Findung geeigneter Quellen. Von den aufgeführten und gefundenen Quellen wurden im Nachhinein diejenigen zur Bearbeitung des Themas verwendet, die ein den Zeitabschnitten entsprechendes Datum und verlässliche Quellen vorzuweisen hatten. Bei der Literaturrecherche stellte sich schnell heraus, dass gegenwärtig speziell zum Verlauf der Rezeptionsgeschichte von Max und Moritz kein allumfassendes Werk zur Verfügung steht. Allerdings existieren es zu einzelnen Komponenten der Rezeptionsgeschichte inzwischen umfangreiche Aufrisse.