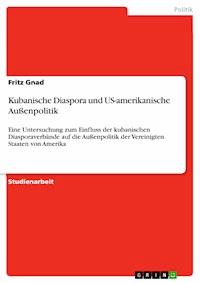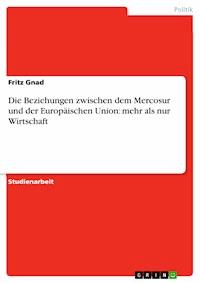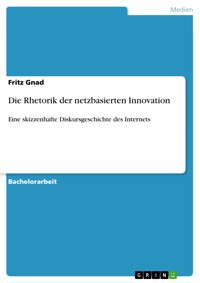
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,7, Ruhr-Universität Bochum (Institut für Medienwissenschaft), Veranstaltung: Abschlussarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: „Die Rhetorik der netzbasierten Innovation“ leistet einen Beitrag zur Diskursgeschichte des Internets, indem die Rhetorik der netzbasierten Innovation beim Medium Internet untersucht wird. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Inhalte diesen Rhetoriken der Innovation zugrunde liegen und ob sich diese im Untersuchungszeitraum – von den 1940er Jahren bis Ende 2006 - verändern. Der Ausdruck Rhetorik der Innovation bezieht sich dabei implizit auf das Begriffspaar „Apokalyptiker und Integrierte“ von Umberto Eco. Hierbei handelt es sich um eine Formulierung Ecos aus den 1960er Jahren, die zum damaligen Zeitpunkt darauf abzielte, zwei sich kontrastierende Standpunkte in der Wissenschaftsgemeinde hinsichtlich der Massenkultur auf den Punkt zu bringen. Die „Apokalyptiker“ repräsentieren dabei eine skeptische und ablehnende Haltung gegenüber der Massenkultur. Sie verstehen technische Neuerungen als potenziell erfolgreiche Angriffe auf ihre eigenen kulturellen Werte und werden aus diesem Grund prinzipiell abgelehnt. Die „Integrierten“ hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine optimistische Grundhaltung gegenüber Neuerungen an den Tag legen. Ein ähnlich gespaltenes Meinungsspektrum lässt sich auch bei der akademischen Auseinandersetzung mit dem Internet feststellen: Vor allem die „Integrierten“ verfügen idealtypisch über einen großen Optimismus hinsichtlich der weiteren Entwicklung, der gesellschaftlichen Auswirkungen und den Folgen des Internets. In dieser Arbeit werden besonders jene Diskursfragmente vorgestellt und untersucht, die dem Internet neue Nutzungspotenziale zuschreiben und deren gesellschaftliche Implikationen prognostizieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
1. Einleitung
1.1. Fragestellung
„Die Geschichte der Medien wird häufig am Leitfaden technischer Erfindungen erzählt. Dieser Band macht den Vorschlag, anstelle technischer Erfindungen die Diskurse zu untersuchen, die aus bloßen Ereignissen in der Technik solche der Kultur macht.“1
Mit diesen Zeilen leiten Kümmel/Scholz/Schumacher den SammelbandEinführung in die Geschichte der Medienein und präsentieren einen produktiven Ansatz um Mediengeschichte zu analysieren. Dieser geht davon aus, dass es nicht sehr sinnvoll ist, Mediengeschichte unter einem Apriori technischer Erfindungen zu untersuchen. Die Technikgeschichte stelle zwar für das Aufkommen eines neuen Mediums eine Grundvoraussetzung dar, doch reiche das bloße Vorhandensein einer technischen Neuerung nicht für dessen Erfolg als Medium, im Sinne gesellschaftlicher Durchdringung, aus. Vielmehr würden die technischen Erfindungen erst im Diskurs, also auf der Ebene der gesellschaftlich geteilten Bedeutungen, in die Lage versetzt, sich als ein „neues Medium“ zu etablieren.2
Auch William Uricchio, der sich mit der Funktion des Imaginären für die Entwicklung der neuen Medien auseinander setzt, zeigt, dass die starke Gewichtung der Technik bei der Geschichtsschreibung von Medien keinen vorteilhaften Ausgangspunkt darstellt. Vielmehr geht auch er davon aus, dass die
„sozialen Prozesse, durch die bestimmte Technologien hervortreten und dominant oder unterdrückt, übergangen oder bei der Geburt erstickt werden, genauso von der diskursiven Positionierung wie von der technologischen Möglichkeit ab[hängen].“3
Er vermutet, dass dem Imaginären und der ausgesprochenen Erwartung dabei die Rolle zufällt, technische Kapazitäten in kulturelle Praxis umzuformen und somit den gesellschaftlichen Erfolg eines Mediums zu ermöglichen oder auszuschließen.
Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag zur Diskursgeschichte des Internets leisten, indem ich die Rhetorik der netzbasierten Innovation beim Medium Internet, also einen
1 Kümmel/Scholz/Schumacher 2004, S. 7
2 Ebd., S. 9 3 Uricchio 2001, S. 308
Page 2
Teilaspekt seiner diskursiven Positionierung, untersuche. Dabei will ich der Frage nachgehen, welche Inhalte diesen Rhetoriken der Innovation zugrunde liegen und ob sich diese im Untersuchungszeitraum verändern.
Mit dem AusdruckRhetorik der Innovationbeziehe ich mich dabei implizit auf das Begriffspaar „Apokalyptiker und Integrierte“ von Umberto Eco. Hierbei handelt es sich um eine Formulierung Ecos aus den 1960er Jahren, die zum damaligen Zeitpunkt darauf abzielte, zwei sich kontrastierende Standpunkte in der Wissenschaftsgemeinde hinsichtlich der Massenkultur auf den Punkt zu bringen.
Die „Apokalyptiker“ repräsentieren dabei in dem sich binär kontrastierenden Modell eine skeptische und ablehnende Haltung gegenüber der Massenkultur. Sie verstehen technische Neuerungen als potentiell erfolgreiche Angriffe auf ihre eigenen kulturellen Werte und werden aus diesem Grund prinzipiell abgelehnt. Die „Integrierten“ hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine optimistische Grundhaltung gegenüber Neuerungen an den Tag legen und der Massenkultur gegenüber durch und durch positiv eingestellt sind.4
Ein ähnlich gespaltenes Meinungsspektrum lässt sich auch bei der akademischen Auseinandersetzung mit dem Internet feststellen. So konstatiert beispielsweise der Medienwissenschaftler Hartmut Winkler:
„Die Medientheorie erscheint aufgespalten in einen Diskurs, der bei den analogen Medien verharrt und die Computer als eine Art Sündenfall betrachtet, und einem zweiten, der, gegenwarts-kompatibel und medienpräsent, die Rechner um so entschiedener zu seiner Sache macht.“5