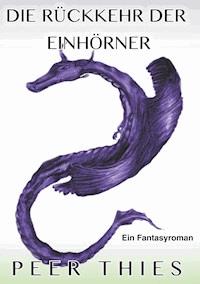
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mark wusste gar nicht wie ihm geschieht. Mit einem seltsamen Horn in seinem Rucksack, findet er sich in einer für ihn fremden Welt wieder. Der Himmel strahlt Rot über ihm und fantastische Kreaturen erfüllen die Landschaft. Zusammen mit dem eigentümlich wirkenden Zauberer Tombars macht er sich auf, den Weg nach Hause zu finden. Doch schon bald wird den beiden bewusst, dass Marks Ankunft eine viel größere Bedeutung hat, als er es erahnen konnte. Laut einer alten Legende soll seine Anwesenheit die Rückkehr der längst verschollenen Einhörner einläuten. Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als einfach, denn nicht ohne Zufall haben die Kreaturen der Dunkelheit begonnen Jagd auf sie zu machen. Sie suchen ihn und das seltene Artefakt in seinem Rucksack. Eine abenteuerliche Reise durch eine fremde Welt beginnt in der Mark nicht nur neue Freunde findet, sondern sich auch vor Wolfsmenschen und Orks wehren muss, um an sein Ziel zu kommen. Doch ist er wirklich der, von dem in der Prophezeiung erzählt wird? Oder haben sie alle ihre Hoffnung in den Falschen gesetzt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Kinder Rachel und Niklas
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Prolog
oder
Die Reise beginnt
Das Zimmer, in dem unsere Geschichte begann, lag noch im Halbdunkel der aufgehenden Sonne. Ihre Strahlen leuchteten zaghaft durch das halb verdeckte Fenster. Sie setzten ihren Weg fort und trafen auf das Bett eines kleinen Jungen, der dort friedlich schlief.
Wir blickten uns in dem Zimmer des Jungen um und sogleich fielen uns einige Merkwürdigkeiten auf:
Es lag kein Spielzeug auf dem Boden. Die Regale waren ordentlich eingeräumt. Was jedoch keine Ausnahme war. Der Junge im Bett musste nicht am Abend vorher sein Zimmer aufräumen. Es war meistens ordentlich.
Mark, so hieß der Junge übrigens, mochte keine Unordnung. Mit einem Blick in seine Schubladen, während er noch schlief, entdeckten wir dort sorgfältig eingeräumte Hosen, T-Shirts und Socken. Daneben im Regal standen seine Bücher alphabetisch sortiert nebeneinander. Mark las sehr gerne Bücher. Doch mochte er es nicht, wenn sich Melville vor Dumas befand oder Dostojewski nach Goethe.
Warum er Ordnung so liebte, konnten sich seine Eltern nicht erklären. Sie hätten sich wegen des sauberen Zimmers aber auch nie beschwert.
Umso überraschender schien es, dass ein so normaler und ordentlicher Junge, wie Mark es war, in ein Abenteuer hineingeriet, in welches er nun einmal hineingeraten sollte.
Es begann genau an diesem Tag, an dem er so friedlich in seinem Bett schlief und die ersten Strahlen des Morgens Muster auf seine Haut warfen.
Seine Schule begann um 8 Uhr. Er brauchte für den Weg dreiundzwanzig Minuten. Um seine Jacke und Schuhe anzuziehen und davor seine Zähne zu putzen weitere acht Minuten. Für das Frühstück brauchte er dreizehn Minuten. Davor musste er sich noch waschen und frische Kleidung anziehen. Dafür benötigte er weitere neun Minuten. Wer jetzt aufmerksam mitgerechnet hat merkt, dass Mark in der Früh genau dreiundfünfzig Minuten braucht.
Die Uhrzeit war jetzt auf den Punkt genau sieben Uhr und sieben Minuten. Marks Wecker klingelte. Daraufhin zog er sich an und ging zum Frühstückstisch. Seine Mutter war eine groß gewachsene, schlanke Frau. Sie wusste, dass Mark immer sehr pünktlich war. Des Weiteren war ihr klar, wann er zum Frühstückstisch kam und wann er das Haus verlassen würde. Sie wusste auch genau, wann er nach der Schule wieder zu Hause sein würde. Denn Mark ging immer geradewegs nach Hause. Ohne mit den anderen Kindern aus der Klasse zu spielen. Vielleicht hätte er es getan, wenn er viele Freunde gehabt hätte, aber leider hatte Mark nicht viele Kinder, die gerne mit ihm spielten, und so war er jeden Tag zur gleichen Zeit zu Hause.
Seine Mutter würde ihn bestimmt nicht so freudig und gütig am Frühstückstisch erwarten, wenn sie geahnt hätte, dass er heute nicht pünktlich aus der Schule kommen würde. Tatsächlich sollte sie sich schon Sorgen machen, als er zwei Minuten nach seiner üblichen Zeit noch nicht zu Hause war. Doch noch war alles normal und seine Mutter freute sich, ihn zu sehen. Sie war insgesamt eine sehr nette und fürsorgliche Frau. Mark mochte seine Mutter sehr gerne, was wahrscheinlich auf so ziemlich jedes Kind der Welt zutrifft.
Dem Umstand geschuldet, dass jetzt erst mal nichts Interessantes passiert, lassen wir Mark in Ruhe und treffen ihn ein paar Stunden später wieder. Dort wo die Geschichte, die es zu erzählen gilt, endlich anfängt.
Mark duellierte sich auf dem Schulhof. Nicht mit einem Revolver, wie es die harten Kerle im wilden Westen getan haben, aber mit Karten, wie es die fast genau so harten Jungs hinter der Schule zu tun pflegten. Um genau zu sein mit Spielkarten, auf denen jede ein anderes Motiv trug. Es gab Karten mit verschiedenen Monstern, mit Zentauren, Elfen und Zwergen, Heiltränke oder Waffen waren genauso abgebildet wie Zaubersprüche. Also konnte man sagen: ein Kartenset gefüllt mit fantastischen Figuren. Mit diesen galt es, den Gegner mit Hilfe der besseren Karten und vor allem mit durchdachter Strategie in einem Duell der Ehre fertig zu machen. Mark liebte dieses Spiel. Denn, wie schon bemerkt, er war ja sehr durchdacht und auch sehr strategisch. Dutzende von Schülern umringten sie. Alle waren gespannt auf den Ausgang des Spiels.
Es war einer der wenigen Momente, wo sich Mark freute, ein Kind zu sein, denn viele Freunde hatte er nicht. Wegen seiner peniblen Art und auch weil er die Schule und den Unterricht eigentlich mochte, mieden ihn die anderen Kinder. Zumindest wenn er Glück hatte, mieden ihn die anderen Kinder. Wenn er jedoch Pech hatte, wurde er von einigen Raufbolden aufgeknöpft und allzu oft rannte er so schnell ihn seine Beine trugen in ein Versteck (falls er nicht stolperte), wo sie ihn nicht fanden. Doch hier im Duell auf dem Pausenhof gab es so etwas nicht. In diesem Moment wurde er von den anderen Kindern nahezu ehrfürchtig respektiert. Mark verstand es, drei Schritte im Voraus zu denken. Dadurch war er in diesem Spiel seinen Mitschülern weit voraus. Was ihn zum Pausenhof-Meister machte, da es bis jetzt keinen gab, der sich mit ihm messen konnte.
Für Mark selbst waren diese Kämpfe seine erste und einzige Chance, sich vor seinen Mitschülern zu beweisen. Stark war er nicht und im Laufen ungeschickt. Schienen seine Beine doch jede Bodenerhebung für ausreichend zu halten, dort zu verharren. Für den Rest von Marks Körper bedeutete dies einen Flug auf die Nase. Wie gesagt, war der einzige Vorteil den Mitschülern gegenüber, seine Fähigkeit, geordnet denken zu können. Was ihn bei allen anderen Begebenheiten in der Schule zum Außenseiter machte, spann sich hier zu seinem Vorteil. Und doch sollte es gerade seine Ordentlichkeit sein, die ihn in das jetzt schon so oft erwähnte Abenteuer hineinpurzeln ließ, wofür ihn vielleicht der eine oder andere seiner Mitschüler sogar beneidet hätte.
Die Schüler umringten Mark und Theobald, einen Mitschüler Marks, während diese ihren Kampf der Karten austrugen. Jeder hatte nur noch zwei bis drei Karten auf der Hand und es wurde offensichtlich, dass Mark diesen Theobald auch diesmal besiegen würde. Er ließ es sich jedoch nicht anmerken. Sein Blick blieb sachlich kühl, wie das Gesicht eines wahren Pokerspielers. Theobald hingegen hatte einige Schweißtropfen auf der Stirn und schien ein wenig blasser geworden zu sein. Er wusste, dass er verlieren würde. Das machte ihn nervös.
Mark war klar, dass er sich nach dem Spiel wieder einige Schimpfwörter anhören musste. Jungens der Art, wie Theobald einer war, konnten nicht zugeben, verloren zu haben. Er würde ihn einen Nerd oder Idioten beschimpfen, wenn die Runde vorbei war. Doch machte es Mark nichts aus. Die Pause war gleich vorbei und verprügeln konnten sie ihn nicht. Er jedoch konnte für diesen Moment zeigen, welch schlechter Spieler und vor allem Verlierer Theobald war und das reichte ihm vollkommen.
Auf einmal und aus heiteren Himmel (dieser war sonnenklar und bis dahin auch windstill) kam ein kräftiger Windstoß und wirbelte die Duell-Karten hoch, durcheinander und in alle vier Himmelsrichtungen. Überrascht von dieser Begebenheit standen die zwei Duellanten auf und sahen sich verwirrt um. Machten sich aber sogleich daran, mit Hilfe aller Kinder, die in der Nähe standen, die herabgefallenen Spielkarten aufzusammeln und zu sortieren. Mark fiel auf, wie die meisten Kinder Theobald halfen, die Karten einzusammeln. Es war also wie immer.
„Hey, Theo. Heute hättest du ihn voll fertiggemacht, diesen Tomaten-Mark.“
Tomaten-Mark nannten sie ihn, weil er so schnell rot wurde und auch jetzt spürte Mark, wie die Röte in sein Gesicht schoss.
„Natürlich hätte ich das“, ließ sich Theobald aus. Das reichte Mark. Mühsam nur beherrschte er sich, um freundlicher zu klingen, als er es gerne wäre.
„Dann müssen wir morgen noch mal eine Runde Spiel spielen, damit wir sehen, wer der Bessere von uns ist“, erwiderte er. Nicht sehr schlagfertig. Wortlos wollte er sich aber auch nicht geschlagen geben.
Dann fiel ihm auf, dass ihm noch eine Karte fehlte. Es war zwar eine Karte die nicht auffallen würde, wenn er sie nicht mehr hätte, auch hatte er noch drei Karten der gleichen Sorte, aber der Ordnung halber wollte er sie wiederhaben. Es konnte ja nicht möglich sein, dass eine Karte einfach verschwindet. Auch wenn ein Windstoß kommt und sie durcheinanderwirbelt, lässt dieser trotzdem keine Karten verschwinden. Er packte sein restliches Kartenset in seinen Ranzen und hängte ihn über die Schulter, als auch schon die Schulglocke zur nächsten Stunde läutete.
Genau in diesem Moment sah er seine Karte nahe am Waldrand liegen, der etwas entfernt vom Pausenhof begann. Mark lief los, um sie noch schnell zu holen. Schließlich gehörte eine Spielkarte nicht auf die Wiese, sondern in seine selbst gebastelte Kartenbox. Sich gegen die Massen von Schulkameraden lehnend, welche rechtzeitig zum Unterricht wollten (oder eher mussten), machte er sich auf, um noch schnell seine Karte zu ergattern. Er hüpfte leichtfüßig wie selten über den Zaun vom Pausenhof und sprintete zur Spielkarte. Da lag sie auch so verlockend, als ob sie auf ihn wartete, wippte auf einem niedergefallenen Stück Ast hin und her.
Als Mark angerannt kam und sich gerade bückte, um die verflixte Karte aufzuheben, da flog sie auch schon wieder behände vom Wind erfasst, genauso verlockend wie sie zuvor dalag, weg und tief in den Wald hinein. Mark stand mit offenem Mund da und schaute der Karte hinterher.
„Was sollte das jetzt?“, dachte er bei sich, „die will doch nur, dass ich zu spät zum Unterricht komme. Das kann diese Karte aber vergessen.“
Er wurde ein wenig nervös, da er jetzt nur noch wenig Zeit hatte, pünktlich zu sein.
Kurzerhand hüpfte er der Karte hinterher, aber gerade, als er bei dieser ankam, wurde sie wiederum vom Wind erfasst und noch weiter in den Wald getragen. Mark rannte hinterher. Er rannte auch immer noch hinterher, als die Karte das Spielchen ein weiteres Mal machte. Und dann noch einmal. Der Unterricht war inzwischen vergessen.
Als er schließlich dorthin kam, wo seine Karte zuletzt verschwand, war von dieser keine Spur mehr zu sehen. Er schaute sich um. Hinter dem Gebüsch, vielleicht unter dem umgestürzten Baum? Er wagte auch noch einen Blick unter den Blätterhaufen hinter einem großen Stein, aber die Karte blieb spurlos verschwunden.
„Kein Wunder, dass ich die Karte nicht finde, wenn hier auch alles durcheinanderliegt. Da kann man ja nichts finden. Da ein Stock, dort ein Stein“
Gerade als Mark dies vor sich hin nuschelte, fiel ihm wieder ein, dass er jetzt viel zu spät zum Unterricht kommen würde.
Plötzlich war die Karte egal. Wenn er bei der bösen Englischlehrerin mit diesem eigenartigen Puschel als Frisur zu spät käme, dann könnte er sich auf was gefasst machen. Einige behaupteten, Frau „Puschelblumenkopf“ habe schon mal einem Kind ein Bein ausgerissen, wie es das Kind selbst höchstens bei einer Fliege gemacht hätte. Und das Ganze nur, weil der arme Junge vergessen hatte, was Bein auf Englisch heißt. Mark wusste nicht, wie viel davon stimmte, aber ausprobieren wollte er es auch nicht. Dass sie böse und gemein war, das wusste er auch ohne diese Gruselgeschichte.
So durch den Wald sprintend, lief er den Weg zurück, den er gekommen war. Das Problem war nur, dass er jetzt schon viel zu lange in diese Richtung lief. Der Wald hätte schon lange hinter ihm liegen sollen. Mark blieb stehen. Er lauschte ob er irgendwas in der Ferne hörte. Aber da war nichts außer dem Rascheln der Blätter und ein paar zwitschernden Vögeln. Mark rannte wieder los so schnell er konnte. Nach ein paar Minuten stolperte er blindlings über eine alte Wurzel, die aus dem Boden ragte. Schmerzverzerrt setzte er sich auf und begutachtete sein Knie. Es war aufgeschürft und blutete. Am meisten ärgerte Mark, dass seine Hose jetzt kaputt war. Aber daran konnte er jetzt nichts ändern.
Als er wieder aufstand, drehte er sich in die Richtung, wo er hergekommen war, und da lag immer noch der umgestürzte Baum, unter dem er seine verlorene Karte gesucht hatte, und daneben der große Stein. So langsam wurde ihm ein wenig unbehaglich zumute. Verwirrt ging er um den Stein und langsam um den umgestürzten Baum. Das war genau der Ort, wo er vorhin umdrehte, um nicht zu spät zum Englischunterricht zu kommen. Und dass er im Kreis gelaufen war, das konnte er sich auch nicht vorstellen. Was ging hier vor sich?
Als Mark behutsam an der herausgerissenen Wurzel des Baumes vorbeiging, schaute er in das riesige düstere Loch, in dem der Baum fest verankert gestanden hatte, bevor er durch irgendeinen Sturm, heraus gerissen worden war.
Der Baum war anscheinend erst vor kurzem umgefallen. Die Erde, die an den herausgerissenen Wurzeln hing, war noch feucht und roch leicht modrig. So wie Erde riecht, wenn man ein frisches Loch in den Boden gegraben hat.
Irgendwas schimmerte unten in dem Loch, das die Wurzeln des Baumes hinterlassen hatten. Es war ungefähr so tief wie Mark groß war. Angezogen von diesem seltsamen Schimmer im Loch, kletterte Mark hinein.
Es war nur eine kleine Spitze, die aus der Erde ragte und bläulich flackerte. Sich fragend was es denn sein könnte, fing er an, es auszubuddeln. Als Mark so grub, legt er das Ding frei. Es war ungefähr so lang wie sein Unterarm und so dick wie sein Daumen, während es nach oben hin immer schmaler wurde, so dass es an einem Ende spitz zulief. Insgesamt war es ganz leicht gebogen und sah so aus als ob es warm gemacht wurde und ein wenig in der Länge gedreht. Es erweckte den Anschein, als ob sich der Stab um sich selbst windet. Von der Farbe her war es ganz weiß begleitet von diesem zarten, bläulichen Schimmer, der von ihm ausging.
Fasziniert von seinem Fund fing er an, ein bisschen tiefer zu buddeln, um zu sehen, ob dies das einzige war, was dort im Verborgenen lag. Kurz darauf fand er noch etwas Weißes und Hartes in der Erde und schaufelte es mit vollem Eifer frei, um zu sehen, was es denn sei. Als er ungefähr die Hälfte frei gegraben hatte, zog er sich angeekelt zurück und beobachtete mit Entsetzen, was dort lag. Es war nämlich nichts weniger als der Schädel eines längst verstorbenen Tieres.
„Irgendjemand muss dieses Tier getötet haben. Ja, vielleicht sogar mit dem Stab den ich gefunden hab“, dachte Mark bei sich und ihm wurde unheimlich bei dem Gedanken.
Der Totenkopf des Tieres hatte genau in der Mitte der Stirn ein kreisrundes Loch.
„Das muss die Stelle sein, an der das arme Tier seinen Todesstoß bekommen hatte“, dachte Mark.
In aller Hast machte sich Mark auf, wieder aus dem Loch zu klettern. Das war ihm zu unheimlich. Allerdings ging er nicht los, ohne diesen zauberhaften Stab mitzunehmen. Er packte ihn vorläufig in seinen Rucksack, um besser hinaus klettern zu können. Oben angelangt beeilte er sich, von dem Loch wegzukommen. Dabei schaute er immer wieder nach hinten, um sicher zu gehen, dass er nicht wieder an der gleichen Stelle blieb, so wie es ihm vorhin ergangen war. Aber diesmal nahm alles seinen gewöhnlichen Lauf. Der Ort, von dem er wegging, blieb immer weiter in der Ferne zurück. Und diesmal kam er zu dem Ende des Waldes.
Er rannte erleichtert hinaus und fand sich auf einer großen Lichtung. Dort, wo eigentlich sein Schulhof mit Schule hätte stehen sollen, war nichts. Dafür stand er auf einmal auf einer riesigen Lichtung, mit zahlreichen bunten Blumen zu seinen Füßen. Keine Gebäude oder Straßen, soweit das Auge reichte.
Er drehte sich um und sah dort nur Wald. Dadurch, dass er auf einer kleinen Anhöhe stand, konnte er weit in die Ferne blicken. Nichts, was er sah, erinnerte ihn auch nur im Entferntesten an seine Schule. Oder gar an die Stadt, in der er wohnte. Wo zum Teufel war er hier nur gelandet? Wo waren nur seine Schule, seine Lehrer und seine Eltern?
I.
Die Ebene, die sich vor Marks Augen darbot, erstreckte sich kilometerweit in alle Richtungen vor ihm. Links endete sie in weiter Ferne an einem gewaltigen See oder einem Meer; das andere Ufer konnte er nicht ausmachen. Von der anderen Seite wurde sie wiederum eingerahmt von dem Wald, aus dem Mark so eilig gerannt gekommen war.
Das Eigenartigste, ohne Zweifel, war jedoch der Himmel, an dem sich zwar normale Schäfchenwolken zeigten, der aber anstatt wie sonst blau rot war. Er überlegte, ob es schon Abend wurde, aber dafür war es definitiv zu früh. Außerdem konnte er die Sonne hoch oben am Himmel sehen. Der Abend war also noch fern. Ansonsten schien alles normal (wenn man davon absah, dass Mark eigentlich gar nicht hier sein sollte).
Unten, die Lichtung hinab, dort, wo der See und der Wald sich berührten, glaubte er ein kleines Haus zu erkennen. Mark setzte sich und begann zu grübeln, was mit ihm passiert war. Verzweifelt schaute er sich um. Wo ist seine Schule abgeblieben? Die Straßen waren weg. Die ganze Stadt verschwunden. Somit auch seine Eltern, das Haus, in dem er wohnte, und sein Zimmer. Fassungslos lief er ein wenig am Waldrand entlang. Er war total ratlos. Wie konnte das Ganze passieren? Hier war nichts, was ihn auch nur im Entferntesten an seine alte Heimat erinnerte. Er war mitten im Nirgendwo!
Nach einiger Zeit setzte er sich auf einen großen Stein, der auf der Wiese lag. Verzweiflung überkam ihn.
Schließlich vergrub er seinen Kopf in den Armen und Tränen kullerten über sein Gesicht.
Eine ganze Weile saß er so da und konnte sie einfach nicht mehr zurückhalten.
„Was weinst du denn so?“ Mark drehte sich erschrocken um.
„Es ist doch so ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Ich habe mich heute nicht im Wald verlaufen und sogar was zu essen gefangen, das ich unmöglich alleine aufessen kann.“
Verdutzt schaute Mark auf den Mann der vor ihm stand und vergaß für einen kurzen Moment seine verzweifelte Lage. So sonderbar wirkte der Mann auf ihn.
Er maß ungefähr zwei Meter in der Höhe, und sah ziemlich gemütlich aus mit seinem großen Bauch. Ein Lächeln blitzte durch seinen langen Bart. Ein wenig erinnerte er Mark an den Weihnachtsmann. Seine Kleidung war jedoch eine ganz andere. Er war in einen weiten, weißen Umhang gehüllt, und die nackten Füße schauten unten heraus. An der Seite waren zwei weite Ärmel für die Arme angebracht.
Neben ihm lagen zwei tote Hasen, die er auf der Jagd erlegt hatte. Jedenfalls glaubte Mark, dass es Hasen waren, denn vor den Ohren wuchsen zwei kleine Hörner empor.
„Komm schon, steh auf. Ich möchte heute nicht alleine essen“, sagte der Mann mit einem freundlichen Lächeln.
Zögernd stand Mark auf und folgte ihm.
Kurze Zeit später saß Mark im Haus des bärtigen Jägers, welches im Übrigen die Hütte war, die er schon in der Ferne ausgemacht hatte. Das ganze Haus bestand nur aus dem Raum, in dem er sich befand und einem kleineren Zimmer, wohin der freundliche Jäger sich wahrscheinlich zur Nachtruhe begab.
In dem großen Raum thronte ein massiver Holztisch mit vier Stühlen in der Mitte. An einer Wand ragte ein großer Kamin empor, in dem ein Kochtopf herabhing. In diesem Kamin entzündete der Jägersmann nun ein Feuerchen und war dabei, die hasenartigen Tiere zuzubereiten.
Der Rest des Zimmers war voll gestopft mit irgendwelchem Kram: Unrat, Bücher und alles Erdenkliche lag am Boden. Alles wahllos übereinander, durcheinander und ineinander geworfen, so dass
Mark sich fragte, wie überhaupt irgendjemand in dieser Unordnung wohnen konnte.
Auf einem von den Stühlen, die den Tisch umgaben, saß Mark jetzt. Seine Beine baumelten in der Luft.
„So, wie war noch mal dein Name? Entschuldigung, ich kann mir Namen nicht so gut merken. In letzter Zeit vergesse ich sogar, wie ich selbst heiße“, begann der alte Mann die Stille in dem Raum zu brechen.
„Ähm, ... ich ... hab meinen Namen noch gar nicht genannt. Ich heiße Mark. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf?“
„Nicht so vornehm, Junge. Wir sind hier doch nicht am Hofe der großen Stadt. Du kannst mich gerne duzen. Hier in den Wäldern von Tringsten nehmen wir das nicht so genau.“
Der alte Mann streckte Mark seine große Hand entgegen.
„Man nennt mich Tombars vom Tringstensee. Das ist übrigens der große See gleich neben meinem bescheidenen Haus, wie du dir vielleicht schon gedacht hast. Es reicht aber, wenn du mich Tom nennst. Ich werde dich auch nur - . Wie war nochmal dein Name?“
„Mark, Herr Tombras vom Pfingstensee.“
„Tringsten, Tringstensee.“ Mit einer Handbewegung wischte er die Bemerkung beiseite.
„Ist ja auch egal. Mark. Genau so werde ich dich nennen. Klingt nach einem alten Namen. Ich glaube die Elfen in den Wäldern, weit im Osten, hatten auch solche wunderlichen Namen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre.“
Und so redete der freundliche Mann mit dem kleinen, verstörten Mark, der gar nicht wusste, was er von diesem seltsamen Herrn und seiner Hütte halten sollte.
„Hast du schon mal meinen Eintopf probiert? Bestimmt nicht. Ich habe nämlich seit Jahrzehnten keinen Besuch mehr gehabt. So lange ist das schon her. Und damals hatte ich auch nur ungebetenen Besuch, weil ein Riese aus Versehen mein Haus zertrampelte. Aber du schaust nicht aus, als ob du älter bist als ein Jahrzehnt. Dann hast du mein Kringaeintopf bestimmt noch nicht probiert.
Woher kommst du?“
Tombars begutachtete ihn von oben bis unten.
„Deiner Größe nach könntest du vom Zwergenvolk sein? Kommst du aus der großen Stadt im Norden? Du musst mir erzählen, was es Neues gibt. Und wie du hierhergekommen bist.“
Während Mark eingeschüchtert und verwirrt auf dem Stuhl saß, schien Tombars sichtlich erfreut über den Besuch zu sein.
„Ist das schön. Endlich jemand zum Reden. Und nach dem Essen mach ich Musik und wir singen und tanzen.“
„Vom Zwergenvolk bin ich nicht.“ Mark schien sichtlich verstört über das seltsame Gerede des alten Mannes. Was sollte das mit den Zwergen? War das eine komische Art von Humor?
„Ich bin nur noch nicht so groß, weil ich ein Junge bin, der aus dem Wald kam“, mit einer Handbewegung deutete er die Richtung an, wo ihn Tombars aufgegabelt hatte.
„Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Hier sollte eigentlich meine Schule sein und … meine Eltern.“
„Eine Schule? Interessant, hier war noch nie eine Schule, mein Junge. Genau genommen, weiß ich noch nicht mal, was das ist.
Eine Schule.
Aber erzähl bitte von vorne, ich bin wahnsinnig neugierig auf neue Geschichten aus der Welt. Ich habe so lang keine Geschichte mehr gehört, außer die, die ich mir selbst erzähle in dieser Einsamkeit.“
Mark fing an, ihm sein Abenteuer zu erzählen. Wie er seiner Spielkarte hinterhergelaufen ist. Von seinem Fund in dem verzauberten Wald und wie er, als er endlich aus dem Wald kam, auf einmal auf der Lichtung stand. Bis zu dem Moment, wo er Tombars getroffen hatte. Als er zu der Stelle mit dem Himmel kam, und fragte warum er nicht blau ist, horchte Tombars auf. „Das ist wirklich seltsam. Einen blauen Himmel, sagst du, gibt es dort, wo du herkommst?
Dieser Himmel war schon lange nicht mehr blau. Seit Jahrhunderten schon ist er so rot wie jetzt. Bist du dir wirklich sicher? Und dieser Fund, magst du ihn mir mal zeigen?“
Mark nahm daraufhin sein Rucksack und öffnete ihn. Er glaubte nicht, dass Tom ihm etwas Böses antun wollte. Dazu war der alte Mann in seiner Art zu sanft und freundlich.
Als Tom den Stab sah, den Mark in seinem Rucksack trug, hüpfte er auf einmal aufgeregt durchs Zimmer.
„Das kann nicht sein. Das ist ja fantastisch. Ich hab gedacht, die gibt es gar nicht mehr.“
„Was gibt es nicht mehr? Was ist das denn für ein Stab, dass Sie so herumhüpfen?“
Der alte Mann wirkte auf Mark immer kauziger, da ein zwei Meter großer, alter Mann mit weißen Bart einen sehr eigenartigen Anblick gibt, wenn er durch das Zimmer hopst.
„Das ist kein Stab. Das ist eine Legende. Welch Labsal für meine alten Augen. Ich spüre förmlich wie das Leben wieder in meine, des Wartens müden Glieder kehrt. Komm, steck ihn wieder ein. Wir wollen nach draußen gehen.“
Und schon war Tombars auf dem Weg zur Tür. Er wirkte weniger verwirrt als noch vor ein paar Minuten.
Draußen ging er ein gutes Stück vom Haus weg. Mark hechtete ihm mit seinem Rucksack hinterher.
„So, jetzt pack den Stab noch mal aus, den du gefunden hast.“
Mark machte, was Tom von ihm wollte, auch wenn er nicht verstand, was das Ganze sollte. Als Mark den Stab aus dem Rucksack zog, traute er seinen Augen nicht. Der komplette Himmel bis zum Horizont wurde auf einmal blau.
„Wie ist das möglich? Das ist ja unglaublich.“
„Das ist es, Mark. Da gebe ich dir recht. Ich habe den Himmel seit über 1000 Jahren nicht mehr in dieser Pracht erleben dürfen. Er ist wunderschön. Schöner als ich ihn noch in Erinnerung hatte.
Kleiner, geh mal weg von mir, bis dir etwas auffällt.“ Mark gehorchte und stellte nach einiger Zeit fest, das sich der Himmel wieder rötlich färbte, wenn er sich weit genug von Tom und dem Stab entfernte.
„Der Himmel ist wieder rot geworden.“ Mark rannte wieder zu Tom.
„Wie ist so etwas möglich?“
„Das will ich dir später erzählen. Unser Abendessen ist fertig. Lass uns erst einmal essen, Kleiner. Wir haben noch genug Zeit miteinander zu reden.“
Und leise nuschelte er etwas vor sich hin. Mark meinte etwas von “Ich glaube die alten Zeiten kommen wieder“, verstanden zu haben.
Er packte seinen Stab zurück in die Tasche und die beiden kehrten zurück in Tombars Haus am Tringstensee. Irgendwo in den Wäldern von Tringsten in einer Welt, die Mark so fremd war wie Afrika, Süditalien oder Hinterpommern.
II.
„Was ist denn jetzt mit meinem Stab, Tom?“
Mark fragte jetzt schon zum wiederholten Male. Inzwischen hatten die beiden neuen Freunde diese eigenartigen Hasen gegessen, die jedoch - wie Mark fand - eher nach Känguru oder Krokodil schmeckten. Auf jeden Fall nach einem Tier, dass er noch nie zuvor gegessen hatte.
Tombars war gerade dabei, seine alte Gitarre in dem Haufen Unrat zu finden oder, um genau zu sein, verzweifelt zu suchen.
„Geduld. Ich würde dir gerne erst ein altes Lied vorspielen. Ich muss nur meine Gitarre finden. Die war doch hier irgendwo.
Naja, weglaufen kann sie ja nicht. Hoffe ich zumindest. Mein Sessel ist vor zwei Jahren auch weggelaufen. Dem wurde das zu langweilig hier.
Da ist sie ja! So Junge, jetzt passe mal auf, das ist ein sehr altes Volkslied, welches von den Begebenheiten handelt, kurz bevor sich der Himmel verfärbte. Es spielt hier in den Tringstenwäldern. Direkt in der Nähe von der Lichtung, wo ich dich fand.“
Und Tom, nachdem er seine Gitarre gestimmt hatte, fing an, mit einer tiefen und vollen Stimme zu singen. Die Stimme hatte etwas Angenehmes, Warmes in ihrem Klang und Mark lehnte sich neugierig und satt in seinem Stuhl zurück.
„Horcht in die Wälder, nahe des Meers
Wo sie einst kämpften, die Männer des Heers
Gegen den Feind aus der tiefsten Quell
Mit Hilfe von Magie; so rein und so hell
Mit den gehörnten Pferden im Bund
Gegen die Scharen aus dem Höllenschlund
Doch Verloren sie die Hüter in größter Not
Färbten den Himmel durch ihr Blut tiefrot
Der Rest wurde gebannt jenseits der Welt
Ausschau haltend nach einem großen Held
Welcher klein vom Wuchs und groß im Herz
Uns erlöst von dem alten Schmerz.
Tombars hörte auf zu singen und legte die Gitarre wieder beiseite.
„Das ist ein schönes Lied, Herr Tom. Was ist das für eine Schlacht, von der das Lied handelt?“
„Ich will dir erzählen, wie es sich damals zutrug, denn es ist viel mehr als nur ein Lied.
Ich war ja selbst dabei. Entschuldige, wenn ich die eine oder andere Sache vergessen haben sollte. Die langen Jahre in der einsamen Hütte haben mein Hirn ein wenig einrosten lassen.“ Tom suchte seine Pfeife kurz im Zimmer, fand sie allerdings nicht. Er setzte sich tief in seinen Stuhl, lehnte sich bedächtig nach vorne nahe an Marks gespanntes Gesicht und fing an zu erzählen.
„Was damals passierte, war fürchterlich. Viele Leute fanden den Tod. Es war einer der grausamsten Kriege, die wir in unserem Land je führten. Erbarmungslos und ohne Gnade zogen die Diener des Bösen über das Land, um unsere Häuser zu zerstören und die Bewohner zu zerschlagen:
Es war vor circa 1500 Jahren in diesen Wäldern ein paar Kilometer weiter südlich. Dort fängt der unendliche See an. Ein unendlich weites Meer, dessen anderes Ufer noch nie erreicht wurde. Wenn der Wind hinüberweht, kann man die salzige Luft noch hier riechen.
Aus diesem großen Meer kam damals der Sohn des Meeresgottes Potelón. Der hieß ... . Der Name war so ähnlich wie der von seinem Vater. Einen Moment mir fällt es gleich wieder ein. Po.. Po.. Potereón. Genau das war der Name: Potereón.
Potelón hatte keinen Grund, stolz auf seinen Sohn zu sein. Dieser war nämlich von dem Wunsch besessen zu herrschen und versuchte, das Land mit Gewalt zu regieren. Man sagt, er kam an Land, weil sein Vater das Wasser regierte und nicht freigab. Gegen seinen Vater zu kämpfen, das wagte er nicht. Er stellte eine Armee zusammen. Mit Dämonen, die aus der tiefen Erde gekrochen kamen. Wolfsmenschen und Orks. Aber auch Kreaturen hatte er auf seiner Seite, welche mit den Sternen auf diese Welt gestürzt kamen, wie es heißt.
Es unterstützten ihn viele aus deinem Volk, Kleiner. Die Menschen sind sonderbar in ihrer Art und leicht auf den falschen Weg zu bringen. Sie lassen sich schnell blenden von dem leichten Weg, den das Böse verspricht. Vielleicht setzte er sie auch unter Druck oder zwang sie. Wahrscheinlich reichte das Versprechen nach Ruhm und Gold.
Wie dem auch sei. Die Armee von Potereón kam aus Richtung des unendlichen Sees und betrat hier das Land. Allerdings wurden sie schon von der Armee des Königs aus der großen Stadt erwartet. Die Zauberer dort haben viel Macht und vermögen sogar in die Zukunft zu blicken, sofern sie unausweichlich ist. Die mächtigsten Kämpfer und Könige schlossen sich gegen die Armee von Potereón zusammen. Die Menschen aus der großen Stadt im Norden. Die Zwerge aus den Hügelebenen noch weiter im Norden. Dort wo die Schluchten so tief sind, dass keiner es vermag sie zu durchqueren.
Aber auch die Elfen, die auf ihren gehörnten Pferden daherkamen. Die mächtigsten Reiter, unerschrocken und tapfer. Die gehörnten Pferde, so heißt es, lassen nur die edelsten Menschen auf sich reiten. Solange die Menschen mit den Pferden zusammenleben, bleiben sie nahezu unsterblich und altern nicht mehr. Sie sind auch schöner anzuschauen als die übrigen Menschen. Manche sagen, das kommt von ihrer Lebensgemeinschaft mit den Pferden zusammen. Die Elfenreiter hatten goldenes Haar und ein wunderschönes Gesicht und sie wussten die schönsten Lieder zu singen. Von sonderbaren und fremden Welten. Jeder freute sich, wenn ein paar Elfenreiter bei ihm übernachteten.
Diese gehörnten Pferde, die den Elfen so viel Macht verliehen, sagt man, wurden von den Göttern gezüchtet. Es wurde das Lieblingstier und der treue Begleiter der Violer. Durch die Magie, die in den gehörnten Pferden schlummerte, behüteten diese Pferde schließlich das Gute auf der Welt, noch lange nachdem uns die Violer verließen. Jedoch schweife ich ab. Es sind lange keine gehörnten Pferde mehr gesichtet worden und somit auch keine Elfenreiter mehr.
Allerdings wurden die meisten Pferde in dieser großen Schlacht von Potereón und seinen Schargen umgebracht. Potereón lockte sie in eine Falle, aus der sie nicht mehr heraus amen, und durch ihr Blut färbte Poteréon in dieser Schlacht den Himmel rot, ohne dass Helíon, der Sonnengott, etwas hätte ausrichten können.
Es wird gemunkelt, dass der Gott der Unterwelt, Morgón, sein heimlicher Verbündeter war. Die Pferde, die in der Schlacht nicht getötet wurden, flüchteten aus unserer Welt oder wurden verbannt. Ich persönlich glaube jedoch, dass Potereón damals alle gehörnten Pferde erwischt hat.
Der Kampf selbst erstreckte sich über Jahrzehnte. Die stolzesten Krieger wurden getötet. Die mächtigsten Magien wurden freigesetzt.
Es gibt immer noch einige Orte, die von schrecklicher Magie durchtränkt sind.
Danach gelang es einem kläglichen Rest von unserem Volk, den schwer verletzten Potereón wieder ins Meer zurück zu jagen. Seitdem versteckt er sich vor seinem Vater, dem Gott der Meere, und bereitet sich auf den nächsten, seinen letzten Angriff vor.
Immer wieder treffen wir auf Ungeheuer. Sie kommen aus der Erde gekrochen, wo sie sich versteckt halten, und verbreiten Angst und Schrecken. Sie sind nur in kleinen Gruppen unterwegs und meist auch nicht wirklich gefährlich. Orientierungslos ziehen sie durch das Land, solange es keinen Anführer gibt, der sie zu führen weiß. Dieser sitzt irgendwo in den Tiefen der Meere und leckt seine Wunden.
Seit dem vorläufigen Sieg über Potereón bin ich der Wächter des unendlichen Sees und warne die Welt im Falle des nächsten großen Angriffs aus dem Meer. Neben mir gibt es noch drei weitere Magier. Die an den drei anderen Enden unserer Welt Wache halten. Aber der schlimmste Verlust ist der Tod unserer weißen Pferde. Ohne sie gibt es in unserer Welt keinen einzigen Elfenreiter mehr. Am Ende des Liedes heißt es, wird ein kleinwüchsiger Held die Welt erneut retten und die gehörnten Pferde zurückbringen. Seitdem halten sich die Zwerge für unheimlich wichtig, da ihrer Meinung nach einer aus ihrem Volk uns zum Sieg führen soll.“
„Tom, dieser Stab, den ich gefunden hab und der mich anscheinend auch hierher ebracht hat, der hat was damit zu tun, nicht wahr? Warum wird der Himmel blau, wenn man ihn bei sich trägt?“
„Das ist doch ganz einfach. Das ist das Horn von einem gehörnten Pferd.“
„Du meinst, das ist das Horn von einem Einhorn? Aber die gibt es doch gar nicht.“
„Einhorn. So. Nennt man die bei dir so? Warum soll es die nicht geben? Du hast doch ein Horn von so einem. Ich verstehe dich nicht.“
„Die Einhörner kommen bei uns nur im Märchen vor. Erfundene Geschichten. Die gibt es nicht wirklich.“
„Da könntest du recht haben. Es war schließlich schon tot, als du es gefunden hast. Aber ich hoffe, dass du dich irrst und es doch noch welche gibt. Ohne die Einhörner haben wir keine Chance in der entscheidenden Schlacht, die mit Sicherheit bald kommen wird. Ich spüre es. Jetzt, wo du da bist mit diesem Horn von einem Einhorn, wie du es nennst, glaube ich, dass die Zeit nicht mehr fern sein kann.
Die Zeit, in der sich Potereón nochmals aus den Tiefen des Meeres emporheben wird, um unsere Welt zu unterdrücken. Und letzten Endes kommen die Einhörner zurück, wenn die Prophezeiung stimmt.“
Tombars überlegte vor sich hin und strich mit seiner Hand langsam durch den Bart.
„Wir werden über das weitere Vorgehen sprechen müssen. Ich weiß nicht genau, was wir mit einem Horn von einem gehörnten Pferd anfangen sollen. Ehrlich gesagt ging ich davon aus, die gehörnten Pferde kommen lebendig wieder.
Aber so ist das wohl. Es passiert nie so, wie man es sich denkt.
Aber für heute war das schon genug Aufregung, wir werden es uns erst einmal gemütlich machen und schlafen. Morgen wird die Welt noch nicht untergehen.“
Mit diesen Worten beendete Tombars das Gespräch und richtete noch schnell ein Bett aus alten Laken und einer Strohmatratze her, welche er irgendwo aus dem Unrathaufen hervorzauberte. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Er stöberte ein paar Minuten in dem Krusch, der im Zimmer verteilt lag, bis er fand, was er suchte, und die beiden begaben sich zur Nachtruhe.
Als Mark am nächsten Tag aufwachte, fand er sich alleine in der kleinen Hütte wieder. Im ersten Moment war er verwirrt und musste sich kurz orientieren. Doch schnell fiel ihm wieder ein, dass er sich in der Hütte des wunderlichen, alten Mannes befand.
Er bemerkte, dass der Hut und auch das Jagdmesser von Tom weg waren. Alles beide trug er gestern, wo Mark ihn das erste Mal getroffen hatte. Daraus schloss Mark kurzerhand, dass Tom unterwegs sein musste, um das Frühstück zu jagen.
Auf dem Tisch stand eine Schüssel mit Besteck daneben. In der selbigen befand sich ein gelblich-grüner Brei, der trotz des komischen Aussehens vorzüglich roch, wie Mark fand. Er setzte sich an den Tisch und aß diesen Brei, der um einiges besser schmeckte, als er aussah.
„Dann jagt er halt das Mittagessen“, dachte er beim Schlemmen vor sich hin.
Er schlang den Brei geradezu hinunter. Nebenbei ließ er sich noch mal das, was er gestern alles gehört hatte, durch den Kopf gehen. Einhörner, als Beschützer der Welt. Ein Zwerg, der alle retten soll. Und Tom, ein alter mächtiger Magier, der hier, in dieser Hütte, die Welt vor der neuen Ankunft des Bösen bewacht? Vielleicht ein älterer, netter Mann, der gerne ein paar Sachen vergisst und sehr unordentlich ist, aber mehr auch nicht.
Unordentlich war das Stichwort. Mark konnte sich bei diesem Haufen voller Zeugs nicht konzentrieren. Das war ja schrecklich. Kurzerhand fing er an, diesen unmöglich aufeinander geworfenen Haufen von mehr oder weniger hochwichtigem Zeugs aufzuräumen. Nach kurzer Zeit fand er in besagtem Haufen eine Art Besen. Mit diesem bestückt ging die Arbeit schon viel schneller von der Hand.
Er sortierte alles fein säuberlich nach Kleidung (welche er vorher erst zusammenlegen und teilweise auch ein wenig waschen musste), Küchenkram, den Küchenkram wiederum in Nützliches und Essbares. Des Weiteren sortierte er in Haufen von Werkzeug, von Sachen zum Zeitvertreib, wozu auch die Gitarre gehörte, und in Undefinierbares, das es auch wirklich war in seinen Augen.
Er fand ein kleines Amulett beim Aufräumen, das ihn sehr interessierte. Auf dem Amulett waren zwei ineinander geschlungene Drachen abgebildet, welche sich gegenseitig anschauten und mit ihren Flügeln einen nahezu perfekten Kreis bildeten. Wenn Tom wieder kam, wollte er ihn fragen, ob er es leihen dürfte. Es glänzte so schön und erinnerte ihn ein bisschen an seine Goldmedaille, die er zu Hause im Schrank stehen hatte. Er hatte die Goldmedaille letztes Jahr bei einem Sortierwettbewerb in seiner Schule gewonnen. (Den Schülern, vor allem Mark, hatte es sehr viel Spaß gemacht und die Schule hatte danach endlich wieder eine gut sortierte Bibliothek.)
Bei den Gedanken an zu Hause musste Mark an seine Eltern denken. Sie würden ihn wohl ziemlich vermissen. Wahrscheinlich noch mehr, als er sie vermisste, und das ist schon nicht wenig. Wie sollte er nur jemals nach Hause zurückkommen. Er wusste ja noch nicht mal genau, wie er hierher gekommen war. Irgendwie hatte das Einhorn-Horn ihn hierher gebracht, aber könnte es ihn auch wieder zurückbringen? Und seine Spielkarte hatte er letzten Endes auch nicht wiedergefunden. Die ganze Situation fing an, Mark gar nicht zu gefallen. Wenn er jetzt noch in einen Kampf gezogen wurde? Ein Kampf, welcher gar nicht seiner war.
Mark hörte nach einer Weile, wie Tom draußen näher kam. Mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen. Tom öffnete die Tür und blieb mit aufgerissenen Augen und offenen Mund im Türrahmen stehen. Neben ihm zwei Tiere, die ausschauten wie eine Mischung aus Känguru und Huhn. Er glaubte einfach nicht, was er da sah. Sein großer Haufen Unordentlichkeit war in viele kleine Haufen Ordentlichkeit sortiert.
„Was…“ mehr brachte Tombars nicht heraus. Er ging wie in Trance auf den gut sortierten Haufen seiner Besitztümer zu.
„Was.. Wie…?! Aber Mark wieso bringst du denn meine Utensilien so durcheinander?“ Er dreht sich zu Mark, welcher ihn nicht zu beachten schien.
„Mark, was ist los? Du hast ja Tränen im Gesicht?“
„Ich möchte nach Hause, Tom. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, und ich weiß nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Meine Eltern werden sich Sorgen machen. Meine Mutter macht sich doch so leicht Sorgen. Was wird die denn jetzt sagen? Ich bin schon über ein Tag weg. Länger als jemals zuvor in meinem Leben. Irgendeinen Weg muss es doch wieder zurückgeben, oder Tom? Du musst doch einen Weg kennen.“
„Natürlich gibt es einen Weg, Mark. Es gibt immer einen Weg zurück. Nein, es sind viele Wege, aber wir müssen erst herausfinden, welcher der Beste ist. Die Engstirnigen sind es, die nur nach vorne blicken. Aber unsere Pflicht ist es, jetzt alle Richtungen im Auge zu behalten. Ich bitte dich: Gedulde dich. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du deine Eltern wiedersehen wirst. Doch noch sind zu viele Rätsel offen.“
„Dann gibt es also eine Möglichkeit, wie ich nach Hause komme?“ fragte Mark verwirrt nach dieser Antwort.
„Ich bin schon so lange hier auf diesem Wachposten, dass ich das eine oder andere inzwischen vergessen habe. Ich werde dir wahrscheinlich nicht helfen können. Aber es sollte Leute geben, die das können. Wenn du wirklich nach Hause willst, dann musst du in die große Stadt im Norden. Der Zauberer dort wird dir weiterhelfen können. Sie haben Bücher aus allen Zeitaltern, in Bibliotheken, die größer sind als die Höhle, in der der Baum von Ehggdrehs wächst.
Mit Zaubersprüchen, von unglaublicher Eleganz und Schönheit. Die Leute dort wissen, warum du hier bist und auch wie du wieder zurückkommst. Vertraue mir. Dorthin zu gelangen sollte nicht sonderlich schwierig sein. Der Weg ist zwar weit, aber friedlich. Die Leute, die du treffen wirst, sind nett und immer hilfsbereit.“
Tombars machte eine kurze Pause.
„Ich werde dich selber bis zur Stadt am anderen Ende des Tringstensees bringen. Weiter werde ich dich nicht begleiten können, bin ich doch an meinen Eid gebunden, hier zu spähen, bis es Zeichen für einen neuerlichen Ausbruch der Dämonen gibt. Wie ich dir gestern schon gesagt habe, glaube ich nicht, dass es noch sehr lange dauert. Dann wird sich der Sohn des Wassergottes wieder melden und aus den Tiefen des Südmeeres hervorkommen. Deswegen muss ich hier Wache stehen, verstehst du?“
Bei diesen Worten war Mark nicht wirklich wohl zu mute. Er mochte Tombars sehr und konnte sich nicht vorstellen, ohne ihn auch nur einen Schritt in dieser fremden Welt zu gehen.
„Auf der anderen Seite des Tringstensees gibt es ein Dorf. Trolfs Mühle heißt es. Bis dorthin kann ich dich begleiten.
In diesem Dorf finden wir auch einen Führer für dich, der dich zur großen Stadt bringen kann. Bei der gleichen Gelegenheit nimmst du das Horn mit und gibst es dem obersten Zauberer in der Stadt. Ich kenne ihn gut. Ich weiß nur nicht mehr, wie er heißt. Namen sind immer so kompliziert. Schwer zu merken. Passen nicht immer zu dem, der ihn trägt. Er wird dich auf jeden Fall erkennen mit dem Amulett, das du dir selber schon genommen hast, als du meine Unordnung durcheinandergebracht hast.“ Verwirrt stellte sich Tom vor die verschiedenen Haufen seiner Besitztümer.
„Wie finde ich mich denn jetzt zurecht? Ist da irgendein System in diesen Haufen, die du gemacht hast? Ich glaube, du musst mir helfen, mich da zurechtzufinden. Ich möchte die Bolker gerne zubereiten. Auch brauche ich eine Tasche für die Überfahrt nach Trolfs Mühle. Wir werden mit dem Boot reisen.“
Immerhin schien es einen Weg nach Hause zu geben. Wenn Tom recht hatte und der Weg nicht gefährlich war, könnte er es wohl versuchen. Warum auch nicht?
Mark machte sich gleich daran, zu erklären, warum er den Haufen von Tom sortiert hatte und wo er denn nun was finden könne. Nachdem Tom aufmerksam lauschte, war er hell auf begeistert von der Ordnung, die er nun in seinen Sachen hatte. Er fand sogar sofort seine gute alte Pfeife nebst Tabak wieder, die schon seit Jahren im großen Unrathaufen verschollen gewesen war. Genüsslich zündete er sie an und lehnte sich in seinen Stuhl zurück.
„Der Tabak ist zwar schon alt, aber immer noch trocken. Ah, herrlich. Ein wahrer Glücksfall, dass du gekommen bist, Mark. Ein wahrer Glücksfall.“
Dann saß er eine Zeit schweigend in seinem Sessel und wiegte sich langsam vor und zurück. Plötzlich blies er eine große Wolke Rauch aus.
„Asamin! So hieß er. Das ist der Name unseres höchsten Zauberers: Asamin!“
III.
Nach einem angenehmen und entspannenden Abend in Tombars Hütte folgte die Nacht. Tom spielte noch das eine oder andere Stück auf seiner Gitarre, während Mark in seinen Gedanken an seine Heimat dachte, die irgendwo in weiter Ferne lag. Er konnte sich nicht ausmalen, wo diese Welt war, oder wie man hierher geraten konnte. War dies hier vielleicht ein komplett anderer Planet? Lichtjahre von seiner Erde entfernt? Das schien Mark zu unwahrscheinlich. Woher sprachen die Menschen hier sonst die gleiche Sprache wie er. Warum gibt es hier dann überhaupt Menschen? Auf anderen Planeten stellte sich Mark die Ausserirdischen erheblich anders vor.
Also wohl eher keine extraterrestrische Reise durchs All.
Was ihn auch ins Grübeln brachte, waren die Fabelwesen, die es hier zu geben schien. Ebensolche Fabelwesen, von denen es dort, wo Mark herkam, unzählige Geschichten und Märchen gab. War nicht sogar sein Kartenspiel, dass ihn letztendlich hierhergeführt hatte, gefüllt mit Zwergen, Zauberern und eben auch mit Einhörnern?
Vielleicht eine Zeitreise?
Dies konnte sich Mark noch irgendwie vorstellen. Jedoch wusste er, dass, wenn sie in einer anderen Zeit wären, sie sich nicht verstehen würden. Einer seiner Lehrer hatte ihnen mal erzählt, dass sich die Sprache schnell wandelt und wir heute schwerlich jemanden verstehen könnten, der aus dem Mittelalter kam. Auch wenn wir beide Deutsch sprechen würden. Nein. Auch diesen Gedanken musste Mark wohl über den Haufen werfen.
Ein Traum schien es auch nicht zu sein. Dafür war hier alles zu echt. Zu real. Er konnte die kleinen Fliegen genau sehen, wie sie an den geleerten Tellern nach Resten suchten. Das Essen selbst konnte er riechen und Tombars an und für sich war viel zu echt und einzigartig, als nur von ihm erfunden zu sein. Einen Zauberer, dachte sich Mark, würde er sich anders ausdenken. Gewiss nicht in der Form eines eher leicht senilen Halbriesen, wie Tombars den Anschein machte. Mit diesen Gedanken schlief Mark auf seinem Platz ein und Tombars, der Zauberer, legte ihn in sein Bett.
Am Morgen darauf machten sich die beiden Gefährten auf zum See, wo das Boot auf sie wartete. Ihr Marsch zum Wasser wurde begleitet von einem atemberaubenden Sonnenaufgang. Die Luft war klar und die wenigen Wolken, welche sich am Himmel zeigten, zeigten sich in einem warmen Orange getaucht. Fast sah es am Himmel aus wie ein normaler Sonnenaufgang in Marks Welt.
Es roch nach feuchtem Gras und eine Brise kam von den Wäldern. Erfüllte ihre Nasen mit einem süßen, harzigen Duft. Ihr Weg führte sie einen steinigen Pfad entlang zu einer felsigen Landschaft direkt am See. Dort zwischen zwei riesigen Steinen lag ein kleines Boot am Pflock befestigt am Ufer. Mark wunderte sich über den guten Zustand des Bootes. Wenn Tom wirklich seit Jahrzehnten bei seiner Hütte zubrachte, hatte er wahrscheinlich auch das Boot nicht gebraucht. Er äußerte seine Gedanken Tombars gegenüber. Dieser jedoch fing nur an zu schmunzeln.
„Du besitzt eine sehr gute Auffassungsgabe. Wirklich fantastisch. Das Boot habe ich gestern ein wenig aufgefrischt. Mit Magie, wenn du verstehst“, und dabei zwinkerte er Mark mit seinen lächelnden Augen entgegen.
Unverzüglich machten sie es sich in dem Boot bequem und Tom fing an zu rudern. Mark schaute sich begeistert um. So eine schöne Landschaft hatte er noch nie gesehen. Am Ufer ragten die Felsen empor und dahinter die riesigen Wälder von Tringsten. Das Wasser selbst war so rein, dass er die Fische rumtollen sehen konnte. Sogar der Grund des Sees war noch leicht zu erkennen, obwohl der schon mehrere Meter tiefer lag. So klar war das Wasser. Tom indessen ruderte mit einer Leichtigkeit und Ausdauer, wie Mark sie noch nie gesehen hatte.
„Wir werden die andere Seite des Sees frühestens zum Anbruch der Dunkelheit erreichen. Ich bin nicht mehr so in Form wie früher. Wir haben auf jeden Fall genug Zeit, uns gegenseitig Geschichten zu erzählen. Du musst wissen, mir ist gerade eingefallen, welche Geschichte sich um Trolfs Mühle erzählt wird. Das wird dir bestimmt gefallen. Es ist eine Geschichte mit einer ganz besonderen Freundschaft.
Es war vor mehreren Generationen, da lebte eine Drachenfamilie in der Nähe von Trolfs Mühle, in einer Höhle. Die Drachen waren mit bei der großen Schlacht auf der Seite von Potereóns Heer. Nach dessen Niederlage hatten sie sich in eine Höhle zurückgezogen, auf der anderen Seite des Sees. Mehr als ein Jahrhundert flogen die Drachen Nacht für Nacht raus und verwüsteten die Umgebung, wie Drachen es für gewöhnlich zu tun pflegen.
So wurde auch ein kleines Fischerdorf am Tringstensee des Öfteren von den Drachen heimgesucht. Die Fischer hatten sich an die nächtlichen Streiche der Drachen gewöhnt, und blieben nach Sonnenuntergang im Haus, ohne großartig was zu unternehmen.
Es traute sich niemand aus dem Dorf gegen die Drachen zu kämpfen, da die Fischer eher friedlicher Natur waren, und keiner die Lust verspürte, Heldentaten zu unternehmen. Keiner wollte sein Leben lassen für ein solch sinnloses Unterfangen. So zogen also die Drachen des Nachts über ihre Köpfe hinweg und raubten das Vieh, wenn sie konnten.
Kurz vor diesem Dorf gab es an einem Fluss eine Mühle, in der ein Müller namens Trolftian wohnte. Trolftian selbst musste sich weniger Gedanken wegen der Drachen machen. Er besaß keine Haustiere, welche zu ihrer Beute gehörten. Hier gab es nur Getreide, welches er zu Mehl verarbeitete.
Es war früh morgens, als Trolftian von einem kläglichen Gewinsel geweckt wurde. Erst dachte er, ein Hund habe sich irgendwo verletzt. Trolftian zog sich eiligst an um nachzusehen was dieser Tumult sollte. Als er aus seiner Mühle trat, erblickte er jedoch keinen Hund, sondern einen dunkelgrünen Drachen mit seinem Schwanz eingeklemmt im Mühlrad. Vor Schreck wich Trolftian einen Schritt zurück.
Der Drache erblickte den Müller und wurde noch ein bisschen wilder und fing an, um sich zu schlagen. Trolftian erkannte sofort, dass der Drache nicht alt sein konnte. Er rannte zurück in die Mühle und holte einen Großteil seiner Vorräte. Mit diesen bestückt traute er sich nochmals zu dem Drachen.
Der junge Drache erkannte den guten Willen von Trolftian und traute sich nach längerem Zögern zu den ihn mitgebrachten Geschenken, um diese gierig zu verschlingen. Währenddessen besänftigte ihn Trolftian, indem er langsam näher kam und dabei seine Hand beschwichtigend auf die Nase des Drachen hielt. Schließlich befreite er den eingeklemmten Schwanz des Drachen aus dem Mühlenrad.
Als der besagte Drache befreit war, machte er sich mit einem frohen Gefiepse auf in die Lüfte und traf dort auf seine Mutter, die in der Nähe auf ihn gewartet haben musste. Beide flogen einen Tanz am Himmel, indem sie immer wieder um sich selbst flogen, weit in die Wolken hinauf und wieder runter.
Der kleine Drache kam seitdem noch viele Male zu der Mühle von Trolftian und erlaubte diesem sogar auf ihm zu reiten und sich mit ihm durch die Lüfte zu schwingen, so dankbar war er für die Rettung. Noch nie hatte man gehört, dass ein Mensch auf einem Drachen reiten durfte. Die Fischer im nahegelegenen Dorf nannten den Drachen seitdem Trolf und so dauerte es nicht lange, bis das Dorf den Namen Trolfs Mühle erhielt. Ein Name, der für immer an die Geschichte erinnert, seit der sie in Frieden neben den Drachen wohnen. Doch außer Trolftian durfte bis jetzt niemand auf einem Drachen reiten.
Aber die Bewohner des Dorfes brauchten keine Angst mehr haben, dass die Drachen sie in der Nacht attackierten. Dankbarkeit kann es auch bei Monstern geben. Oder solchen, die man für Monster hält. Der Drache selbst, so heißt es, haust noch in den Hügelhöhen nahe bei Trolfs Mühle. Dort gibt es ein unterirdisches Netz großer Höhlen, in denen ein Drache, wie Trolf es ist, sich mühelos zurückziehen kann.
Jetzt weißt du, wie es zu den Namen des Dorfes kam. Die Drachen gehören zu der kleineren Sorte. Sie können zwar Feuer spucken, doch nur wenn sie richtig wütend sind, kann es passieren, dass sie etwas in Brand stecken.“
Nachdem Tom seine Geschichte des Dorfes erzählt hatte, ruderten sie noch ein paar Stunden weiter und Mark erzählte manch lustige Geschichte, die ihm in seiner Schule passiert war. So lachten sie über Lehrer mit Puschelblumenfrisuren und peinlichen Unfällen im Sportunterricht. Es verging die Zeit wie im Fluge und die Sonne war schon wieder auf ihrem Weg nach unten, da trafen sie auf ein Segelboot voller Fischer. In der Ferne ganz weit draußen war auch schon das Ufer zu erkennen, welches sie erreichen wollten. Die Fischer selbst waren gerade mit ihrem Fischfang fertig und begleiteten unsere Freunde, Schiff an Schiff, Richtung Dorf.
Der Kapitän des kleinen Fischerbootes hieß Flortas, er war ein kleinwüchsiger, bärtiger Mann mit stämmigen Beinen und einem knorrigen Gesicht:
„Ihr zwei solltet vorsichtiger sein, wenn ihr über das Wasser rudert“, sprach Flortas zu den zwei Gefährten.
„Die Gewässer sind nicht mehr so ruhig, wie sie mal waren. Letzte Woche haben wir hier in der Gegend kleine Wasserdämonen herumschwimmen sehen. Zum Glück sind sie nicht sehr groß, aber die Leute im Dorf sind trotzdem vorsichtig geworden.
Ich sage dies, falls ihr vorhaben solltet, noch weiter auf dem See zu rudern. In der Nacht könnte es dann ungemütlich werden.“
„Ich danke dir für die Warnung, Flortas. Wir werden unsere Augen offen halten. Aber wo bleibt mein Benehmen. Dies hier ist Mark. Ein kleiner Junge aus weiter Ferne. Ich selbst bin Tombars aus den Tringstenwäldern. Wir zwei suchen eine Unterkunft für heute Nacht bei euch im Dorf.“
„Dann wird es euch in der Seebucht gefallen. Meinem Onkel gehört der Schuppen. Ich werde ihn gleich benachrichtigen, wenn wir ans Ufer gelangt sind.“
Mit diesen Worten machten sich Flortas und die Fischer auf und segelten voraus zum Ufer.
„Dir wird es im Dorf gefallen. Es sind freundliche Leute dort. Wir finden sicher jemanden, der dich mit in die große Stadt nehmen kann. Im Gasthaus sind immer ein paar Wanderer auf der Durchreise.“
Mark gefielen diese Worte nicht. Er wusste nicht, ob er sich ohne Tombars weiter trauen würde.
Inzwischen konnte man auch schon gut das Fischerdorf erkennen mit mehreren kleinen Booten, die in der Bucht am Hafen im Wasser ihre Anker gelichtet hatten. Zahlreiche, kleine Häuser standen am Ufer dicht an dicht. Alle aus Stein gebaut mit einem Strohdach, aus dem ein Kamin ragte. Ungefähr in der Mitte war ein höheres Gebäude, das so ähnlich aussah wie eine Kirche. Mark fragte sich, ob es hier überhaupt richtige Kirchen gab. Die Welt war hier schon anders als die, wo er herkam.
Hier sollte es Drachen, Einhörner, Dämonen, alles Kreaturen, die er vorher nur aus Büchern gekannt hatte.
„Woher weiß ich eigentlich, dass es die Wesen hier denn auch wirklich geben soll?“ dachte Mark so bei sich.
„Bis jetzt habe ich keine gesehen. Und dieses Horn, das ich bei mir habe... das ist zwar ganz schön, aber deswegen muss es ja nicht von einem Einhorn sein. Obwohl…der Totenkopf sah schon aus wie ein Pferdeschädel. Ein bisschen eigenartig ist das schon. Vielleicht haben die Leute hier nur eine etwas übertriebene Fantasie. Bei der Unordnung sind ihre Gedanken vielleicht auch recht durcheinander. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich bin. Die können mich ja hierher geschleppt haben, damit sie... .
Damit sie, was eigentlich? Was sollten die davon haben, mich zu entführen und in eine erdachte Welt zu stecken?“ Mit diesen und ähnlichen Gedanken jonglierte Mark in seinem Kopf. Auch nicht klüger als die Gedanken am Vortag.
Als er auf einmal ein Platschen am anderen Ende des Bootes hörte. Ruckartig drehte er sich um und sah, dass irgendwas aufs Boot gehüpft war und sie beide grimmig anschaute. Das Tier sah aus wie eine etwas größere Kröte mit Krallen an den Füßen, dazwischen Schwimmhäute. Die Haut war glitschig und mit Warzen übersät. Im Gesicht selber saßen zwei milchige Augen, die die beiden Seefahrer böse anstierten, darunter ein breiter Mund mit kleinen, aber scharfen Zähnen besetzt.
„Da haben wir ja schon unseren Wasserdämonen“, entgegnete Tom und schleuderte den selbigen in gleichem Atemzug mit einer gekonnten Handbewegung weit über Bord.
Also doch keine erfundenen Kreaturen. So ließ sich auch dieser Gedanke von Mark über den Haufen schmeißen.
„Dann werden wir uns beeilen müssen, der ist nicht alleine unterwegs.“
Als Mark ins Wasser blickte, sah er tatsächlich noch mehrere dieser Wasserdämonen ums Boot schwimmen. Insgesamt sechs bis sieben Stück, wenn Mark sich nicht verzählt hatte. Und der ordentliche Mark verzählte sich selten. Tombars hatte inzwischen sein Tempo beim Rudern fast verdoppelt und sie kamen schnell dem Ufer näher. Flortas war mit seinem Schiff schon im Hafen eingelaufen. Schon wieder kam einer dieser Dämonen ins Boot gehüpft.
„Einfach raus schleudern, im Wasser sind sie zwar schnell, aber auf unserem Boot plump genug, dass wir uns ihrer noch erwehren können.“
Mark schnappte sich einen Holzscheit, der im Boot lag, und beförderte dieses Tier in gleicher Manier nach draußen, wie er es bei Tom gesehen hatte. Jetzt hüpften immer wieder welche ins Boot, die Mark dann wieder auf dem Luftweg baden schickte. Bei einem schrie Mark auf einmal auf. Hatte sich dieser doch blitzschnell in seiner Hand verbissen. Er erkannte am geschwollenen Auge des komischen Frosches, dass er ihn schon mal hinausgeschleudert haben musste. Mark dankte ihm dies mit ein paar Schlägen auf den Kopf und schleuderte ihn weiter als jeden anderen davor ins Wasser.
Als sie nicht mehr weit vom Ufer entfernt waren, Tom ruderte jetzt so schnell es ging, hörten sie auf einmal ein tosendes Geräusch. Beide Bootsinsassen drehten ihren Kopf ruckartig in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Das Wasser lag ruhig vor ihnen. Nichts war zu sehen. Auf einmal schoss in einer riesigen Wasserfontäne ein Dämon von der Sorte, die die zwei die ganze Zeit belästigte, aus dem Wasser. Nur war dieser Kamerad um ein Vielfaches größer.
„Der ist ja mindestens so groß wie ein Haus“, stammelte Mark während Tom weiterruderte. Als das Ungetüm das nächste Mal aus dem Wasser sprang, hatte es schon gut die Hälfte von dem Weg zum Boot hinter sich gebracht. Beim nächsten Mal müsste er das Boot erreicht haben. Dieser Wasserdämon war unglaublich schnell. Die kleineren Kollegen von ihm hatten sich inzwischen ganz zurückgezogen und waren nicht mehr zu sehen. „Mark. Such dir etwas zum Festhalten. Gleich wird es ungemütlich.“
Tombars Stimme war abgehackt und von schwerem Atem begleitet. Mark ließ sich dies nicht zweimal sagen und hielt sich an einem Balken am Bootsrand fest so gut es ging.
Kurz bevor unsere zwei Freunde das rettende Ufer erreichten, es waren vielleicht zehn bis fünfzehn Meter, da kam das Ungetüm direkt neben ihrem Boot aus dem Wasser gesprungen, flog über Mark und Tom hinweg, so dass diese den hässlichen Bauch des Dämons bewundern konnten, und tauchte auf der anderen Seite des Bootes wieder ins Wasser.
Ihr kleines Boot wurde durch die Wellen aufgewirbelt und kenterte schließlich, so dass die zwei Freunde ins Wasser geschleudert wurden. Sofort fingen sie an zu schwimmen, um das rettende Ufer zu erreichen. Sie erreichten es sogar und spürten schon den sandigen Grund unter ihren Füßen. Wieder schnalzte der Dämon hinter ihnen aus dem Wasser. Diesmal flog er mit geöffnetem Maul direkt auf sie zu. Die zwei wurden durch die Welle, die er vorausschickte zum Ufer geschleudert, und entkamen nur durch die Wucht des Wassers dem Rachen des Dämons.
Am Ufer angekommen hechteten sie weiter auf das Festland hinaus und schmissen sich, total außer Atem, ins Gras, wo sie erst mal liegen blieben. Hinter ihnen hörten sie die Riesenkröte schreien, die sich über ihr entgangenes Abendessen ärgerte. Es war ein blubbernder und irgendwie kläglicher Laut. Das Ungetüm stand am Ufer mit den Hinterbeinen im Wasser und traute sich nicht weiter raus. Vom Dorf kamen inzwischen ein paar Fischer mit Stöcken und Anlegehaken bewaffnet zu ihnen herüber gerannt. Nochmal schrie die Monsterkröte ihrer Beute hinterher, die sie schon für sicher gehalten hatte. Danach drehte sie sich um und verschwand wieder im See, bevor ihr der erste Fischer auch nur einen Streich versetzen konnte.
IV.
„Ich hätte schwören können, euer letztes Stündchen hat geschlagen.“
Mark und Tombars wurden von mehreren Fischern umringt. Sie erhoben sich. Mark schaute an sich hinab. Klatschnass waren sie.
„Ich stehe da vorne und lade den heutigen Fang ab, als auf einmal die Leute mit dem Finger auf den See zeigen.“
Einer der Fischer schien das eben Erlebte von sich geben zu müssen, obwohl jeder der Leute, die um sie herum standen, alles mit angesehen hatte.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















