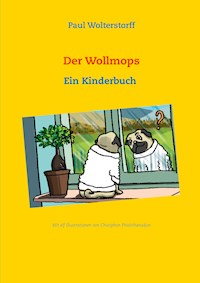Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sehnen sich nach Leichtigkeit? Nach Schmunzeln, in Ihnen aufsteigenden Glucksern und explodierendem Lachen? Dann spüren Sie der unaufhaltsamen Verrohung des Gärtners Thaddeus Blum nach, der mit besten ökologischen Absichten einen Garten Eden erschafft, bis Schnecken, Wühlmäuse und Läuse seine Wege kreuzen und seine Nerven zerrütten. Folgen Sie einer verletzten Kundenseele, die mit Stil verwöhnt werden will, sich aber schon bald in den Tentakeln einer allzu beflissenen Schar von Kellnern verfängt. Chillen Sie mit Klaus Fernsehkanäle zappend auf der Couch, bis die nach Höherem strebende Gattin ihn in die Oper zerrt und er nur mit viel Fantasie übergewichtige Sitznachbarn, schmetternde Tenöre und fiedelnde Virtuosen übersteht. Egal ob launig lustig, bitter böse oder feinsinnig - Sie werden bei der Lektüre dieser elf Humoresken schmunzeln, kichern und laut lachen. Garantiert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSANGABE
Die Sache mit…
…der verletzten Kundenseele
…der Wellness
…den Verpackungen
…den Migranten
…dem Laufen
…dem Aufstieg und Fall des Gärtners Thaddeus Blum
…den lieben(den) Beatles
…dem Anbaggern
…dem Fußball
…der klassischen Musik
…dem spirituellen Wachstum
Die Sache mit…
…der verletzten Kundenseele
Die leidende Seele
Theo liegt fast auf dem Tresen. Seinen Kopf auf die linke Hand gestützt starrt er auf die vor ihm ausgebreitete Tageszeitung. Der Zeigefinger der rechten Hand folgt den Sätzen, die er gerade liest. Wie in Zeitlupe gleitet er die Seite hinab. Theos Mundwinkel folgen dieser Bewegung, bis sein Mund einem auf den Kopf gestellten Halbmond gleicht. Eins ist klar: Theo ist mit etwas ganz und gar nicht einverstanden.
Als ich neu in dieser alternativen Kunstkneipe war, dachte ich, dass Theos Missmut beim Zeitunglesen etwas mit den aktuellen Tagesnachrichten zu tun haben könnte. Vielleicht hatte er ja gerade von einer katastrophalen Niederlage seines Lieblingsvereins gelesen. Oder sein favorisierter Politiker steckte in der Bredouille. Oder er imitierte mit seinen Gesichtsmuskeln intuitiv die grafisch illustrierte Entwicklung seines Aktienfonds.
Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass kein Fußballverein so oft verlieren, kein Politiker so oft versagen und kein Fonds so oft abstürzen konnte. Das Problem musste deutlich oberhalb der Zeitung liegen. Irgendwo in Theo, der mit sich, der Welt und den zwischen beiden Bereichen entstehenden Schnittstellen nicht recht klar zu kommen scheint.
Was ja eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Vermutlich gibt es Zigtausende Theos, die allabendlich am Tresen hängen und ihren Missmut auf die eine oder andere Art raus lassen. Dumm ist nur, dass Theo auf der anderen Seite des Tresens hängt. Mir diagonal gegenüber, da, wo die Flaschen stehen und ausgeschenkt wird. Er ist definitionsgemäß Angestellter eines Bewirtungsbetriebes und sollte Gäste mit Speis und Trank versorgen, zudem Ansprechpartner und Repräsentant des Etablissements sein und durch beste Servicequalität die Attraktivität dieses Kleinunternehmens erhöhen.
Von all dem weiß Theo jedoch leider nichts. Wenige Zentimeter über der Zeitung hängend ist er völlig von der Widerwertigkeit des durch die Tageszeitung dokumentierten Weltgeschehens gefangen genommen. Ich neige meinen Kopf etwas nach unten und versuche Blickkontakt aufzunehmen. Ein leichtes Stechen im Rücken verrät mir, dass ich nicht noch weiter herunter gehen sollte. Erster Versuch der non-verbalen Kontaktaufnahme gescheitert. Also versuche ich mal die Audio-Schiene und lasse die bereits abgezählten Euro-Münzen zwischen den Fingern kreisen. Es klimpert vernehmlich in meiner Hand. Theo hat’s nicht mitbekommen, unbeirrt gleitet der Zeigefinger weiter die Seite hinab, rutscht knapp an der Abbildung von Angela Merkel vorbei und nähert sich der Landkarte Syriens.
Ich habe Durst. Der kriegt mal wieder nichts mit. Also muss eine massive Attacke her. Ich gehe noch einen Schritt vor und stoße dabei nicht ganz unbeabsichtigt gegen den Barhocker, der krachend den zahlreichen Schrammen an der Theke eine weitere hinzufügt. Meine rechte Hand platziere ich unübersehbar neben der Landkarte Syriens,
wobei mir rein zufällig ein Eurostück entgleitet, das über die gesamte Auslandsnachrichtenseite rollt, und dann torkelnd neben dem Artikel über den bevorstehenden Nahostgipfel zum Stillstand kommt.
Theos Kopf zuckt hoch. Rot geäderte Augen schauen mich entnervt an. Jeder kennt den Gesichtsausdruck eines Obers, bei dem man um 22.56 Uhr noch etwas bestellt und der frustriert seinen pünktlichen 23 Uhr-Feierabend schwinden sieht. Genau so schaut Theo jetzt, nur dass es 18.20 Uhr ist und Theo ihm zusetzende Kunden immer so anschaut.
„Ja, bitte?“, bellt er im Ton eines Beamten, der einen unerwünschten Besucher abwimmeln will.
„Ein Weizen, bitteschön“, zirpe ich und bemühe mich inständig, einen Hauch von Freude in Theos düsteres Dasein zu bringen. Der dankt es mir, indem er theatralisch zur Decke schaut, um mich wenig später fast mitleidig zu mustern. Er hebt seine Leseorientierungshand und dreht die Handfläche nach oben. Gereizt fragt er:
„Ein Kristallweizen? Ein Hefe? Ein dunkles Hefe? Alkoholfrei?“
Eigentlich eine berechtigte Frage. Allerdings komme ich hier schon seit 10 Jahren so um die fünfmal die Woche her und trinke immer ein helles Hefe. Macht Pi mal Daumen 2500 Hefeweizen, es wäre theoretisch möglich, dass irgendwo in Theos Schädel eine Erinnerung daran besteht. Aber heute ist es noch nicht so weit. Also trällere ich:
„Ein helles Hefe, wie immer“. Als Theo sich immer noch nicht bewegt füge ich schnell noch „Mit Alkohol“ hinzu und ringe mir ein herziges Lächeln ab. Er erhebt sich schwerfällig, holt die Flasche aus dem Kühlschrank und knallt sie vor mich.
„Glas?“, fragt er.
„Nee, `nen Strohhalm“, würde ich nun gerne knurren und Theo so auf die Dämlichkeit seiner Frage hinweisen. Aber ich sehne mich nach einem friedlichen Feierabend und säusele daher:
„Oh ja, das wäre super“!
Das Geld wechselt den Besitzer, Theos Hände und Mundwinkel nehmen wieder die Grundstellung ein und ich entferne mich leise, um ihn nicht weiter zu stören.
In einer entfernten Ecke setze ich mich an einen freien Tisch und denke frustriert über die Ungerechtigkeit der Welt nach. Eigentlich stände mir eine Medaille mit eingravierter Würdigung zu: „Zum 2500 ten. Alles Gute! Dein Theo“. Stattdessen muss ich immer wieder betteln, um überhaupt bedient zu werden. Klar, ich könnte rein theoretisch den Einsatzplan dieser Kneipe studieren und Theo aus dem Weg gehen. Dann müsste ich mich allerdings mit anderen Spezialisten in Sachen Kundenvertreibung und Umsatzverhinderung herumquälen.
Mit Bernd, zum Beispiel. Bernd ist eigentlich ganz nett, aber leider auch sehr schreckhaft. Was sich vor allem beim Auftauchen von Kundschaft bemerkbar macht. Wissenschaftlich ausgedrückt besteht eine signifikante Korrelation zwischen dem Erscheinen von Kunden und Bernds Verschwinden. Bernd kann eine ganze Stunde ohne Kundenaufkommen stoisch hinter dem Tresen verbringen. Kaum nähert sich jemand der Theke, spürt er das intuitiv und verschwindet sofort aus der Gefahrenzone. In den Keller, um Getränke zu holen. Vor die Tür, um endlich auch einmal eine Zigarette rauchen zu dürfen. Oder schlicht aufs Klo, aus nachvollziehbaren Gründen.
Erwischt man einen Bernd-Bedienungstag, findet man sich unweigerlich in einer langsam wachsenden Schlange vor dem Tresen wieder. Kneipenneulinge erkennt man daran, dass sie hektisch den Kopf verdrehen, um nach der verschwundenen Bedienung Ausschau zu halten. Gestandene Profis deklinieren einfach zum Zeitvertreib die Anordnung des dreistöckigen Spirituosen-Regals. Wenn man gedanklich die Whiskysorten durch hat und langsam die Liköre rezitiert, kommt er meistens zurück. Schnaufend und mit unruhig flackernden Augen, als ob er gerade mit einem sich ankündigendem Burn-Out zu kämpfen hätte.
Oder Uwe, der die immer gleichen 60er Jahre-Hits so laut spielt, dass man sich nur mit Zeichensprache verständigen kann. Oder Herbert, der alte Sozi, der schon alleine das Erscheinen bei der Arbeit als soziales Engagement einstuft.
Ich trinke einen tiefen Schluck und spüre in mir den bitteren Schmerz einer verletzten Kundenseele. In dem Maß, in dem der Inhalt in meinem Glas schwindet, wächst in mir die Gewissheit, dass ich mir nach all den Mühen des Lebens einmal richtig guten Service gönnen sollte. Mit einem weiteren tiefen Schluck besiegele ich feierlich meine Entscheidung: Morgen werde ich in einem Etablissement dinieren, in dem der Kunde noch König ist.
„Skoll!“, und runter mit dem Rest des hefigen Getränks.
Zu neuen Ufern
Um 19 Uhr des folgenden Tages ist es dann so weit. Frisch geduscht und in feinstem Zwirn öffne ich die Eingangstür des italienischen Top-Restaurants Emilia Romagna. Genauer gesagt – ich möchte sie öffnen. Als ich die Klinke bereits in der Hand habe, wird die Türe von innen aufgerissen. Ich stolpere nach vorne und kann mich gerade noch am übereifrigen Türsteher abstützen.
Vor mir erstrahlen zehn festlich gedeckte Tische, auf denen Silberbesteck, Blumengebinde und ganze Garnisonen von Trinkgefäßen zum Dinieren im großen Stil einladen. Als ich frohgemut einen Schritt in Richtung des anvisierten Tisches machen will, hält mich etwas an beiden Schultern fest. Ich rucke nochmals ein wenig nach vorne, aber Giovanni von der Tür lässt sich nicht abschütteln und hält beharrlich den Kragen meines Mantels fest.
„Un momento, Signore“, säuselt er und will mir partout aus dem Mantel helfen. Mit Pinguin ähnlicher Eleganz strecke ich meine Arme nach hinten und versuche den Tüll abzuschütteln. Ich zapple, er zieht, es braucht einige Versuche bis ich mich aus dem Mantel geschält habe.
Endlich in Freiheit mache ich zwei energische Schritte in Richtung des von mir auserkorenen Tisches, aber ein Kellner versperrt mir den Weg.
„Tavolo per una persona?“, fragt er.
„Si, gracias“, antworte ich höflich. Er lächelt dünn und führt mich zu einem direkt neben dem Küchenausgang gelegenen Tisch. In den beim Cinque Terre Urlaub aufgeschnappten Sprachbrocken kramend, deute ich auf den Tisch meiner Begierde und frage:
„Esto tabolo nix possibile?“.
Giovanni der Zweite schluckt und meint pikiert:
„Dies ist ein Tisch für vier Personen, mein Herr.“
Ich schlucke ebenfalls. Der spricht ja deutsch. Etwas überrascht vom plötzlichen Sprachwandel meine ich:
„Macht nichts. Den hätte ich gerne.“
„Einen Moment der Herr“, wird mir geantwortet und mein Gegenüber eilt zu einem Herrn, der sich von den bisherigen Kellnern durch eine Bordeaux-rote Weste abhebt. Es wird gestikuliert und getuschelt, man ist wieder bei Italienisch angelangt. Dann wird mir signalisiert, mich noch ein wenig zu gedulden. Der Bordeaux-Rote wendet sich an die älteste Bedienung in dunklem Anzug, die unauffällig in der Ecke stehend den ganzen Raum überblickt. Wieder wird getuschelt und gestikuliert. Ein scharfer Blick und der Herr in rot verstummt und nähert sich meinem Kellner. Ein Tuscheln und ein scharfer Blick und mein Kellner eilt zu mir und meint:
„Aber gerne können Sie an diesem Tisch sitzen, mein Herr, wenn sie mir bitte folgen möchten.“
Na also, geht doch. Gefühlte zwanzig Teller, Gläser und Bestecke werden flink vom Tisch geräumt. Dann öffnet sich die Tür zur Küche und ein weiterer schwarz-weiß Gestreifter kommt mit zwei Karten hervor. Als ob er salutieren möchte schlägt er die Hacken zusammen und verbeugt sich devot.
Er murmelt etwas wie „brägel amo“, noch nie gehört. Mit elegantem Schwung holt er ein silbernes Feuerzeug aus der Westentasche, entzündet die Kerze auf meinem Tisch und fragt:
„Aperitivo?“.
Sprachlich gesehen ein Rückfall in alte Unsitten, inhaltlich kommt die Botschaft aber bei mir an. Mit einem energischen:
„Erst mal ein Pils!“
bekenne ich mich zu meinen germanischen Wurzeln. Er schaut mich konsterniert an. Als er sich nach ein paar Sekunden immer noch nicht rühren will, füge ich erklärend
„Gegen den Durst“
hinzu und deute Verständnis heischend auf meinen Rachen. Scheinbar hilft es. Er murmelt etwas, das der Pfälzer in mir als „Komme se, Desidera“ versteht. Mit Schwung drapiert er die nach Wäschestärke riechende Serviette auf den Unterarm, schwingt diesen hinter seinen Rücken und entschwindet in Richtung Küche. Hat was, wie der das macht. Muss ich daheim mal üben.
Ich ignoriere erst einmal die „Carta dei vini“ und wende mich dem Menu zu. Schnuppere am roten Einband – ist tatsächlich Leder – und beginne mit in Vorfreude feucht werdendem Gaumen das Studium der angepriesenen Leckereien. Neben mir klappert es. Ich blicke erschrocken auf, der Rote von halb hinten rechts hat einen mit Goldrand versehenes Schälchen neben mich gestellt. Darauf ruht ein Zwei-Euro-Stück großes Leckerli mit Sahnehäubchen darauf. Er säuselt etwas von salmone, crostini und weiteren nach Oper klingenden Wörtern. Ich schaue ihn fragend an.
„Scusa“, meint er, und ergänzt: „Lachcrostini mit Meerrettichschaum. Ein Gruß des Hauses.“
„Schöne Grüße auch meinerseits“, erwidere ich höflich und nasche an dem kleinen Taler. Köstlich!
„Das erste Mal im Emilia Romagna?“ fragt der Rote.
Ich bejahe.
„Sie werden es genießen“, versichert er und entfernt sich wieder.
Wo war ich stehen geblieben? Bei den Zuppa, richtig. Eine kleine Illustration verrät mir, dass die Zuppa di Lumache aus Schnecken hergestellt wird. Diese Biester zerfressen mir immer den Gartensalat. Könnte mich ja rächen und hier ein paar von ihnen zerfleischen. Wie du meinem Salat, so ich dir. Aber so richtig geheuer sind mir diese kriechenden Schleimlinge nicht. Lieber mal schauen was die Antipasti hergeben.
Neben mir scheppert es wieder. Ein silbernes Tellerchen tanzt auf dem Tisch, mit einem gemurmelten „scusa“ entschuldigt sich der Kellner für seinen übergroßen Eifer. Als er ein gülden schimmerndes Pils mit majestätischer Krone auf den Teller stellt, ist ihm alles verziehen. Ich stoße mit mir selbst auf einen gelungenen Abend an, nehme einen kräftigen Schluck und wende mich dann wieder der Speisekarte zu.
„Tris di Carpaccio“ wird als Nächstes genannt. Carpaccio! Genau mein Geschmack. Aber was ist „Tris“? Leider habe ich meine Lesebrille daheim vergessen und kann die kleingedruckte Übersetzung ins Deutsche nicht lesen. Aber egal, wird schon schmecken.
Mit dem Carpaccio in meinem geistigen Einkaufskorb blättere ich weiter. Da raschelt es schon wieder neben mir. Ein schwarz-weiß Gestreifter steht neben mir. Den Notizblock in der einen Hand, den Stift in der anderen, schaut er mich mit erhobenen Augenbrauen an.
„Was darf es sein, Signore?“
Sprachlich gesehen ein fairer Kompromiss, vom Timing her allerdings recht unpassend.
„Tris und die Carpaccio“ fühle ich mich linguistisch ein. Er zuckt leicht und notiert dann beflissen meine Bestellung.
„Primi?“, fragt er.
„Ja, bin zum ersten Mal hier“, antworte ich, „hat mich ihr Kollege auch schon gefragt.“
„Welcher Zwischengang?“, fragt er nach, „Pasta? Risotto? Gnocchi?“
„Nee, “ erwidere ich, „heute gibt’s was Richtiges: Fleisch!“
Er setzt zu einer Erklärung an, besinnt sich dann aber eines besseren, macht einen Strich auf seinem Block und fragt:
„Secondi? Welches Fleischgericht?“
Ich blättere schnell weiter in meiner Karte und studiere die Rubrik Carne, die großgedruckten Titel kann ich gerade noch so lesen. Manzo alla Nonna klingt nach Enthaltsamkeit und Ossobuco nach Oper. Aber hier, Saltimbocca alla Romagna, gefällt mir, das nehme ich.
„Molto bene!“, meint mein Gestreifter und zieht sich zurück.
Ich atme durch und strecke mich ein wenig. Bis auf ein leise tuschelndes Paar im Eck bin ich der einzige Gast. Mit einem weiteren Schluck leere ich mein Pils. Kaum habe ich es abgesetzt, kommt schon wieder ein Kellner zu mir. Diesmal der Rote, scheint sich um eine wichtigere Angelegenheit zu handeln.
Der Wein zum essen, richtig, hätte ich fast vergessen. Ich schnappe mir die „Carta dei Vini.“ Angepriesen werden Weißweine mit wohlklingenden Namen wie „Bianco di Costoza“ und an Bahnhofssäufer erinnernde Rotweine à la „Lambrusco“ und „Valpolicella“. Da lass ich mich wohl besser beraten. Zum Carpaccio eher etwas Leichteres, meint der Rote und schlägt einen Brusci di oder so vor, ging alles zu schnell, konnte ich mir nicht merken. Soll mild und abgerundet sein, zudem blumig, mit schlankem Körper. Mir also nicht so ähnlich, aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Den nehme ich.
Zum Kalb dann eine Note kraftvoller, wegen des Salbeis und des Specks, doziert er. Aber eine gute Note kraftvoller, stimme ich ihm zu. Wie’s denn mit dem Sangiovese di Romagna von der Emilia Romagna wäre. Die kenne ich jetzt nicht persönlich, passt aber vom Namen her bestens zum Kalbsgericht. Doc Titel hat er, Castellucio ist der Tropfen auch noch. Ja, der Sangio ist es. Mit einem weiteren „Molto Bene“ wird die Auswahl besiegelt.
Königlich umgarnt
Ich rolle meine Schultern, um eine leichte Nackenverspannung zu lösen. Erfordert doch ein bisschen Konzentration, so ein genussreicher Abend! Als ich gerade ausgerollt habe, schwebt eine gigantische Silberplatte vor mir nieder und landet exakt zwischen Gabel und Messer. Dreierlei in feine Scheiben geschnittene Fleischsorten liegen kunstvoll drapiert auf der glänzenden Platte. Na dann mal los, denke ich mir, und greife zum Besteck
„Momentaneamente“, meint der Ober und streckt mir wie ein Verkehrspolizist die emporgehobene Hand entgegen. Er faucht etwas in Richtung des jüngsten und kleinsten in der Bedienungsbrigade. Der eilt zum neben dem Kücheneingang aufgestellten Anrichte und holt eine Karaffe Öl. Wie bei einer Teezeremonie gießt er feierlich einen feinen Strahl auf die edlen Scheiben. Als er absetzt schwebt seine Hand einen Meter über meinem Teller. Technisch gesehen eine Spitzenleistung, allerdings würde ich jetzt gerne essen. Meine Gabel zuckt ein wenig vor. Aber die erhobene Hand des Zeremonienmeisters mahnt mich erneut zu Geduld.
Der zweite Gestreifte aus der Bedienungs-Viererkette löst sich nun aus dem Verband und holt Parmesan und einen Hobel. So ausgerüstet baut er sich vor mir auf und lässt feinste Käsescheiben wie übergroße Schneeflocken auf die Fleischscheiben rieseln. Sehr hübsch und echt passend zur Jahreszeit. Ich blicke schüchtern nach oben. Darf ich jetzt? Ja, tatsächlich, alle Streifen- und Oberhörnchen ziehen sich mit besten Wünschen zurück und ich bin endlich allein mit meiner Platte.
Das Dunkelrote da links ist wohl so eine Art Roastbeef. Am Gaumen umschmeichelt das edle Öl sehr gekonnt den zarten Filetgeschmack. Der Parmesan sorgt für eine feinwürzige Abrundung der Komposition. Sehr fein, da könnte ich doch schon einmal die neun Punkte. Bewertung zücken. Als ich mich gerade dem zweiten Drittel der Köstlichkeit widmen will, naht der Jungkellner mit einer Pfeffermühle, deren Ausmaß an seine Körpergröße heranreicht.
Ob es denn noch ein wenig Pfeffer sein dürfe? Mit etwas Schräglage gelingt es ihm, das Monstrum über meiner Platte zu platzieren. Er dreht und schaut mich fragend an. Einer geht noch, signalisiere ich ihm nickend und er dreht noch eine Runde.
Ich wende mich wieder der nun schwarz gesprenkelten Vorspeise zu. Das in der Mitte ist wohl Ente, stelle ich mümmelnd fest. Sehr aromatisch, allerdings ein wenig zu trocken. Und der letzte Pfefferdreher war doch ein bisschen zu viel. Ich schubse mit dem Messer einige Pfefferkörner zur Seite, als sich etwas neben mich schiebt. Der etwas Ältere ist es. Ob es noch ein wenig Parmesan sein dürfe. Ich will ja keine Arbeitsplätze vernichten, also stimme ich zu und es schneit wieder auf meinen Teller. Nun ist vor lauter schwarzen Punkten und gelblichen Flocken kaum noch was vom Carpaccio zu sehen.
Während ich noch versuche das letzte Drittel meiner Vorspeise frei zu legen, rollt schon wieder etwas klappernd an mich heran. Was ist denn nun schon wieder?
Ein Servierwägelchen ist es, verloren steht mein Achtele Brusci di auf dem riesigen Gefährt. Mit großer Geste wird mir ein Schluck des edlen Tropfens kredenzt. Wie schon einmal im Fernsehen gesehen, halte ich das Glas vors Kerzenlicht und lass den dunklen Wein kreisen. Sieht hübsch aus, man könnte alleine vom Zuschauen einen Schwips bekommen. Da man es von mir erwartet, schnuppere ich noch ein wenig am Glas und lasse zu guter Letzt einen Schluck im Mund kreisen. Feines Stöffchen, denke ich mir, und nicke zustimmend. Zwei weitere Finger des edlen Tropfens werden in mein Glas gefüllt.
Im Herzen der Courtoisie
So – hoffentlich kann ich mich jetzt endlich einmal meiner Vorspeise widmen. Der letzte Teil des Dreigespanns besteht aus mariniertem Kalbfleisch. Auch sehr lecker. Mit einem kräftigem Schluck Brusci di schmeckts noch besser. Nun ist das Glas schon leer, na der war aber rasant im Abgang.
Ein Schatten fällt auf meinen Tisch. Welch eine Ehre! Der Herr in schwarz, seines Zeichens Chef der gesamten Bedienungsbrigade hat sich zu mir bemüht. Ob es denn schmecke? Ja, wirklich, es schmeckt ausgezeichnet! Der Wein auch, danke der Nachfrage. Wohltemperiert, ohne Frage. Ja, ich sitze auch gut. Ob auch sonst alles recht sei. Ja, ja, sehr recht, schöne Grüße auch ans Haus. Schließlich geht er endlich – nicht ohne dem obersten Roten noch kurz zu signalisieren, dass mein Glas fast leer sei. Worauf der dem obersten Gestreiften selbiges vorwurfsvoll zuraunt, der dies weitergibt und das unterste Streifenhörnchen schließlich schuldbewusst nachschenkt.
Dann kehren alle wieder zur Grundaufstellung zurück, eine Kette, an deren Anfang der bedauernswerte Jungkellner steht und dessen Ende leicht versetzt mein Man in Black bildet. Damit ihnen nur ja kein Wunsch meinerseits entgeht, rücken sie alle noch einen Schritt in meine Richtung vor. Die drei Gestreiften verfolgen jede meiner Bewegungen, der Rote passt auf, dass den Gestreiften nichts entgeht und der Schwarze überwacht, dass dem Roten nicht entgeht, was die Gestreiften gerade vermasseln.
Die Vorspeise schmeckt jetzt wie Fondue, auch egal. Ich stopf mir die Fleisch-Käse Pampe in großen Bissen in den Mund und kippe den Rest des Roten nach. Während der in Rotwein ertränkte Kloß noch in meinem Mund kreist, wird schon der Vorspeisenteller entfernt. Vor mir wischt der Unterdödel mit einem Silber-Bürstchen nicht vorhandene Krümel vom Tisch, der Oberunterdödel räumt derweil Glas und Karaffe hinweg, der Hochgediente kümmert sich um den Sangiovese und der erste Oberkellner weist sein Fußvolk auf stilistische Fehler in ihrer Bedienungskür hin.
Links neben mir schwebt ein neues Glas heran, von rechts werden zwei Zentimeter eingeschenkt. Ich schlucke es in einem Zug und nicke. Während der eine noch über meine rechte Schulter hinweg nachschenkt, wird schon von rechts die Saltimbocca gereicht. Der Teller sei sehr heiß, Vorsicht sei geboten. Ach ja, danke für den Hinweis. Kaum beiße ich rein, wird noch ein Extraschälchen Rosmarinkartoffeln gereicht. Danke schön auch. Und noch ein Extraschälchen Bohnen. Sehr freundlich, wirklich. Dann wird mir nachgegossen. Ob es noch ein bisschen Pfeffer brauche? Noch ein wenig Wein vielleicht? Ja, klar, so ein Achtel lohnt ja kaum. Vielleicht eine andere Sorte? Ob der Barchef vielleicht nochmal vorbei schauen solle? Ein wenig Brot vielleicht noch? Eine Flasche Wasser dazu? Vielleicht ein San Bernadetto? Oder ein Acqua Panna?
Panna!
Endlich fällt das richtige Stichwort. Richtig große Panna! Und zwar in die Kopfe! Ich winke den Herrn in schwarz zu mir. In würdevollem Schritt kommt er herbei und fragt, ob es ein Problem gebe. Ja, meine ich, ich würde gerne gemütlich essen.
Was mich denn daran hindere, fragt er nach.
„Sie!“, antworte ich. „Sie alle!“
Wie soll man denn genießen, wenn dauernd etwas um den Tisch herum hüpft? Und kehrt? Und streut? Und reibt? Nachschenkt und nachfragt? Sich versichert und dann nachversichert?
Cheffe neigt leicht den Kopf und schaut mich mit dem Blick eines Psychiaters an, dessen Patient gerade von seinen letzten Abenteuern als Kreuzspinne berichtet. Dann macht er einen großen Schritt rückwärts, drückt knapp sein Bedauern aus und verspricht sofortige Besserung.
Er nähert sich dem Roten, der seine Dienstfarbe nach kurzen aber heftigen Rüffeln nun auch im Gesicht trägt. Mit energischen Zischlauten, beordert er die gesamte Bedienungsmannschaft zwei Meter zurück. Die schauen nun hochkonzentriert an mir vorbei. Fest zusammen gepresste Kiefer und Bleistiftstrich dünne Lippen lassen vermuten, dass ich eine seit Generationen bestehende Berufsehre verletzt habe. Vermutlich würde man mir am liebsten einen schwarzen Handschuh zuwerfen und sofortige Satisfaktion fordern.
Ein donnerndes Schweigen erfüllt den Raum. Selbst das turtelnde Pärchen am Ecktisch hat das Gurren und Tätscheln eingestellt und starrt entsetzt in meine Richtung. Mein Besteck klappert laut und unbeholfen. Meine Kaugeräusche scheinen von den Wänden widerzuhallen. In erhöhtem Tempo verschlinge ich das eigentlich vorzügliche Saltimbocca. Dann zahle ich, reiße Giovanni von der Tür meinen Mantel aus den Händen und verlasse gesenkten Kopfes das Etablissement. Sorry allerseits, war irgendwie ein Missverständnis.
Back to the roots
Am nächsten Abend bin ich wieder zurück in meiner Stammkneipe. Theo hat Dienst. Gemütlich liegt er auf seinem Tresen über der Tageszeitung und hat schlechte Laune. Ich nähere mich ganz vorsichtig und bleib dann mit respektvollem Abstand stehen. Schon nach ein paar Minuten entdeckt er mich und knurrt:
„Ja, bitte?“
„Ein Weizenbier, bitteschön“, zwitschere ich und freue mich schon auf seine Antwort.
„Was für’n Weizen? Hefe? Kristall? Mit Alk? Ohne?“, bellt er.
„Ein helles Hefe, mit Alkohol, wenn’s recht ist“.
„Da!“, meint er und knallt Bier und Glas auf den Tresen.
„Danke vielmals“, entgegne ich und lächle ihn an.
Er erwidert mein Lächeln mit einem giftigen Blick und versenkt sich wieder in seine Lektüre.
Ist das schön, wieder zu Hause zu sein!
…der Wellness
Non-Wellness
Zur Wellness bin ich über das Gegenteil gekommen: Über die Non-Wellness.
Nur, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Ich meine: Niemand würde sagen: Ich gehe jetzt mal zur Non-Wellness, oder? Man sagt einfach: Ich gehe jetzt mal ins Büro. Was meiner Meinung nach genau das Gleiche ist – jede Verwaltung beherbergt ein Arsenal von Unwohligkeiten mit vielen Facetten der Qual.
Nehmen wir als Beispiel meinen Schreibtischstuhl, auf dem ich einen unangenehm großen Teil meines Lebens verbringe. Das Ding heißt Ortho-Well Plus. Das ist in etwa so, wie wenn du einen Trabi Donnerpfeil oder die Ekelwurst beim Discounter Délice du roi nennst.
Dieser angebliche Well-Plus Stuhl quietscht und ächzt beim Rollen so laut, dass mich bei jeder Bewegung 10 Augenpaare giftig anstarren. So, als ob ich es wäre, der geächzt und gequietscht hätte.
Mein Ortho-Well Plus hat drei Hebel. Diese dienen der Optimierung meines Non-Wellness-Gefühls.
Mit dem Hebel links unter der Sitzfläche ist die Höhe verstellbar. Da kann ich wählen, ob ich so niedrig sitze, dass ich gerade so über die Schreibtischkante reiche. Oder ich sitze so hoch, dass ich beim Schreiben beste Aussicht habe, diese aber nach einem halben Tag Tippen mit durchgestrecktem Arm mit einer Sehnenscheidenentzündung bezahle.
Der Hebel rechts unter der Sitzfläche lässt meine Rückenlehne zurücksacken. Wenn ich ein bisschen zu stark drücke, liege ich wie ein Astronaut fast waagrecht. Nur dass über mir keine Sterne blinken, mich keine Triebwerke erzittern lassen und niemand im Kontrollraum den baldigen Takeoff verkündet. Stattdessen starre ich auf die aus Styroporquadraten zusammengefügte Kassettendecke. An den Ecken sind die Dinger vergilbt. Die sie umfassenden Leisten haben sich an manchen Stellen gelöst. Was wenig anheimelnd aussieht. Also drücke ich den Hebel energisch in die andere Richtung - und schon bin ich in einer Stuhlganghaltung; stark nach vorne gekrümmt kommen die mittlerweile chronischen Rückenschmerzen besonders gut zur Geltung.
Zur Gegensteuerung hat der Ortho-Well Plus noch einen Hebel rechts unter der Sitzfläche. Der ist für die Neigung der Sitzfläche verantwortlich. Drücke ich ihn zweimal nach unten, scheinen sich mir sehr wichtige Körperteile plötzlich in einer Art Kartoffelpresse zu befinden. Bei hektischer Gegensteuerung rutsche ich unweigerlich dem Papierkorb entgegen. Nur ein rascher Griff zur Schreibtischkante bewahrt mich vorm Absturz.
Mein inneres Kind glaubt an eine mögliche Idealeinstellung des Ortho-Well Plus. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt sich dieser naive kleine Trottel und hört nicht auf an dem Sitz herum zu justieren. Mit dem einen Hebel geht er durch alle Höhen und Tiefen. Mit dem anderen verpasst er sich phänomenale Absacker und Phoenix-gleiche Auferstehungen. Mit dem dritten lotet er alle bekannten und unbekannten Neigungen aus.
Aber nach 10 Jahren Suche nach der rechten Einstellung entlasse ich mein inneres Kind fristlos und ergebe mich meinem Schicksal. Die in der Werbebroschüre angepriesene ergonomisch hochwertige Wohlfühl-Sitzhaltung existiert wohl nur im Geist des Werbetexters. Im real existierenden Funktionalismus hat Bequemlichkeit und Wohlgefühl keinen Platz. Die Rückenschmerzen gehören zum Büroalltag wie das blaue Schienbein zum Fußballer.
„Es ist wie es ist“, sagt der in mir wohnende Zen-Mönch und verbringt den Arbeitstag weitgehend bewegungslos auf seinem Ortho-Well Plus. Vor mich hin tippend, ab und an am lauwarmen Kaffee nippend, habe ich mich in die Non-Wellness ergeben.
Die Verheißung
Bis zu diesem schicksalhaften Montagmorgen.
Wie Buddha höchstpersönlich saß ich bewegungslos auf meinem Bürostuhl und versuchte mein Inneres mit den Anforderungen der kommenden Arbeitswoche in Einklang zu bringen.
Mary unterbrach meine Kontemplation. Wohlig räkelte sie sich auf ihrem vor dem Schreibtisch platzierten ergonomischen Sitzball und seufzte:
„Oh, war das gut“.
Mary, muss ich kurz erklären, ist in unserer Schadensabteilung für die Buchstaben A-H zuständig. Sie ist hübsch, temperamentvoll und Single.
„Was denn?“, fragte Sue, die für die Buchstaben I-P zuständig ist.
„Das Wellness-Wochenende. Hab‘ mir die volle Dröhnung gegeben: Bäder, Massagen, Peeling. Das war so …!“
An dieser Stelle strahlte Mary, wie nur sie es kann.
„Geil?“, fragte Sue nach, um den Satz nicht unvollendet im Raum stehen zu lassen.