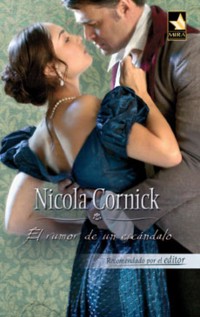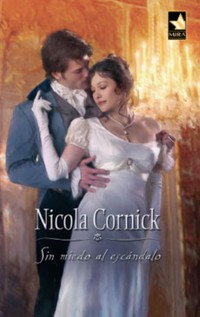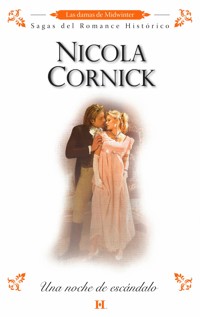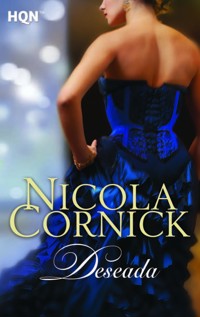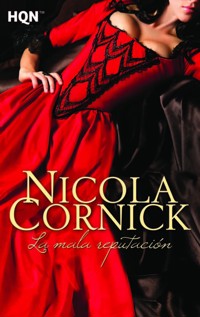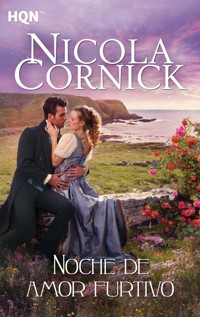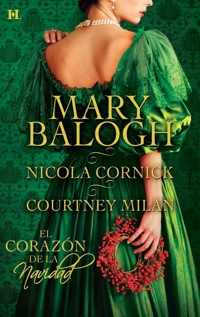4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Hollys Bruder Ben spurlos verschwindet, macht sich die junge Frau verzweifelt auf die Suche nach ihm. Sie reist nach Oxfordshire, wo Ben zuletzt in dem kleinen Ort Ashdown nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte forschte. Hier entdeckt Holly das mysteriöse Anwesen Ashdown House - ein Ort, an dem sich die Schicksale zweier Frauen mit ihrem eigenen verknüpfen. Die dunkle Vergangenheit des herrschaftlichen Gutes verbirgt den Schlüssel zu Bens Verschwinden. Nur wenn sich Holly den Mysterien längst vergessener Zeiten stellt, hat sie eine Chance, Ben zu finden.
Fans von Kate Morton werden diese fesselnde Geschichte lieben!
Candis (British Women's magazine)
Nicola Cornick ist eine Meisterin des Schreibens, eine wahre Königin ihres Genres! Romance Junkies
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Die alte Wassermühle von Ashdown war für Holly schon immer ein geheimnisvoller Ort. Als Kind verbrachte sie hier ihre Ferien und erkundete zusammen mit ihrem Bruder Ben das historische Gemäuer. Jahre später kehrt Ben zurück nach Ashdown – und verschwindet spurlos. Um herauszufinden, was mit ihrem Bruder geschehen ist, zieht Holly in die alte Mühle. Dort entdeckt sie das Tagebuch einer Kurtisane aus dem 19. Jahrhundert. Hat Bens Verschwinden etwas mit den wertvollen Schmuckstücken zu tun, die auf mysteriöse Weise mit der Geschichte des herrschaftlichen Ashdown House verwoben zu sein scheinen? »Nicola Cornick ist eine Meisterin des Schreibens, eine wahre Königin ihres Genres!«Romance Junkies
Zur Autorin
Nicola Cornick ist Historikerin und Autorin. Sie hat an der London University und dem Ruskin College Oxford studiert und arbeitet als Museumsführerin beim National Trust in Ashdown House, einem Jagdschloss aus dem siebzehnten Jahrhundert in Oxfordshire. Ihre prämierten Bücher sind internationale Bestseller und wurden in 26 Sprachen übersetzt.
MIRA® TASCHENBUCH
Copyright © 2017 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der englischen Originalausgabe: House of Shadows Copyright © 2015 by Nicola Cornick erschienen bei: Harlequin MIRA, an imprint of HarperCollinsPublishers, London
Published by arrangement with Harlequin Books S.A.
Covergestaltung: ZERO Media, München Coverabbildung: incamerastock / Alamy Stock Foto, FinePic München Redaktion: Anne Schünemann E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783955767105
www.harpercollins.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Widmung
Für Andrew, der viele Jahre mit meiner Leidenschaft für Ashdown House und William Craven gelebt hat.All meine Liebe wie immer.
Zitat
»Lass dein Leben leichtfüßig auf den Rädern der Zeit tanzen.«
Rabindranath Tagore
Prolog
London, Februar 1662
In der Nacht, bevor sie starb, träumte sie von dem Haus. Im Traum fühlte sie sich wieder unbedeutend wie ein Kind; die Miniaturausgabe einer Königin in einem cremeweißen, goldbestickten Seidenkleid. Der Kragen kratzte an ihrem Nacken, als sie den Kopf zurücklegte und zu dem blendend weißen Haus vor dem blauen Himmel hinaufsah. Ihr wurde schwindelig. In ihrem Kopf drehte sich alles, und die goldene Kugel, die das Dach zierte, schien wie eine Sternschnuppe auf die Erde zuzurasen.
Jenseits der Wände ihres Schlafgemachs kauerte die Stadt; schmutzig, laut und strotzend vor Leben. In ihren Träumen jedoch war sie weit fort von London. Sie war dem breiten Band der Themse flussaufwärts gefolgt, vorbei am Jagdrevier in Richmond und den hohen grauen Mauern von Windsor bis dorthin, wo zwei Flüsse aufeinandertrafen. Nun nahm sie den schmaleren Pfad durch schlummernde Wiesen, vorbei an Gänseblümchen und summenden Bienen, denn in ihrem Traum war sie eine Sommerprinzessin, keine Winterkönigin. Der Fluss verwandelte sich in einen kreidefarbenen Strom, der mit Wassern aus sprudelnden Quellen tief in den bunten Mischwäldern gespeist wurde, bis sie endlich aus den Schatten auf die Hochebene hinaustrat, und dort lag das Haus in einer Bergsenke, ein kleiner weißer Palast, einer Königin angemessen.
Sie bewegte die Lippen. Eine ihrer Damen beugte sich besorgt über sie, bemüht, das Flüstern zu verstehen. Es konnte jetzt nicht mehr lange dauern.
„William.“
Sein Name löste Verwirrung aus. Sie hatte ihn fortgeschickt, ihren Kavalier; hatte ihre Bediensteten angewiesen, die Tür vor ihm zu verriegeln.
„Madam …“ Die Frau wirkte unsicher. „Ich glaube nicht …“
Die Lider der Königin flatterten, der Blick ihrer blassblauen Augen war klar und streng. „Sofort.“
„Eure Majestät.“ Die Frau knickste und eilte davon.
Es war heiß im Zimmer; Fenster und Türen waren geschlossen, und im Kamin prasselte ein helles Feuer. Sie war halb wach, halb schlief sie, dem Schatten schon ganz nah. Draußen brach die Dämmerung über dem Fluss an, sein Wasser kräuselte sich silbern. Es war ungewöhnlich mild für Februar, die Luft fühlte sich schwer an, wartend.
Er kam.
Sie spürte die Bewegung, den kühlen Luftzug, ehe die Tür wieder geschlossen wurde.
„Lasst uns allein.“
Niemand erhob einen Einwand, und das war auch gut so, denn sie war jetzt zu müde zum Streiten. Sie schaffte es nicht, die Augen zu öffnen, doch in der Stille konnte sie alles ganz deutlich hören; das Zischen der Flammen, als ein Holzscheit in sich zusammenfiel; das Knarren der Bodendielen unter seinen Stiefeln, als er durch das Zimmer auf sie zukam.
„Setz dich. Bitte.“ Das Sprechen fiel ihr schwer. Sie hatte jetzt keine Zeit für Diskussionen oder Entschuldigungen – selbst wenn sie sich hätte entschuldigen wollen, was aber nicht der Fall war.
Er setzte sich. So aus der Nähe konnte sie die Nachtkühle und den Geruch der Stadt an ihm wahrnehmen. Sehen konnte sie ihn nicht, aber das brauchte sie auch nicht. Sie kannte jeden Zug seines Gesichts, jeden Schwung, jede Linie. Es war, als wären sie in ihr Herz eingebrannt, ein unauslöschliches Bild.
Da war etwas, das sie ihm sagen musste. Sie nahm ihre ganze Kraft zusammen. „Der Kristallspiegel …“
„Ich hole ihn zurück, ich verspreche es“, erwiderte er sofort. Eine Sekunde später spürte sie seine warme, beruhigende Hand auf ihrer, trotzdem schüttelte sie den Kopf. Sie wusste, es war zu spät.
„Das wird dir nicht gelingen“, sagte sie. Er hatte die Macht des Ordens der Rosenkreuzer und seiner Instrumente nie verstanden, aber vielleicht tat er es nun, nachdem der Schaden angerichtet worden war. „Gefahr … für dich …“ Ein letztes Mal versuchte sie, ihn zu warnen. „Nimm dich in Acht, sonst wird er dich und die Deinen vernichten, so wie er mich und die Meinen vernichtet hat.“ Sie rang angstvoll nach Luft.
Er drückte ihre Hand fester. „Ich verstehe. Glaub mir.“
Sie spürte, wie ihre Anspannung nachließ. Sie musste ihm vertrauen, es gab keine Alternative. Ihr Leben löste sich auf wie ein Wollknäuel, bald würde der Faden zu Ende sein. „Ich möchte, dass du das an dich nimmst. Verstecke sie gut und bewahre sie sicher auf.“ Mit großer Mühe schlug sie die Augen auf und öffnete die Finger ihrer rechten Hand. Eine riesige Perle rollte auf ihren Schoß und leuchtete unheilvoll im dämmerigen Licht. Selbst jetzt, als sie sie zum letzten Mal ansah, konnte sie sich nicht überwinden, die Perle zu mögen, trotz ihrer ätherischen Schönheit. Sie war einfach zu machtvoll. Natürlich konnte die Perle nichts dafür, wohl aber die Männer, die sie für ihre eigenen bösartigen Zwecke benutzt hatten. Sowohl dem Spiegel als auch der Perle hatte einmal die Macht des Guten innegewohnt, stark und beschützend, bis diese Macht von habgierigen Menschen zu üblen Zwecken ausgenutzt worden war. Die Ritter waren gewarnt worden, die Instrumente des Ordens nicht zu missbrauchen, und sie hatten nicht gehorcht. Mit Feuer und Wasser hatten sie Zerstörung heraufbeschworen, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte.
Sie hörte, wie Craven den Atem anhielt. „Die Sistrin-Perle sollte deinem Erben übergeben werden.“
„Noch nicht.“ Sie war jetzt so unendlich müde, doch diese letzte Aufgabe musste sie noch vollenden. „Das Band zwischen der Perle und dem Spiegel muss durchtrennt werden. Eines Tages wird der Spiegel zurückkehren, und dann muss er vernichtet werden. Bis das geschehen ist, verwahre sie sicher.“
Craven wies die Gabe nicht zurück, und er sagte auch nicht, er hätte keine Zeit für solchen Aberglauben. Früher einmal hatte er sich über ihre Überzeugungen lustig gemacht, doch das war längst vorbei. Er hob die Perle an ihrer schweren Goldkette hoch und ließ sie in sein Hemd gleiten. Seine Miene war ernst und angespannt, als bereitete er sich auf eine Schlacht vor; so schwer lastete ihr Auftrag auf ihm.
„Danke.“ Sie lächelte matt und schloss die Augen. „Nun kann ich schlafen.“
Plötzlich wurde es laut. Die Tür flog mit einem Knall auf, die Türangeln protestierten knarrend. Stimmen, laut und gebieterisch. Schritte, ebenfalls laut; ihr Sohn Ruprecht kam, um zum Schluss bei ihr zu sein, wie immer in Eile, wie immer verspätet.
Es blieb nur noch so wenig Zeit.
Wieder öffnete sie die Augen. Die Schatten und das Rot und Gelb der Flammen verschwammen ineinander; ihr war kalt. Ein letztes Mal sah sie Craven an; Trauer und Schmerz zerfurchten sein Gesicht. Alt sind wir geworden, dachte sie, wir haben unsere Zeit gehabt. Der Verlust schmerzte wie ein Messerstich. Wenn sie doch nur …
„William“, sagte sie. „Es tut mir leid. Ich wünschte, wir bekämen noch eine weitere Chance.“
Seine Miene hellte sich auf, und er schenkte ihr das Lächeln, bei dem sie schon schwach geworden war, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. „Vielleicht bekommen wir sie ja“, erwiderte er, „in einem anderen Leben.“
Sie vergaß, dass ihr Leben jetzt nur noch wenige Atemzüge lang dauern würde, keine Stunden, nicht einmal mehr Minuten, und griff nach seiner Hand. „Die Rosenkreuzer glauben an die Wiedergeburt der Seele, aber das widerspricht der christlichen Lehre.“
Er nickte, und seine Augen lächelten. „Ich weiß, ich glaube aber trotzdem daran. Es tröstet mich, mir vorzustellen, dass wir uns irgendwann in einer anderen Zeit wiedersehen.“
Sie schloss die Augen, ein schwaches Lächeln lag auf ihren Lippen. „Mich tröstet es auch“, erwiderte sie leise. „Das nächste Mal werden wir immer zusammen sein. Beim nächsten Mal scheitern wir nicht.“
1. Kapitel
London, heute
Holly schlief fest, als ihr Handy klingelte. Sie hatte den ganzen Tag und den größten Teil des Abends an Stücken ihrer neuesten Kollektion von graviertem Glas gearbeitet und war erschöpft. Um zehn hatte sie ihr kleines Atelier und die Werkstatt verlassen, schnell noch ein Sandwich gegessen und war ins Bett gegangen.
Sie tauchte aus den Tiefen eines Traums auf und tastete auf ihrem Nachttisch nach dem Handy. Das grelle Leuchten des Displays blendete sie. Normalerweise schaltete sie es nachts aus, aber dieses Mal musste sie es vergessen haben. Sie hatte mit Guy mal wieder über ihre Arbeit gestritten. Er war ins Gästezimmer gestürmt, hatte die Tür hinter sich zugeknallt, eine theatralische Zurschaustellung seines Zorns. Normalerweise hätte Holly danach wach gelegen und sich darüber geärgert, dass sie erneut gestritten hatten, aber an diesem Abend war sie einfach zu müde gewesen, um sich deswegen Gedanken zu machen.
Auf dem Display war das Bild ihres Bruders zu sehen, es war siebzehn Minuten nach zwei. Das Handy klingelte und klingelte.
Stirnrunzelnd drückte Holly auf die grüne Taste, um das Gespräch anzunehmen. „Ben? Was um alles in der Welt fällt dir ein, um diese Uhrzeit anzurufen …“
„Tante Holly?“ Die Stimme am anderen Ende klang hoch und zittrig vor Angst, die einzelnen Worte wurden immer wieder von Schluchzern unterbrochen. Es war nicht Ben, sondern seine sechsjährige Tochter Florence. „Tante Holly, bitte komm! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Daddy ist verschwunden, und ich bin ganz allein hier. Bitte, hilf mir! Ich …“
„Flo!“ Holly setzte sich auf, um die Nachttischlampe einzuschalten, griff aber daneben, als ihr die panische Angst ihrer Nichte zu Bewusstsein kam und ihr Puls sich beschleunigte. „Flo, warte! Erzähl mir, was passiert ist! Wo ist Daddy? Und wo bist du?“
„Ich bin in der Mühle.“ Florence weinte jetzt. „Daddy ist schon seit Stunden weg, und ich habe keine Ahnung, wo er ist! Tante Holly, ich habe Angst! Bitte, komm her …“ Es rauschte in der Leitung, die Worte wurden unverständlich.
„Flo!“, rief Holly erneut. „Flo?“ Doch es war nur noch Rauschen zu hören, ein Knistern, und dann war die Leitung tot.
„Bist du verrückt?“
Guy war zwei Minuten zuvor aus dem Gästezimmer gekommen; er trug nur seine zerknitterten Boxershorts, seine Augen waren verschlafen, und seine Haare standen übel gelaunt in alle Richtungen ab. „Du kannst doch nicht mitten in der Nacht einfach nach Wiltshire fahren“, sagte er jetzt. „Was für eine selten blöde Idee.“
„Nach Oxfordshire“, verbesserte Holly mechanisch. Sie warf einen Blick auf die Uhr, während sie die Stiefel anzog. Der Reißverschluss klemmte, sie zerrte daran. Zwei Uhr siebenundzwanzig. Sie hatte bereits zehn Minuten vergeudet.
Einige Male hatte sie versucht, Florence zurückzurufen, aber ohne Erfolg. In der Mühle, Bens und Natashas Ferienhaus, gab es kein Festnetz, und der Handyempfang war schon immer schlecht gewesen. Man musste an einer ganz bestimmten Stelle stehen, um telefonieren zu können.
„Hast du es schon auf Tashas Handy versucht?“, fragte Guy.
„Sie arbeitet gerade irgendwo im Ausland.“ Ben hatte es ihr erzählt, aber Holly wusste nicht mehr genau, wo. „Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen.“ Tasha hatte einen Spitzenjob beim Fernsehen; sie moderierte ein Reisemagazin und war deshalb nur selten zu Hause.
„Ben ist wahrscheinlich längst wieder da.“ Guy setzte sich neben sie auf das Bett und legte ihr die Hand auf den Arm, vermutlich sollte sie das beruhigen. „Hör mal, Holly, keine Panik. Ich meine, vielleicht hat das Kind etwas falsch verstanden …“
„Das Kind heißt Florence“, gab Holly knapp zurück. Es ärgerte sie unglaublich, dass Guy nur selten die Namen ihrer Familie oder ihrer Freunde benutzte, hauptsächlich, weil er sich gar nicht die Mühe gab, sie sich zu merken. „Sie klang völlig verängstigt“, fügte sie hinzu. „Was soll ich deiner Meinung nach tun?“ Sie drehte sich abrupt zu ihm um. „Sie dort allein lassen?“
„Wie gesagt, bestimmt ist Ben mittlerweile zurück.“ Guy unterdrückte ein Gähnen. „Wahrscheinlich hat er sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um sich mit irgendeinem Flittchen zu treffen, und hat gedacht, das Kind schläft und bekommt davon nichts mit. Ich würde das auch tun, wenn ich mit dieser Zicke verheiratet wäre.“
„Das kann ich mir denken.“ Holly versuchte gar nicht erst, ihre Gereiztheit zu verbergen. „Aber Ben ist nicht wie du. Er …“ Sie stockte. „Ben würde Flo niemals allein lassen.“
Sie stand auf. Ihr erschrockenes Herzklopfen hatte sich gelegt, sie spürte nur noch ein besorgtes Flattern, aber der Zeitdruck blieb. Halb drei. Wenn nicht viel Verkehr war, brauchte sie anderthalb Stunden, um nach Ashdown zu fahren. Anderthalb Stunden, in denen Flo allein war und Angst hatte. Ihre frühere Panik meldete sich zurück. Wo zum Teufel steckte Ben? Und warum hatte er sein Handy nicht mitgenommen? Warum hatte er es im Haus zurückgelassen?
Fieberhaft überlegte sie, worüber sie bei ihrem letzten Telefonat gesprochen hatten. Er hatte ihr erzählt, dass er mit Florence für ein verlängertes Wochenende in die Mühle fahren wollte. Dafür hatte er sich ein paar Tage von seiner Praxis in Bristol freigenommen, es war die Zeit um den ersten Mai. „Ich werde etwas Ahnenforschung betreiben“, hatte er erklärt und Holly damit zum Lachen gebracht, denn weder die Geschichte seiner Familie noch Geschichte ganz allgemein hatten ihren Bruder je sonderlich interessiert.
Sie verschwendete Zeit. „Hast du meinen Autoschlüssel gesehen?“, fragte sie.
„Nein.“ Guy folgte ihr ins Wohnzimmer und blinzelte, als sie die helle Deckenbeleuchtung einschaltete. „Toll“, meinte er gereizt. „Jetzt bin ich hellwach. Du willst mir wohl unbedingt die Nacht verderben.“
„Ich dachte, du kommst vielleicht mit“, erwiderte Holly.
Sein aufrichtig verblüffter Gesichtsausdruck sagte genug. „Warum überhaupt die Fahrerei?“, fragte Guy mürrisch und wandte sich ab. „Ich begreife das immer noch nicht. Ruf doch einfach die Polizei an oder irgendeinen Nachbarn, damit er hinübergeht und nach dem Rechten sieht. Wohnt da nicht auch eine alte Freundin von dir in der Nähe? Fiona? Freda?“
„Fran.“ Holly nahm ihren Autoschlüssel vom Tisch. „Fran und Iain sind für ein paar Tage verreist. Und warum ich dorthin fahre?“ Sie ging ein paar Schritte auf ihn zu. „Weil meine sechsjährige Nichte allein ist, Angst hat und mich um Hilfe gebeten hat. Hast du es jetzt begriffen? Sie ist noch klein. Sie fürchtet sich. Schlägst du mir etwa vor, ich soll mich wieder ins Bett legen und das Ganze vergessen?“
Sie nahm ihre Handtasche und packte ihr Portemonnaie, das Handy und ihr Tablet ein. Das Klappern des Schlüsselbunds hatte Bonnie, ihre Retrieverhündin, aus ihrem Körbchen in der Küche gelockt. Sie sah putzmunter aus und wedelte freudig mit dem Schwanz.
„Nein, Bon“, sagte Holly. „Du bleibst …“ Sie verstummte und sah Guy an. Er würde mit Sicherheit vergessen, sie zu füttern und mit ihr spazieren zu gehen. Außerdem wäre es tröstlich, Bonnie dabeizuhaben. Holly holte das Hundefutter aus dem Küchenschrank und hängte sich die Leine über den Arm. „Gut, dann lass uns gehen.“ In der Tür blieb sie noch einmal stehen. „Soll ich dich anrufen, wenn ich weiß, was passiert ist?“, fragte sie Guy.
Er war schon auf dem Weg in ihr Schlafzimmer, um den frei gewordenen Platz in ihrem Bett für sich zu beanspruchen. „Ja, klar“, rief er zurück, und Holly wusste schon jetzt, dass sie sich nicht bei ihm melden würde.
Alle paar Minuten wählte Holly Bens Nummer, aber es nahm niemand ab, und sie hörte jedes Mal das Klicken des Anrufbeantworters und die Ansage, Ben wäre zurzeit leider nicht zu erreichen, man möge doch bitte eine Nachricht hinterlassen. Irgendwann hörte auch das auf. Tasha rief ebenfalls nicht zurück. Holly überlegte kurz, ob sie ihren Großeltern in Oxford Bescheid sagen sollte. Sie konnten viel schneller in Ashdown Mill und bei Florence sein als Holly, obwohl sie auf den leeren Straßen zügig vorankam. Sie ließ die blendenden Lichter der Straßenlaternen hinter sich, und schon bald umgab Holly nur noch Dunkelheit, als sie stetig weiter nach Westen fuhr.
Schließlich beschloss sie, Hester und John nicht anzurufen. Sie wollte den beiden keinen Schreck einjagen, erst recht nicht, wenn es vielleicht gar keinen Grund zur Besorgnis gab. Obwohl sie wütend auf Guy war, wusste sie, dass er eventuell recht hatte. Möglicherweise war Ben längst zurück, Florence schlief wieder tief und fest und hatte bis zum Morgen vergessen, dass sie überhaupt um Hilfe gebeten hatte.
Die Polizei hatte Holly aus verschiedenen Gründen nicht benachrichtigen wollen; aus praktischen, weil alles vielleicht nur ein falscher Alarm war, und aus moralisch nicht ganz vertretbaren, weil sie nicht wollte, dass ihr Bruder Probleme bekam. Sie und Ben hatten sich immer gegenseitig beschützt; ganz besonders eng war ihr Verhältnis nach dem Unfalltod ihrer Eltern geworden, als Holly elf und Ben dreizehn gewesen waren. Sie hatten sich aufopfernd umeinander gekümmert, mit einer unerschütterlichen Loyalität, die auch im Lauf der Jahre nicht nachgelassen hatte. Jetzt war ihr Umgang miteinander entspannt und locker, aber sie standen sich noch genauso nahe wie früher. Zumindest hatte Holly das geglaubt, bis das hier geschehen war, und sie fragte sich wieder einmal, was zum Teufel ihr Bruder vorhatte.
Sie verdrängte den unerwünschten Verdacht, dass es Dinge im Leben ihres Bruders gab, von denen sie nichts wusste und auch nichts verstand. Guy hatte diese Zweifel gesät, aber sie hatte sie wütend beiseitegeschoben; sie wusste, dass Ben und Tasha eine Ehekrise hatten, aber Holly konnte sich nicht vorstellen, dass Ben untreu war. Er war einfach nicht der Typ dazu. Noch weniger konnte sie sich vorstellen, dass er sein Kind vernachlässigte. Es musste einen anderen Grund für seine Abwesenheit geben, falls er denn tatsächlich verschwunden war.
Doch zu Hause in Ashdown wartete Florence, erst sechs Jahre alt, allein und verängstigt. Also war Holly letztlich die Entscheidung leichtgefallen. Sie hatte schließlich doch bei der örtlichen Polizei angerufen, eine möglichst kurze und sachliche Erklärung abgegeben und sich dabei weitaus gelassener angehört, als sie sich fühlte. Wenn Florence etwas zustieß und sie nicht alles getan hätte, um ihr zu helfen, dann hätte Holly nicht nur Ben, sondern auch ihrer Nichte gegenüber versagt.
Das Ortsschild von Hungerford leuchtete im Scheinwerferlicht auf und überraschte Holly. Sie hatte bereits die Abbiegung erreicht. Die Uhr zeigte zwölf Minuten vor vier. Der Himmel vor ihr war noch stockdunkel, aber im Rückspiegel glaubte sie, das erste schwache Licht der Frühlingsdämmerung zu sehen. Aber vielleicht war das auch nur reines Wunschdenken. In Wahrheit fühlte sie sich auf dem Land einfach nicht wohl. Sie war ein Stadtkind durch und durch; in Manchester aufgewachsen hatte sie dann, nach dem Tod ihrer Eltern, in Oxford gelebt und war anschließend zum Kunststudium nach London gezogen und endgültig dort geblieben. London war ein guter Ort für ihr Glasgravuren-Geschäft. Sie hatte eine kleine Galerie und einen Laden gleich neben ihrer Wohnung und eine ansehnliche Kundschaft.
Am Verkehrskreisel bog sie erst nach rechts ab, Richtung Wantage, dann nach links, Richtung Lambourn. Sie kannte die Strecke eigentlich recht gut, aber die Straße kam ihr trügerisch verändert vor, weil Holly nur das sehen konnte, worauf das Licht ihrer Scheinwerfer fiel. Da gab es Kurven, Abzweigungen und Bodenwellen, die sie nicht wiedererkannte. Sie befand sich jetzt wirklich mitten auf dem Land und fuhr an ein paar abgelegenen Cottages vorbei, deren Fensterläden geschlossen waren. An einer Kreuzung nahm sie die rechte Abzweigung nach Lambourn und fuhr hinunter ins Tal; die Scheinwerfer beleuchteten den weiß gestrichenen Lattenzaun der Pferderennbahn, die neben der Straße verlief. In der kleinen Stadt war alles still, während sie die engen Straßen passierte. Als die Häuser und Stallungen hinter ihr zurückblieben und wieder Felder vor ihr lagen, überkam Holly dasselbe Gefühl wie immer, wenn sie sich Ashdown Mill näherte; ein Gefühl der Erwartung, das sie sich nie so ganz hatte erklären können, als fiele sie zurück in eine andere Zeit, während die dunkle Straße vor ihr breiter wurde und die baumlosen Hügel zu ihrer Rechten zurückwichen.
Sie und Ben waren als Kinder zur Kuppe des sogenannten Wetterhahn-Hügels hinaufgerannt, hatten sich oben schwer atmend ins weiche Gras fallen lassen und hatten den Wetterhahn betrachtet, dessen Spitze sich in den hohen blauen Himmel über ihnen bohrte. Der ganze Ort hatte sich wie verzaubert angefühlt.
Ben. Die Sorge um ihn schnürte ihr wieder die Kehle zu. Sie war jetzt fast da. Was würde sie erwarten?
Das Scheinwerferlicht fiel auf eine große Werbetafel am Straßenrand, aber Holly konnte im Vorbeifahren nur die ersten Wörter erkennen: „Ashdown Park, ein exklusives Projekt zum Umbau historischer Gebäude …“
Zu ihrer Linken drängten sich jetzt Bäume ganz nah an die Straße, wie eine kleine Armee in Gefechtsstellung. Als sich eine Lücke zwischen ihnen auftat, glaubte Holly, etwas Weißes hindurchschimmern zu sehen; ein großes viereckiges Gebäude, auf dessen Glaskuppel sich der Mond spiegelte und die Kugel darauf versilberte. Einen Moment später war die Vision verschwunden, der Wald schloss wieder seine Reihen, dunkel und abweisend.
Die Abzweigung nach links überraschte sie, beinahe hätte sie sie übersehen, obwohl sie schon so viele Male hier gewesen war. Sie holperte die einspurige Straße entlang, vorbei an einer Bushaltestelle, die vor den Resten einer verfallenen Mauer stand. Der alte Hof für die Kutschen befand sich links; wie es aussah, fand dort der Großteil der Umbauarbeiten statt, hinter der hohen Backsteinmauer. Selbst im Dunklen konnte Holly das von schweren Maschinen umgepflügte Gras erkennen und den Umriss eines großen Baggers. Auf dem Gelände stand ein weiteres Schild, ein diskreteres in Cremeweiß mit grünen Buchstaben. Es nannte den Namen der Bauleitung und bat darum, alle Lieferungen zum Baustellenbüro im Innenhof zu bringen.
Die schmale Straße bog wieder nach links ab, führte um das Dorf herum und wand sich dann zur Kuppe eines Hügels hinauf. Rechts lag die Einfahrt, ein weiß gestrichener Holztorpfosten, ein Tor mit fünf Querbalken, das nicht mehr zu schließen war, weil Gras und Löwenzahn so hoch wucherten.
Ashdown Mill.
Sie hielt auf der kreisförmigen gekiesten Auffahrt vor der Wassermühle und stellte den Motor ab. Bonnie bellte einmal kurz auf, und Holly hörte ihr aufgeregtes Schwanzwedeln, während die Hündin ungeduldig darauf wartete, aus dem Auto springen zu dürfen. Zwei weitere Autos standen auf der Auffahrt; eine kleinere Limousine und Bens Allradantrieb. Erschöpfung und Erleichterung machten sich schlagartig bemerkbar. Hollys Schultern waren völlig verspannt und taten weh. Wenn Ben da war und es sich nur um ein großes Missverständnis gehandelt hatte, würde sie ihn umbringen.
Sie öffnete die Tür und stieg langsam aus, ihre Beine waren steif, und ihr Rücken schmerzte. Die Luft um sie herum war so kurz vor Sonnenaufgang ziemlich frisch. Das erste Tageslicht fiel bereits durch die Äste der Bäume und ließ den Mond verblassen.
Endlich der Enge im Wagen entkommen, lief Bonnie fröhlich und mit der Nase auf dem Boden schnüffelnd kreuz und quer durch den Garten, dann flitzte sie um die weiß getünchte Mühle herum und war verschwunden. Holly schlug die Wagentür zu und eilte ihr nach; sie stieß die kleine Gartenpforte auf, lief den unebenen Steinpfad entlang auf die Haustür zu und rief dabei nach Bonnie.
Im Innern der Mühle brannten alle Lichter, und die Tür ging auf, noch ehe Holly dort angekommen war.
„Ben!“, rief sie. „Was zum …“
„Miss Ansell?“ Eine uniformierte Polizistin stand vor ihr. „Ich bin PC Marilyn Caldwell. Wir hatten vorhin telefoniert.“ Sie hatte freundliche Augen und ein blasses, übermüdet wirkendes Gesicht, und irgendetwas in ihrem Tonfall warnte Holly vor schlechten Neuigkeiten.
Hollys Herz begann wieder zu rasen, sie bekam Kopfschmerzen. Ihr fiel auf, dass das Holz neben dem Türschloss zersplittert und geborsten war.
„Wir mussten die Tür aufbrechen.“ In PC Caldwells Stimme schwang Bedauern mit. „Der Türgriff war zu hoch für Florence, sie konnte uns nicht öffnen.“
„Ja.“ Holly wusste, dass die Tür einen schweren altmodischen Eisenriegel hatte. Also war Ben nicht da gewesen, als die Polizei eingetroffen war, und auch jetzt konnte sie ihn nirgends entdecken. Das ungute Gefühl wurde intensiver, und sie zwang sich, tief durchzuatmen, während sie gegen ihre aufsteigende Panik ankämpfte. „Ist mit Florence alles in Ordnung?“
„Es geht ihr gut.“ Marilyn Caldwell legte Holly beruhigend eine Hand auf den Arm. Sie wich ein Stück zur Seite, sodass Holly in das lang gezogene Wohnzimmer der Mühle blicken konnte. Florence saß auf dem Sofa neben einer anderen Polizistin. Die beiden lasen in einem Buch, obwohl Florence die Augen, die noch ganz verquollen vom früheren Weinen waren, immer wieder vor Müdigkeit zufielen.
Hollys Herz pochte glücklich in ihrer Brust und sie machte unwillkürlich einen Schritt nach vorn. „Kann ich bitte zu ihr gehen?“
„Einen Moment noch.“ PC Caldwells Tonfall ließ Holly innehalten. „Leider haben wir Ihren Bruder nicht gefunden, Miss Ansell.“ Sie sah Holly jetzt mit professioneller Distanziertheit an. „Wir haben das Haus und den unmittelbar angrenzenden Wald abgesucht, auch alle Straßen hier in der Nähe, aber ohne Erfolg.“
Holly erschrak, die Angst kam zurück. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht.
„Ist das da draußen Dr. Ansells Wagen?“
„Ja.“ Holly rieb sich die erschöpften Augen. „Er kann also nirgendwohin gefahren sein.“
„Vielleicht hat ihn ein Freund abgeholt“, schlug PC Caldwell vor. „Oder er ist zu Fuß losgegangen, um sich mit jemandem zu treffen.“
„Mitten in der Nacht?“, wandte Holly ein. „Ohne sein Handy?“
Die Miene der Polizeibeamtin verhärtete sich. „So ungewöhnlich ist das nicht, Miss Ansell. Ich könnte mir vorstellen, er dachte, dass Florence schläft, und ist leise gegangen. Vielleicht hat er sich in der Zeit verschätzt.“
„Das wäre vollkommen verantwortungslos.“ Holly spürte ihre wachsende Wut und versuchte, sich zu beherrschen. Sie war müde, besorgt und hatte eine lange Fahrt hinter sich. Sie musste unbedingt zur Ruhe kommen. Offensichtlich war PC Caldwell der gleichen Meinung.
„Wir rechnen fest damit, dass Dr. Ansell heute Morgen wieder auftauchen wird“, sagte sie kühl. „Wenn das der Fall ist, würden Sie uns bitte Bescheid geben? Das wäre nett.“
„Da werden Sie wohl Schlange stehen müssen“, erwiderte Holly. Dann fügte sie hinzu: „Verzeihung. Ja, natürlich. Aber …“ Wieder regten sich Zweifel und Furcht in ihr. Die Gefühle waren zwar verschwommen, aber sehr stark. Ihr Instinkt sagte ihr, dass Ben nicht einfach nur aus dem Haus gegangen war. „Er hat sein Handy hiergelassen, alle seine Sachen liegen noch herum. Das sieht nicht so aus, als hätte er vorgehabt auszugehen.“
PC Caldwell gab ihrer Kollegin bereits diskret ein Zeichen, dass es Zeit war zu gehen. Sie wirkte nicht im Geringsten interessiert. „Wir haben Mrs. Ansell ausfindig gemacht“, berichtete sie. „Sie ist auf dem Weg von Spanien hierher, schafft es aber vielleicht nicht, vor morgen Abend hier zu sein. Offenbar war sie …“ Sie warf einen Blick auf ihren Notizblock. „Beim Helikopter-Skiing in den Pyrenäen?“ Sie klang zweifelnd.
„Sehr wahrscheinlich“, gab Holly trocken zurück. „Tasha arbeitet für ein Reisemagazin im Fernsehen – Extreme Pleasures.“
„Oh ja!“ Marilyn Caldwell begann zu strahlen. „Donnerwetter! Natasha Ansell – natürlich! Das ist ja aufregend! Nun …“ Sie verstummte, weil ihr bewusst wurde, dass in dieser Situation Promi-Geplauder eher fehl am Platz war. „Wir kommen morgen wieder.“ Dann fiel ihr noch etwas ein. „Wissen Sie, was Ihr Bruder hier gemacht hat, Miss Ansell?“
„Die Mühle ist sein Ferienhaus“, erklärte Holly. „Sie gehört uns beiden.“ Wieder rieb sie sich die müden, brennenden Augen. Plötzlich war sie so erschöpft, dass sie am liebsten an Ort und Stelle geschlafen hätte. „Er ist mit Flo hierhergekommen, während Tasha beruflich unterwegs ist. Er meinte, er wollte ein wenig nachforschen. Über die Geschichte unserer Familie. Es ist ruhig hier, ein guter Ort zum Nachdenken.“
PC Caldwell nickte. „Stimmt.“ Holly sah ihr deutlich an, dass sie sich fragte, wie eine so glamouröse Person wie Tasha bloß in eine so missliche Situation geraten konnte mit einem Mann, für den Ahnenforschung das Größte war. „Also“, sagte die Polizistin, „wir kommen morgen wieder, um uns mit Mrs. Ansell zu unterhalten.“
Das glaube ich dir gern, dachte Holly. Sie war wütend; auf PC Caldwell, weil die sich mehr für Tashas Berühmtheit interessierte als für Bens Verschwinden; auf Tash, weil die sie nicht einmal angerufen hatte, um zu fragen, ob es in Ordnung wäre, wenn Holly sich bis zu Tashas Rückkehr um Flo kümmerte, und am meisten auf Ben, weil er einfach so wortlos verschwunden war. Diese Wut half ihr, denn dahinter lauerte immer noch die Angst, das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte und dass Ben niemals freiwillig weggehen und seine Tochter allein lassen würde.
Bonnie spürte Hollys Stimmung und fiepte leise. Florence sah von ihrem Märchenbuch auf. Ihre Augen begannen zu leuchten, als sie die beiden entdeckte, und sie kletterte vom Sofa.
„Tante Holly!“ Florence rannte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. „Du bist da!“ Holly hob sie hoch, spürte die weiche Wange ihrer Nichte an ihrer und atmete den Duft von Shampoo und Seife ein. Florence klammerte sich wie ein Äffchen an sie, ihre warmen Tränen benetzten Hollys Hals. Holly spürte ihre Angst und Verzweiflung, das Mädchen tat ihr schrecklich leid. Sicherheit war ein so zerbrechlicher Zustand, wenn man ein Kind war. Das verstand Holly besser als die meisten anderen.
„Hallo, Flo“, sagte sie liebevoll. „Natürlich bin ich da. Ich komme immer, wenn du nach mir rufst. Das weißt du doch.“
„Wo ist Daddy?“, jammerte Florence. „Warum ist er weggegangen?“
„Ich weiß es nicht.“ Holly drückte sie noch fester an sich. „Er ist bald wieder hier, da bin ich mir ganz sicher.“ Sie wünschte, sie wäre es wirklich.
Später, als Florence endlich erschöpft eingeschlafen war, trug Holly ihre Nichte im fahlen Licht der Dämmerung nach oben, legte sie behutsam auf das große Doppelbett im Schlafzimmer und drückte ihr ein Plüschkaninchen in die Arme. Dann ging sie hinüber zum Fenstersitz, lehnte den Kopf an die vertäfelte Einfassung und schloss für einen Moment die Augen.
Obwohl Ben und sie sich als Kinder das kleinere Schlafzimmer nebenan geteilt hatten, war das hier der Raum, der sie von jeher angezogen hatte. Sie liebte es, wie das Licht durch die hohen Fenster ins Zimmer fiel.
So früh am Morgen lag es aber noch im Schatten. Bens Sachen waren überall verstreut; über der Stuhllehne hing ein Hemd, seine Uhr lag auf der Kommode, das Bett war ungemacht. Es sah aus, als hätte er nur für einen Augenblick das Zimmer verlassen und würde jeden Moment zurückkommen, was Holly eher beunruhigte als ermutigte. Das alles hier war so untypisch für ihn.
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten und ein unbestimmtes Gefühl, fast wie Trauer, breiteten sich in ihr aus. Sie erinnerte sich, wie sie und Ben sich als Kinder immer vorgestellt hatten, das Bett wäre ein fliegender Teppich, mit dem sie in ferne Länder flogen. Sie hatten sich gegenseitig Geschichten erzählt, die ausgefallener, abenteuerlicher und spannender gewesen waren als alles, was sie je in Büchern gelesen hatten. Es war märchenhaft gewesen. Unter dem Kissen des Fenstersitzes hatte es sogar ein kleines Geheimfach gegeben, in dem sie geheime Botschaften füreinander hinterlassen hatten …
Ihr stockte der Atem. Holly stand ganz leise auf, um Florence nicht zu wecken, und hob das Kissen hoch. Der kleine Messinggriff war noch da, ganz wie sie ihn in Erinnerung hatte. Sie zog daran. Nichts geschah. Der Deckel klemmte offenbar. Sie zog fester, und der Deckel löste sich so laut knarrend, dass sie schon befürchtete, Florence könnte davon aufwachen, aber das Kind rührte sich nicht. Holly kniete sich hin und spähte in das Fach darunter. Es war leer, bis auf die Quittung von irgendeiner Reinigung, eine tote Spinne und ein seltsam geformter gelber Kieselstein.
Ein Gefühl grenzenloser Enttäuschung überkam sie. Was hatte sie denn erwartet – dass Ben ihr heimlich eine Nachricht hinterlassen hatte, wohin er gegangen war? So unwahrscheinlich sie es auch finden mochte, dass er einfach so verschwunden war, aber vermutlich hatte die Polizei doch recht. Schon bald würde Ben wieder auftauchen, voller Sorge um Flo, mit lauter Entschuldigungen und Erklärungen … Doch an diesem Punkt ließ ihre Vorstellungskraft sie im Stich. Ihr fiel kein einziger Grund ein, warum er sich so verhalten haben sollte.
Irgendwann, als sie sich halbwegs beruhigt hatte, legte sie sich zu Flo auf das breite Doppelbett. Sie schlief nicht, sondern hörte ihrer Nichte beim Atmen zu, und das tröstete sie ein wenig. Nach einer Weile verfiel sie in einen unruhigen Schlaf, und Bonnie machte es sich zu ihren Füßen bequem.
Ein anhaltendes Klingeln weckte sie. Einen Moment lang fühlte sie sich glücklich und zufrieden, bis die Erinnerung an das, was geschehen war, wieder zurückkehrte. Verschlafen stand sie auf, ging nach unten und griff nach ihrer Handtasche, um das Handy herauszuholen. Ob das wohl Guy war, der wissen wollte, was passiert war?
Doch es war nicht ihr Handy, das klingelte. Fast in der Ritze des Sofas verschwunden fand sie Bens Telefon, zog es heraus und nahm den Anruf an.
„Dr. Ansell?“ Es war eine Stimme, die sie nicht kannte, männlich, mit einem ganz leichten Akzent, angenehm und geschäftsmäßig. „Hier spricht Espen Shurmer. Verzeihen Sie, dass ich so früh anrufe, aber ich wollte, dass Sie unser Treffen am Freitag noch einmal bestätigen …“
„Hier ist nicht Ben“, unterbrach Holly ihn hastig. „Ich bin seine Schwester.“
Kurze Pause am anderen Ende. „Dann bitte ich nochmals um Verzeihung.“ Der Mann klang ein wenig belustigt. „Wenn Sie so nett wären, Dr. Ansell ans Telefon zu holen?“
„Das tut mir leid“, sagte Holly, „er ist nicht da. Ich …“ Sie merkte selbst, dass sie stotterte, weil sie noch so verschlafen war. Sie war sich nicht sicher, warum sie überhaupt an Bens Handy gegangen war, und jetzt wusste sie nicht, was sie sagen sollte. „Ich fürchte, er ist verschwunden“, platzte sie heraus.
Dieses Mal dauerte das Schweigen am anderen Ende deutlich länger. Als sie schon mit einer gewissen Erleichterung glaubte, Espen Shurmer hätte aufgelegt, meldete er sich wieder zu Wort. „Verschwunden? Im Sinne von Sie wissen nicht, wo er ist?“ Er klang aufrichtig interessiert.
„Ja“, erwiderte Holly. „Seit gestern Abend.“ Sie war sich nicht sicher, warum sie dem Mann das erzählte, wahrscheinlich war er nur ein Geschäftsfreund von Ben. „Ich fürchte daher, dass ich nicht weiß, ob er es schaffen wird, den Termin einzuhalten … Ich meine, wenn er zurückkommt, sage ich ihm natürlich Bescheid, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass er da sein wird …“ Sie verstummte und kam sich absolut dumm vor.
„Miss Ansell“, sagte der Mann, „verzeihen Sie, dass ich mich noch nicht richtig vorgestellt habe. Mein Name ist Espen Shurmer, und ich bin Sammler von Kunstgegenständen aus dem siebzehnten Jahrhundert, Gemälden, Glas, Schmuck…“ Er hielt inne. „Ich hatte mit Ihrem Bruder für Freitagabend um halb acht ein Treffen vereinbart, nach einer Vernissage im Ashmolean Museum in Oxford. Er hat mich vor ein paar Wochen kontaktiert und um dieses Treffen gebeten.“
„Oh“, entgegnete Holly ratlos. „Nun, ich bedauere, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, Mr. Shurmer, aber ich habe keine Ahnung, worüber Ben mit Ihnen sprechen wollte. Eigentlich überrascht es mich sogar, dass er Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat. Kunst ist gar nicht sein Ding …“ Wieder verstummte sie, weil sie merkte, dass sie immer noch stammelte, obwohl das, was sie sagte, vollkommen der Wahrheit entsprach. Ben interessierte sich nicht im Geringsten für Kunst. Er hatte sie bei ihrem Kunststudium immer unterstützt und ihr sogar ein paar ihrer Briefbeschwerer für seine Praxis abgekauft, aber sie wusste, er hatte das nur getan, weil sie diese selbst hergestellt hatte. Dafür hatte sie ihn geliebt, aber sie gab sich keinen Illusionen hin, was sein Interesse an Kunst und Kultur betraf.
„Ich weiß, worüber Ihr Bruder mit mir sprechen wollte, Miss Ansell“, erwiderte Espen Shurmer. „Er wollte ein paar Informationen über eine ganz bestimmte Perle, ein legendäres Juwel von beträchtlichem Wert.“
Holly ließ sich aufs Sofa fallen. „Eine … Perle?“ Sie glaubte, sich verhört zu haben.
„Im Sinne von Schmuck? Sind Sie sicher? Ich meine …“ Es war zwar möglich, dass Ben ein Geschenk für Natasha gekauft hatte, aber sie war davon überzeugt, dass er moderneren Schmuck ausgesucht hätte, anstatt sich an einen Antiquitätensammler zu wenden. Auf diese Idee wäre er ganz sicher niemals gekommen.
„Ich glaube, wir sollten uns treffen, um darüber zu reden“, sagte der Mann nach einer Weile. „Es ist wirklich äußerst wichtig. Falls Ihr Bruder den Termin nicht einhalten kann, könnten Sie dann an seiner Stelle kommen, Miss Ansell? Ich wäre Ihnen mehr als dankbar.“
Holly hatte noch nicht einmal über die nächsten Stunden hinausgedacht, geschweige denn bis Freitag. „Ich glaube nicht“, erwiderte sie. „Es tut mir leid, Mr. Shurmer, aber Ben ist bis dahin sicher längst zurück, und ich habe mit der Sache ohnehin nichts zu tun.“
„Um halb acht am Ashmolean Museum in Oxford“, fiel Shurmer ihr so leise ins Wort, dass sie es beinahe gar nicht mitbekommen hätte. „Es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie sich entscheiden würden zu kommen, Miss Ansell“, fügte er mit altmodischer Höflichkeit hinzu.
Ein Klicken in der Leitung ertönte, das Gespräch war beendet.
Langsam legte Holly das Handy weg, nahm ihre Tasche und holte das Tablet hervor. Sie gab den Namen Espen Shurmer ein, das Datum, die Uhrzeit und den Begriff Ashmolean Museum. Das Ergebnis kam sofort – eine Lesung und eine Vernissage mit Gemälden und Kunstgegenständen vom Exilkönigshof von Elizabeth, der Winterkönigin, Schwester von König Charles I. Eine neue große Ausstellung dazu sollte Ende Mai beginnen. Espen Shurmer, so las sie, war ein holländischer Sammler von Gemälden und Glas aus dem 17. Jahrhundert, er hatte dem Museum bereits eine Reihe von Objekten gespendet.
Sie empfand plötzlich Bedauern, als sie das Tablet ausschaltete. Nur zu gern hätte sie sich eine Ausstellung mit Kunstgegenständen aus dem 17. Jahrhundert angesehen und mit einem anerkannten Experten darüber gesprochen. Doch dazu bestand kein Grund, Ben würde bald zurück sein, dessen war sie sich ganz sicher. Sie musste sich sicher sein, denn sie hatte Florence zu beruhigen und ihre eigenen Ängste zu bekämpfen. Je länger Ben fort war, desto größer wurden diese Angstmonster; die Angst, dass Ben nie mehr zurückkam und sie wieder allein sein würde, ganz allein dieses Mal, ähnlich wie damals, als ihre Eltern gestorben waren, nur noch viel schlimmer …
Sie verdrängte ihre Panik. Jetzt war es wichtig, sich mit irgendetwas zu beschäftigen. Sie musste für Flo Frühstück machen, dann konnten sie beide mit Bonnie spazieren gehen, und danach war Ben sicher wieder zu Hause …
Doch als Holly am Mittag hinunter ins Dorf fuhr, um ein paar Sandwiches zu holen, war Ben immer noch nicht wieder da. Und noch immer fehlte jede Spur von ihm, als Holly und Flo um drei von einem weiteren Spaziergang mit Bonnie nach Hause kamen. Den ganzen Tag über spürte Holly, wie ihre Angst zunahm. Sie kämpfte unentwegt dagegen an, doch die Angst wuchs, breitete sich immer weiter in ihr aus und setzte sich in ihrem Kopf fest, bis Holly sich auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte. Als sie einen Wagen den Weg zur Mühle hochfahren hörte, musste sie sich zurückhalten, um nicht sofort nach draußen zu laufen und nachzusehen, ob es Ben war.
„Das ist Mommy!“ Flo besaß nichts von Hollys Zurückhaltung. Sie sprang von dem Bild auf, das sie gerade gemalt hatten, und rannte zur Tür hinaus, begleitet von Bonnie. Holly folgte ihnen langsamer. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwägerin war schon immer etwas angespannt gewesen. Ben war das Bindeglied zwischen ihnen, aber nun war er fort und Holly plötzlich argwöhnisch.
Tasha, die so elegant aussah, als wollte sie gerade den Laufsteg betreten, schlug die Tür ihres kleinen roten Sportwagens zu und eilte auf schwindelerregend hohen Absätzen über den Kies.
„Was zum Teufel soll das alles?“, fragte sie ohne Einleitung, als sie bei Holly an der Gartenpforte angekommen war. „Ich musste extra aus Spanien zurückkommen! Wo ist er, der verdammte Mistkerl?“
Holly zuckte zusammen. Tasha schien Flo erst jetzt zu bemerken und bückte sich, um sie hochzuheben. „Hallo, Liebling.“ Sie hielt Flo und ihre farbverschmierten Hände ein Stück von sich weg, ehe sie sie wieder auf den Boden stellte. „Keine Sorge, Süße, jetzt bin ich ja da.“ Sie klopfte Bonnie auf die Flanke, zur Begrüßung, aber auch, um sie wegzuschieben. Tasha machte sich nichts aus Tieren.
„Lass uns hineingehen“, sagte Holly.
„Ich habe nicht vor zu bleiben.“ Tasha nahm ihre Sonnenbrille ab und sah Holly mit ihren großen blauen Augen an. „Ich fahre nach Hause, nach Bristol. Ich warte hier doch nicht ab, bis Ben irgendwann auftaucht, wenn ihm danach ist. Hast du Flos Tasche gepackt?“
„Nein“, erwiderte Holly kalt, „da du mir ja nicht gesagt hast, dass du kommst.“ Sie war zu erschöpft, um taktvoll sein zu können. Tasha und sie waren sich noch nie nahe gewesen; zwar hatte Holly versucht, ihre Schwägerin zu mögen, doch das hatte sich als sehr schwierig erwiesen.
„Entschuldigung.“ Zu Hollys Überraschung schien Tasha plötzlich zu schrumpfen wie ein Luftballon, in den man mit einer Nadel gestochen hatte. „Ich weiß es wirklich zu schätzen, Holly, dass du gekommen bist und dich um Flo gekümmert hast, aber ich bin einfach so furchtbar wütend! Es sieht Ben gar nicht ähnlich, all seinen Verpflichtungen plötzlich den Rücken zuzukehren …“ Sie brach in Tränen aus.
„Warte.“ Holly legte die Hand auf Tashas Arm. „Wie meinst du das? Du glaubst doch bestimmt nicht, dass er sich einfach auf und davon gemacht hat?“
„Doch, genau das glaube ich.“ Tasha wischte sich die Tränen fort, ehe sie sich energisch wieder die Sonnenbrille aufsetzte. „Er hat seine ganze freie Zeit hier verbracht. Wahrscheinlich trifft er eine andere Frau.“
„Er hat hier Ahnenforschung betrieben!“, protestierte Holly.
Ihre Schwägerin sah sie so verächtlich an, dass Holly errötete. „Ja, und ich bin Marilyn Monroe.“
„Das glaube ich jetzt nicht!“ Holly war so zornig, dass sie Flo ganz vergaß, die alles mitbekam und mit geweiteten blauen Augen zuhörte, die denen ihrer Mutter so sehr ähnelten. „Verdammt, Tasha, du weißt, so etwas würde Ben niemals tun! Und schon gar nicht würde er Flo allein lassen! Außerdem, wohin sollte er denn gehen? Er würde niemals verschwinden, ohne jemandem Bescheid zu sagen!“
„Du meinst, er würde niemals verschwinden, ohne dir Bescheid zu sagen“, erwiderte Tasha mit einem mitleidigen Unterton, der Holly zur Weißglut reizte. „Ach, Holly …“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich weiß, du glaubst, ihr beide steht euch wirklich nahe, aber so gut kennst du Ben auch wieder nicht, vertrau mir.“ Sie nahm Flos Hand. „Komm, Süße, wir packen jetzt deine Sachen.“
Holly sah ihnen nach, als sie den Pfad entlanggingen und in der Mühle verschwanden. Trostlosigkeit machte sich in ihr breit, gepaart mit der Furcht, ihre Schwägerin könnte eventuell recht haben. Insgeheim hatte sie immer gedacht, Ben besser zu kennen als jeder andere Mensch, einschließlich seiner Frau. Hatte Ben ihr ernsthaftere Probleme in seiner Ehe verschwiegen? Holly konnte es nicht glauben.
Die Sonne, die sich glitzernd auf dem Mühlteich spiegelte, blendete sie. Plötzlich fühlte sie sich den Tränen nahe. Ihr war, als wäre sie in einer Welt gefangen, in der nichts so war, wie es den Anschein hatte, und sie war die Einzige, die verzweifelt an ihrem Glauben festhielt. Bonnie stand angespannt neben ihr, neigte den Kopf zur Seite und spürte wieder einmal instinktiv, in welcher Stimmung Holly war.
„Komm, Bon“, sagte Holly grimmig. „Ich weiß, dass hier etwas nicht stimmt. Es ist mir egal, was alle anderen denken.“
Zurück in der Mühle konnte sie Tasha oben hin und her gehen hören. Die Fußbodendielen knarrten, und dann erschienen Tasha und Flo auf der Treppe. Flo schmollte und ließ ihren kleinen Koffer auf jeder Stufe aufprallen. Tasha trug Bens Reisetasche und machte ein verstimmtes Gesicht.
„Ich bin sicher, er taucht wieder auf, Holly“, sagte sie, als sie die unterste Stufe erreicht hatte. „Mach dir keine Sorgen.“
„Ich weiß, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht“, erwiderte Holly hartnäckig.
„Hör mal.“ Tasha ließ die Tasche mit einem dumpfen Laut auf den Boden fallen. „Glaub nicht, dass ich das nicht verstehe. Das tue ich wirklich. Du hast immer ein wenig geklammert, wenn es um Ben ging, nicht wahr?“ Und dann, noch ehe Holly den Mund aufmachen konnte, um ihr eine scharfe Antwort zu geben: „Oh, ich verstehe ja, warum. Ich weiß, dass ihr eure Eltern verloren habt und all das, und ich habe nichts dagegen. Wirklich nicht.“ Sie bedachte Holly mit einem leicht herablassenden Lächeln, als hätte sie Ben voll und ganz die Erlaubnis erteilt, auf die Bedürfnisse seiner neurotischen Schwester einzugehen. „Aber all das ist doch schon einmal passiert, nicht wahr? Damals, als du auch dachtest, Ben wäre verschwunden, dabei hatte er nur ein Wochenende mit seinen Kumpels verbracht.“
Holly schoss das Blut in die Wangen. „Das ist Jahre her, und das war etwas ganz anderes!“
Tasha zuckte die Achseln. „Wie dem auch sei. Die Wahrheit ist, du hast eine ziemlich idealistische Vorstellung von deinem großen Bruder und machst dir viel zu viele Sorgen um ihn. Ich rate dir, dich zu beruhigen. Wie ich schon sagte, in ein paar Tagen ist er wieder da.“ Sie sah sich im Wohnzimmer um. „Falls ich etwas vergessen habe, schick es mir einfach nach, ja?“
Holly atmete tief durch und zählte bis zehn. Dann schob sie unauffällig Bens Handy in ihre Hosentasche. „Aber natürlich.“
2. Kapitel
In der Mühle war es totenstill, nachdem Tasha und Flo weggefahren waren. Die Stille war so laut, dass sie Holly in den Ohren wehtat. Es war halb vier, und sie fühlte sich unerträglich müde, gleichzeitig aber auch furchtbar unruhig. Die Zeit hatte ihre Bedeutung verloren. Holly wartete auf das Klingeln ihres Handys, ein Klopfen an der Tür, eine Stimme – auf irgendetwas, das Bens Rückkehr ankündigte.
Sie nahm ihr Telefon und ging nach draußen, um besseren Empfang zu haben. Sie wählte Guys Handynummer, aber er meldete sich nicht. Auch unter seiner Festnetznummer erreichte sie ihn nicht. Er hatte nicht angerufen, um sich zu erkundigen, was geschehen war und ob es ihr gut ging. Die Erkenntnis, dass ihn das alles nicht interessierte, schien sie nicht mehr verletzen zu können. Nichts durchdrang die Benommenheit und Einsamkeit, die sie umgab wie ein Leichentuch.
Erneut überlegte sie, ihre Großeltern anzurufen, entschied sich dann jedoch dafür, sie nicht unnötig zu beunruhigen. Wenn Ben bei ihnen gewesen wäre, hätte er sich schon längst gemeldet. Sie befand sich in einem frustrierenden Schwebezustand; in der einen Minute war sie beinahe verrückt vor Sorge und in der nächsten so wütend auf ihren Bruder, dass sie ihn am liebsten angeschrien hätte. Da sonst niemand etwas zu unternehmen schien, hielt sie es schließlich für die beste Idee, hinauszugehen und selbst im Wald nach ihm zu suchen. Sie musste unbedingt wieder an die frische Luft, sie bekam allmählich Klaustrophobie, und ihr war übel. Also zog sie ihre dünne Fleecejacke an und ging nach draußen. Bonnie, die keine Lust auf einen weiteren Spaziergang zu haben schien, blieb schnarchend auf dem Sofa liegen.
Es war ein schöner Tag mit einem wolkenlosen blauen Himmel. Holly wusste nicht so recht, wo sie mit der Suche beginnen sollte, also schlug sie den Weg hinunter ins Dorf ein, nach rechts über eine Brücke, vorbei an einer Bushaltestelle, wo ein Mädchen mit langem blonden, im Wind wehenden Haar wartete. Etwa neunzehn Jahre alt, groß, zu dünn und in einen langen gestreiften Schal gewickelt, stand die junge Frau dort, rauchte und machte ein gelangweiltes Gesicht. Sie nickte kurz, als Holly vorbeiging, dann ließ sie die Zigarette fallen und drückte sie mit dem Schuh aus.
Die verfallene Mauer erhob sich links von Holly, dahinter lag der alte Kutschenhof. Hier fand der Großteil der Bauarbeiten statt, und Holly konnte das Ächzen und die Pieptöne eines Baggers hören. Etwa hundert Meter weiter befanden sich der Parkplatz und der Innenhof, wo Fran ihr Café mit angrenzendem Imbiss und die Teestube besaß. Ein Dutzend Autos standen in dem gepflasterten Hof, und über der Eingangstür schaukelte ein Schild mit der Aufschrift „Eis“. Sie dachte kurz daran, hineinzugehen, doch dann fiel ihr ein, dass Fran erst am kommenden Tag zurück sein würde. Holly fühlte sich seltsam orientierungslos. Sie war an diesem Tag schon einmal hier gewesen, um die Sandwiches zu holen, vor wenigen Stunden erst, aber ihr kam es so vor, als sei es Wochen her. Sie war so müde.
Am Telegrafenmast neben der Straße heftete ein kleines Plakat. Ein Hund namens Lucky wurde vermisst, und die Besitzer boten demjenigen eine Belohnung, der ihn wieder zu ihnen brachte. Holly betrachtete das traurige kleine Hundegesicht und spielte mit dem Gedanken, Plakate mit einem Foto von Ben anzufertigen und sie an allen möglichen Stellen anzubringen. Vielleicht hatte ihn ja jemand im Wald gesehen. Schließlich konnte er an die frische Luft gegangen sein, dann hätte ihm schlecht geworden sein können, oder er war gestürzt und hatte das Bewusstsein verloren. Vielleicht hatte er sich ja auch den Knöchel gebrochen und konnte nicht mehr nach Hause humpeln. Die Polizei hatte ihr zwar versichert, man hätte den Wald in der nächsten Umgebung abgesucht, doch sie vermutete, dass es im besten Fall nur eine oberflächliche Suche gewesen war.
Obwohl die Sonne warm schien, fror Holly. Es verblüffte sie, dass so viele Feiertagstouristen im Dorf waren. Aus irgendeinem Grund hatte sie mit mehr Ruhe gerechnet. Sie schlenderte über den Pfad zum Wald und folgte mehreren Besuchergruppen; Familien mit lustlos vor sich hin schlurfenden Kindern, und Paaren, die Händchen hielten. Holly sah sie alle wie durch eines ihrer gravierten Gläser, klar, aber ganz leicht verzerrt. Sie spazierten ziellos dahin, bewunderten den Blick über die Downs, wo der Wetterhahn auf dem Hügel in den Himmel ragte und am Horizont die sanft geschwungenen Berge zu sehen waren. Holly fühlte sich entsetzlich einsam.
Ihr Handy klingelte.
„Hol?“ Es war Guy, und er klang verkatert. „Was ist los? Warum die siebentausend Anrufe? Was gibt’s?“
„Ben wird immer noch vermisst“, sagte Holly schroff. „Er ist nicht nach Hause gekommen.“
„Was?“ Guy hörte sich verwirrt, ja beinahe gereizt an. „Wo ist er denn?“
„Ich weiß es nicht“, erwiderte Holly. „Das ist es ja gerade, niemand weiß es. Tasha meint …“ Sie biss sich auf die Zunge, aber es war schon zu spät.
„Er hat eine andere“, vollendete Guy den Satz eindeutig schadenfroh. „Schön für ihn.“
„Ich bin mir sicher, sie irrt sich“, widersprach Holly.
Guy ging gar nicht darauf ein. „Dann kommst du also zurück? Wenn Tasha das Kind abgeholt hat …“
„Nein. Ich bleibe hier, bis Ben wieder auftaucht.“
Stille. „Was? Warum um alles in der Welt willst du da rumhängen?“, fragte Guy.
„Für den Fall, dass ihm etwas passiert ist“, erklärte Holly. „Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht herkommen möchtest?“ Sie hörte selbst ihren flehenden Unterton und hasste sich dafür. Ganz gleich, was Tasha auch gesagt hatte, normalerweise klammerte sie nicht, aber an diesem Tag hatte sie das Gefühl, außerordentlich dünnhäutig zu sein. Es musste eigentlich gar nicht Guy sein, wie ihr klar wurde, sie sehnte sich nur nach Gesellschaft und Trost. Sie wollte die Last von Bens Verschwinden mit jemandem teilen. Es war schrecklich, sich so allein zu fühlen.
Sie glaubte, Guy fluchen zu hören. „Hol, du überreagierst. Dein Bruder ist kein Kind mehr, er kann auf sich selbst aufpassen. Um Himmels willen, komm nach Hause …“
„Ich mache mir Sorgen“, erwiderte Holly. „Ich weiß, da stimmt etwas nicht.“
Dieses Mal fluchte Guy tatsächlich. „Verdammt noch mal, Holly, du bist nicht sein Babysitter!“
„Vergiss es“, sagte Holly schnell. „Vergiss, dass ich dich gebeten habe zu kommen. Und erwarte mich auch nicht zurück.“ Sie schnitt Guy das Wort ab und beendete das Gespräch.
Der kurze Wutausbruch hatte ihr gutgetan, doch ihre Stimmung verdunkelte sich schnell wieder. Als sie den Wald betrat, fühlte sie sich verloren. Das Blätterdach schloss sich dicht über ihr, grüne Dunkelheit umgab sie. Vom Hauptpfad zweigten viele kleinere ab und führten scheinbar ins Nichts. Sie ging etwa zweihundert Meter weit, dann blieb sie stehen, weil sie merkte, dass sie nicht einmal ihre festen Schuhe angezogen hatte. Tränen des Zorns und der Enttäuschung stiegen ihr in die Augen. Innerlich aufgewühlt machte sie sich auf den Rückweg zur Straße.
Was wollte sie eigentlich? Sie war jemand, der Beweise suchte angesichts einer geballten Ladung von Gleichgültigkeit. Niemand sonst schien zu glauben, dass etwas nicht stimmte, und es machte ihr Angst, dass sie selbst kurz davor war, auch so zu denken; sie fürchtete sich davor, eventuell den Verstand verloren zu haben.
In der Kirche an der kleinen steinernen Brücke war soeben eine Trauung zu Ende gegangen. Als die Kirchturmuhr Viertel vor vier schlug, öffnete sich die Kirchentür, und die Hochzeitsgesellschaft strömte hinaus auf den Friedhof. Eine plötzliche Böe drückte der Braut den Schleier ins Gesicht und zerrte an den Mänteln der Gäste wie ein Aufmerksamkeit forderndes Kind. Der Wind wirbelte das Konfetti auf, ließ es wie winzige Blütenblätter um Hollys Kopf tanzen und riss der Braut den Blumenstrauß aus der Hand, der genau vor Hollys Füßen landete.
Holly bückte sich, um ihn aufzuheben; es war ein Bouquet aus pinkfarbenen duftlosen Rosenknospen
Plötzlich war sie umgeben von Hochzeitsgästen; auch die Braut kam lachend auf sie zu. „Vielen, vielen Dank! Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte – gleich werden wir fotografiert!“
Holly reichte ihr den Strauß mit einem Lächeln. Ihr Gesicht fühlte sich dabei ein wenig starr an, als wüsste es nicht, welche Muskeln dazu bewegt werden mussten. Das schien jedoch niemand zu bemerken. Alle schwelgten völlig in ihrem Glücksgefühl; keiner ahnte, wie einsam und isoliert sie sich fühlte. Sie gingen zurück zur Kirchentür, wo der Fotograf Anweisungen für das offizielle Foto gab. Gleichzeitig verspürte Holly einen stechenden Schmerz in der Brust. Sie nahm diesen Leuten ihr Glück nicht übel, aber dadurch wurde ihr Gefühl der Einsamkeit womöglich noch unerträglicher.
„Ist alles in Ordnung mit Ihnen?“
Holly zuckte zusammen. Sie war nicht die einzige Zuschauerin. Ein Mann stand neben dem überdachten Friedhofstor. Noch relativ jung, zwei- oder dreiunddreißig etwa; Holly war nicht gut darin, ein Alter zu schätzen. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte sie, ihn schon einmal gesehen zu haben, doch als er näher kam, war dieser Moment des Wiedererkennens verstrichen, und der Mann erschien ihr völlig fremd.
Er war groß, dunkelhaarig und sah ganz passabel aus in seiner abgetragenen Jacke, der braunen Hose aus Englischleder und den Stiefeln. Seine Augen schimmerten sehr dunkel, genau wie das Haar, das ihm in die Stirn fiel. Eine Kamera, die äußerst teuer wirkte, hing an einem Riemen um seinen Hals. Holly nahm an, dass er wahrscheinlich ein Tourist war, der einen Spaziergang gemacht hatte und von der Hochzeit ebenso angezogen worden war wie sie. Sie zwang sich zu einem Lächeln.
„Mir geht es gut, danke. Ich bin nur stehen geblieben, um zuzusehen.“
Er erwiderte ihr Lächeln, sah sie aber mit seinen dunklen Augen scharf an. „Ganz sicher? Sie wirken ein wenig … mitgenommen.“
Hinter ihnen nahm die Gruppe eine neue Pose für ein weiteres Foto ein. Holly steckte die Hände in die Taschen ihrer Fleecejacke und wandte sich ab. „Ich möchte Sie nicht davon abhalten, Ihre Bilder zu machen …“
Der Mann grinste, offensichtlich war ihm nicht entgangen, dass sie ihn abwimmeln wollte. „Die Sonne steht ungünstig, außerdem wirkt das Ganze für mich zu gestellt. Ich mag Spontaneität.“
Holly runzelte ein wenig die Stirn. „Spontaneität. Ja. Das ist schön. Entschuldigen Sie mich bitte …“ Sie hatte sich noch keine zwanzig Meter von ihm entfernt, da musste sie langsamer gehen, weil ihr die Tränen über die Wangen strömten und sie kaum noch sehen konnte, wohin sie ging. Wie furchtbar peinlich. Sie stolperte, hörte Schritte hinter sich und spürte seine Hand auf ihrem Arm.
„Hören Sie, kann ich irgendwie helfen …“
„Nein!“ Holly drehte sich aufgebracht zu ihm um, und er ließ die Hand sinken.
Er wich zurück. „Also gut.“ Seine Stimme klang ruhig und seltsam tröstlich. „Nun … passen Sie gut auf sich …“
„Oh Gott, es tut mir leid.“ Ihre guten Manieren meldeten sich zurück, und Holly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. „Ich wollte wirklich nicht unhöflich sein …“
Seine Mundwinkel zuckten, als wollte er lächeln. Er hatte ein bemerkenswertes Gesicht, schmal, gebräunt, mit hohen Wangenknochen und dunklen aufmerksamen Augen unter kräftigen Augenbrauen. Holly ertappte sich dabei, ihn weiter ansehen zu wollen.
„Bitte, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen“, erwiderte er leichthin. „Ich habe mich wie eine Nervensäge benommen …“
Holly fing wieder an zu weinen. „Seien Sie doch nicht so freundlich zu mir …“
„Hören Sie, das ist doch Unsinn. Warum trinken wir nicht einfach eine Tasse Tee, bis es Ihnen wieder etwas besser geht? Gibt es dort drüben nicht gleich eine Teestube?“
„Ja, aber …“ Holly fühlte sich entsetzlich verwundbar, sie wollte nicht, dass jemand sie so sah. Sie standen jedoch bereits im Innenhof, und der Mann führte sie zu einem der draußen stehenden Tische, wo sie sich in eine Ecke setzen konnte und vor neugierigen Blicken geschützt war.
Holly nahm Platz und beobachtete, wie er hineinging und ein paar Minuten später mit zwei großen, blau-weiß gestreiften und dampfenden Bechern wieder herauskam. Sie legte die Hände um ihren Becher und trank mit großen Schlucken. Der Tee war sehr heiß, aber er wirkte tröstend.
„Ich danke Ihnen so sehr“, sagte sie. „Was bin ich Ihnen schuldig?“
„Machen Sie sich darüber keine Gedanken.“ Er zog eine Augenbraue hoch. „Für den Fall, dass Sie mit wildfremden Menschen nicht Tee trinken wollen – ich heiße Mark.“
„Holly.“ Sie überlegte kurz, ihm die Hand zu geben, entschied sich dann aber dagegen.
„Freut mich, Sie kennenzulernen, Holly.“ Mark lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. „Also, wollen Sie darüber reden?“
„Wie bitte?“ Sie starrte ihn einen Moment lang verwirrt an. Ihre Augen brannten ein wenig. „Oh nein, danke.“
„Gut“, erwiderte Mark ruhig.
Schweigend tranken sie ihren Tee. Holly studierte sein Gesicht mit den Augen der Künstlerin; seine Züge waren ebenmäßig und markant, wie die eines stilisierten Engels … Er drehte den Kopf, und ihre Blicke trafen sich. Wieder durchzuckte sie das Gefühl des Wiedererkennens, aufregend und gefährlich. Normalerweise hätte sie bei einer so spontanen Anziehungskraft sofort die Flucht ergriffen, aber an diesem Tag war das anders. Alles war anders.
Sie nickte zu seinem Fotoapparat. „Das ist eine sehr schöne Kamera. Haben Sie heute ein paar gute Bilder machen können?“
Mark lächelte. „Oh ja. Hier gibt es eine Menge vielversprechender Motive. Interessieren Sie sich für Fotografie?“
„Ja, sehr. Ich fotografiere gern, und manchmal habe ich Glück. Das heißt aber nicht, dass ich gut bin.“
Mark neigte den Kopf zur Seite. „Und womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?“
„Ich bin Graveurin. Für Glas.“ Holly merkte, dass sie nicht über sich reden wollte. „Und Sie? Sind Sie auch beruflich Fotograf?“
Mark verzog das Gesicht. „Leider nicht, ich bin nur Amateur. Eigentlich arbeite ich als Bauingenieur, war aber in letzter Zeit viel auf Reisen.“
Holly leerte ihren Becher. „Wo waren Sie denn?“
„Ich habe eine Weile in Asien gearbeitet, dann war ich in Norwegen. Meine Schwester lebt dort, daher bin ich den Winter über geblieben und habe ihrem Mann auf seinem Fischkutter geholfen.“
Sie sah ihn überrascht an. Sie hatte genug Fernsehsendungen geschaut, um zu wissen, dass das keine Arbeit für Amateure war. „Sie sind also ein guter Seemann?“
„Nein.“ Mark schmunzelte. „Ein ganz schlechter, aber mit irgendetwas musste ich ja mein Geld verdienen.“ Er stand auf, fast ein wenig abrupt, und Holly spürte, dass es auch für ihn Grenzen gab, die er in ihrer Unterhaltung nicht überschreiten wollte. „Sollen wir gehen? Ich begleite Sie zu Ihrem Wagen.“
„Oh.“ Holly erkannte, dass er sie auch für eine Touristin hielt. Sie zögerte, plötzlich war ihr bewusst, wie seltsam sie sich fühlte, irgendwie verzerrt, unwirklich. „Ich wohne hier in der Nähe.“
„Dann begleite ich Sie zu Fuß zurück.“
Holly war sich nicht sicher, ob sie wirklich Gesellschaft haben wollte. „Das ist nicht nötig …“
Mark lächelte sie an. Sie mochte die Fältchen, die sich beim Lächeln in seinen Augenwinkeln bildeten, und die Längsfalte auf seiner Wange. All das registrierte sie ganz objektiv und gleichzeitig ganz und gar nicht objektiv.